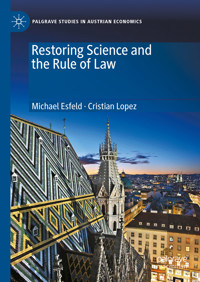17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Suhrkamp Verlag
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
In seinem neuen Buch verteidigt der Philosoph Michael Esfeld den wissenschaftlichen Realismus gegen Verschwörungstheoretiker und Antirealisten, zeigt aber auch die Grenzen wissenschaftlicher Erklärungen auf. Entgegen so mancher überschießender Ambition haben sie nämlich nicht die Kraft, mit Handlungsfreiheit begabten Personen Normen für die Gestaltung individuellen und gesellschaftlichen Lebens vorzugeben. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse implizieren keine Prädetermination menschlichen Handelns und Denkens, der Determinismus in Physik, Biologie oder den Neurowissenschaften schränkt die menschliche Freiheit daher keineswegs ein. Im Gegenteil: Wissenschaft setzt gerade die Freiheit voraus, Theorien zu formulieren, zu testen und zu rechtfertigen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
3Michael Esfeld
Wissenschaft und Freiheit
Das naturwissenschaftliche Weltbild und der Status von Personen
Suhrkamp
Übersicht
Cover
Titel
Inhalt
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
Inhalt
Cover
Titel
Inhalt
Einleitung
1. Materie in Bewegung: das wissenschaftliche Weltbild
1.1 Atomismus von Demokrit bis Feynman
1.2 Primitive Ontologie
1.3 Dynamische Struktur
1.4 Wahrscheinlichkeiten und die Richtung der Zeit
1.5 Jenseits der klassischen Mechanik: die klassische Feldtheorie
1.6 Von der Feldtheorie zur Relativitätsphysik
1.7 Von der statistischen Mechanik zur Quantenmechanik
2. Wie Wissenschaft erklärt: wissenschaftliche Erklärungen und ihre Grenzen
2.1 Das Problem der Lokalisation und seine Lösung: der Funktionalismus
2.2 Was wissenschaftliche Erklärungen leisten und was ihre Grenzen sind
2.3 Was sind Naturgesetze?
2.4 Wieso der Determinismus dem freien Willen nicht entgegensteht
3. Wieso Personen unhintergehbar sind: das manifeste Weltbild
3.1 Sinnesqualitäten als Problem für das wissenschaftliche Weltbild
3.2 Normativität als der Angelpunkt
3.3 Das wissenschaftliche und das manifeste Weltbild
3.4 Die synoptische Sicht
3.5 Eine zweigleisige Konzeption von Freiheit
Zusammenfassung
Literatur
Namenregister
Sachregister
Fußnoten
Informationen zum Buch
Impressum
Hinweise zum eBook
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
7Einleitung
Das Zeitalter der Aufklärung hat zwei Gesichter. Auf der einen Seite steht die Befreiung des Menschen, ausgedrückt zum Beispiel in Immanuel Kants Definition der Aufklärung als »Ausgang des Menschen aus seiner selbst verschuldeten Unmündigkeit« (Kant, »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?« (1784), erster Satz). Auf der anderen Seite steht der Szientismus mit der Idee, dass naturwissenschaftliches Wissen unbegrenzt ist: Es umfasst auch den Menschen und alle Aspekte unserer Existenz. Diese Seite kommt zum Beispiel in Julien Offray de La Mettries L’homme machine (1747) zum Ausdruck. Beide weisen Wissensansprüche traditioneller Autoritäten wie zum Beispiel der Kirche zurück. Die von Kant betonte Seite zielt dann darauf ab, jeder mündigen Person die Freiheit zu geben, ihre eigenen, überlegten Entscheidungen zu treffen. La Mettries Seite bahnt hingegen der Position den Weg, der zufolge naturwissenschaftliches Wissen die angemessenen Entscheidungen sowohl auf der individuellen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene vorzeichnen kann.
Diese beiden Seiten kann man bis in die griechische Antike zurückverfolgen. Gemäß Aristoteles’ Politik ist die Organisation von Staat und Gesellschaft eine Frage von Entscheidungen, welche die Bürger in gemeinsamer Beratung zu treffen haben. Für Platon hingegen ist es eine Frage des Wissens, wie man das individuelle und das gesellschaftliche Leben zu gestalten hat. Dementsprechend sollen die Philosophen herrschen, wie er in seinem Hauptwerk Der Staat darlegt. In der Neuzeit nimmt dann das naturwissenschaftliche Wissen die Stelle ein, die Platon dem Wissen zuschreibt, das durch philosophisches Nachdenken erlangt wird.
Dieses Buch hat das wissenschaftliche Weltbild und seine Grenzen zum Thema. Sein zentrales Anliegen ist es aufzuzeigen, wie Wissenschaft uns frei macht und dadurch zur offenen Gesellschaft beiträgt – im Sinne von Karl Poppers berühmtem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde (1945) (welches das erste philosophische Buch war, das ich gelesen habe). Ich möchte daher zunächst aufweisen, wieso die Naturwissenschaft mit den Gesetzen, die sie entdeckt, unsere Freiheit bestärkt, statt diese einzuschränken, und 8dann darauf aufbauend zeigen, wieso es verfehlt ist anzunehmen, dass aus der Wissenschaft Normen folgen, die vorgeben, wie wir die Gesellschaft und unsere individuellen Leben zu gestalten haben. Dieser Fehler ist schon in der La Mettrie’schen Vorstellung der Aufklärung angelegt und wird später im Marxismus umgesetzt. Heute erhält er Auftrieb durch eine Fehleinschätzung der Entdeckungen, die in der Physik, der Evolutionsbiologie, der Genetik und den Neuro- und Kognitionswissenschaften gemacht werden. Der Wissenschaft eine solche Macht zuzuschreiben, provoziert die übertriebene Gegenreaktion, die darin besteht, nicht anzuerkennen, dass die Wissenschaft überhaupt Wahrheiten über die Welt entdeckt. Diese leider auch unter postmodernen Intellektuellen verbreitete Ansicht fordert geradezu dazu auf, die Abgrenzung zwischen fact und fake aufzugeben. Dadurch lässt man aber nicht nur den Szientismus fallen, sondern auch die Idee, dass Wissenschaft zur Befreiung der Menschheit beiträgt.
Demgegenüber legt dieses Buch dar, was an den weit verbreiteten Behauptungen falsch ist, gemäß denen unsere Freiheit ausgehebelt wird durch wissenschaftliche Gesetze (wie insbesondere fundamentale und universelle, deterministische Gesetze in der Physik), wissenschaftliche Entdeckungen (wie zum Beispiel in der Genetik oder in den Kognitionswissenschaften) und wissenschaftliche Erklärungen (wie zum Beispiel Erklärungen menschlichen Verhaltens in der Evolutionsbiologie oder den Neurowissenschaften). Kurz gesagt: Erstens ist die Ontologie der Wissenschaften – das, was als existierend angenommen werden muss, um den Wahrheitsanspruch wissenschaftlicher Theorien zu verstehen – gar nicht reich genug, um zu Konsequenzen zu führen, welche die menschliche Freiheit in Frage stellen könnten. Des Weiteren beziehen sich wissenschaftliche Gesetze, Entdeckungen und Erklärungen auf kontingente Tatsachen statt auf Notwendigkeiten (im Sinne von Dingen, die nicht anders hätten sein können). Am wichtigsten aber ist, dass wissenschaftliche Theorien in einem normativen Netz des Gebens von und Fragens nach Gründen formuliert werden, das die Freiheit von Personen im Formulieren, Testen und Beurteilen von Theorien voraussetzt. Deshalb können Personen nicht ihrerseits im wissenschaftlichen Weltbild verortet werden. Folglich gibt uns die Wissenschaft Informationen über die Welt, aber keine Normen – weder für die individuelle Lebensgestaltung noch für die Gesell9schaft. Wissenschaft befreit uns, indem sie zeigt, dass wir die Freiheit haben, die Normen für unser Denken und Handeln – sowohl als Individuen als auch in der Gesellschaft – selbst zu setzen, damit aber auch die Verantwortung für unsere Gedanken und Handlungen tragen.
Was ist Wissenschaft? Die Wissenschaft ist zumindest durch die folgenden drei Merkmale von anderen menschlichen Unternehmungen einschließlich anderer intellektueller Aktivitäten unterschieden:
Objektivität: Was die Wissenschaft über die Welt aussagt, hängt von keinem spezifischen Standpunkt ab. Es ist unabhängig von Geschlecht, Rasse, Religion und geographischer oder zeitlicher Position. Wissenschaftliche Theorien beziehen einen Standpunkt von nirgendwo und nirgendwann. Natürlich haben die Theorien einen bestimmten Ursprung, aber ihr Geltungsanspruch ist davon unabhängig. Jeder kann Teil der wissenschaftlichen Gemeinschaft werden. Es gibt keine chinesische Mathematik, Physik oder Biologie im Unterschied zu einer amerikanischen. Dasselbe gilt für die Philosophie, insofern sie ein argumentatives Unternehmen ist, das nach Wissen über die Welt und uns selbst strebt.
Systematizität: Eine wissenschaftliche Theorie versucht, so viele Phänomene wie möglich mit einem so einfachen Gesetz wie möglich zu erfassen. Bekannte Beispiele sind das Gesetz der natürlichen Auslese in der Evolutionsbiologie und das Gravitationsgesetz in der Physik. Letzteres ist ein ideales Beispiel für ein Naturgesetz, weil es sich auf alles im Universum bezieht.
Bestätigung durch Beobachtung und Experiment: Jede wissenschaftliche Behauptung muss durch Indizien bestätigt werden können, die unabhängig von der betreffenden Behauptung sind. Das heißt: Die betreffende Behauptung muss es ermöglichen, Voraussagen abzuleiten, die bestätigt werden können, ohne auf die betreffende Behauptung angewiesen zu sein. Zum Beispiel sagt Albert Einsteins Theorie der Gravitation voraus, dass Licht von entfernten Sternen durch das Gravitationsfeld der Sonne abgelenkt wird. Diese Ablenkung kann man bei einer Sonnenfinsternis beobachten (erstmals geschehen 1919). Die Beobachtung dieses Phänomens ist unabhängig von den theoretischen Behauptungen der allgemeinen Relativitätstheo10rie über die Struktur von Raum und Zeit und das Verhalten des Gravitationsfeldes. Wie dieses Beispiel zeigt, erfordert Bestätigung nicht immer einen Eingriff in das Naturgeschehen durch Experimente. Entscheidend ist die Beobachtung neuer Phänomene, welche die Theorie voraussagt und erklärt.
Diese Merkmale als Kennzeichen von Wissenschaft herauszustellen, wird gewöhnlich mit dem Standpunkt verbunden, der als wissenschaftlicher Realismus bekannt ist: Die Wissenschaft deckt den Aufbau der natürlichen Welt auf. Wenn überhaupt ein menschliches Unternehmen dieses leisten kann, dann sicher nur die Wissenschaft. Insofern steht dieses Buch zum wissenschaftlichen Realismus. Entscheidend in unserem Zusammenhang ist aber dies: Diese Merkmale von Wissenschaft anzuerkennen, verhindert nicht, uns der Grenzen von Wissenschaft bewusst zu werden und insbesondere zu realisieren, wie Wissenschaft Freiheit ermöglicht, statt sie zu verhindern.
In einem größeren Zusammenhang gesehen ist dieses Buch ein Essay über das Zusammenspiel dessen, was Wilfrid Sellars (1962) das wissenschaftliche Weltbild und das manifeste Weltbild nennt. Das manifeste Weltbild ist dabei allerdings nicht der Alltagsverstand. Die Frage nach dem Verhältnis dieser beiden Weltbilder ist dementsprechend nicht dadurch beantwortet, dass man zeigt, wie man vom wissenschaftlichen Weltbild aus die uns vertrauten makroskopischen Gegenstände und deren Verhalten verstehen kann. Sellars zufolge ist das manifeste Weltbild vielmehr die philosophisch reflektierte Sicht der Welt, die Personen in den Mittelpunkt stellt, ja als unhintergehbar und damit als ontologisch primitiv anerkennt. Das ist deshalb für das wissenschaftliche Weltbild wichtig, weil dieses nur formuliert, akzeptiert und gerechtfertigt werden kann, indem man auf die Ressourcen des manifesten Weltbildes zurückgreift.
Das Verhältnis zwischen dem wissenschaftlichen und dem manifesten Weltbild kann man auf drei verschiedene Weisen denken:
(i)Das wissenschaftliche Weltbild ist vollständig: Personen können ebenso wie alles andere, das nicht explizit in den Naturwissenschaften vorkommt, durch funktionale Definitionen auf die Ontologie der Naturwissenschaften reduziert werden. Letztlich ist dies die Ontologie der Physik. Das heißt: Die Personen, die es in der Welt gibt, sind mit bestimmten Materiekonfigu11rationen und deren Verhalten unter bestimmten Umweltbedingungen identisch. Aus einer vollständigen physikalischen Beschreibung der Welt könnten im Prinzip auch alle wahren Aussagen über Personen abgeleitet werden, einschließlich der Aussagen über deren Denken und Handeln.
(ii)Das manifeste Weltbild ist vollständig: Alles was es in der Welt gibt, wird dadurch korrekt erfasst, dass man es in gewisser Weise in Analogie zu Personen denkt. Wissenschaftliche Theorien, welche von diesen personenanalogen Zügen absehen, haben dementsprechend nur einen instrumentellen Wert: Sie ermöglichen effiziente Voraussagen, decken aber nicht die Essenz dessen auf, was es in der Welt gibt.
(iii)Dualismus von wissenschaftlichem und manifestem Weltbild: Das wissenschaftliche Bild ist wahr in Bezug auf die Welt ohne die Merkmale, die Personen charakterisieren. Diese Merkmale sind ontologisch ebenso primitiv wie Materie in Bewegung.
Dieses Buch folgt Kants Aufklärungsphilosophie und Sellars’ Plädoyer für eine synoptische Sicht der beiden Weltbilder, indem es für eine bestimmte Version von Position (iii) argumentiert: Das wissenschaftliche Weltbild – ebenso wie jede wissenschaftliche Theorie – setzt die Freiheit von Personen voraus, Begriffe zu bilden und Theorien zu entwickeln. Eine Person zu sein, ist jedoch kein zur Materie hinzukommendes Ding, keine zusätzliche Tatsache oder Eigenschaft. Es ist eine Einstellung, die man in Bezug auf sich selbst und andere einnimmt. Indem man diese Einstellung entwickelt, bringt man sich selbst hervor als ein Wesen, welches Bedeutung schafft und damit Regeln für das Denken und Handeln setzt und welches infolgedessen das, was es denkt und tut, rechtfertigen muss.
Auf dieser Grundlage argumentiert das Buch für eine zweigliedrige Konzeption der Freiheit: Da ist zunächst Freiheit in dem Sinne, dass naturwissenschaftliche Gesetze, selbst wenn sie deterministisch sind, weder unser Verhalten noch die Bewegungen irgendwelcher anderen Objekte vorherbestimmen. Erst kommt nämlich die Bewegung der Objekte, dann kommen die Theorien und Gesetze, die kontingente Muster und Regularitäten in dieser Bewegung aufdecken. Falls das wissenschaftliche Weltbild vollständig wäre, gäbe es nur diese Art von Freiheit. Wenn man sich jedoch vor Augen führt, dass das wissenschaftliche Weltbild von Personen in normativen 12Einstellungen des Gebens und Fragens nach Gründen formuliert, akzeptiert und gerechtfertigt wird, dann sieht man, dass es auch noch eine Freiheit gibt, die charakteristisch für Personen ist. Diese Freiheit besteht darin, selbst Normen für das Denken und Handeln zu setzen (bzw. setzen zu müssen). Von Seiten der Wissenschaften gibt es nichts, was uns daran hindert, aus dieser Freiheit heraus unser Handeln zu gestalten.
Das Buch ist in drei Teile oder Kapitel gegliedert. Das erste Kapitel ist eine philosophische Darstellung dessen, was die Naturwissenschaft in Bezug auf den Aufbau der Welt herausgefunden hat. Der Schwerpunkt liegt auf den fundamentalen und universellen Theorien der Physik von der Newton’schen Mechanik bis zur heutigen Quantenphysik. Das Kapitel beantwortet folgende Frage: Welches sind die minimalen ontologischen Festlegungen, die man akzeptieren muss, um zu verstehen, was die Naturwissenschaften über die Welt aussagen? Das Ziel dieses Kapitel ist allerdings keine allgemeinverständliche Darstellung der Physik, obwohl einige physikalische Details zur Sprache kommen werden. Das Ziel ist es, die philosophischen (Stand-)Punkte herauszuarbeiten, die unerlässlich sind, um zu verstehen, wieso die naturwissenschaftlichen Theorien nicht in Konflikt mit der menschlichen Freiheit kommen. Kapitel 2 beschreibt auf dieser Grundlage die Leistungen ebenso wie die Grenzen naturwissenschaftlicher Erklärungen und Gesetze. Es führt zu einem Argument dafür, dass diese Erklärungen und Gesetze die menschliche Freiheit unterstützen, statt sie auszuhebeln. Am Ende von Kapitel 2 werden wir ein Argument dafür gewonnen haben, dass es keine grundlegenden Konflikte zwischen dem wissenschaftlichen und dem manifesten Weltbild in Bezug auf Zeit und Willensfreiheit gibt (die beide zusammenhängen: ohne Veränderungen und Zeit als deren Maß gibt es keine Freiheit). Solche Konflikte sind, mit Rudolf Carnap (1928) gesprochen, Scheinprobleme: Sie ergeben sich aus einem fehlgeleiteten Verständnis der ontologischen Festlegungen wissenschaftlicher Theorien. Auf dieser Grundlage wendet sich Kapitel 3 dem zentralen Punkt des Konfliktes zwischen dem wissenschaftlichen und dem manifesten Weltbild zu, nämlich der Normativität, die nicht erst das Handeln, sondern bereits das Denken durchdringt. Dieses Kapitel arbeitet heraus, wie beide Weltbilder zu menschlicher Freiheit führen, entwickelt die erwähnte zweigleisige Konzeption von Freiheit und er13örtert ihre Konsequenz: Es gibt kein Wissen – weder wissenschaftliches noch Wissen anderen Ursprungs –, welches diese Freiheit aushebeln könnte. Am Schluss steht eine Zusammenfassung der wesentlichen Thesen des Buches.
Für hilfreiche Kommentare und Diskussionen danke ich meinen Mitarbeiter*innen und den Teilnehmer*innen meines Forschungsseminars in Lausanne im akademischen Jahr 2018/19 – insbesondere Guillaume Köstner und Christian Sachse –, den Mitarbeiter*innen des Forschungskollegs »Imaginarien der Kraft« an der Universität Hamburg – insbesondere Frank Fehrenbach und Cornelia Zumbusch für die Einladung im Sommersemester 2019 – sowie Andreas Hüttemann, Ingvar Johansson, Barry Loewer, Anna Marmodoro, Daniel von Wachter und Gerhard Wagner. Vor allem gilt mein Dank Jan-Erik Strasser vom Suhrkamp Verlag für zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung des Textes.
141. Materie in Bewegung: das wissenschaftliche Weltbild
1.1 Atomismus von Demokrit bis Feynman
Die Naturwissenschaft in der abendländischen Kultur hat ihren Ursprung bei den vorsokratischen Naturphilosophen. Zu diesen gehören auch Leukipp und Demokrit, die ersten Atomisten. Gemäß der Überlieferung durch Plutarch behauptet Demokrit:
In dem Leeren zerstreut bewegten sich Substanzen, der Zahl nach unendlich wie auch unteilbar und unterschiedslos und ohne Qualität und für Einwirkung unempfänglich; wenn sie sich einander näherten oder zusammenstießen oder verflöchten, so träten einige dieser Anhäufungen als Wasser, andere als Feuer, andere als Pflanze und wieder andere als Mensch in Erscheinung.[1]
Ähnlich schreibt Isaac Newton am Ende der Optik:
Nach allen diesen Betrachtungen ist es mir wahrscheinlich, daß Gott im Anfange der Dinge die Materie in massiven, festen, harten, undurchdringlichen und beweglichen Partikeln erschuf. […] Keine Macht von gewöhnlicher Art würde im Stande sein, das zu zertheilen, was Gott selbst bei der ersten Schöpfung als Ganzes erschuf. […] Damit also die Natur von beständiger Dauer sei, ist der Wandel der körperlichen Dinge ausschliesslich in die verschiedenen Trennungen, neuen Vereinigungen und Bewegungen dieser permanenten Theilchen zu verlegen.[2]
Wenn wir uns der heutigen Physik zuwenden, so schreibt Richard Feynman am Beginn der berühmten Feynman-Vorlesungen:
Wenn in einer Sintflut alle wissenschaftlichen Kenntnisse zerstört würden und nur ein Satz an die nächste Generation von Lebewesen weitergereicht werden könnte, welche Aussage würde die größte Information in den wenigsten Worten enthalten? Ich bin überzeugt, dass diese die Atomhypothese (oder welchen Namen sie auch immer hat) wäre, die besagt, dass alle Dinge 15aus Atomen aufgebaut sind – aus kleinen Teilchen, die in permanenter Bewegung sind, einander anziehen, wenn sie ein klein wenig voneinander entfernt sind, sich aber gegenseitig abstoßen, wenn sie aneinandergepresst werden. In diesem einen Satz werden Sie mit ein wenig Phantasie und Nachdenken eine enorme Menge an Information über die Welt entdecken.[3]
Das ist der Atomismus, dessen Siegeszug der Erfolgsgeschichte der modernen Naturwissenschaft den Boden bereitet. Aus den obigen Zitaten geht hervor, wieso der Atomismus so vielversprechend ist: Auf der einen Seite ist er ein Vorschlag für eine Theorie über das, was es im Universum gibt, die sowohl allumfassend als auch sparsam ist. Auf der anderen Seite gibt er eine klare und einfache Erklärung des Gegenstandsbereichs, der uns in der Erfahrung unmittelbar zugänglich ist. Alle Gegenstände dieses Bereichs sind aus einer großen Anzahl kleinster Teilchen zusammengesetzt. Alle Unterschiede zwischen diesen Gegenständen – sowohl zu einer bestimmten Zeit als auch über die Zeit hinweg – werden auf die räumliche Anordnung dieser Teilchen und die Veränderungen in dieser Anordnung zurückgeführt.
Diese Sichtweise wird in der klassischen Mechanik umgesetzt. Sie erobert den gesamten Bereich der Physik durch die statistische Mechanik (die zum Beispiel Wärme auf die Bewegung von Molekülen zurückführt), die Chemie über das Periodensystem der Elemente, die Biologie in Form der Molekularbiologie (die zum Beispiel die molekulare Zusammensetzung der DNA aufdeckt) und schließlich die Neurowissenschaft; Neuronen bestehen aus Atomen, und die Neurowissenschaft ist Physik, die auf das Gehirn angewendet wird. Kurz gesagt: Die Naturwissenschaft ist vor allem deshalb so erfolgreich, weil sie alles in Elementarteilchen zerlegt und es dann von den Interaktionen dieser Teilchen aus erklärt.
Um zu verstehen, wie die Teilchen interagieren, benötigt man Gesetze, die deren Bewegung beschreiben. Deshalb kommt der Atomismus in der Antike nicht über den Status einer interessanten, aber spekulativen Hypothese hinaus und wird erst in der Neuzeit zur Naturwissenschaft; denn erst die moderne Physik formuliert Bewegungsgesetze für die Atome. Nichtsdestoweniger hängt die Attraktivität des Atomismus nicht davon ab, wie diese Gesetze genau aussehen. Seine Attraktivität ist unabhängig von bestimmten 16physikalischen Theorien. Sie besteht in diesen beiden Ideen: Alles ist aus kleinsten Teilchen zusammengesetzt, und alle Unterschiede in der Welt bestehen in Unterschieden in dieser Zusammensetzung. Es gibt eine direkte, intuitive Verbindung von dieser Idee zu den beobachtbaren, makroskopischen Gegenständen.
Diese Verbindung ist direkt und intuitiv, weil alles, was wir in wissenschaftlichen Experimenten und im Alltag beobachten, die relativen Lagen diskreter Gegenstände und die Veränderung dieser Lagen sind – mit anderen Worten: die unterschiedlichen Abstände, die Objekte zueinander haben, und die Veränderung dieser Abstände. Dementsprechend werden alle Messergebnisse als relative Positionen diskreter Objekte aufgezeichnet, wie zum Beispiel Zeigerpositionen oder digitale Anzeigen auf einem Bildschirm. John Bell formuliert es so: »In der Physik sind die einzigen Beobachtungen, die wir in Betracht ziehen müssen, Ortsbeobachtungen, und seien es die Orte der Zeiger von Instrumenten.«[4] Die Einschränkung »in der Physik« ist angebracht, weil Alltagswahrnehmungen typischerweise Farben, Töne oder Gerüche räumlich angeordneter Gegenstände involvieren. Die Orte von Gegenständen werden durch diese Sinnesqualitäten unterschieden. Sinnesqualitäten treten aber – zumindest explizit – in keiner physikalischen Theorie auf (darauf werde ich in Kapitel 3.1 eingehen).
Dessen ungeachtet ist alle Evidenz, die wir in der Naturwissenschaft zur Verfügung haben, die Evidenz von Lagen diskreter Gegenstände relativ zu anderen diskreten Gegenständen. Sogar im Fall der 2016 durch LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) entdeckten Gravitationswellen besteht alle experimentelle Evidenz in der Beobachtung der Veränderung der relativen Lagen diskreter Objekte, die letztlich Teilchen sind. Diese Veränderung wird dann mathematisch in Begriffen einer Welle beschrieben, die durch das Gravitationsfeld zieht. Diese Tatsache bestätigt die direkte Verbindung zwischen der experimentellen Evidenz und der Idee des Atomismus: Es handelt sich um relative Lagen diskreter Objekte, von den makroskopischen Gegenständen hinunter bis zu den kleinsten Teilchen und von den kleinsten Teilchen hinauf bis zu den makroskopischen Gegenständen. Folglich gilt: Wenn eine Theorie die raum-zeitliche Anordnung der Teil17chen richtig darstellt, dann hat sie alles richtig dargestellt, was jemals experimentell überprüft werden kann. Zwei mögliche Welten, die in Bezug auf die raum-zeitliche Anordnung der Teilchen gleich sind, können durch keine naturwissenschaftlichen Mittel voneinander unterschieden werden.
Mithin sind für die Erklärung der beobachtbaren makroskopischen Objekte und der Unterschiede zwischen ihnen nur die relativen Lagen der Teilchen und die Veränderung dieser Lagen relevant; eine intrinsische Natur, Form oder Essenz der Atome spielt überhaupt keine Rolle. Das steht im Gegensatz zum Hauptstrom der antiken und mittelalterlichen Metaphysik. Dort liegt der Fokus auf einer inneren Form (eidos) der Gegenstände, auf etwas, das dem jeweiligen Gegenstand unabhängig von allen anderen Gegenständen zukommt und das ihn von allen anderen Gegenständen (oder zumindest von allen Arten anderer Gegenstände) unterscheidet. Aristoteles’ Kategorien und seine Metaphysik sind die klassischen Referenzwerke für diese Sichtweise. Gemäß dem Atomismus sind hingegen kleinste Teilchen (Atome) die Substanz der Welt. Sie sind beständig: Weder entstehen noch vergehen sie. Aber sie sind Substanzen nur in dem Sinne permanenter Existenz, keine Substanzen im Sinne von Gegenständen, die eine innere Form haben. Atome haben keine inneren, charakteristischen Merkmale. Ihr gesamtes Sein besteht in ihrer räumlichen Anordnung – das heißt in ihren relativen Lagen oder Abständen zueinander – und der Veränderung dieser Abstände.
René Descartes ist der zentrale Denker, der den Paradigmenwechsel vollzog von aristotelischen Formen in der mittelalterlichen, scholastischen Naturphilosophie zu einer Essenz der materiellen Gegenstände, die nur in deren Ausdehnung – das heißt deren relativen Lagen oder Abständen – und Bewegung (das heißt der Veränderung dieser Abstände) besteht. Für ihn ist die Natur lediglich res extensa. Descartes stellte darüber hinaus auch Bewegungsgesetze auf. Diese erwiesen sich allerdings als nicht korrekt, insbesondere weil er die Interaktion der materiellen Gegenstände als direkten Kontakt konzipierte und damit Mechanik wörtlich als Druck und Stoß verstand. Interaktionsgesetze, die in der Physik Bestand hatten, gehen auf Newton zurück mit dem Gravitationsgesetz als paradigmatischem Beispiel. Die Newton’sche Schwerkraft ist Wechselwirkung ohne direkten Kontakt, wie zum Beispiel die Anziehung 18der Erde durch die Sonne. Schauen wir uns nun das Zusammenspiel zwischen Objekten und Gesetzen genauer an.
1.2 Primitive Ontologie
Die Atome des Atomismus können nicht in noch kleinere Objekte zerlegt werden, weil sie nicht mehr ausgedehnt sind: Sie sind Punktteilchen. Alle Ausdehnung entstammt den räumlichen Beziehungen, in denen sie stehen und durch die sie eine Konfiguration von Punktteilchen aufbauen. Soweit es die Naturwissenschaften betrifft, ist dieses das Fundament des Universums. Man kann in der naturwissenschaftlichen Forschung nicht weiter zurückgehen als zu nicht ausgedehnten Punktteilchen, die räumlich angeordnet sind und deren räumliche Anordnung sich ändert. Diese Teilchen und deren Anordnung sind der finale Bezugspunkt der naturwissenschaftlichen Theorien, das, wovon diese Theorien letztlich handeln. Führen wir hierfür den philosophischen Begriff der primitiven Ontologie ein. Ontologie handelt von dem, was es gibt, was ist oder existiert (to on – das Seiende – im Altgriechischen). Die primitive Ontologie bezieht sich auf das, was als ursprünglich, grundlegend oder schlechthin existierend angenommen werden muss in dem Sinne, dass es nicht von irgendetwas anderem abgeleitet oder durch seine Funktion für etwas anderes eingeführt werden kann. Was dieses Etwas ist, hängt von der Theorie ab: Die Hypothese der naturwissenschaftlichen Theoriebildung lautet, dass das Universum letztlich aus räumlich angeordneten Punktteilchen besteht. Wenn diese Hypothese richtig ist, dann ist die Teilchenkonfiguration des Universums die Grundlage – das, was schlechthin existiert.
Gibt es Alternativen zum Atomismus? Die vorsokratischen Naturphilosophen sind nicht alle Atomisten wie Leukipp und Demokrit. Ihnen voraus gingen Thales, Anaximander, Anaximenes und Anaxagoras, die nach dem Stoff suchten, aus dem alles besteht. Für Thales war dieser Stoff das Wasser, während die nachfolgenden Naturphilosophen etwas Abstrakteres im Auge hatten. In jedem Fall steht die Theorie eines grundlegenden Stoffes dem Atomismus entgegen: Statt einer Vielzahl diskreter, unteilbarer Objekte (der Atome) gibt es einen kontinuierlichen Stoff, der sich über das gesamte Universum erstreckt. Ein Problem für diese Theorie besteht 19darin, dass die Annahme eines reinen, eigenschaftslosen Stoff-Substrats der Materie mysteriös anmutet. Ferner muss dann als primitive Tatsache angenommen werden, dass dieses Stoff-Substrat verschiedene Dichtegrade hat: In manchen Gebieten des Raumes gibt es mehr Stoff als in anderen Gebieten. Kurz gesagt: Es gibt in der Theorie eines primitiven Stoffes nichts, was materielle Gegenstände individuiert und damit voneinander unterscheidet. Im Atomismus hingegen unterscheiden die räumlichen Relationen – ihre relativen Lagen – die Atome voneinander.
Viel wichtiger als diese Bedenken ist jedoch, dass es unklar ist, wie die Stoff-Theorie der Materie den uns vertrauten Bereich makroskopischer Gegenstände erklären könnte. Es gibt in dieser Theorie nämlich nichts, was der Theorie der Zusammensetzung aus kleinsten Teilchen im Atomismus entspricht: Dort bauen die räumlich angeordneten Punktteilchen zunächst das auf, was heute als »Atome« im Sinne der chemischen Elemente bezeichnet wird. Diese wiederum bauen die Moleküle auf, die schließlich die uns bekannten makroskopischen Gegenstände bilden. So ist etwa – anders als Thales glaubte – Wasser kein kontinuierlicher, primitiver Stoff. Man denke an die antike Sichtweise der vier Elemente Erde, Wasser, Luft und Feuer, die alle als einfache, kontinuierliche Stoffe angesehen wurden. Es besteht vielmehr aus Molekülen, die aus Wasserstoff- und Sauerstoffatomen zusammengesetzt sind, welche wiederum aus Protonen, Neutronen und Elektronen bestehen … bis man schließlich zu den Punktteilchen der theoretischen Physik gelangt.
Die primitive Ontologie ist somit keine Frage philosophischer Spekulation. Was auch immer die physikalische Grundlage des Universums bildet: Es wird sehr weit von den Gegenständen entfernt sein, die uns im Alltag vertraut sind. Nichtsdestoweniger muss es eine klar nachvollziehbare Verbindung von den grundlegenden Zügen des Universums zu den uns im Alltag vertrauten Gegenständen geben, wie zum Beispiel die Verbindung von Punktteilchen zu makroskopischen Gegenständen durch Zusammensetzung im Atomismus. Entscheidend ist allerdings nicht allein die Idee der Zusammensetzung, wie nachvollziehbar oder sogar intuitiv diese Idee auch immer sein mag. Entscheidend ist vielmehr, das Versprechen einzulösen, alle Unterschiede in den makroskopischen Gegenständen durch Unterschiede in deren Zusammensetzung durch 20räumlich angeordnete Punktteilchen und die Veränderung in dieser Zusammensetzung zu erklären. Hierfür sind Bewegungsgesetze für die Atome unerlässlich. Deshalb wird dieses Versprechen erst durch die moderne Naturwissenschaft eingelöst. Folglich bleiben sowohl der Atomismus als auch die Sicht der Materie als kontinuierlicher Stoff vor der neuzeitlichen Naturwissenschaft spekulativ. Letztere löst dann das Versprechen des Atomismus ein, indem sie Bewegungsgesetze für die Teilchen formuliert. Mit diesen Gesetzen kann man dann die Unterschiede in den makroskopischen Gegenständen durch die Unterschiede in der räumlichen Zusammensetzung durch die Punktteilchen und deren Bewegung erklären.
Hieran wird deutlich, dass die intuitive Verbindung von räumlich angeordneten Punktteilchen zu makroskopischen Gegenständen durch Zusammensetzung nicht das stärkste Argument für die primitive Ontologie des Atomismus ist – genauso wenig wie die Tatsache, dass alles, was im Alltag wie in den Wissenschaften beobachtet wird, die räumliche Anordnung diskreter Objekte und deren Veränderung ist. Diese Tatsache und diese intuitive Verbindung legen es nahe, eine primitive Ontologie vorzuschlagen, die Punktteilchen postuliert, die alleine durch ihre relativen Lagen und die Veränderung dieser Lagen gekennzeichnet sind. Das entscheidende Argument für diese Ontologie ist dann aber ihre Erklärungskraft, nämlich die Weise, wie man mit dieser sparsamen Ontologie alle beobachteten Unterschiede in den makroskopischen Gegenständen durch Bewegungsgesetze der Teilchen erklären kann.
Selbst wenn für die wissenschaftlichen Beobachtungen und Erklärungen allein die relativen Lagen der Punktteilchen und deren Veränderung relevant sind, kann man sich fragen, ob das Sein der Punktteilchen nicht in mehr als deren räumlicher Anordnung bestehen muss, damit sie die Substanz der Welt ausmachen können. Anders gesagt: Selbst wenn eine innere Form der Atome irrelevant und unzugänglich für die Naturwissenschaft ist, so muss es eine solche vielleicht geben, damit die Punktteilchen die grundlegenden Dinge der Natur sein können. Und auch wenn es keine innere Form jedes einzelnen Atoms gibt, so scheint es doch eine allgemeine Stoff-Essenz der Materie geben zu müssen – etwas über die räumlichen Relationen hinaus, aufgrund dessen die Punktteilchen materielle Gegenstände sind. Wenn in der naturwissenschaftlichen Forschung von der Materie nur die Geometrie räumlicher Abstän21de zwischen einfachen Punktteilchen und die Veränderung dieser Abstände übrig bleibt, verschwindet deren materielle Natur bei genauem Hinsehen dann nicht einfach? Diese Bedenken sind allerdings fehlgeleitet.
Wenn mehrere Gegenstände vorhanden sind, dann muss es etwas geben, das diese individuiert: Es muss etwas geben, das die Frage beantwortet, was die Gegenstände voneinander unterscheidet, so dass mehr als nur ein Gegenstand vorhanden ist. Des Weiteren muss es jedoch auch etwas geben, das diese Gegenstände miteinander verbindet, so dass sie eine Welt aufbauen. Es muss eine weltbildende Relation geben, das heißt eine Relation, die alle (und nur diejenigen) Gegenstände miteinander verbindet, die zusammen in einer Welt existieren. Es ist offensichtlich, dass die Abstandsrelation diese Aufgabe erfüllt. Alle und nur diejenigen Objekte, die räumlich miteinander verbunden sind – von denen es Sinn ergibt zu fragen, wie weit sie voneinander entfernt sind –, bilden eine Welt. Sollte es Objekte geben, die in keinem Abstand voneinander stehen, gehören diese verschiedenen Welten an. Wenn sie durch einen Abstand miteinander verbunden sind, dann (und nur dann) gehören sie ein und derselben Welt an.[5]
Darüber hinaus individuieren die Abstandsbeziehungen die Objekte, und nur sie tun dies: Das, was ein Objekt in einer Konfiguration von Objekten von allen anderen Objekten unterscheidet, ist die Lage, die es relativ zu den anderen Objekten einnimmt. Selbst wenn eine Konfiguration teilweise symmetrisch ist, gibt es immer mindestens ein Objekt außerhalb dieser Symmetrie, in Bezug auf das man alle anderen Objekte voneinander unterscheiden kann. So kann zum Beispiel Bewegung letztlich immer auf die Fixsterne bezogen werden als dasjenige Bezugssystem, relativ auf das die anderen Objekte in Bewegung sind und in Bezug auf das sie sich durch ihre Abstände und deren Veränderung unterscheiden. Vollständig symmetrische Konfigurationen mögen vorstellbar sein (sofern man implizit die Anschauung eines absoluten Raumes zugesteht, in den sie eingebettet sind); aber gemäß dem Leibniz’schen Prinzip der Identität des Ununterscheidbaren stellen sie keine mögliche Welt dar, weil es nichts in solchen Konfigurationen gibt, was ihre Elemente individuiert. Folglich ist es eine Illusion zu glauben, man 22habe es in einem solchen Fall mit einer Vielzahl von Elementen oder Objekten (und folglich mit einer Konfiguration) zu tun.[6]
Parameter, die den Objekten in naturwissenschaftlichen Theorien über ihre relativen Orte hinaus zugeschrieben werden – wie zum Beispiel Masse oder Ladung –, können diese nicht unterscheiden. Diese Parameter lassen zwar eine Unterscheidung zwischen verschiedenen Arten von Teilchen zu, wie zum Beispiel den verschiedenen Teilchenarten im heutigen Standardmodell der Physik, können aber nicht zwischen den einzelnen Teilchen derselben Art unterscheiden. Alle Teilchen einer Art – wie zum Beispiel alle Elektronen – haben die gleichen Werte von Masse, Ladung usw. Folglich gibt es keine qualitativen Eigenschaften, welche die Teilchen individuieren könnten. Hieran bestätigt sich: Die Frage danach, was die physikalischen Objekte individuiert, wird durch die Abstandsrelationen beantwortet, und nur durch diese. Das Ergebnis dieser Überlegung ist also: Es ist nichts weiter erforderlich als Abstandsrelationen, um sowohl die Objekte zu individuieren als auch eine Relation zur Verfügung zu haben, welche die Objekte miteinander verbindet, so dass sie eine Welt bilden. Diese Einsicht ist eine der Kernthesen der Position, die in der heutigen Metaphysik als »ontischer Strukturenrealismus« bekannt ist.[7]
Genügt dies jedoch wirklich, um die Teilchen als materielle Objekte zu kennzeichnen? Wie oben erwähnt, definiert Descartes die Materie als res extensa, und das ist in der Tat das, was die Materie gemäß der Naturwissenschaft ist. Alles, was die Materie ausmacht, besteht in Ausdehnung im Sinne von Abstandsrelationen zwischen Punktteilchen und deren Veränderung. Es gibt insbesondere keine Stoff-Essenz der Materie, und es ist auch völlig unklar, was eine solche Stoff-Essenz sein könnte. Auch die Undurchdringlichkeit der Materie wird durch die Individuation der materiellen Objekte durch die Abstandsrelationen erfasst: Damit es zwei materielle Objekte gibt, muss es einen Abstand zwischen ihnen geben, also eine Distanz, die nicht verschwindet (das heißt nicht null wird). Folglich kann kein Objekt ein anderes durchdringen.
Ferner ist die Definition der Materie durch Abstandsrelationen gehaltreich; sie grenzt materielle von nicht-materiellen Gegenstän23den ab. Descartes definiert die Materie als res extensa und den Geist als res cogitans.[8] Das besagt: Punkte sind Materiepunkte (Punktteilchen) genau dann, wenn sie in Abstandsrelationen stehen. Geistpunkte (im Sinne von mens) sind Punkte hingegen dann und nur dann, wenn sie in Denkrelationen stehen. Mit diesen Definitionen allein ist nicht gesagt, dass es tatsächlich auch fundamentale Denkrelationen und fundamentale Geistpunkte gibt. Alles mag materiell sein. Das ist eine Frage wissenschaftlicher und philosophischer Argumente, die ich in Kapitel 3 erörtern werde. An dieser Stelle ist nur wichtig, sich darüber im Klaren zu sein, dass Abstandsrelationen eine nichttriviale und operationelle Definition der Materie ermöglichen, die das Materielle vom Nichtmateriellen abgrenzt (unabhängig davon, ob es tatsächlich Nichtmaterielles gibt).
Zusammenfassend können wir die primitive Ontologie des Atomismus durch die folgenden beiden Axiome oder Prinzipien auf den Punkt bringen:
(1)Es gibt Abstandsrelationen, die einfache Objekte, nämlich Punktteilchen (Materiepunkte), individuieren;
(2)Die Punktteilchen sind beständig, während die Abstände zwischen ihnen sich ändern.[9]
1.3 Dynamische Struktur
Kann es Abstandsrelationen ohne einen Raum geben, in den diese Relationen eingebettet sind? Und kann es Veränderungen dieser Relationen geben ohne eine Zeit, in welcher diese Veränderungen stattfinden? Isaac Newton verneint das; ihm zufolge gibt es einen absoluten Raum und eine absolute Zeit. Raum und Zeit existieren somit unabhängig von der Materie. Man kann sie sich wie einen Container vorstellen, in den die Konfiguration der Materie eingebettet ist und in welchem sich ihre Entwicklung entfaltet.[10] Gottfried Wilhelm Leibniz greift Newton an dieser Stelle an. Sein Argument ist, in heutigen Begriffen ausgedrückt, dass es sich bei 24Raum und Zeit um eine Surplus-Struktur handelt: Ein absoluter Raum und eine absolute Zeit lassen viel mehr Möglichkeiten zu als diejenigen, welche empirisch unterscheidbar sind. Wenn zum Beispiel die gesamte Konfiguration der Materie des Universums in einen absoluten Raum eingebettet wäre, dann könnte sie in diesem Raum als Ganze verschoben oder gedreht werden. Keine solche Verschiebung oder Rotation würde jedoch einen empirischen Unterschied ergeben: Alle Relationen zwischen den materiellen Objekten blieben gleich. Es handelte sich sozusagen um einen Unterschied (unterschiedliche Positionen aller Objekte im absoluten Raum), der keinen Unterschied macht.[11]
Leibniz zufolge ist der Raum die Ordnung dessen, was zusammen existiert – das heißt Teilchen, die durch Abstandsrelationen miteinander verbunden sind und dadurch eine Welt aufbauen. Es gibt also nur räumliche Relationen. Der Raum selbst existiert nicht; er ist nur ein Mittel, um zu repräsentieren, wie diese Relationen die Objekte zusammenbinden, so dass sie zusammen existieren. Die Objekte sind Punktteilchen und folglich ausdehnungslos. Die Ausdehnung besteht ausschließlich in den Abstandsrelationen zwischen ihnen. Diese sind aus nichts zusammengesetzt, insbesondere nicht aus Punkten. Ebenso wenig wie einen Raum gibt es Raumpunkte. Die Zeit ist die Ordnung der Abfolge: Die Abstände zwischen den Objekten verändern sich. Die Zeit ist das Mittel, um diese Veränderung zu repräsentieren in dem Sinne, ihr eine Metrik aufzuerlegen. Grundlegend ist mithin die Veränderung, und die Zeit ist von ihr abgeleitet.[12]
Die Abstandsrelation hat mehrere Merkmale. Sie ist irreflexiv: Nichts kann einen Abstand zu sich selbst haben. Sie ist symmetrisch: Wenn Punktteilchen i einen bestimmten Abstand zu Punktteilchen j hat, dann hat j denselben Abstand zu i. Sie verbindet alle Objekte: Beliebige zwei Objekte in einer Konfiguration stehen in einer Abstandsrelation zueinander. Sie erfüllt die Dreiecks-Ungleichung: Für beliebige Punktteilchen i, j und k gilt, dass die Summe der Abstände zwischen i und j und j und k größer, als der oder gleich dem Abstand zwischen i und k ist. Es kommt alleine auf 25die Verhältnisse oder Proportionen zwischen den Abständen an – nicht darauf, wie weit i von j absolut entfernt ist, sondern wie weit i von j entfernt ist im Vergleich dazu, wie weit i von k entfernt ist und k von j. Um solche Vergleiche durchzuführen, benötigt man Zahlen – genauer gesagt die reellen Zahlen – als Darstellungsmittel. Aber durch den Gebrauch von Zahlen wird nichts Neues oder gar Unendliches in die Ontologie eingeführt, Zahlen sind lediglich ein Repräsentationsmittel. Die Ontologie des Universums besteht aus sehr vielen Punktteilchen. Wenn es N Punktteilchen gibt (mindestens 3), dann gibt es endlich viele Abstandsrelationen, nämlich 1/2N(N–1) Abstandsrelationen.
Es ist offensichtlich, dass die Abstandsrelationen, die es im Universum gibt, noch mehr Merkmale aufweisen, als lediglich die Dreiecks-Ungleichung zu erfüllen, die das minimale Kriterium für eine metrische Ordnung ist.[13] Aber man kann alles, was diese Relationen ausmacht, in einer Weise darstellen, die keine absoluten Größen (wie zum Beispiel absolute Längen) erfordert. Wie gesagt: Nur die Verhältnisse zwischen den Abständen gehören zur Ontologie, zu dem, was es in der Welt gibt. Dementsprechend ist der am besten ausgearbeitete Vorschlag, die Physik allein auf der Basis von Abstandsrelationen zwischen Objekten zu verstehen, die relationale Mechanik, die von Julian Barbour und seinen Mitarbeitern seit den 1970er Jahren entwickelt wird.[14] Diese Theorie ist auch als Dynamik geometrischer Figuren (shape dynamics) bekannt, denn alles, was die Punktteilchen ausmacht, ist in der Figur der Teilchenkonfiguration enthalten. Dazu ist es erforderlich, Abstände und Winkel, welche die Figur definieren, als primitiv anzuerkennen, aber man benötigt keine absoluten Größen. Es ergibt also keinen Sinn zu fragen, wie weit ein Teilchen von anderen Teilchen in einem absoluten Sinne entfernt ist, sondern nur, in welchem Verhältnis die Entfernungen der Teilchen zueinander stehen. Die Theorie ist somit invariant in Bezug auf Streckungen oder Stauchungen der geometrischen Figuren (scale invariance).
26Leibniz’ Sicht der Zeit als Ordnung der Abfolge ist eine Form dessen, was als kausale Theorie der Zeit bekannt ist: Veränderung ist eine primitive Tatsache, die mithin auf nichts anderes zurückgeführt werden kann. Auf dieser Grundlage ist dann Zeit das Maß der Veränderung, also ein Mittel, um die Veränderung zu repräsentieren. Der Begriff »kausale Theorie der Zeit« ist jedoch insofern irreführend, als es hier nicht um Ursachen der Veränderung geht. Es geht hier nur darum, dass Veränderung in der räumlichen Konfiguration der Materie primitiv ist, ohne dass es eine Zeit gibt, in welcher diese Veränderung stattfindet. Nichtsdestoweniger ist Veränderung gerichtet: Sie führt im Ausgang von einer bestimmten Konfiguration von Abstandsbeziehungen zu einer anderen bestimmten Konfiguration von Abstandsbeziehungen innerhalb der Teilchenkonfiguration des Universums. Folglich gibt es eine objektive Entwicklung oder Geschichte des Universums, nämlich eine bestimmte Abfolge, in der sich die Abstandsbeziehungen zwischen den Teilchen im Universum ändern.
Abbildung 1.1: Konfiguration von Punktteilchen, die durch ihre relativen Lagen individuiert werden.
Abbildung 1.2: Abfolge sich verändernder Abstandsrelationen zwischen einer festen Anzahl permanenter Punktteilchen mit einer objektiven Ordnung τ dieser Abfolge. Diese Abbildung ist jedoch in der Hinsicht irreführend, dass sie die Veränderung als diskret statt kontinuierlich darstellt.