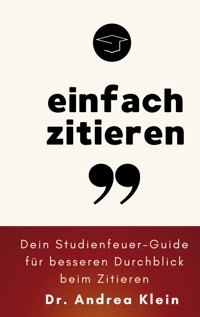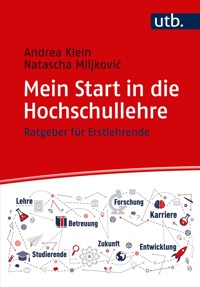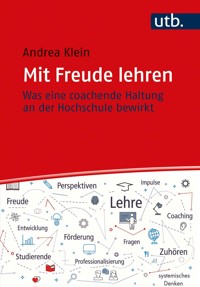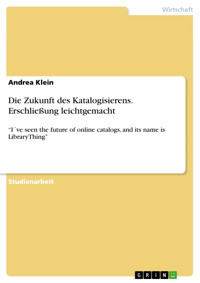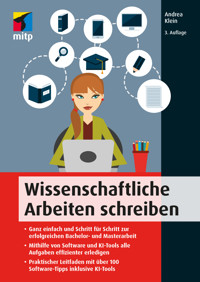
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: MITP
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Serie: mitp Professional
- Sprache: Deutsch
- Effektive Methoden, um Hürden beim Schreiben zu bewältigen, sich besser zu organisieren und die vorhandene Zeit gut zu planen sowie hilfreiche Strategien für unterschiedliche Schreibtypen
- Wertvolle Tipps für Software, die in allen Phasen der Arbeit sinnvolle Unterstützung leisten kann
- Alle Aufgaben des wissenschaftlichen Arbeitens einfach erläutert: Literaturverwaltung, -recherche und -auswertung, Inhalte sammeln und strukturieren, Schreiben und effektives Überarbeiten
Dieser Leitfaden ist eine motivierende Anleitung für das erfolgreiche Schreiben wissenschaftlicher Arbeiten und zeigt hilfreiche Methoden, wie sich alle Aufgaben viel leichter und effizienter bewältigen lassen, unabhängig vom Studienfach.
Einen besonderen Fokus legt die Autorin auf den Einsatz von Software als sinnvolle Unterstützung und Arbeitserleichterung in allen Phasen des wissenschaftlichen Arbeitens. Dazu beschreibt sie den Einsatz von über 100 verschiedenen Softwarelösungen von Citavi über Zotero bis hin zu vielen kleinen hilfreichen Programmen. Auch den Umgang mit KI-Tools behandelt die Autorin konstruktiv und zeigt auf, inwiefern diese eine gute Unterstützung beim Schreiben sein können.
Die Autorin behandelt alle Themen des wissenschaftlichen Schreibens Schritt für Schritt: vom Orientieren und Planen über das Sammeln und Strukturieren von Inhalten bis hin zum Schreibprozess. Sie zeigt sinnvolle Vorgehensweisen und gibt zahlreiche Tipps, so dass sich alle Aufgaben meistern lassen, ohne sich zu verzetteln und den Zeitplan aus den Augen zu verlieren.
Mithilfe der passenden Software und diesem praktischen Leitfaden wird das wissenschaftliche Arbeiten deutlich leichter.
Aus dem Inhalt:- Teil I: Orientieren und Planen
- Selbstorganisation, Motivation und Zielerreichung
- Methoden zur Zeitplanung und Tagesstruktur
- Einsatzbereiche von Software
- Anforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit
- Inhaltlicher Einstieg: Thema und Fragestellung finden sowie Methoden für die Orientierungsphase
- Teil II: Sammeln und Strukturieren
- Literaturverwaltung, -recherche und -auswertung
- Effektives Lesen sowie Verarbeiten der Inhalte
- Einsatz empirischer Methoden
- Gliederung und Aufbau der Arbeit
- Teil III: Schreiben und überarbeiten
- Schreibtechniken
- Verschiedene Schreibstrategien
- Überzeugende Vermittlung von Inhalten
- Korrektes Zitieren
- Überarbeiten: Feedback einholen und verarbeiten
Die Features der beschriebenen Software in einem praktischen Überblick
Amazon-Rezension zur Vorauflage:»Auf geniale Weise werden hier ‚Wissenschaftlich Arbeiten‘ und ‚Wissenschaftlich Schreiben‘ miteinander vereint. Checklisten, tolle Praxis-Tipps und Software-Empfehlungen runden die Teil-Aspekte des Schreib-, Lese- und Forschungsprozesses ab, die alle Schritt für Schritt behandelt werden! Warum gibt es das erst jetzt? :-)«
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Andrea Klein
Wissenschaftliche Arbeiten schreiben
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
ISBN 978-3-7475-0702-5 3. Auflage 2023
www.mitp.de E-Mail: [email protected] Telefon: +49 7953 / 7189 - 079 Telefax: +49 7953 / 7189 - 082
© 2023 mitp Verlags GmbH & Co. KG
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften.
Dieses E-Book verwendet das EPUB-Format und ist optimiert für die Nutzung mit Apple Books auf dem iPad von Apple. Bei der Verwendung von anderen Readern kann es zu Darstellungsproblemen kommen.
Der Verlag räumt Ihnen mit dem Kauf des E-Books das Recht ein, die Inhalte im Rahmen des geltenden Urheberrechts zu nutzen. Dieses Werk, einschließlich aller seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Der Verlag schützt seine E-Books vor Missbrauch des Urheberrechts durch ein digitales Rechtemanagement. Bei Kauf im Webshop des Verlages werden die E-Books mit einem nicht sichtbaren digitalen Wasserzeichen individuell pro Nutzer signiert. Bei Kauf in anderen E-Book-Webshops erfolgt die Signatur durch die Shopbetreiber. Angaben zu diesem DRM finden Sie auf den Seiten der jeweiligen Anbieter.
Lektorat: Sabine Schulz, Nicole Winkel Sprachkorrektorat: Petra Heubach-Erdmann Covergestaltung: Christian Kalkert Coverbild: © conorcrowe / stock.adobe.com Satz: III-satz, Kiel, www.drei-satz.deelectronic publication: III-satz, Kiel, www.drei-satz.de
Vorwort zur dritten Auflage
Als ich im Jahr 2016 am Manuskript zur ersten Auflage dieses Buches arbeitete, hatte ich nicht die leiseste Ahnung, wohin das alles führen würde. Ich hoffte, dass das Buch seine Leserschaft finden würde, und nahm in Kauf, dass ich für etwaige Folgeauflagen die Informationen zur Software ein wenig nachrecherchieren und auf den aktuellen Stand bringen muss. Künstliche Intelligenz hatte damals wenig mit meinem Leben zu tun.
Dennoch haben mich die jüngsten Entwicklungen nicht komplett überrascht. Mittlerweile bin ich in etliche Netzwerke zu den verschiedenen Aspekten des wissenschaftlichen Arbeitens eingebunden, wie etwa in das Kompetenzzentrum VK:KIWA für künstliche Intelligenz beim wissenschaftlichen Arbeiten. Somit bin ich »am Puls der Zeit«. Zudem habe ich selbst die Gründung des Vereins PARWIN e.V. initiiert, der den Austausch über das wissenschaftliche Arbeiten und die Lehre in diesem Bereich fördern möchte und mit dem wir einen Referenzrahmen für das wissenschaftliche Arbeiten gestalten.
Auch das eigene wissenschaftliche Arbeiten nimmt wieder mehr Raum in meinem Leben ein. Und was läge bei mir näher, als auf dem Gebiet des wissenschaftlichen Arbeitens zu forschen?
All diese Erfahrungen in Lehre und Forschung sowie durch den kollegialen Austausch fließen in das Buch ein.
Was hat sich im Vergleich zur ersten Auflage geändert?
Am offensichtlichsten sind die Ergänzungen zu künstlicher Intelligenz beim wissenschaftlichen Arbeiten. Der Hype um KI-Tools wird zwar abflachen. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Tools verschwinden werden – im Gegenteil. Wir werden in den kommenden Jahren noch viele neue und neuartige Lösungen sehen. Daher soll Sie natürlich gerade dieses Buch zur Software beim wissenschaftlichen Arbeiten über den Umgang mit KI-Tools informieren. Auch die Angaben zur herkömmlichen Software habe ich für die dritte Auflage erneut ergänzt und aktualisiert. Zudem habe ich Änderungen am Text vorgenommen, wo es mir inhaltlich geboten schien. Der Aufbau des Buches hat sich bewährt und wurde demnach so belassen.
Über die Autorin
Dr. Andrea Klein – Dozentin, Coach und Autorin – lehrt seit vielen Jahren an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens. Im Jahr 2019 hat sie den Online-Kongress »Studienfeuer« ins Leben gerufen (www.studienfeuer.de). In hochschuldidaktischen Workshops teilt Andrea Klein ihre Erfahrungen mit Dozierenden und entwickelt mit ihnen Herangehensweisen für die Lehre sowie für die Betreuung und Begutachtung studentischer Arbeiten. Ihr Fachblog »Wissenschaftliches Arbeiten lehren« (www.wissenschaftliches-arbeiten-lehren.de) richtet sich ebenfalls an Dozierende. Dr. Andrea Klein ist Vorstand des im Jahr 2022 gegründeten Vereins PARWIN e.V. (Promoting Academic Research and Writing – an international network).
https://www.perfectible.de
Danksagung
»Die Neugier steht immer an erster Stelle eines Problems, das gelöst werden will.« (Galileo Galilei)
Neugier und auch Ausdauer braucht es beim wissenschaftlichen Arbeiten und beim Verfassen eines Buches gleichermaßen.
Ein herzlicher Dank geht an alle, die mich beim Schreiben des vorliegenden Buches begleitet haben.
Dem Verlag danke ich für die angenehme Zusammenarbeit und hier insbesondere Sabine Schulz für das sehr umsichtige und hilfreiche Lektorat sowie Nicole Winkel für die engagierte Unterstützung beim Fertigstellen der dritten Auflage.
Die Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden hat mir im Lauf der Jahre ungezählte wertvolle Impulse gegeben – im persönlichen Gespräch, in den Lehrveranstaltungen und in den Kommentaren auf meinem Blog. Danke an jede einzelne Person! Unserem Team des VK:KIWA bin ich sehr dankbar für den engagierten und unkomplizierten Austausch über KI-Tools beim wissenschaftlichen Arbeiten.
Bei der dritten Auflage hatte ich großartige Unterstützung von Sandra Müller und Sezgi Ceylanoglu, die Tools recherchiert und getestet, mir Feedback zu neuen Textpassagen gegeben und die eine oder andere Abbildung angepasst haben.
Besonders bedanken möchte ich mich bei meinem Wegbegleiter Dr. Daniel Kraft. Mit seinem Feedback hat er mir neben wohltuender Bestätigung auch viele konstruktive Hinweise zum Inhalt gegeben.
Meiner Familie danke ich für ihre Nachsicht, als meine Neugier auf das Buchprojekt siegte, und für den bedingungslosen Rückhalt, als im weiteren Verlauf Ausdauer gefragt war.
Einleitung
Mit diesem Buch lernen Sie nach und nach, die Teilaspekte des wissenschaftlichen Arbeitens zu bewältigen. Die große Aufgabe »Eine wissenschaftliche Arbeit schreiben« ist in mehrere Arbeitspakete unterteilt.
Außerdem erhalten Sie in diesem Buch wichtige Informationen zum Einsatz von Software beim wissenschaftlichen Arbeiten. Nirgendwo sonst werden diese Hilfsmittel so gebündelt präsentiert wie hier.
Zielgruppe des Buches
Das Buch richtet sich an Studierende aller Fachrichtungen, in denen schriftliche Arbeiten – damit sind hier vorrangig Haus-, Seminar- und Abschlussarbeiten gemeint – verfasst werden. Es ist als eine Art Basisbuch zu verstehen, als ein gemeinsamer Nenner für viele Fachrichtungen. Immer wieder finden Sie jedoch auch Hinweise auf Spezifika in einzelnen Fächern oder Fachgruppen.
Das Buch richtet sich sowohl an klassische Präsenzstudierende als auch an Fernstudierende. Gerade Fernstudierenden helfen die vielfältigen digitalen Angebote bei Austausch und Zusammenarbeit mit den Mitstudierenden über größere Distanzen.
Das Buch eignet sich sowohl am Anfang als auch im fortgeschrittenen Studium. Wenn Sie gerade zum ersten Mal eine wissenschaftliche Arbeit schreiben (was je nach Aufbau des Studiengangs auch die Abschlussarbeit sein kann), bietet das Buch Ihnen eine vollständige Erklärung des wissenschaftlichen Arbeitens – und außerdem der Software. Als »Fortgeschrittene« bezeichne ich all jene, die in ihrem Studium schon eine oder mehrere Arbeiten geschrieben haben. Sie haben entweder zu diesem Buch gegriffen, weil Sie jetzt gezielt Software einsetzen wollen oder weil Sie Ihre bisherige Arbeitsweise verbessern möchten.
Wichtig
Das Beherrschen des grundlegenden Umgangs mit dem Rechner wird vorausgesetzt. Darunter ist zu verstehen, dass Sie über Grundkenntnisse der gängigen Office-Programme verfügen. Sie sollten zudem Software herunterladen und installieren können. Sind diese Voraussetzungen noch nicht gegeben, sollten Sie diese unbedingt in naher Zukunft schaffen.
Ziel des Buches
Das Buch soll ein ermutigender Ratgeber für Sie sein, mit dem Sie das wissenschaftliche Arbeiten erlernen können. Es behandelt zum einen die Aspekte, die Sie auch in anderen einschlägigen Ratgebern finden, nämlich den Prozess von der Idee bis zur fertigen Arbeit und die Konventionen des wissenschaftlichen Schreibens. Zum anderen lernen Sie zusätzlich viel über den Aspekt des Software-Einsatzes. All dem sind zwei ausführliche Kapitel zu Selbststeuerung und Zeitplanung vorangestellt. Denn damit steht und fällt das Anfertigen einer wissenschaftlichen Arbeit.
Haben Sie keine Bedenken, dass das Buch schnell veralten könnte. Es ist absichtlich so geschrieben, dass Sie auch dann einen großen Nutzen davon haben, wenn vielleicht einmal eine neue Software auf den Markt kommt oder bestehende Software sich verändert. Denn Sie kennen durch die Lektüre des Buches die Kriterien, auf die Sie bei der Auswahl von Software achten sollten. Zudem sind die generellen Inhalte zum wissenschaftlichen Arbeiten zeitlos.
Bei der Auswahl der vorgestellten Software habe ich mich von mehreren Aspekten leiten lassen. Mit Rücksicht auf den studentischen Geldbeutel habe ich vorzugsweise kostenlose oder günstige Programme in die engere Wahl genommen und sehr teure Software nur beschrieben, wenn Sie vermutlich über Hochschullizenzen einen kostenlosen Zugang dazu erhalten können. Ich habe des Weiteren darauf geachtet, für alle Betriebssysteme Vorschläge zu machen.
Ansatz des Buches
Als Lehrende der Veranstaltung »Wissenschaftliches Arbeiten« habe ich über die Jahre viele verschiedene Studierende kennengelernt. Die mitunter recht intensive Zusammenarbeit hat mich zu dem Schluss gebracht, dass es beim wissenschaftlichen Arbeiten keine Patentrezepte für alle geben kann – egal, wie sehr die Fragen und Nöte sich ähneln. Die Menschen sind zu unterschiedlich, als dass man ihre Arbeitsweise in ein bestimmtes Schema pressen könnte. Es liegt mir also fern, dogmatisch vorzugehen und Standardlösungen vorzuschlagen.
Finden Sie selbst heraus, welche der vorgestellten Arbeitsweisen zu Ihnen passt. Nutzen Sie Ihre Stärken und bauen Sie diese aus, und lernen Sie mit Schwächen so umzugehen, dass sie Ihnen nicht mehr im Weg stehen – anstatt vergeblich und mit zunehmender Lustlosigkeit einem Idealbild nachzueifern. Das gilt auch und besonders für den Software-Einsatz. Nutzen Sie Software mit Sinn und Verstand. Verwenden Sie sie nur in den Bereichen, in denen es Ihnen wirklich sinnvoll erscheint.
Aufbau des Buches
Die kurze Einführung in Kapitel 1 bereitet Sie auf die Inhalte von Teil I bis III des Buches vor. Zunächst geht es um den persönlichen Nutzen des wissenschaftlichen Arbeitens und um Wissenswertes zum wissenschaftlichen Arbeitsprozess. Ein paar Vorurteile über den idealen Wissenschaftler werden auch noch ausgeräumt.
Jeder Teil des Buches besteht aus mehreren Kapiteln. Übrigens: Bei fast allen Themen kommt Software zum Einsatz, auch wenn sie in den folgenden Kurzbeschreibungen nicht ausdrücklich erwähnt wird.
Teil I: Orientieren und planen bildet den Rahmen für das Anfertigen von wissenschaftlichen Arbeiten. Bevor Sie mit Ihrer eigenen Arbeit loslegen, sollten Sie die organisatorischen und technischen Voraussetzungen schaffen und sich außerdem ein paar grundlegende Gedanken über Ihre eigene Arbeitshaltung machen. In Hinblick auf die Software ist in Teil I neben allen erdenklichen Selbststeuerungs- und Zeitplanungs-Tools auch Software zur Zusammenarbeit mit anderen interessant.
Kapitel 2über Selbststeuerung steht nicht zufällig am Anfang des Buches. Hierin geht es um zwei wesentliche Aspekte erfolgreichen Studierens: Motivation und Zielerreichung. Wenn Sie wissen, was Sie motiviert, und auf welchen Wegen Sie Ihre Ziele erreichen wollen, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass dies auch tatsächlich passiert. Im Optimalfall empfinden Sie dann sogar Freude dabei! Da in vielen Studiengängen auch Gruppenarbeit verlangt wird, man bei der Zielerreichung also auch auf andere angewiesen ist, sind die Ausführungen zur Gruppenarbeit in dieses Kapitel integriert.
Um Zeitplanung geht es in Kapitel 3. Hier finden Sie Informationen für eine Planung, die wirklich zu Ihnen passt. Sie lernen verschiedene Methoden kennen, die geeignet sind, Ihren Semestern, Monaten, Wochen, aber auch den einzelnen Tagen eine sinnvolle Struktur zu verleihen. Was tatsächlich als sinnvoll gelten kann, ist individuell sehr unterschiedlich. Dies erkennen Sie auch an den drei Beispielen für die Planung einer Abschlussarbeit.
Kapitel 4 ist vollständig dem Thema Software gewidmet. Nach der Klärung der wesentlichen Fragen – wieso und welche Software beim wissenschaftlichen Arbeiten – liegt der Fokus dieses Kapitels auf der Auswahl der für Sie richtigen Software. Sie erfahren alles über die Entscheidungskriterien, die Sie beim Einsatz von Software zugrunde legen sollten. Eine Checkliste fasst diese Kriterien zusammen, sodass Sie die Programme, die Sie in die engere Wahl genommen haben, besser vergleichen können. Diese Checkliste finden Sie unter www.mitp.de/0700 zum Herunterladen. Für die dritte Auflage habe ich ein Unterkapitel zum Einsatz künstlicher Intelligenz beim wissenschaftlichen Arbeiten ergänzt.
In Kapitel 5 wenden wir uns der Wissenschaft als solcher zu. Ausgehend von einem Wissenschaftsverständnis, das wissenschaftliches Arbeiten als Dialog ansieht, werden vor allem zwei Fragen beantwortet: Erstens, welche Anforderungen werden überhaupt an wissenschaftliche Arbeiten gestellt? Zweitens, wo liegt der Unterschied zwischen Alltagswissen und wissenschaftlichem Wissen? Zudem erhalten Sie eine kurze Einführung in die Wissenschafts- und Erkenntnistheorie.
Insbesondere diejenigen, die mit dem Studium gerade erst beginnen sollten dieses Kapitel aufmerksam lesen. Aber auch Fortgeschrittene werden ein paar neue Erkenntnisse und vielleicht sogar Aha-Momente mitnehmen.
Den Einstieg in die eigene Arbeit soll Ihnen Kapitel 6erleichtern. Der Ausgangspunkt ist hier die Suche nach Ideen für ein passendes Thema. Daran schließt sich das Entwickeln einer geeigneten Fragestellung an. Sie bekommen etliche Methoden an die Hand, die Ihnen die Orientierungsphase erleichtern.
In Teil II: Sammeln und strukturieren geht es um das Material und seine Ordnung. Mit »Material« ist hauptsächlich die wissenschaftliche Literatur gemeint, in manchen Fällen jedoch auch die Daten, die Sie für Ihre Arbeit benötigen. Demnach lernen Sie vor allem Software zur Literaturverwaltung und für den Einsatz empirischer Methoden kennen.
Die Literaturverwaltung wird in Kapitel 7 noch vor der Recherche und Auswertung behandelt. Der Grund hierfür liegt in der Software: Viele Programme in diesem Bereich haben sich zu wahren Alleskönnern entwickelt. Daher sollten Sie vor der eigentlichen Recherche deren vielfältige Möglichkeiten kennengelernt haben. Damit kommen Sie nämlich in kürzerer Zeit zu besseren Ergebnissen. Um bei der Vielzahl von Features, die die verschiedenen Literaturverwaltungsprogramme aufweisen, eine gute Entscheidung zu treffen, werden sowohl die geeignetsten Vertreter als auch die drei Hauptauswahlkriterien vorgestellt. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Einstieg ist ebenfalls enthalten.
In Kapitel 8 lernen Sie dann schließlich, wie Sie bei der Literaturrecherche und -auswertung vorgehen sollten. Neben den generellen Suchstrategien und -techniken lernen Sie auch die besten Suchorte kennen. Sie erfahren, wie Sie die gefundene Literatur in zwei Schritten auswerten.
Lesen ist das Thema von Kapitel 9. Beim sogenannten aktiven Lesen nehmen Sie gedanklich eine andere Haltung ein als beim normalen Lesen und Nutzen verschiedener Techniken, um den Inhalt der Texte möglichst gut zu erfassen. Wie Sie diesen am besten weiterverarbeiten, wird auch behandelt. Neben gewöhnlichen Notizprogrammen stehen hier digitale Zettelkästen im Fokus.
Kapitel 10 wendet sich an fortgeschrittene Anfänger, die den Einsatz empirischer Methoden in Erwägung ziehen. Anhand der beiden Phasen Datenerhebung und -erfassung sowie Datenauswertung erfahren Sie Grundlegendes über qualitative und quantitative Methoden.
Wie Ihr Material in seine neue Struktur findet und Sie es in eine formal ansprechende Form gießen, erfahren Sie in Kapitel 11, Gliederung und formaler Aufbau. Das bedeutet übrigens nicht, dass dies zwingend vor dem Schreiben geschehen muss.
Der letzte Teil des Buches, Teil III: Schreiben und überarbeiten, ist dem Prozess und dem Produkt Ihres wissenschaftlichen Schreibens gewidmet. Softwareseitig sind in diesem Teil naturgemäß Textverarbeitungsprogramme von Interesse.
Auf dem Weg zu Ihrem neu zu verfassenden Text will zuerst einmal in Kapitel 12 die Schreibtechnik näher betrachtet werden. Darunter fallen das Zehnfingersystem ebenso wie nützliche Tastaturkürzel. Eignen Sie sich außerdem neue Kenntnisse der Textverarbeitung an, die Ihnen das Schreiben auf Dauer erleichtern. Damit Sie auch dauerhaft auf Ihre Ergebnisse zugreifen können, ist der Datensicherung ebenfalls ein Abschnitt gewidmet.
Kapitel 13 über den Schreibprozess behandelt die unterschiedlichen Strategien, die verschiedene Schreibende entwickelt haben. Der Weg zum fertigen Text muss nicht einem starren Muster folgen. Finden Sie heraus, wie Sie Ihre eigene Strategie durch neue Ansätze bereichern können.
Die Methodensammlung liefert Ihnen Übungen für den Schreibeinstieg und das Dranbleiben.
Kapitel 14 beschäftigt sich mit dem Vermitteln von Inhalten, also damit, wie Sie Ihre Ergebnisse der Leserschaft am besten präsentieren – sei es durch überzeugenden Text, sei es durch aussagekräftige Abbildungen und Tabellen. Sie erfahren, wie Sie den Text leserfreundlich gestalten und wie Sie Ihre Aussagen durch ansprechende Darstellungen untermauern.
In Kapitel 15 erhalten Sie die wesentlichen Informationen über das Korrekte Zitieren: eine Erläuterung von Zitierfähigkeit und Zitierwürdigkeit sowie einen Überblick über die verschiedenen Zitiertechniken und über das Einbinden von Zitaten in den eigenen Text, auch mittels entsprechender Software. So können Sie die Quellenangaben im Text und das Literaturverzeichnis nach allen Regeln der Kunst verfassen.
Eines der wichtigsten Kapitel ist Kapitel 16 mit dem Thema Überarbeiten. Dieser Arbeitsschritt geht einher mit dem Feedback anderer. Dabei wollen bestimmte Regeln beachtet sein, damit die Rückmeldung gelingen und zu einem besseren Text führen kann. Die inhaltliche, formale und sprachliche Überarbeitung schließt sich an das Feedback an. Damit sind Sie auf die Zielgerade eingebogen und stehen kurz davor, Ihre Arbeit einzureichen.
In Kapitel 17, Allerletzte Schritte, stelle ich Ihnen zum Abschluss einige Fragen zur Reflexion, damit das Erstellen Ihrer nächsten Arbeit noch besser läuft.
Die Fact Sheets im Anhang geben Ihnen einen schnellen Überblick über die Software.
Erlauben Sie mir noch zwei Hinweise, bevor Sie mit der Lektüre beginnen.
Gern möchte ich mit inklusiven Formulierungen möglichst viele Menschen ansprechen. Die von mir bevorzugte Schreibweise mit einem Doppelpunkt ist nicht konform mit den Vorgaben des Duden-Verlags und konnte daher in diesem Buch nicht zum Einsatz kommen. An einigen Stellen im Text habe ich daher, wenn eine inklusive Formulierung für mein Sprachempfinden zu sehr zu Lasten der Lesbarkeit gegangen wäre, einseitig die weibliche oder die männliche Form verwendet. Dies ist als sprachliche Vereinfachung zu verstehen.
Sollten Sie Anregungen zum Inhalt des Buches haben, dürfen Sie mich gern kontaktieren. Sie erreichen mich unter der E-Mail-Adresse:
Kapitel 1: Eine Ermutigung
Wissenschaftliches Arbeiten und alles, was damit zusammenhängt, klingt oft sehr kompliziert. Gerade zu Beginn fühlt es sich wie eine unüberwindbare Aufgabe an, selbst eine wissenschaftliche Arbeit verfassen zu sollen. Ob das Erlernen des wissenschaftlichen Arbeitens so richtig nützlich ist, scheint vielen Studierenden überdies mehr als fraglich.
In diesem kurzen Einstiegskapitel möchte ich mit Ihnen zunächst ergründen, inwiefern das Erlernen des wissenschaftlichen Arbeitens für Sie persönlich nützlich werden könnte, wie der wissenschaftliche Arbeitsprozess im Allgemeinen tatsächlich abläuft und wie »der ideale Wissenschaftler« oder »die ideale Wissenschaftlerin« aussieht, wenn es ihn oder sie denn gibt.
Sie werden überrascht sein!
1.1 Persönlicher Nutzen des wissenschaftlichen Arbeitens
Angesichts der Menge an schriftlichen Arbeiten, die in manchen Studiengängen zu verfassen sind, stöhnen viele Studierende auf und stellen sich die Sinnfrage. Wozu soll das bitte schön gut sein? Wieso werden einem so viele wissenschaftliche Arbeiten abverlangt? Dieses Können braucht man doch nie wieder, wenn man nicht gerade eine wissenschaftliche Karriere einschlagen möchte!
Selbstverständlich wird im Berufsleben in den seltensten Fällen von Ihnen gefordert, seitenlange Arbeiten zu verfassen, für deren Anfertigung Sie wochen- oder monatelang Zeit haben. Allerdings wird das wissenschaftliche Schreiben oft als sogenannte Schlüsselkompetenz bezeichnet. Mit diesem Begriff werden Kompetenzen beschrieben, die allgemein und überfachlich von Nutzen sind. Es geht demnach nicht um fachliches Wissen, sondern um den Umgang damit. Wer bestimmte Schlüsselkompetenzen aufgebaut hat, kann auch neuartige Probleme lösen. Damit gelingt es, handlungsfähig zu bleiben, obwohl man mit dem aktuellen Problem noch nie konfrontiert war und demnach die Lösung dafür erst einmal finden muss.
Durch die Beschäftigung mit dem wissenschaftlichen Arbeiten lernen Sie:
die passende Herangehensweise an eine Fragestellung aus vielen möglichen Herangehensweisen auszuwählen
die Lösungsstrategie für ein Problem nicht nur zu planen, sondern auch umzusetzen
große Mengen an Text und Informationen zu finden, aufzunehmen und weiterzuverarbeiten
abstrakt, vernetzt, analytisch und kreativ zu denken
diese Gedanken nachvollziehbar zu präsentieren
schlüssig zu argumentieren
komplexe Sachverhalte verständlich und anschaulich darzustellen
Nebenbei schulen Sie Ihre Ausdauer und Sorgfalt sowie Ihre Fähigkeiten in Zeitplanung und Organisation. Eigenverantwortung und Selbstständigkeit werden auch noch gefördert. Für das berufliche Fortkommen sind alle genannten Fähigkeiten hilfreich.
Das soll nun im Umkehrschluss nicht bedeuten, dass Sie die aufgeführten Aspekte erst beherrschen, wenn Sie mehrere wissenschaftliche Arbeiten verfasst haben. In der Summe werden Sie jedoch merken, dass Sie sich darin im Laufe der Semester deutlich verbessern, wenn Sie Ihr Studium ernsthaft betreiben.
1.2 Wissenswertes über den wissenschaftlichen Arbeitsprozess
In diesem Abschnitt erhalten Sie einen ersten Überblick über die Teilbereiche im wissenschaftlichen Arbeitsprozess. All diese Themen werden ab Kapitel 2 noch einmal aufgegriffen und detaillierter beschrieben.
Im Wesentlichen unterscheidet man zwischen linearen und rekursiven Modellen des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses.
Lineare Modelle gehen davon aus, dass der wissenschaftliche Arbeitsprozess aus Schritten aufgebaut ist, die in einer festen Reihenfolge nacheinander und getrennt voneinander ablaufen.
Schritt 1: Orientieren und planen
Schritt 2: Sammeln und strukturieren
Schritt 3: Schreiben und überarbeiten
Schritt 4: Einreichen
Sobald Schritt 1 abgeschlossen ist, wendet man sich Schritt 2 zu, danach wiederum Schritt 3, bis die Arbeit fertiggestellt ist. Klingt eigentlich ganz einfach, oder? Mit etwas Erfahrung im Verfassen einer wissenschaftlichen Arbeit ließe sich anhand eines solchen linearen Modells leicht ein Zeitplan aufstellen. Darin würde man festlegen, wann welcher Schritt abgeschlossen zu sein hat.
In vielen Ratgebern zum wissenschaftlichen Arbeiten und auch in vielen Köpfen von Lehrenden finden Sie das Ideal des linearen Arbeitens – zumindest dann, wenn es darum geht, wie Studierende ihre Arbeiten verfassen sollen. Nach den eigenen Arbeitsmethoden befragt, berichten die meisten Lehrenden dann von einem komplett anderen Vorgehen. Die linearen Modelle scheinen also nicht für alle Schreibenden und alle Schreibaufgaben realistisch zu sein.
Die neueren, rekursiven Modelle gehen von Schleifen im Bearbeitungsprozess einer wissenschaftlichen Arbeit aus. Merkt man während eines späten Schrittes, dass man in einem früheren Schritt etwas übersehen hat, nimmt man die Arbeit daran einfach noch einmal auf.
Abb. 1.1: Vereinfachtes rekursives Modell des wissenschaftlichen Arbeitsprozesses
So könnte es beispielsweise passieren, dass Sie während des Schreibens zufällig auf einen aktuellen Zeitschriftenartikel aufmerksam werden, der Ihnen verdeutlicht, dass Sie noch einmal Literatur recherchieren sollten, um die relevanten Quellen auch tatsächlich in vollem Umfang zu erfassen. Oder beim Überarbeiten merken Sie, dass Sie in Ihrer Argumentation einen zentralen Aspekt außer Acht gelassen haben und die Gliederung und im Anschluss auch den Rohtext ergänzen müssen.
Eine Zeitplanung wird bei rekursiven Modellen erschwert, wenn man versucht, sie starr anhand der einzelnen Schritte auszurichten. Besser überlegt man sich, welche inhaltlichen Fortschritte man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht haben möchte (siehe Abschnitt 3.5).
Bei einer Arbeit, die man bereits von Anfang an inhaltlich gut überschauen kann, mag ein lineares Vorgehen gut funktionieren. Das wäre gleichzeitig eine Arbeit, bei der der persönliche Erkenntnisgewinn relativ klein wäre. In anderen Worten: Sie würden dabei kaum etwas lernen. Ein objektiver Erkenntnisgewinn, also etwas wissenschaftlich Neues, wird bei einer Erstsemesterarbeit sowieso nicht erwartet. Ihr persönlicher Erkenntnisgewinn, also das Dazulernen, ist trotzdem gegeben.
Der Bearbeitungsprozess bei Arbeiten mit einem fremden oder als schwierig empfundenen Thema wird immer rekursiv verlaufen. Sie müssen sich mit dem unbekannten Gebiet erst einmal vertraut machen und lernen in jeder Stunde dazu, in der Sie sich mit dem Thema befassen. Sie erschließen es sich im Laufe der Zeit. Wie wollen Sie da vorab festlegen, wann etwa die Literaturrecherche endgültig abgeschlossen sein soll? Sie wissen ja zu Beginn der Bearbeitung noch nicht einmal, welche und wie viele Untergebiete relevant werden könnten.
Der Umfang der Arbeit oder der objektive Anspruch der Arbeit spielt bei dieser Betrachtung nur eine untergeordnete Rolle. Wenn jemand im ersten Semester eine zehnseitige Arbeit abgeben soll, kann und darf er sein Thema zu Bearbeitungsbeginn genau so schwierig und unüberschaubar finden wie ein Bachelorkandidat sein Thema kurz vor Studienende.
Achtung
Je umfangreicher Ihr persönlicher Erkenntnisgewinn aus der Arbeit ausfällt, desto rekursiver verläuft vermutlich der Prozess des wissenschaftlichen Arbeitens.
Neben dem Kriterium des persönlichen Erkenntnisgewinns kommt noch ein zweites Argument für die rekursiven Modelle hinzu. Schreiben ist ein wichtiges Element für das wissenschaftliche Vorankommen und nicht ein Schritt unter vielen. Die linearen Modelle ordnen dem Schreiben allerdings einen festen Platz zu, nämlich nach der Literaturrecherche und dem Erstellen einer Grundstruktur, der (Grob-)Gliederung. Mit einer solchen Denkweise beraubt man sich jedoch der Kraft des Schreibens. Sie »dürfen« zu jedem Zeitpunkt schreiben, und nicht erst, wenn die Gliederung steht (siehe Kapitel 13).
Lassen Sie sich also nicht weismachen, dass Sie beim wissenschaftlichen Arbeiten auf jeden Fall eine bestimmte Reihenfolge an Schritten nacheinander abzuschließen haben. Es ist normal, genau dies nicht zu tun. Vielmehr sehen Sie mit den in der Zwischenzeit gewonnenen Erkenntnissen die frühen Vorarbeiten in einem anderen Licht.
1.3 Auf der Suche nach der idealen Wissenschaftlerin
Wissenschaft hat immer mit Lesen und Schreiben zu tun. In manchen Disziplinen kommen zwar noch andere Tätigkeiten hinzu, wie etwa das Durchführen von Experimenten oder Befragungen. Das Lesen und Schreiben aber ist allen Wissenschaften gemein.
Viele, die mit dem Studium beginnen, gehen davon aus, dass die ideale Wissenschaftlerin (an dieser Stelle verwende ich der Einfachheit halber nur die weibliche Form und meine damit alle Geschlechter) auch komplexe, wissenschaftliche Texte mühelos lesen, deren Inhalt auf Anhieb verstehen und diesen dann auch noch dauerhaft behalten kann.
Ähnliches gilt für das Schreiben: Vermutetermaßen ist die ideale Wissenschaftlerin derart genial, dass sie ihre Ideen direkt druckreif zu Papier bringt. Sind ihre Gedanken erst einmal zu Ende gedacht, formuliert sie sie mühelos zu einem wohlstrukturierten und gut lesbaren Text.
Glauben Sie das nicht! Ohne Mühe läuft Wissenschaft wohl bei niemandem ab. Das lateinische »studere« heißt übrigens nicht nur »sich wissenschaftlich beschäftigen«, sondern auch »sich um etwas bemühen, etwas eifrig betreiben«.
Selbstverständlich kann man auch in der Wissenschaft durch Übung besser und schneller werden. Wenn Sie am Ende des Studiums noch einmal einen Text zur Hand nehmen, den Sie im ersten Semester für kaum zugänglich hielten, werden Sie ihn sicher besser und schneller verstehen. Sie haben nicht nur Ihre Wissensbasis, sondern auch Ihr Repertoire an Lesefähigkeiten ausgebaut. Es wird Ihnen ein bisschen gehen wie in der Schule, wenn Sie zu Beginn des Schuljahres den Englischtext aus einer bestimmten Lektion kaum verstehen konnten und am Ende wenig Mühe damit haben.
Auf das Schreiben lässt sich diese Entwicklung sinngemäß übertragen. Schreibaufgaben, die Ihnen anfangs schwerfallen, gehen Ihnen am Ende deutlich leichter von der Hand. Oder Sie erledigen deutlich schwierigere Aufgaben in der gleichen Zeit mit vergleichbarem Aufwand.
Kruse (2015, S. 60) hat mit seiner Beschreibung erfahrener Schreibenden die wesentlichen Aspekte auf den Punkt gebracht.
Erfahrene Schreibende ...
Lesen Sie hierzu…
nutzen das Schreiben als einen Weg, um Gedanken langsam zu präzisieren, zu prüfen und miteinander in Beziehung zu setzen.
Kapitel 13 und Kapitel 14
überarbeiten ihre Texte mehrfach, nicht nur, um sie zu verbessern, sondern auch, um herauszufinden, was sie eigentlich sagen möchten.
Kapitel 16
sind mit dem rekursiven Charakter des Schreibens vertraut, das heißt mit der Tatsache, dass sie zu Textteilen, die sie früher geschrieben haben, noch einmal zurückkehren müssen, um sie im Lichte dessen zu verändern, was sie in der weiteren Arbeit dazugelernt haben.
Kapitel 1, Kapitel 13, Kapitel 14 und 16
vertrauen den eigenen Fähigkeiten, den Schreibprozess zu einem guten Ende zu bringen, und halten die anfängliche Unsicherheit aus.
Kapitel 13 und Kapitel 14
holen Feedback und Rat von anderen ein, wenn sie ins Stocken kommen.
Kapitel 16
verwenden die Merkmale des Textgenres, um das Wissen im Text optimal zu organisieren.
Kapitel 5, Kapitel 9, Kapitel 11 und Kapitel 14
Eine wissenschaftliche Haltung einnehmen, bedeutet, sich der möglichen Schwierigkeiten im Arbeitsprozess bewusst zu werden, sie anzugehen und eigene Lösungswege dafür zu entwickeln.
Die ideale Wissenschaftlerin erreicht nicht mühelos ihr Ziel, sondern reduziert die Mühe durch den Einsatz der jeweils angemessenen Technik.
Teil I: Orientieren und planen
In diesem Teil:
Kapitel 2
Selbststeuerung
Kapitel 3
Zeitplanung
Kapitel 4
Software beim wissenschaftlichen Arbeiten
Kapitel 5
Inhaltliche Anforderungen an eine wissenschaftliche Arbeit
Kapitel 6
Inhaltlicher Einstieg in eine gelungene Arbeit
Kapitel 2: Selbststeuerung
Es geht in diesem Kapitel zuerst um Ihre eigene Motivation und Ihre persönlichen Ziele sowie Methoden, die zur Zielerreichung beitragen. Anschließend wird thematisiert, wie Sie gewinnbringend mit anderen zusammenarbeiten.
2.1 Motivation und Ziele
Dieses Kapitel behandelt einen wichtigen Faktor im wissenschaftlichen Arbeitsprozess, wenn nicht sogar den wichtigsten: Sie selbst und Ihre Motivation.
Den inhaltlichen, technischen und organisatorischen Aspekten kommt beim Erstellen einer schriftlichen Arbeit eine große Bedeutung zu, aber ohne ausreichend Motivation werden sie unwichtig.
Woher kommt Ihre persönliche Leistungsmotivation? Kann wissenschaftliches Arbeiten vielleicht sogar Freude bereiten?
Sie sind ja angetreten, um ein großes Ziel zu erreichen, als Sie Ihr Studium aufgenommen haben. Was war Ihr Beweggrund dafür? Inhaltliches Interesse an Ihrem Fach? Der Wunsch nach einem Beruf mit einer ausfüllenden, sinnstiftenden Tätigkeit? Oder vielleicht der Wunsch nach Status und Einfluss im Job? Das Verlangen nach einem (sehr) guten Einkommen? Das Bedürfnis nach Sicherheit, nach etwas Solidem?
Für Rookies
Werden Sie sich über Ihre Beweggründe bewusst. Warum wollen Sie einen Abschluss in ... erreichen?
Motive bestimmen unser Leben. Nicht immer sind wir uns ihrer bewusst, nicht alle können wir klar benennen. »Trotzdem« steuern sie Tag für Tag unsere Entscheidungen: Soll ich in der Bibliothek Quellen recherchieren oder doch lieber mit Freunden gemütlich einen Kaffee trinken? Soll ich jetzt an meiner Arbeit weiterschreiben oder doch lieber einen Film ansehen?
Versuchen Sie, Ihre verborgenen Motive aufzuspüren. Anderenfalls arbeiten diese gegen Sie und torpedieren Ihre Willenskraft. Ihre wissenschaftlichen Ziele müssen zu Ihren sonstigen Zielen im Leben passen. Sonst wird es anstrengend und bisweilen auch aussichtslos.
Im Laufe der Zeit kann sich die Motivation verschieben. Sie erlangen durch das Studium einen realistischeren Blick auf die Inhalte, und durch Praktika und Gespräche Menschen, die den Studiengang schon absolviert haben und bereits in dem Berufsfeld tätig sind, erhalten Sie einen besseren Einblick. Vielleicht ist dadurch etwas Ernüchterung eingetreten, vielleicht zweifeln Sie auch an der Richtigkeit Ihrer Studienwahl. Oder umgekehrt: Sie haben so richtig Feuer gefangen und legen erst jetzt richtig los.
Fortgeschrittene
Was ist mittlerweile Ihr Grund, den Abschluss anzustreben? Handelt es sich noch um den gleichen Grund wie zu Studienbeginn, oder hat sich in dieser Hinsicht etwas geändert?
Solange Sie hinter Ihrem großen Ziel stehen, sollten Sie alles daransetzen, es auch zu erreichen. Dabei hilft es, den langen Weg bis zum Abschluss in einzelne kleine Schritte herunterzubrechen (siehe Abschnitt 3.3), ohne das große Ziel aus den Augen zu verlieren.
Anfangs erscheint Ihnen das Studium wahrscheinlich als ein riesiger Berg oder ein sehr langer Weg. Die Belohnung für die Mühen, nämlich das Abschlusszeugnis, gibt es erst mehrere Jahre nach dem Beginn.
Viele planen am Anfang ihres Studiums zwar nicht über das erste Semester hinaus (in dem zugegebenermaßen sehr viel Neues auf einen zukommt), aber irgendwo im Hinterkopf ist natürlich die Gewissheit: »Das hier wird über mehrere Jahre anstrengend sein!« Dabei handelt es sich um einen lähmenden Gedanken, der Ihnen nicht weiterhilft. Besser setzen Sie sich erreichbare Zwischenziele.
Bei der Formulierung von Zielen hat sich die S.M.A.R.T.-Formel als nützlicher Ansatzpunkt erwiesen. Ziele sollten demnach spezifisch, messbar, attraktiv, realistisch und terminiert sein. (Manchmal wird die Abkürzung auch anders aufgelöst, aber letzten Endes spielt das keine große Rolle.) Was verbirgt sich hinter diesen Begriffen, und wie können Sie das für das wissenschaftliche Arbeiten umsetzen?
S wie spezifisch
Hier unterscheidet sich das Ziel von einem Wunsch, indem Sie eindeutig und präzise festhalten, was Sie erreichen wollen. Das ist sozusagen der Inhalt des Ziels.
»Ich lese Texte zur Bedeutung von Social Media für mittelständische Unternehmen und notiere mir die wichtigsten Inhalte.«
Das ist schon einmal konkreter, aber immer noch nicht konkret genug, um damit wirklich arbeiten zu können.
M wie messbar
Ohne die Komponente der Messbarkeit würden Sie nie wissen, ob Sie Ihr Ziel tatsächlich erreicht haben. Wie viel müssen Sie tun? Woran können Sie festmachen, dass Sie Ihr Ziel erreicht haben?
»Ich lese mindestens einen Fachartikel und einen Bericht aus der Praxis und fasse die wesentlichen Inhalte auf einer Seite zusammen.«
A wie attraktiv
Attraktiv bedeutet anziehend. Das Ziel sollte auf Sie also wirken, dass Sie Lust bekommen, es auch anzugehen. Wenn Sie nicht gerade gern lesen und schreiben, sollten Sie vielleicht eher von »Informationen zusammentragen« oder »Wissen aufbauen« sprechen, wenn das für Sie positiver besetzt ist. Die Tätigkeit ist die gleiche, aber Sie starten wahrscheinlich mit einer anderen Einstellung.
R wie realistisch
Ist das Ziel überhaupt erreichbar? Im Beispiel wäre das dann der Fall, wenn Ihnen die Texte bereits vorliegen oder zumindest frei zugänglich sind und Ihnen genügend Zeit zur Verfügung steht.
Aber wie hoch sollte man seine Ziele setzen?
Da kleine Erfolge motivierend wirken, starten Sie lieber erst einmal mit niedrigeren Zielen. Erhöhen können Sie sie immer noch. Das fühlt sich auf jeden Fall besser an, als zu hoch zu greifen und später die Latte wieder niedriger legen zu müssen. Wenn Sie mit kleinen Zielen starten, sehen Sie, was Sie erreicht haben. Sie haben sich etwas vorgenommen und es geschafft. Das gibt Ihnen Schwung für weitere Aufgaben.
Das Ziel sollte allerdings auch nicht zu leicht zu erreichen sein, denn sonst ist es nicht herausfordernd und motiviert Sie nicht zum Handeln. Für den Fall, dass andere Ihnen eine Aufgabe stellen, die Ihnen zu einfach erscheint, erhöhen Sie selbst den Schwierigkeitsgrad, indem Sie die Zeit begrenzen und gegen sich selbst wetten.
T wie terminiert
Ziele sollten mit einem Termin versehen sein, damit Sie auch wissen, bis wann Sie sie erreicht haben sollen, also etwa »bis zum 31. Oktober«. Mehr dazu lesen Sie im Kapitel zur Zeitplanung (siehe Kapitel 3).
Zwischen den fünf Begriffen gibt es manchmal Überlappungen und Unschärfen. Nutzen Sie daher die S.M.A.R.T-Formel eher als eine Art Schablone, ohne sich immer allzu genau daran zu halten. So oder so werden Sie voraussichtlich von dieser Zielformulierung profitieren. Denn ein schwammig formuliertes Ziel, wie »Ich informiere mich über die Bedeutung von Social Media für mittelständische Unternehmen«, lässt zu viel Spielraum. Machen Sie die restlichen Bestandteile explizit, die Sie sonst nur mitdenken würden.
Ziele stehen mitunter in Konkurrenz zueinander, wie in den genannten Beispiel-Entscheidungen: Selbstverständlich können Sie auch mit Ihren Freunden gemeinsam in der Bibliothek recherchieren und danach zur Belohnung ins Café gehen oder erst an Ihrer Arbeit schreiben und im Anschluss den Film schauen. Dies lässt sich jedoch nicht unendlich weiterführen. Da die zur Verfügung stehende Zeit begrenzt ist, müssen Sie an bestimmten Punkten Entscheidungen treffen.
Nehmen Sie sich daher nicht zu viele Ziele auf einmal vor. Passen Sie die Menge an Zielen Ihrer Willenskraft an. Finden Sie heraus, wie viel Sie sich zumuten können und wollen. Manchmal müssen Ziele gestrichen oder zumindest auf später verschoben werden. Gerade in Umbruchsituationen wäre es nicht ratsam, weitere, nicht unbedingt nötige Veränderungen anzugehen, um sich nicht zu überfordern.
2.2 Wege zur Zielerreichung
2.2.1 Fokussieren
Wenn jemand in der Lage ist, seine Energie auf das Erreichen eines Ziels auszurichten, nennt man das Fokussierungsfähigkeit. Diese Person kann sich gegen Ablenkungen so weit wie nötig abschirmen.
Echtes Multitasking ist sowieso nicht möglich. Es ist eine Illusion zu glauben, wir könnten mehrere Dinge auf einmal tun. In Wahrheit wechseln wir einfach nur sehr schnell zwischen den Aufgaben hin und her. Der sogenannte Sägeblatt-Effekt verhindert dann, dass wir wirklich effizient sind. Es geht also darum, die eigene Aufmerksamkeit auf eine bestimmte Aufgabe zu lenken und sich eben nicht davon »ab-lenken« zu lassen.
Gerade das Internet und dort vor allem Social Media bringen ständig neue Anregungen und Inhalte. Soziale Motive spielen dabei eine große Rolle: Für die Mitglieder einer lose verbundenen Gruppe baut sich über die Nachrichten und Neuigkeiten eine Art von Nähe auf, obwohl sich die Gruppenmitglieder weit entfernt voneinander aufhalten. Durch das ständige Kontakthalten kann man weiterhin Teil einer Gruppe sein, auch wenn man eigentlich gerade lernen und schreiben sollte. Dabei geht die Konzentration auf die eine Sache verloren. Denn man könnte ja etwas verpassen.
Tatsächlich verpassen Sie aber etwas anderes, sehr Wertvolles. Sie verpassen das gute Gefühl, an einer Sache ungestört gearbeitet zu haben und gut vorangekommen zu sein. Sie berauben sich des Flows, manchmal auch Tunnel genannt.
Der Flow ist ein Zustand, in dem Störungen ausgeblendet sind und in dem man sich ganz in seiner Aufgabe verliert. Er tritt dann ein, wenn die Fähigkeiten den Anforderungen entsprechen – und wenn man sich nicht stören lässt. Um überhaupt »in den Flow« kommen oder »im Tunnel« arbeiten zu können, müssen Sie die potenziellen Ablenkungen reduzieren. Die menschliche Willenskraft ist begrenzt, also sollten Sie alle zur Verfügung stehenden Hilfen nutzen, um sich nicht in Versuchung führen zu lassen.
Internet- und App-Sperren
Leech Block
Leech Block (http://www.proginosko.com/leechblock/) ist ein kostenloses Add-on, das für Firefox, Chrome, Edge sowie für Chrome-basierte Browser wie z.B. Opera erhältlich ist. Es lassen sich verschiedene »Blocks« definieren. Darin legt man fest, welche Websites jeweils blockiert werden sollen. Das geht für einen bestimmten Zeitraum jeden Tag (z.B. »von 9 bis 12 Uhr«) und/oder nach Ablauf einer Zeitspanne, die man auf der Seite verbracht hat (z.B. »10 Minuten innerhalb einer Stunde«). Es handelt sich also um ein recht flexibles Tool, das allerdings leicht umgangen werden kann, indem man eben einen anderen Browser benutzt.
Cold Turkey Blocker
Cold Turkey Blocker (https://getcoldturkey.com/) behebt dieses Problem und funktioniert über alle Browser hinweg. Den Cold Turkey Writer, ein verwandtes Schreib-Tool, finden Sie in Abschnitt 6.3.1.
Focal Filter
Focal Filter (http://www.focalfilter.com/) verwendet keine vordefinierten Zeiträume wie Leech Block, sondern blockiert Websites zwischen fünf Minuten und zwölf Stunden – allerdings immer erst dann, wenn man es startet. Es funktioniert über alle Browser hinweg.
Productivity Owl
Bei Productivity Owl (http://www.productivityowl.com/), eine Erweiterung für Chrome, fliegt eine Eule über den Bildschirm und schließt Tabs, wenn Sie Zeit vertrödeln. Die erlaubten Seiten und Zeiten lassen sich individuell festlegen.
SelfControl und SelfRestraint
Das kostenlose SelfControl (http://selfcontrolapp.com/) für Mac und SelfRestraint (https://github.com/ParkerK/selfrestraint) für andere Betriebssysteme gehen sehr hart vor. Sie lassen sich nicht umgehen, selbst wenn man den Rechner neu startet oder die Anwendung löscht! Hier sollten Sie also gut überlegen, auf welche Zeit Sie den Timer stellen.
Wer eher von seinem Handy abgelenkt ist als vom Internet auf seinem Rechner, sollte sich die folgenden Apps einmal ansehen:
OFFTIME
OFFTIME (https://offtime.app/the-app.php, für Android und iOS) zeichnet zum einen Ihre Nutzungsgewohnheiten auf und kann zum anderen Apps blockieren und Anrufe von vorher festgelegten wichtigen Personen durchlassen.
Freedom und Quality Time
Freedom (https://freedom.to/why, für iOS auf allen Geräten plus Windows und Android) blockiert Websites und Apps und ist für 3,33 Dollar pro Monat im Jahresabonnement erhältlich. Sieben Mal können Sie Freedom kostenlos testen. Quality Time (http://www.qualitytimeapp.com/, für Android, kostenlos) geht in die gleiche Richtung.
FocusMe
FocusMe (https://focusme.com/, für PC und Mac) blockiert Apps und Websites, kann Pomodoro integrieren (siehe Abschnitt 3.4.3) und erinnert Sie bei Bedarf auch an Ihre Pausen. Sie zahlen dafür entweder 2,62 Euro/Monat im Zwei-Jahres-Abo bzw. als Studierende 30 Prozent weniger. Es gibt eine 60-Tage-Geld-zurück-Garantie.
Übersicht über die Internet- und App-Sperren
Die folgende Übersicht fasst die wesentlichen Punkte noch einmal zusammen:
Tool
Erläuterungen
Leech Block
Für Firefox, blockiert Websites für einen bestimmten Zeitraum
Cold Turkey Blocker
Für alle Browser, blockiert Websites für einen bestimmten Zeitraum
Focal Filter
Für alle Browser, erlaubt eine voreingestellte Nutzungszeit und blockiert die Seiten nach Ablauf
Productivity Owl
Chrome-Erweiterung, die Tabs schließt
SelfControl
Für Mac, die Sperre ist nicht zu umgehen
SelfRestraint
Für alle Betriebssysteme, die Sperre ist nicht zu umgehen
OFFTIME
Blockiert sowohl Websites als auch Apps
Freedom
Für iOS und Android, blockiert sowohl Websites als auch Apps
Quality Time
Für Android, blockiert sowohl Websites als auch Apps
FocusMe
Blockiert sowohl Websites als auch Apps, kann Pomodoro integrieren
Konzentration durch Musik und Geräuschkulissen
Spotify
Auch Musik kann dabei helfen, sich zu fokussieren – wenn es die richtige ist. Unter den Stichworten »concentration«, »focus« oder »productivity« bieten Musik-Streaming-Dienste wie Spotify (https://www.spotify.com/, für Windows, Mac, Android und iOS) verschiedene Playlists an, sodass für jeden Geschmack etwas dabei sein sollte. Für das kostenlose Konto, »Spotify Free«, melden Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Ihrem Facebook-Account an. Sie können Spotify über den Client oder die Web-App nutzen. Die Premium-Version bietet einige nützliche Funktionen (4,99 Euro für Studierende).
Focus at Will
Spezielle Musik zur Konzentrationsförderung bietet auch Focus at Will (https://www.focusatwill.com/) mit der »music to boost concentration«. 15 Tage lang können Sie das Angebot kostenlos testen, danach kostet es 7,49 Dollar pro Monat.
Noisli und Soundrown
Wenn Sie mit anderen Geräuschkulissen besser arbeiten als mit Musik, sollten Sie sich die kostenlosen Websites oder Apps von Noisli (http://www.noisli.com/) oder Soundrown (http://www.soundrown.com/) einmal ansehen. Dort haben Sie Zugriff auf verschiedene Geräusche wie zum Beispiel Regen oder Gewitter, Lagerfeuer, Waldgeräusche, aber auch das Rattern von Zügen oder die typischen Geräusche in einem Café. Diese lassen sich auch mischen.
In Abschnitt 12.3 sind unter dem Stichwort »Ablenkungsfreies Schreiben« weitere Tools für möglichst konzentriertes Schreiben zusammengestellt.
2.2.2 Gewohnheiten etablieren
Wenn das mit dem wissenschaftlichen Arbeiten nicht immer so anstrengend wäre!
Von Natur aus sind viele Menschen erst einmal faul und versuchen, Anstrengungen zu vermeiden. Um sich an den Schreibtisch zu setzen, bedarf es jedoch einer gewissen Überwindung. Man muss sich einen Ruck geben, und das ist anstrengend. Lieber würden wir natürlich die Dinge tun, die uns Freude bereiten.
Gewohnheiten helfen dabei, Tätigkeiten als nicht mehr ganz so anstrengend zu empfinden. Das ähnelt ein wenig dem Prinzip der Automatisierung. Neue Handlungen oder Abläufe strengen uns an, weil wir ständig nachdenken müssen, welcher Schritt als Nächstes an der Reihe ist. Erinnern Sie sich noch, als Sie Rad oder Auto fahren gelernt haben? Es war anfangs mühsam, das richtige Pedal im richtigen Moment mit der richtigen Intensität zu betätigen. Mittlerweile, mit etwas Übung, fahren Sie wahrscheinlich, ohne viel darüber nachzudenken, und können sich nebenher noch angeregt unterhalten.
Zu viele Entscheidungen machen träge. Wenn Sie entscheiden müssen, ob Sie am Abend lernen, sich mit Leuten treffen, zum Sport gehen oder einen Roman lesen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie nichts von alledem tun, sondern auf dem Sofa enden, eine niveaulose Sendung nach der anderen ansehen und sich danach ärgern, dass Sie nichts Sinnvolleres mit Ihrer Zeit anzufangen wussten. Sie »wählen« diese fünfte Option nur, weil die Entscheidung zwischen den ersten vieren zu schwierig ist.
Wer eine Routine aufbaut und manche Dinge immer zur gleichen Uhrzeit oder in der gleichen Reihenfolge tut, erspart sich das Nachdenken und Entscheiden. Das entlastet. Beispiel: Sie richten sich eine Lernzeit ein, in der Sie nicht gestört werden wollen. Es ist dann einfach klar, dass Sie immer samstags zwischen 16 und 18 Uhr für das Studium arbeiten. Diesen Lernzeitraum müssen Sie nicht mehr umständlich einplanen und Sie müssen ihn auf Dauer niemandem mehr erklären. Das Beste: Sie selbst gewöhnen sich auch daran.
Um eine Gewohnheit aufzubauen, benötigt es eine bestimmte Zahl an Wiederholungen. Manche Quellen gehen von 21 aus, andere hingegen von deutlich mehr. Sie müssen also im besten Fall mindestens drei Wochen durchhalten, bis sich ein neues Verhalten eben nicht mehr neu, sondern gewohnt und leicht anfühlt. Drei Wochen sollten doch zu schaffen sein, meinen Sie nicht?
Solche geplanten Veränderungen haben mehr Aussicht auf Erfolg, wenn zwischen Vorsatz und Umsetzung relativ wenig Zeit liegt. Wenn Sie etwas wirklich wollen, warum sollten Sie dann bis Montag oder zum Beginn des nächsten Semesters damit warten? Fangen Sie gleich an, wenn Sie gute Vorsätze gefasst haben.
Tipp
Bauen Sie sich für das Lernen und wissenschaftliche Arbeiten Routinen auf, die Sie über eine lange Zeit hinweg beibehalten können. Fangen Sie am besten direkt damit an und ziehen Sie das mindestens drei Wochen am Stück durch.
Wenn es nicht so recht klappen mag mit den Vorsätzen, können Sie auch mit kleineren Schritten beginnen, die auf den ersten Blick nichts mit dem wissenschaftlichen Arbeiten zu tun haben. Damit bereiten Sie den Boden für die größeren, wichtigeren Vorsätze. Nehmen Sie sich also etwas Einfaches vor, von dem Sie wissen, dass Sie es auch tatsächlich durchhalten können. Beispielsweise jeden Morgen das Bett zu machen oder ein Glas Wasser zu trinken. Sie werden merken, dass das Durchhalten Sie bestärkt und Ihnen Kraft für größere Aufgaben verleiht. Sie sind plötzlich jemand, der etwas durchzieht, das er sich vorgenommen hat.
2.2.3 Visualisieren von Ziel und Weg
Visualisieren ist eine Methode, um etwas so Wichtiges wie ein Ziel im wahrsten Sinne des Wortes nicht aus den Augen zu verlieren.
Aus dem Sport ist Visualisieren als Technik bekannt. Immer wieder werden bei Sportübertragungen Momente vor dem Start eines Rennens gezeigt, in denen sich Menschen mit geschlossenen Augen so intensiv die Strecke vorstellen, dass sie körperlich die Kurven mitgehen. Dem liegt ein ähnliches Prinzip zugrunde.
Menschen denken in Bildern und inneren Filmen, wir stellen uns etwas vor (leider auch Sorgen und Befürchtungen). Diese Anschaulichkeit hilft uns dabei, viele Informationen gleichzeitig zu verarbeiten. Gerade bei komplexen und abstrakten Sachverhalten ist das nützlich. Die Visualisierung wirkt also sehr motivierend und hilft dabei, das Ziel zu erreichen.
Wenn wir das Erreichen eines Ziels visualisieren, schicken wir es auf direktem Weg in das Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein kennt den Unterschied zwischen Realität und lebhaft Eingebildetem nicht. In unserem Geist haben wir mit der Visualisierung etwas erschaffen, das in dieser Dimension real ist.
Auf das Studium oder konkret auf die nächste abzugebende wissenschaftliche Arbeit bezogen, bedeutet das:
Stellen Sie sich ein Bild zu Ihrem Ziel vor. Wie sieht das aus und wie fühlt es sich an, wenn Sie die fertig gebundene Abschlussarbeit abgeben? Wie, wenn Sie die Urkunde in den Händen halten? Machen Sie am besten direkt einen inneren Film daraus, in dem Sie die Hauptrolle spielen.
Das Bild oder der Film muss dabei so klar und realistisch wie möglich sein. Schließen Sie Ihre Augen und stellen Sie sich alles ganz konkret und detailreich vor. Am Ende wirkt am besten alles so echt, dass Sie beinahe glauben könnten, Sie hätten Ihr Ziel schon erreicht.
Beziehen Sie dabei so viele Sinneswahrnehmungen ein wie möglich. Wie sehen Sie mit dem Bachelorhut aus? Wie hört sich der Applaus an, wenn Sie auf der Bühne stehen und die Urkunde überreicht bekommen? Wie schmeckt der Sekt, mit dem Sie auf Ihren Erfolg anstoßen? Wie fühlt es sich an, welche Emotionen spüren Sie?
Durch das Einbeziehen der Sinne speichern Sie Ihr Ziel ganzheitlich ab, es wird für Sie nicht nur rational, sondern auch emotional erlebbar. Dieses Bild lässt sich somit auf mehreren Ebenen ansteuern.
2.2.4 Mentales Kontrastieren
Achten Sie darauf, auch gewünschte Verhaltensweisen zu visualisieren und nicht nur das zu erreichende Ziel. Sonst gaukeln Sie Ihrem Gehirn vor, Sie wären schon am Ziel angelangt. Alle Spannung fällt ab. Sie brauchen diese Spannung aber noch, um aktiv zu werden.
Nutzen Sie die beschriebene Technik also auf jeden Fall auch, um ein Bild oder einen Film von Ihren alltäglichen Studienanstrengungen aufzubauen. Es geht also nicht nur darum, sich etwas zu »erträumen«, sondern auch und vor allem um den Weg dorthin. Was genau tun Sie, um das Ziel zu erreichen? Dabei ist es auch sehr wichtig, sich mit potenziellen Störungen auseinanderzusetzen. Welche Hindernisse könnten auftreten? Was blockiert Sie und hält Sie davon ab, Ihr Ziel zu erreichen? Wie gehen Sie damit um? Machen Sie sich vorab darüber Gedanken oder, noch besser, einen konkreten, schriftlichen Plan.
Diese Technik heißt »mentales Kontrastieren mit Wenn-Dann-Plänen« und wurde von Gabriele Oettingen, Autorin des Buches »Psychologie des Gelingens«, in der Formel WOOP umgesetzt:
wish (Wunsch)
outcome (Ergebnis)
obstacle (Hindernis) und
plan (Plan).
Woop-App
Android- und iOS-User können sich von einer App bei der Umsetzung ihrer akademischen Ziele unterstützen lassen. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.woopmylife.org/.
Wichtig
Visualisieren Sie nicht nur das Ziel, sondern auch den Weg dorthin sowie mögliche Hindernisse und Ihre Reaktionen auf die Hindernisse!
Am besten halten Sie sich Ihr Bild möglichst häufig vor Augen. Das hat einen netten Nebeneffekt: Je öfter Sie Ihr Bild abrufen, desto schneller haben Sie eine exakte Vorstellung im Kopf. Am aufnahmefähigsten sind die meisten Menschen dafür kurz nach dem Aufwachen und kurz vor dem Einschlafen.
Zusätzlich zum reinen Vorstellen können Sie verschiedene Techniken der Visualisierung verwenden.
Schreiben Sie zum Beispiel Ihr Ziel auf ein Kärtchen, lesen Sie es sich mehrmals laut vor und stellen Sie sich dazu Ihr Bild vor. Verwenden Sie auf jeden Fall unkomplizierte und positive Formulierungen, damit sich das Ziel gut einprägt.
Sie können das Vorlesen oder Aufsagen der Ziele auch aufnehmen und zwischendurch immer mal wieder anhören. Über diese Funktionen verfügt mittlerweile jedes Handy.
Bewährt hat sich vor allem der Einsatz von echten Bildern, sowohl von Ausdrucken als auch von Dateien. Lassen Sie sich mit einem Abschlusshut fotografieren, nutzen Sie ein Bildbearbeitungsprogramm wie Canva, Photoshop oder Gimp, oder erstellen Sie eine Collage aus Zeitschriftenbildern oder Bildern aus dem Internet. Das Ergebnis hängen Sie dort auf, wo Sie es häufig sehen und wo es sie am besten motiviert – entweder an Ihren Schreibtisch oder dort, wo Sie sich ablenken lassen. Legen Sie außerdem einen gut sichtbaren Ordner auf dem Computer an, nutzen Sie ein ausgewähltes Bild als Hintergrundbild oder Bildschirmschoner. Auch Ihren Handybildschirm können Sie nutzen, um immer wieder an Ihr Ziel erinnert zu werden.
Achtung
Sorgen Sie dafür, dass Ihre Ziele sichtbar bleiben: als Bild an der Wand und auf dem Bildschirm Ihres Computers und Handys.
Schön wäre jetzt natürlich, wenn Sie nichts weiter tun müssten und sich das Ziel quasi von allein erreicht. So ist das allerdings nicht gemeint. Ohne Ihr Zutun wird das nichts. Sie müssen »trotzdem« lernen, lesen und schreiben. Der Unterschied liegt darin, dass Sie mit Visualisierung Ihre Ziele besser erreichen: mit mehr Antrieb und Freude und daher müheloser.
Auch Vorbilder und bestimmte Handlungsweisen lassen sich visualisieren. Wen gibt es, der Sie inspiriert und der für Sie zum Vorbild werden kann? Wie verhält sich diese Person? Wie würden Sie sich von sich wünschen, dass Sie sich verhalten?
Möchten Sie zum Beispiel auch gern einmal den ganzen Tag diszipliniert am Schreibtisch arbeiten? Überlegen Sie sich, was eine Person tut, die das schafft. Wie bereitet sich diese Person auf ihre Arbeit vor? Wie schafft sie es, die Spannung und die Konzentration einen kompletten Tag lang aufrechtzuerhalten? Wie viele Pausen sind dafür nötig? Was tut diese Person in den Pausen, damit sie danach gut weiterarbeiten kann?
Übrigens hat sich auch gezeigt, dass Menschen leistungsfähiger sind, wenn sie sich mit hochenergetischen Personen umgeben.
Sie merken schon: Je mehr Sie sich mit Bildern und Vorbildern befassen, desto mehr Ideen bekommen Sie. Es entsteht ein Bild in Ihrem Kopf. Das ist Visualisierung.
2.2.5 Selbstbelohnung
Wer sich sehr anstrengt, vielleicht auch noch über einen langen Zeitraum, darf sich ruhig ab und an selbst belohnen. Tun Sie etwas, das Ihnen richtig Freude bereitet. Das hält die Motivation aufrecht. Durststrecken lassen sich so leichter überwinden.
Ihre Fortschritte lassen sich mit unterschiedlichen Methoden visualisieren. Aus der Grundschulzeit kennen Sie sicher noch die Aufkleber oder Stempel für besonders gut erledigte Aufgaben. Machen Sie sich dieses Prinzip zunutze, indem Sie beispielsweise über Ihrem Arbeitsplatz eine Belohnungstabelle aufhängen. Für jedes erreichte Zwischenziel geben Sie sich selbst einen weiteren Stempel. Mit der Zeit wird das Blatt voller, und Sie erinnern sich mit einem guten Gefühl daran, was Sie schon alles geleistet haben. Alternativ können Sie ein großes Glas auf Ihren Schreibtisch stellen und es mit bunten Jetons oder Chips füllen.
Belohnungen, also Dinge, die Sie gern tun und die für Sie interessant sind, fallen Ihnen garantiert schnell ein. Sie müssen nur kurz überlegen, was Sie tun, wenn Sie die Arbeit an Ihrem Schreibprojekt oder das Lernen aufschieben: zum Beispiel Serien schauen, ausgiebig telefonieren oder (viel zu viel) Zeit in den sozialen Netzwerken verbringen. Eine wichtige Änderung ist, dass Sie die Belohnung nach dem Einhalten Ihres Ziels durchführen und nicht mehr anstatt der Tätigkeiten, die zur Zielerreichung nötig sind.
Wenn Sie ein Zwischenziel erreicht haben, sollten Sie sich etwas Gutes tun. Ein solches Zwischenziel muss nicht unbedingt das Bestehen einer Klausur oder eine bestimmte Note sein. Belohnen Sie sich (auch) schon dafür, dass Sie sich über einen bestimmten Zeitraum hinweg angestrengt haben und Selbstdisziplin aufgebracht haben.
Das entspricht erstens dem Prinzip der zeitlichen Nähe zwischen Anstrengung und Belohnung und zweitens liegt damit alles in Ihrer Hand. Für die optimale Vorbereitung können Sie zu 100 Prozent die Verantwortung übernehmen. Im Fall der Klausur hängt die Note nicht ausschließlich von Ihrer Selbstdisziplin beim Lernen ab, sondern in weiten Teilen auch vom Schwierigkeitsgrad der Fragen, von Ihrer Tagesform und von der Härte der Korrektur.
Eine Belohnung sollte angemessen sein, also weder zu groß noch zu klein. Ein Wellness-Wochenende ist für das Bestehen einer einzelnen Klausur in den meisten Fällen wohl überdimensioniert, für das Fertigstellen der Abschlussarbeit mögen Sie es schon eher als angebracht empfinden.
Die Belohnung sollte variieren, damit Sie auch nach einiger Zeit noch Freude verspüren und die immer selbe Belohnung nicht schon Teil Ihres Alltagstrotts ist. Damit würde sie langweilig werden und an Wirkung verlieren.
Gehören Sie zu den Aufschiebern? Wenn Sie vermuten, dass Ihre Tendenz, wichtige Aufgaben aufzuschieben, zu stark ist und Sie tatsächlich beim Erreichen Ihrer Ziele behindert, sollten Sie einmal den Selbsttest der Prokrastinationsambulanz der Universität Münster durchführen:
http://www.uni-muenster.de/Prokrastinationsambulanz/Angebote_Test.html.
Dort erfahren Sie, wie Sie im Vergleich zum Durchschnitt liegen und ob Sie professionelle Hilfe suchen sollten.
Weiterführende Literatur
Rückert, Hans-Werner (2014): Schluss mit dem ewigen Aufschieben. Wie Sie umsetzen, was Sie sich vornehmen. 8. Aufl., Frankfurt am Main: Campus Verlag.
2.3 Gruppenarbeit
Nicht selten ist im Studium auch Gruppenarbeit gefragt. Jetzt treffen Ihre Motive, Ziele und Zeitpläne auf die anderer Menschen.
2.3.1 Grundsätzliches zur Gruppenarbeit
Gruppenarbeiten können kleinere Aufgaben innerhalb einer Lehrveranstaltung sein oder ein gemeinsam umzusetzendes Projekt, das zum Schluss präsentiert wird. Manchmal haben Sie die Gelegenheit, eine Gruppe nach Ihren Vorlieben zu bilden. Oft werden die Gruppen jedoch von den Lehrenden eingeteilt oder nach dem Zufallsprinzip zusammengestellt. Gerade dann sollten Sie sich die folgenden Abschnitte zu Zielen und Regeln besonders aufmerksam durchlesen.
Von solchen »Zwangsgruppen« sind freiwillige Lerngruppen zu unterscheiden. Diese treffen sich, um etwa im Zuge der Prüfungsvorbereitung den Stoff gemeinsam zu erarbeiten. Diese Art von Gruppe schließt sich zusammen, weil die Mitglieder das gleiche Ziel verfolgen, sie sich dabei gegenseitig unterstützen und motivieren wollen und unter Umständen die Arbeit untereinander aufteilen können. In einer solchen Lerngruppe können Sie überprüfen, wo Sie fachlich stehen, und durch den Austausch Unklarheiten beseitigen.
Da es in Gruppen immer vieles abzustimmen und zu klären gibt, ist die Arbeitsgeschwindigkeit geringer als bei Einzelarbeit. Dennoch überwiegt gerade bei anspruchsvollen Aufgaben der folgende Vorteil: Die Ergebnisse einer Gruppenarbeit sind dann qualitativ besser, wenn sie von den verschiedenen Perspektiven und Spezialkenntnissen der Gruppenmitglieder profitieren. Das hängt von der Art der Aufgabenstellung ab.
Bei umfangreichen Aufgaben wären Einzelne unter Umständen nicht in der Lage, in der vorgegebenen Zeit Ergebnisse zu liefern. Die Inhalte können in größerer Breite und Tiefe erfasst werden.
Für die Gruppenmitglieder selbst besteht ein wesentlicher Vorteil darin, dass sie sich im Reden und Argumentieren üben. Diese Fähigkeiten kommen in klassischen Vorlesungen naturgemäß zu kurz. Gute Kommunikations- und Kooperationsfähigkeiten sind auch später im Berufsleben hilfreich. Denn Sie lernen, mit Menschen ergebnisorientiert zusammenzuarbeiten, die Sie nicht sonderlich sympathisch finden oder die einen komplett anderen Arbeitsstil pflegen als Sie selbst.
Wenn Sie selbst eine Gruppe