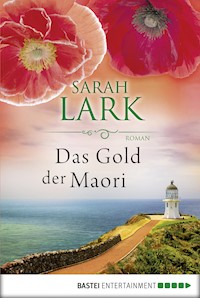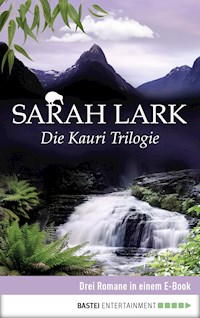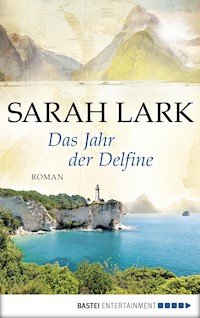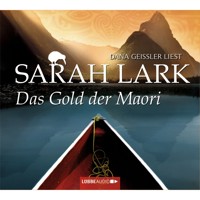9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Neuseeland, Gegenwart: Eine junge Archäologin reist auf die Chatham-Inseln. Sie entdeckt mitten in den historischen Baumzeichnungen der Moriori eine verwitterte Schnitzerei jüngeren Datums. "Kim... und Bran...non", versucht Sophie zu entziffern. Ein Rätsel, dessen Ursprung fast 200 Jahre zurückliegt. Damals erlebte die junge Moriori Kimi die Invasion ihres Landes: Sie wird verschleppt und versklavt - bis sie begreift, dass die Gesetze ihrer Götter sie nicht schützen. Die Deutsche Ruth geht zur gleichen Zeit für ihren Mann bis ans Ende der Welt - doch er lässt sie dort im Stich. Beide Frauen müssen für ihr Glück selbst kämpfen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 818
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Neuseeland, Gegenwart: Eine junge Archäologin reist auf die Chatham-Inseln. Sie entdeckt mitten in den historischen Baumzeichnungen der Moriori eine verwitterte Schnitzerei jüngeren Datums. »Kim... und Bran...non«, versucht Sophie zu entziffern. Ein Rätsel, dessen Ursprung fast 200 Jahre zurückliegt. Damals erlebte die junge Moriori Kimi die Invasion ihres Landes: Sie wird verschleppt und versklavt – bis sie begreift, dass die Gesetze ihrer Götter sie nicht schützen. Die Deutsche Ruth geht zur gleichen Zeit für ihren Mann bis ans Ende der Welt – doch er lässt sie dort im Stich. Beide Frauen müssen für ihr Glück selbst kämpfen.
Über die Autorin
Sarah Lark, geboren 1958, wurde mit ihren fesselnden Neuseeland- und Karibikromanen zur Bestsellerautorin, die auch ein großes internationales Lesepublikum erreicht. Nach ihren fulminanten Auswanderersagas überzeugt sie inzwischen auch mit mitreißenden Romanen über Liebe, Lebensträume und Familiengeheimnisse im Neuseeland der Gegenwart. Sarah Lark ist das Pseudonym einer erfolgreichen deutschen Schriftstellerin, die in Spanien lebt.
SARAH LARK
WO DER TAG BEGINNT
Roman
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Originalausgabe
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.
Für die deutschsprachige Ausgabe:
Copyright © 2019 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Melanie Blank-Schröder
Landkarte und Vignette: Tina Dreher, Alfeld / Leine
Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel | punchdesign, München
Umschlagmotiv: © Luis Boucault/shutterstock.com; freedom100m/shutterstock.com; Andrius_Saz/shutterstock.com; Lovely Bird/shutterstock.com; © Pierre Jean Durieu/shutterstock.com; C Levers/shutterstock.com; © Magdalena Russocka/Trevillion Images
eBook-Erstellung: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7325-7194-9
www.luebbe.de
www.lesejury.de
DAS GEHEIMNIS DER KOPI-BÄUME
Wellington, Nordinsel Neuseeland
Chatham Island
Gegenwart
PROLOG
»Danke, oh vielen Dank!« Sophie tanzte mit den Befunden der Genanalyse, die ihre Freundin Jenna ihr gerade gebracht hatte, durchs Zimmer. »Du glaubst nicht, wie erleichtert ich bin und wie ich mich freue!«
Jenna lachte. »Dann könnt ihr ja jetzt den Hochzeitstermin festlegen«, bemerkte sie und nahm auf Sophies Schreibtischstuhl Platz.
Das Büro ihrer Freundin an der Victoria-Universität in Wellington war winzig. Viel mehr als ein Schreibtisch für den Computer und zwei Stühle passten nicht hinein. Sophie hatte es allerdings sehr individuell dekoriert. Die Wände zierten ausdrucksvolle Reproduktionen von Höhlenmalereien aus aller Welt, entstanden vor vielen Tausend Jahren: galoppierende Pferde, Bisonherden, fliehend vor Raubtieren oder menschlichen Jägern, Abdrücke von Händen und geheimnisvolle Symbole. Sophie bemühte sich, die Sprache dieser Bilder zu entschlüsseln. Sie war Spezialistin für Parietalkunst und hatte zum Thema Höhlenzeichnungen in Carnarvon, Australien, promoviert. Seitdem arbeitete sie an der Universität – in der Forschung sowie als Dozentin.
»Also geheiratet hätten wir sowieso«, erklärte sie jetzt fast etwas beleidigt und warf ihr langes schwarzes Haar zurück. Eigentlich pflegte sie es bei der Arbeit im Nacken zusammenzubinden, bei ihrem wilden Freudentanz hatte sich das Haarband allerdings gelöst. »Das steht außer Frage. Aber ob wir uns getraut hätten, Kinder zu bekommen …«
»Ihr hättet den Test auch ohne meine Hilfe machen können«, meinte Jenna. »Hätte wahrscheinlich sogar die Versicherung bezahlt. Schließlich gibt es Krankheitsfälle in beiden Familien …«
Sophie hatte ihren Freund Norman ein halbes Jahr zuvor kennengelernt, und die beiden hatten sich praktisch auf den ersten Blick ineinander verliebt. Dabei schienen sie gar nicht so viel gemeinsam zu haben: Sophie, die nüchterne Wissenschaftlerin, und der Webdesigner Norman, der für ein Unternehmen filmische Spezialeffekte, Außerirdische und Fabelwesen entwarf. Wahrscheinlich wären die beiden sich nie begegnet, hätte seine Firma keinen so großen Wert auf die Glaubwürdigkeit seiner Fantasiewelten gelegt. Sophie war als Beraterin hinzugezogen worden für die Gestaltung einer Steinzeithöhle. Norman hatte sie durch die virtuelle Berglandschaft geführt und sie ausgelacht, als sie ausführlich darüber doziert hatte, dass man so tief im Berg natürlich ganz andere Lichtverhältnisse und Felsstrukturen haben müsse als in seinem Film.
»Das ist Exanaplanatooch – ein nur entfernt erdähnlicher Planet«, hatte er unbekümmert erklärt. »Aber gut, wenn du unbedingt willst, installieren wir noch ein paar Glühwürmchen wie in Waitomo, die können das Ganze aufhellen. Vielleicht beißen sie ja! Das könnte die Texter auf ganz neue Ideen bringen …«
Sophie hatte mitgelacht und Normans strohblonde Rastalocken ebenso unwiderstehlich gefunden wie seine strahlenden grünen Augen und sein Gesicht, das immer etwas verknautscht wirkte, als wäre er gerade erst aus dem Bett gefallen.
Sehr schnell waren sie unzertrennlich gewesen. Das Glück war nur beim Kennenlernen der gegenseitigen Familien ein wenig getrübt worden: In den letzten Jahrzehnten waren in beiden Familien Fälle von Mukoviszidose aufgetreten. Es war gut möglich, dass sowohl Sophie als auch Norman den Gendefekt aufwiesen, der die Erbkrankheit verursachte. Das Risiko, gemeinsam Kinder zu haben, erschien also groß.
Norman sah das gelassen. Er hatte den Gedanken an Gentests und andere Komplikationen des gemeinsamen Lebens erst mal weggeschoben. Sophie war jedoch nicht zur Ruhe gekommen, und schließlich hatte sie sich Jenna anvertraut. »Komm schon, Sophie, wenn’s weiter nichts ist …«, hatte ihre Freundin gesagt. »Ich schick jede Woche Genmaterial von irgendwelchen Moriori-Abkömmlingen ins Labor für diese große Studie, du weißt schon. Ob wir da ein oder zwei Proben mehr untersuchen lassen, merkt kein Mensch.«
Jenna war forensische Anthropologin und beschäftigte sich zurzeit mit Erbgut und Herkunft eines fast ausgestorbenen Volkes. Die Moriori hatten bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts weitgehend abgeschottet von der sonstigen Welt auf den Chatham-Inseln gelebt und eine einzigartige Kultur entwickelt. Dann waren sie jedoch in der Folge einer Maori-Invasion fast ausgerottet worden, und erst jetzt erwachte wieder größeres allgemeines Interesse an ihrer Herkunft und ihrem Brauchtum. Besonders die Abkommen der Moriori selbst wollten möglichst viel dokumentiert haben – einschließlich einer Erfassung des noch bestehenden Erbguts.
Sophie hatte also mit etwas schlechtem Gewissen ein Haar von Norman aus seiner Bürste stibitzt und selbst eine Blutprobe abgegeben. An diesem Tag war das Ergebnis gekommen: Weder sie noch Norman trugen das verhängnisvolle Gen in sich.
»Ich bin jedenfalls total glücklich, dass ich jetzt Bescheid weiß«, wiederholte Sophie. »Jetzt gleich, nicht irgendwann. Und sonst haben sie auch nichts gefunden, oder?« Sie blickte die Freundin erneut ängstlich an. Bei Licht betrachtet war es seltsam, dass Jenna persönlich herübergekommen war, um ihr das Ergebnis mitzuteilen. Telefonisch wäre das schneller gegangen, zumal sie ihr Büro in einem ganz anderen Bereich der Universität hatte. »Wir sind doch in … äh … jeder Hinsicht kompatibel?«
Jenna lachte wieder. »Wenn du das so nennen willst«, neckte sie Sophie. »Also medizinisch gibt es jedenfalls keine Einwände gegen eure Hochzeit. Ich würde mir höchstens Gedanken darüber machen, dass Norman immer ein bisschen in den Wolken schwebt. Aber gut, vielleicht passt das ja …« Sie machte eine kleine Pause und spielte mit einem bunten Kugelschreiber in Form eines der Zwerge, die in Normans letztem Filmprojekt die Höhlen von Exanaplanatooch bewohnt hatten. »Vielleicht hast du deine Spiritualität einfach noch nicht entdeckt …«
»Wie meinst du das?« Sophie setzte sich ihr gegenüber. »Weshalb sollte ich plötzlich anfangen, Geister zu sehen? Natürlich ist es manchmal gespenstisch in den Höhlen, aber …«
Jenna biss sich auf die Lippen. »Ich dachte, wegen deiner Abstammung …«, murmelte sie dann und straffte sich. »Da ist … da ist nämlich schon noch was, das ich dir sagen muss, Sophie … Du weißt ja, dass ich die DNA-Proben für eine Moriori-Studie eingesandt habe. Die Genanalyse in Bezug auf Erbkrankheiten hat mir die Laborantin als kleinen Gefallen dazugemacht. Aber sie hat eben auch getestet, ob einer von euch vielleicht von den Moriori abstammt. Und … Sophie, bei dir ist das der Fall.«
Sophie runzelte die Stirn. »Unmöglich«, sagte sie. »Meine Familie kommt aus Australien, und sie hat irische Wurzeln … Ich weiß das nicht genau, Ahnenforschung war bei uns nie ein Thema. Aber meine Großmutter war eine regelrechte englische Rose: rotblond, blauäugig …«
»Du dagegen bist ein dunkler Typ«, bemerkte Jenna.
Sophie stand auf und warf einen Blick in den Spiegel, der zwischen all den Höhlenzeichnungen ein bisschen deplatziert wirkte. Prüfend betrachtete sie ihren tatsächlich relativ dunklen Teint und ihr schwarzes Haar, konnte in ihren ebenmäßigen Zügen allerdings nichts erkennen, das auf eine andere Ethnie hinwies als die europäische.
»Aber ich hab blaue Augen …« Sie lächelte schief. »Und das Mukoviszidose-Gen in der Familie. Das gibt’s nur bei Europäern …«
»Und was ist das hier?«, fragte Jenna und wies auf ein weiteres kleines Kunstwerk auf Sophies Schreibtisch. Im Gegensatz zu den Postern an der Wand keine Reproduktion, sondern die Bleistiftzeichnung einer jungen Frau, eindeutig polynesischer Abstammung. »Ein Familienerbstück, hast du mal gesagt.«
Sophie nickte nachdenklich. »Ja«, sagte sie. »Das hab ich gefunden. In einer Mappe mit ausschließlich naturkundlichen Zeichnungen. Mein Urururgroßvater soll mit Ludwig Leichhardt gereist sein, diesem Naturforscher. Die anderen Zeichnungen zeigen Australiens Flora und Fauna.«
»Diese junge Frau war sicher keine Aborigine«, bemerkte Jenna. »Könnte es nicht sein, dass dies die Verbindung ist?«
Sophie zuckte mit den Schultern. »Ich weiß es nicht. Es ist im Grunde auch egal. Hab ich eben ein bisschen Erbgut von den Moriori. Kann ja sein und ist nichts Schlimmes.«
Jenna schüttelte den Kopf. »Im Gegenteil. Es ist etwas Besonderes. Es macht dich zum Teil eines ganz außergewöhnlichen Volkes. Und … und ich dachte … Also, du könntest mir da einen Gefallen tun …«
»Auf die Chatham-Inseln? Eine Expedition?« Norman spielte mit seinem Sektglas. An diesem Abend hatte ihm seine Freundin einige Dinge zu schlucken gegeben. Die Sache mit dem heimlichen Gentest war schon ein starkes Stück! Aber andererseits – hätte er gewusst, wie sehr die Sache Sophie zusetzte, hätte er sich dem Test natürlich freiwillig unterzogen. Mitunter irritierte ihn ihre Verschlossenheit. Er war ein Mensch, der sein Herz auf der Zunge trug und die Widrigkeiten des Lebens nicht allzu schwer nahm. Sophies Neigung zum Grübeln verstand er nicht immer, sie tat ihm sogar oft leid, wenn sie sich in irgendetwas verrannte. Auch jetzt war er nicht böse geworden, sondern hatte sich einfach entschlossen, sich mit ihr über das Ergebnis zu freuen und eine Flasche Sekt zu öffnen. Als sie ihm von ihrer Moriori-Abstammung erzählte, reagierte er gelassen. »Dann wundern wir uns wenigstens nicht, wenn unsere Kinder ein bisschen exotisch aussehen«, sagte er lachend. »Eine kleine Südseeschönheit … oder ein Junge, der aussieht wie Bob Marley.«
»Also karibische Wurzeln habe ich nicht«, wehrte Sophie ab. »Die Moriori kamen ursprünglich wohl aus Hawaiki, genau wie die Maori, aber dann lebten sie auf den Chatham-Inseln …«
»Wo genau liegen die noch?«
Sophie überlegte kurz. »Im Südpazifik. Ungefähr achthundert Kilometer südöstlich von hier. Ein bisschen abgelegen, aber sie gehören zu Neuseeland. Und … ich denke, ich werde sie bald kennenlernen.« Gleich darauf kam sie mit der dritten Eröffnung des Abends heraus: Sie würde sich einer Forschungsexpedition der Universität auf die Chatham Islands anschließen. »Die Moriori sind berühmt für das sogenannte Tree Carving. Sie haben Bilder und Symbole in die Rinde von Bäumen geschnitten. Außerdem gibt es Höhlenmalereien an einem Ort namens Nunuku’s Cave, Ta-Whanga-Lagune«, berichtete Sophie. »Jedenfalls hätte Jenna gern eine Expertin für Parietalkunst dabei, und ganz ehrlich, es interessiert mich. Diese Moriori – sie haben jahrhundertelang auf den Chathams gelebt. Aber hast du jemals was von ihnen gehört? Dabei sollen sie eine ganz spezielle Kultur gehabt haben. Und sehr friedlich waren sie – weshalb sie fast ausgerottet worden wären. Jedenfalls gibt es da eine Menge Dinge, die wiederentdeckt und erhalten werden müssen. Das mit den Bäumen zum Beispiel – kein Mensch weiß, warum sie da diese Zeichen reingeritzt haben. Sie sind einmalig, genau wie die Höhlenmalereien. Die Petroglyphen, diese in Stein gearbeiteten Felsbilder, die Vogelzeichnungen, Reliefs … das findet sich nirgendwo sonst in Polynesien …«
»Schon gut, schon gut!« Norman hob die Hände und gebot ihr lachend Einhalt. »So genau wollte ich es gar nicht wissen. Ich merke schon, du bist angefixt. Wie lange soll die Reise denn dauern? Und wann gehts los?«
Sophie biss sich auf die Lippen. Nun begann der schwierigere Teil der Geschichte.
»Im … im Januar«, gab sie zu. »Weil … da ist das Wetter auf den Chathams einfach am besten. Es ist sonst nämlich eher kalt da, weißt du …«
Norman runzelte die Stirn. »Dir ist schon klar, dass ich mir im Januar Urlaub genommen habe?«, fragte er. »Und dass wir nach Australien wollten? Zum Tauchen?«
Norman hatte seit Langem seinen Tauchschein, und Sophie hatte vorgehabt, ihn in diesen Ferien zu machen und mit ihm das Great Barrier Reef zu erforschen.
Sie nickte schuldbewusst. »Ich kann mir das bloß nicht aussuchen«, meinte sie. »Die Termine stehen fest. Und Jenna … ich konnte ihr das auch nicht gut abschlagen nach der Sache mit dem Test …«
Norman seufzte. »Also schön«, bemerkte er. »Dann hast du jetzt …« Er sah auf die Uhr. »Exakt drei Minuten Zeit, mich von der touristischen Attraktivität der Chatham-Inseln zu überzeugen. Warum sollte ich da meinen Jahresurlaub verbringen, anstatt meinen Bauch in die Sonne Australiens zu halten und das schönste Tauchgebiet der Welt zu genießen, solange es das noch gibt?«
Sophie strahlte. »Du würdest mitkommen?«, fragte sie.
»Die Zeit läuft«, erwiderte er nur.
Sophie überlegte kurz. »Na ja, es ist … also, die Landschaft ist ziemlich unberührt …«
»Also keine Viersternehotels mit Beach Bar«, kommentierte Norman.
»Und es gibt … hm … seltene Vögel wie die … Chatham-Taube oder die Black Robins … die sind vom Aussterben bedroht, und …«
»Keine leckeren Geflügelgerichte …«, bemerkte Norman.
»Aber versteinerte Haifischzähne!«, versuchte Sophie, ihn zu begeistern.
»Wird immer besser«, meinte Norman feixend. »Und wie sagtest du noch, war das Klima? Sommerhöchsttemperatur achtzehn Grad?«
Sophie rieb sich die Stirn. »Okay, ich gebe zu, dass die Chathams für den Durchschnittstouristen wenig reizvoll sind. Allerdings für dich, mein Liebster …«, sie lächelte, »… sollten sie in speziell diesem Januar geradezu unwiderstehlich sein …« Sie machte eine Pause, um die Situation zu dramatisieren, bevor sie ihr ultimatives Argument vorbrachte. »Denn dann bin ich dort!«
Norman sagte nichts mehr. Er zog sie nur in die Arme und küsste sie.
Der Flug von Wellington, der Hauptstadt Neuseelands, die am südlichen Ende der Nordinsel lag, nach Chatham Island, der Hauptinsel der Inselgruppe, war kurz, aber turbulent. Die berüchtigten Westwinde, die das Wetter in der Region der Chathams bestimmten, machten ihrem Namen alle Ehre. Jenna, die ohnehin ungern flog, kämpfte permanent mit der Übelkeit, während Norman das ständige Auf und Ab des kleinen Flugzeugs aufregend fand. Die anderen Teilnehmer der Expedition ertrugen die Turbulenzen stoisch. Außer Jenna und Sophie gehörten noch ein Linguist sowie fünf Studenten zu der Forschergruppe, die sich intensiv mit der Moriori-Kultur auseinandersetzen wollte. Die letzten Forschungen hatten in den Siebzigerjahren stattgefuden. Sophie plauderte mit einer ihrer Studentinnen, einem blonden Mädchen aus Auckland. Kirsty war als Einzige schon einmal auf den Chathams gewesen.
»Mit meinem Freund«, berichtete die junge Frau. »Der studiert Friedens- und Konfliktforschung, und die Fakultät arbeitet mit dem Hokotehi Moriori Trust zusammen. Sie veranstalten gemeinsam Seminare und Workshops – in der Anlage, in der wir wohnen werden. Kopinga Marae hat ein nettes Gästehaus und ist schön gelegen.«
Sophie wusste inzwischen, dass der Hokotehi Moriori Trust die Interessen der Nachfahren der Moriori vertrat. Er hatte einiges an Ausgleichszahlungen erhalten, nachdem das Waitangi-Tribunal die Ansprüche der Moriori auf ihr Erbe endlich anerkannt hatte. Das Geld war unter anderem in den Bau des Gästehauses geflossen, in Versammlungsräume, Seminarräume und ein Museum. Für die Moriori war es vor allem ein spirituelles Zentrum.
»Ist es weit vom Flughafen?«, fragte Sophie. Sie fühlte sich nach dem unruhigen Flug wie gerädert.
Kirsty schüttelte den Kopf. »Nur ein paar Minuten mit dem Auto. Sie holen uns ab. An sich ist gar nichts weit weg auf Chatham Island. Die Insel hat ja nur knapp neunhundert Quadratkilometer, und fast ein Drittel davon ist Lagune. Jedenfalls können wir uns gleich ausruhen.
Sie haben sogar Zimmer in der Lodge gemietet, oder? Die sind total gemütlich. Im Versammlungshaus selbst ist es eher … hm … rustikal. Aber auch schön.«
Kirsty schien allgemein genügsam zu sein. Norman hatte für sich und Sophie allerdings ein Zimmer in der Henga Lodge gebucht, ein dem Kopinga Marae angeschlossenes Hotel, das ebenfalls vom Moriori Trust betrieben wurde. »Schließlich verbringe ich hier meinen Jahresurlaub«, hatte er lachend gesagt. Im Hotel musste man seine Betten nicht eigenhändig beziehen und sich nicht selbst verpflegen wie im Gästehaus, in dem das Expeditionsteam dafür kostenlos willkommen geheißen wurde.
Das Flugzeug näherte sich jetzt Chatham, und Sophie erkannte schroffe, felsige Strände, fahlgrünes Weideland und bewaldete Hänge. Die Insel war hügelig, aber nicht gebirgig. Auf den Ebenen grasten Schafe wie überall in Neuseeland. Sophie wusste, dass die Tiere in der Mitte des 19. Jahrhunderts importiert worden waren. Auf die Wollproduktion wirkte sich das Wetter positiv aus. Es war kalt und unwirtlich auf den Inseln, und es regnete auch, als das Flugzeug schließlich auf der Landebahn des winzigen Tuuta Airport zum Stehen kam. Norman schüttelte sich beim Aussteigen, während Jenna den Eindruck erweckte, den Boden küssen zu wollen. Sophies zierliche blonde Freundin war immer noch kreidebleich.
»Auf dem Rückweg nehme ich die Fähre«, behauptete sie.
Sophie schüttelte den Kopf. »Bis zum Rückflug hast du die Turbulenzen vergessen«, tröstete sie.
Es war möglich, die Chathams per Schiff zu erreichen, doch die Reise war lang und unbequem, und der Seegang setzte den Passagieren sicher ebenso zu wie der Flug.
Da die Chathams zu Neuseeland gehörten, gab es keinerlei Einreiseformalitäten, und tatsächlich erwartete die Forscher bereits ein Kleinbus des Hokotehi Moriori Trust. Der Fahrer begrüßte sie herzlich auf Rekohu, wie die Moriori die größte der Chatham-Inseln nannten.
»Der erste bewohnte Ort der Welt, an dem man am Morgen die Sonne aufgehen sieht«, erläuterte er stolz.
Norman blickte überrascht in den bedeckten Himmel. »Im Ernst?«, fragte er.
Der freundliche Mann lachte. »Das bezieht sich auf die Datumsgrenze«, erklärte er. »Die Chathams liegen nahe dran. Insofern beginnt hier früher als überall sonst auf der Welt ein neuer Tag. Im Alltag unwichtig, aber in der Silvesternacht lassen wir es richtig krachen!«
Sophie erinnerte sich jetzt an rauschende Feiern zur Jahrtausendwende. Damals hatten Menschen Höchstpreise dafür bezahlt, den ersten Sonnenaufgang des 21. Jahrhunderts auf diesem unwirtlichen Eiland erleben zu dürfen.
Der Fahrer hielt seinen Gästen nun die Türen zum Kleinbus auf und chauffierte sie dann tatsächlich in nur zehn Minuten über weitgehend unbefahrene Straßen nach Westen.
»Viel los ist hier ja nicht«, bemerkte Tonga, der Linguist. Er war wie ihr Fahrer maoristämmig.
Der junge Mann zuckte mit den Schultern. »Es leben nur ungefähr sechshundert Leute ständig auf den Chathams.« Er grinste. »Da haben wir selten Probleme mit Staus.«
Das Kopinga Marae war sehr schön gelegen, inmitten von Grasland, nicht allzu weit vom Strand entfernt. Es bestand aus einem großen und mehreren kleinen weißen Holzhäusern, zum Teil mit Spitz-, zum Teil mit Flachdächern. Der Baustil wirkte eher modern als traditionell. Mit den typischen Maori-Häusern auf Neuseeland hatte dieses Anwesen nichts gemein. Es gab keine aufwendigen Schnitzereien und keine riesigen Götterstatuen. Lediglich den Dachfirst zierte eine kleine Figur, die im Gegensatz zu den Maori-tiki nicht bedrohlich wirkte.
Jenna und die meisten anderen Expeditionsmitglieder stiegen hier aus, Norman und Sophie brachte ihr freundlicher Fahrer noch bis zur Lodge.
»Man kann aber auch zu Fuß gehen«, meinte er. »Es sind nur ein paar Hundert Meter.«
Sophie nickte und verabredete sich mit Jenna und den anderen zu einer Vorbesprechung am nächsten Vormittag.
»Aber bloß nicht zu früh«, bat Jenna. »Von dem Flug muss ich mich erst erholen. Was meint ihr? Elf Uhr?«
»Fein, dann können wir vorher noch an den Strand«, sagte Norman optimistisch.
Die Lodge lag nah am Meer, und es sollte sogar einen Sandstrand geben. Wenn der Wind und der Regen allerdings anhielten, verspürte zumindest Sophie keine große Lust auf Strandspaziergänge.
An der Rezeption begrüßte sie eine junge Frau. Sie war sehr hübsch und wies typische Maori-Gesichtszüge auf.
»Darf ich fragen, ob Sie Moriori oder Maori sind?«, erkundigte Norman sich mit freundlichem Lächeln. »Und kann man das irgendwie optisch unterscheiden?«
Die Frau erwiderte das Lächeln offen. »Ich betrachte mich als Moriori«, erklärte sie würdevoll. »Aber ganz reinblütige Mitglieder unseres Volkes gibt es leider nicht mehr. Der letzte, Tame Horomona Rehe, Tommy Solomon, ist 1933 gestorben. Es gibt ein Denkmal, Sie können es sich ansehen, und sein Grab … Aber es kommt ja sowieso nicht so sehr auf die Abstammung an wie auf die Einstellung«, befand die junge Frau. Ihr Name war Marara, wie ein Schild an ihrer Jacke verriet. »Wir haben unsere eigene Kultur, und die muss erhalten bleiben. Beziehungsweise wiederbelebt.«
Norman hob die Brauen. »So gesehen könnte sich natürlich jeder einfach als Moriori bezeichnen …«, bemerkte er.
Marara lachte. »Man muss es schon in sich spüren. Aber grundsätzlich laden wir jeden ein, unser Denken und unseren Glauben zu teilen. Die Welt wäre sehr viel friedlicher, wenn mehr Menschen nach unseren Traditionen und nach unseren kulturellen Vorstellungen leben würden.« Damit händigte sie den beiden ihre Schlüssel aus und wies ihnen den Weg zu ihrem wirklich sehr behaglich eingerichteten Zimmer. »In der Cafeteria gibt es auch noch was zu essen«, erklärte sie.
Sophie nickte. »Danach geht’s aber sofort ins Bett«, bestimmte sie.
Norman lächelte. »Und morgen spüren wir dann die Geister.«
Sophie und Norman gingen tatsächlich früh schlafen und waren am nächsten Tag entsprechend zeitig wach.
»Schau mal, die Sonne scheint«, verkündete Norman nach einem Blick aus dem Fenster. Tatsächlich schien der Tag zwar nicht strahlend zu werden, doch zumindest herrschte kein solches Weltuntergangswetter wie am Tag zuvor.
Sophie schlüpfte unternehmungslustig in Jeans, T-Shirt und ein warmes Holzfällerhemd. Gleich würde sie noch eine dicke Outdoorjacke darüberziehen.
»Dann lass uns mal frühstücken gehen und sehen, was der Morgen so bringt«, meinte sie. »Bis elf ist es ja noch lange hin. Da können wir uns irgendwas ansehen. Die Bäume zum Beispiel …«
»Du willst jetzt schon arbeiten?«, fragte Norman.
Sophie schüttelte den Kopf. »Nicht arbeiten. Nur gucken. Und besser Bäume als Gräber, oder?«
Norman lachte. »Wenn du es so siehst … Okay, machen wir Tommy Solomon also später unsere Aufwartung. Und was die Bäume angeht … vielleicht lässt sich Strand und Wald sogar verbinden. Wir fragen einfach an der Rezeption.«
Die junge Angestellte an der Rezeption – diesmal eine andere, die sich als Riria vorstellte – zeigte sich begeistert über Sophies und Normans Interesse an der Kunst ihres Volkes.
»Natürlich müssen Sie die Bäume sehen«, bemerkte sie strahlend. »Und es ist auch gar nicht so weit bis zum nächsten Hain. Wenden Sie sich einfach am Meer entlang nach Norden. Es gibt da einen Pfad mit zum Teil spektakulären Ausblicken über die Küste. Die Bäume können Sie dann kaum verfehlen.«
Norman sah Sophie an. »Na dann … Kleine Wanderung vor dem Treffen?«
Hin und zurück sollte der Spaziergang vielleicht eine Stunde dauern, und es war gerade mal halb neun. Sophie war einverstanden, das Frühstück abzukürzen.
»Drüben beim Treffen kriegen wir sowieso noch mal Kaffee«, meinte sie. »Wo Jenna ist, gibt’s immer Kaffee.«
Auf den Klippen oberhalb der Küste wehte erneut ein frischer Wind. Er zerrte an Normans Dreadlocks, die er im Nacken zu einer Art Pferdeschwanz zusammengefasst hatte. Sophie fand, dass ihn das sehr verwegen aussehen ließ – wie einen Seemann oder Piraten. Sie selbst hatte ihr glattes schwarzes Haar geflochten, es hing ihr als dicker Zopf über den Rücken. Darüber hatte sie eine Wollmütze gezogen. Auch Norman war warm eingepackt, sodass beiden der Wind nichts ausmachte. Hand in Hand liefen sie über den Höhenweg, atmeten die frische Luft tief ein und genossen die grandiose Landschaft.
»Hier leben möchte ich allerdings nicht«, meinte Norman. »Es ist schön, trotzdem scheint mir die Natur eher feindlich gesinnt zu sein. Es war sicher nicht leicht für die Moriori.«
Sophie zuckte mit den Schultern. »Es war ihre Heimat«, sagte sie. »Sie kannten es nicht anders. Und ich glaube nicht, dass sie die Natur als feindlich empfanden. Im Gegenteil, sie lebten im Einklang mit ihr und ihren Göttern. Und sie schienen ein feines Gespür dafür gehabt zu haben, wie weit sie eingreifen konnten und wie weit nicht. Sie jagten zum Beispiel nur männliche und ältere Seehunde. Insofern hielten sich die Bestände hier jahrhundertelang – bis die weißen Seehundsjäger kamen.«
»Die deine Vorfahren unverständlicherweise nicht vertrieben, bevor sie einen Teil ihrer Nahrungsgrundlage zerstören konnten.« Norman spähte über die Klippe, konnte allerdings keine neue Seehundkolonie entdecken.
Sophie seufzte. »Sie waren sehr friedlich. Du hast das Mädchen gestern doch gehört. Sie nahmen jeden Besucher gastlich auf.«
»Trotzdem haben sie gejagt?«, fragte Norman. »Ich meine … allgemein scheinen sie Blutvergießen nicht gescheut zu haben.«
Sophie lachte. »Also für Vegetarier wären die Chathams wirklich kein Paradies. Pflanzliche Nahrung wächst nicht gerade im Überfluss. Die Moriori haben Flachswurzeln gekaut, Karaka-Kerne gesammelt und die Sprossen des Adlerfarns geröstet – was ihrer Gesundheit nicht zuträglich gewesen sein dürfte. Das Zeug enthält krebserregende Stoffe. Landwirtschaft haben sie nicht betrieben, was daran lag, dass hier keine der Pflanzen wuchs, die sie vormals aus der Südsee mitgebracht hatten. In Neuseeland gedeiht ja immerhin die Süßkartoffel, aber auf den Chathams ist es schlicht zu kalt. Also entwickelten die Bewohner sich zu Jägern und Sammlern. Natürlich wurde auch viel Fisch gegessen. Und du hast schon recht, es war ein hartes Leben.«
Ein Wäldchen kam in Sicht, Sophie und Norman wanderten ins Landesinnere. Die Karaka-Bäume standen relativ eng zusammen, als wollten sie sich gegenseitig vor dem Wind schützen. Sie waren um die fünfzehn Meter hoch und verfügten über dichte Laubkronen. Sophie interessierte sich allerdings mehr für die Stämme.
»Da, schau«, rief sie aufgeregt und wies auf ein gut sichtbares Motiv in der glatten Rinde eines der Bäume. »Die erste Schnitzerei.«
Das Kunstwerk zeigte ein Männchen mit herzförmigem Gesicht, es glich einer Kinderzeichnung. Das Wesen schien zu tanzen.
»Wirkt eigentlich ganz fröhlich«, meinte Norman. »Hast du nicht gesagt, es hätte vielleicht was mit Totenkult zu tun?«
Sophie zuckte mit den Schultern und sah sich die Schnitzerei näher an. »Das habe ich angenommen«, relativierte sie. »Und schau mal, die Brust des Kerlchens. Da sieht man die Rippen. Könnte also ein Skelett sein.«
»Sieht mehr aus wie Fischgräten«, bemerkte Norman. »Vielleicht irgendwelche Mischwesen? Wie alt sind die Schnitzarbeiten? Kann man das bestimmen?«
Sophie hatte inzwischen weitere Bäume mit Schnitzereien entdeckt und wanderte von einem zum anderen. Die meisten zeigten vergleichbare Figuren, nur gelegentlich waren die Umrisse von Tieren zu erkennen, die man als Vögel oder Seehunde deuten konnte.
»Die Altersbestimmung ist leider schwierig, da der Karaka-Baum keine Jahresringe ausbildet«, dozierte sie. »Allerdings … eins kann ich schon mal sagen … die Motive wurden alle mehr oder weniger zur gleichen Zeit eingeschnitzt. Es sieht so aus, als hätte ein einziger Schnitzer fast alle Bäume bearbeitet. Schau sie dir doch an, die Männchen sind immer im selben Stil gehalten, nur wenige fallen aus dem Rahmen. Das kann natürlich Zufall sein – ich werde diese Arbeiten ja noch mit anderen vergleichen, aber es fällt auf. Auch die Führung des Schnitzmessers ist charakteristisch. Die Linien sind nicht mal tiefer, mal weniger tief eingeritzt, sondern immer ziemlich gleich. Und es können keine großen Zeitabstände zwischen den einzelnen Arbeiten gelegen haben. Also vielleicht drei oder vier Jahre, eventuell zehn. Man muss mal sehen, wie schnell die Bäume hier wachsen.«
Norman fasste sich an die Stirn. »Ich verstehe«, sagte er. »Weil die Bilder alle mehr oder weniger auf gleicher Höhe liegen. Die Bäume wachsen schließlich. Wären die Zeichnungen in Abständen von mehreren Hundert Jahren entstanden, könnte man sie in unterschiedlicher Höhe bewundern. Nur was sagt uns das jetzt? War das ein Friedhof, der zu einer nahe gelegenen Ansiedlung gehörte? Wurden die Leute unter den Bäumen beigesetzt? Hat ein Totengräber die Motive eingeritzt?«
Sophie zog ihre Kamera aus der Tasche und machte Fotos. »Ein Friedhof war der Hain nicht«, erklärte sie. »Die Moriori hatten sehr eigenwillige Begräbnisriten. Sie haben ihre Leute am Strand begraben, allerdings nicht ganz, sie wurden sitzend beigesetzt, mit Blick aufs Meer. Der Kopf blieb also frei.«
»Und die Hinterbliebenen mussten mit ansehen, wie ihre Angehörigen verwesten?« Norman begann, zwischen den Bäumen herumzuwandern.
»Ein bisschen morbid, zugegeben«, bemerkte Sophie. »Ich denke, der Wind hat die Leichen ausgetrocknet – und die Vögel werden das Ihre dazu getan haben. Wahrscheinlich war sehr schnell nur noch ein Skelett übrig. Jedenfalls wurden die Toten nicht im Wald begraben. Dies hier könnte höchstens eine Art Erinnerungsstätte sein. Ein Weiterleben der Ahnen im Baum …«
»Sieh mal, es gibt doch einen Hoffnungsschimmer«, rief Norman plötzlich und wies auf einen etwas abseits des Hains stehenden Baum. In gut zwei Metern Höhe war ein Herz eingeritzt, in dem zwei Namen standen.
Sophie stellte sich auf die Zehenspitzen, um sie genauer in Augenschein zu nehmen. »Kim und Bran…on?«, versuchte sie zu entziffern. »Scheint mir allerdings neueren Datums zu sein. Wahrscheinlich Touristen. Die Leute müssen sich ja überall verewigen. Und das ist auch kein Karaka-Baum. Das ist ein Chatham Island Grass Tree. Die Moriori haben da meines Wissens nie was reingeschnitten.«
»Touristen? Noch dazu verliebte? Honeymoon auf den Chathams? Das hatten wir doch schon, in der Beziehung sind wir einmalig.« Er lächelte sie an. »Und wie sollen sie das so hoch oben eingeritzt haben? Ist er ihr auf die Schultern geklettert oder umgekehrt?« Er lachte. »Nein, seit das eingeschnitzt wurde, ist der Baum zweifellos beträchtlich gewachsen.«
Sophie musste ihm recht geben. »Stimmt«, sagte sie. »Die Schrift ist auch schon ziemlich verwittert. Man kann die Namen ja kaum lesen. Also ein weiteres Rätsel …«
»Das du kaum mittels Dendrochronologie lösen wirst«, meinte Norman und strich fast zärtlich über die Rinde des Baumes. »Selbst wenn diese Sorte Baum Jahresringe zeigt. Warum machst du es nicht wie die Maori? Umarm den Baum, und lass ihn zu dir reden.«
Sophie sah ihn strafend an. »Ich glaube nicht an Geister«, sagte sie mit gespielter Strenge.
Norman lächelte. »Aber deine Vorfahren, die Moriori, haben ganz sicher an sie geglaubt.«
Er griff sanft nach Sophies Händen, legte sie an den Baumstamm und seine eigenen Hände darüber. »Wenn wir uns darauf einlassen … Vielleicht schlagen die Geister für uns ja eine Brücke über Zeit und Raum … von einem Liebespaar zum anderen …«
Sophie wollte die Hände erst wegziehen, doch dann spürte sie die Wärme der Rinde, die Lebendigkeit des Baumes … und schließlich tat sie genau das Gegenteil – sie ließ auch ihre Stirn gegen den Stamm sinken. Gleich spürte sie Normans Atem in ihrem Nacken.
»Lass dich einfach fallen«, flüsterte er. »Du hast das Blut der Moriori, werde Teil von ihnen …«
Sophie wusste nicht, ob die Liebe und Zärtlichkeit, die sie plötzlich in eine unwirkliche Umarmung zog, nur von Norman ausging, oder ob sie tatsächlich den Nachhall der Gefühle spürte, die die beiden Verliebten füreinander gehegt hatten.
»Das wäre dann aber der falsche Baum«, bemerkte sie in einer letzten Aufwallung von Realismus. »Die Moriori haben doch nur in die Karaka geschnitzt. Die sie übrigens nicht so nannten. Sie nannten sie Kopi.«
Norman küsste ihren Nacken. »Vergiss das doch mal«, wisperte er. »Nenn den Baum einfach Baum …«
Sophie lächelte. Tröstlich umfasst von Norman ließ sie ihren Geist mit der Geschichte ihres Volkes verschmelzen.
DIE HÄRTE DES GESETZES
Whangaroa – Chatham Island
Kororareka – Nordinsel Neuseeland
1835–1836
KAPITEL 1
»Hier, ich blute!« Nakahu hielt anklagend ihren Arm in die Luft, auf dem sich tatsächlich Kratzspuren abzeichneten. Ihre kleine Schwester Whano hatte ihr kurzerhand die Fingernägel in die Haut gerammt, als der Streit der Mädchen eskaliert war. »Damit hast du gegen Nunukus Gesetz verstoßen«, erklärte Nakahu wichtig und wies mit dem Finger auf Whano, die sie erschrocken ansah. »Und jetzt werden deine Därme verfaulen …«
Whano, gerade mal fünf Jahre alt, schmeckte das in Honig getauchte Stück Flachswurzel, um das sie eben noch so erbittert gekämpft hatte, plötzlich nicht mehr.
»Stimmt das, matahine?«, fragte sie ängstlich, doch ihre Mutter schien sie nicht zu hören. Pourou, die Weise Frau der Moriori von Whangaroa, war in tiefer Trance versunken. Sie sprach mit den Bienen, deren Honigvorräte die Frauen und Mädchen gerade plünderten. Ihre Anrufungen sollten die Tiere gnädig stimmen.
»Kimi?«
Ungeduldig wandte sich das verunsicherte Kind gleich darauf an das älteste der Mädchen. Die vierzehnjährige Kimi war der Zauberin behilflich, indem sie ein Feuer in Gang hielt und Kräuter verbrannte, deren Rauch die Bienen betäubte.
»Ach was, Whano, bei so kleinen Kindern üben die Götter noch Nachsicht.« Kimi, ein zierliches Mädchen mit langem schwarzem Haar, einem großflächigen Gesicht, gerader Nase und für ihr Volk sehr hellen, mandelförmigen Augen, die fast die Farbe des Flachsblütenhonigs aufwiesen, beruhigte das Kind beiläufig. Sie war ganz auf die Zeremonie konzentriert – nicht nur aus Hingabe an die Geister der Bienen, sondern auch, um die über den Raub erbosten Tiere am Stechen zu hindern. »Zumal Nakahu doch wohl angefangen hat. Ich habe das gesehen! Und nun haltet Frieden und lasst uns arbeiten. Dann gibt es bald genug Honig für alle.«
Geschickt näherte sie sich dem Bienenstock und holte mit einem speziellen Werkzeug blitzschnell ein paar Waben heraus, die vor Honig nur so troffen. Es war die Zeit, in der die Moriori den Honig der Flachsblüten tranken – ein Fest für die sonst nicht mit Leckereien verwöhnten Menschen auf den eher unwirtlichen Inseln.
Die Bienen verhielten sich tatsächlich ruhig, aber das hatte Kimi nicht anders erwartet. Pourou war tohunga ahurewa, eine mächtige Zauberin. Sie verstand es, mit den Tieren zu reden, und Kimi war sehr stolz darauf, dass sie nicht nur ihre eigenen Töchter, sondern auch sie selbst in dieser Kunst unterrichtete.
Nun packte sie ihre Beute rasch in Körbe, während Pourou langsam aus ihrer Trance erwachte und nur noch einige abschließende karakia sang, bevor sie sich alle langsam und vorsichtig von den Bienen entfernten. Schließlich würden diese bald aus ihrem Rausch erwachen und den Moriori den Honig vielleicht doch missgönnen.
Whano schien den Streit mit ihrer Schwester schon vergessen zu haben, aber die drei Jahre ältere Nakahu war längst noch nicht davon überzeugt, dass die Götter die kleine Kratzbürste ungeschoren lassen würden. Sobald Pourous gesamte Aufmerksamkeit wieder dem Diesseits zugewandt war, trug sie ihr Anliegen ihrer Mutter vor.
»Matahine, das kann doch nicht sein, dass Nunukus Gesetz für Kinder nicht gilt! Und es hat überhaupt nichts damit zu tun, wer angefangen hat!«
Pourou, eine hochgewachsene, kräftige Frau mit einer scharfen, fast hakenförmigen Nase und fleischigen Lippen, verzog das Gesicht. Sie hatte von dem Streit ihrer Töchter nichts mitbekommen, schien allerdings nicht daran interessiert, die Schuldfrage zu klären. Stattdessen wandte sie sich mit strafendem Blick an Whano.
»Tochter, wie konntest du! Du hast Blut vergossen, und obendrein im Angesicht der Geister!«
Whanos Gesicht spiegelte erneut ihre Angst. »Meine … meine Därme werden verfaulen?«, fragte sie entsetzt.
Pourou seufzte. »Das nun nicht gleich, Whano. Wir sollten dennoch eine Reinigungszeremonie durchführen, und du musst deine Schwester und den Geist des Häuptlings Nunuku um Verzeihung bitten. Und selbstverständlich darfst du es nie wieder tun!«
»Aber sie hat angefangen!« Whano wies noch einmal anklagend auf Nakahu, die selbstgerecht lächelte.
»Das stimmt, tohunga«, kam ihr Kimi zu Hilfe. »Nakahu wollte ihr den Honig wegnehmen, und …«
Pourous strafender Blick traf nun auch Kimi.
»Kimi, meine Schülerin, du solltest es besser wissen«, tadelte sie. »Du kennst die Geschichte, aber vielleicht solltest du sie mir und den Mädchen noch einmal vortragen …«
Kimi nickte ergeben. Es gehörte zu ihren künftigen Aufgaben als tohunga, die Legenden ihres Volkes zu bewahren. Die Moriori schrieben nichts auf, sie behielten die Geschichten in ihren Herzen. Um all das zu behalten, musste die künftige Zauberin die Erzählungen oft wiederholen.
»Es war in Karewa, an der Westseite der Te-Whanga-Lagune«, berichtete Kimi nun mit klingender Stimme. »Die Stämme der Wheteina, der Rauru und der Hamata waren nicht lange zuvor aus Hawaiki nach Rekohu gekommen. Und sie verstanden es nicht, Frieden zu halten. Sie schlugen sich, sie kämpften – sie schreckten nicht einmal davor zurück, die Köpfe ihrer Gegner zu räuchern und ihr Fleisch zu essen.« Kimi bemerkte, dass die beiden kleinen Mädchen sich bei dieser Schilderung erwartungsgemäß gruselten. Die Schwestern hatten ihren Streit vergessen und schmiegten sich schutzsuchend aneinander. Die vier hatten inzwischen an einem Bach angehalten, um zu rasten. Kimi erzählte ihre Geschichte, während Pourou die am Morgen im Wasser ausgelegten Reusen daraufhin überprüfte, ob ihnen ein Fisch in die Falle gegangen war. »Und so führten die Stämme Krieg gegeneinander, und Blut floss und Feuer brannten, bis Nunuku Whenua, der Häuptling der Hamata, zwischen die Kämpfenden trat.« Die kleinen Mädchen lauschten mit offenen Mündern, obwohl zumindest Nakahu die Geschichte sicher schon oft genug gehört hatte, um sie selbst wiedergeben zu können. »Der Häuptling ragte zwischen den Kriegern auf, und ihn erfüllte die Weisheit und die Kraft der Götter, als er mit lauter Stimme zu ihnen sprach: ›Haltet ein! Steckt eure Messer weg, und legt eure Kriegsäxte und Keulen nieder. Es muss ein Ende haben mit den Kämpfen. Nie wieder soll Krieg sein, wie ihn der heutige Tag gesehen hat. Nie wieder sollt ihr das Blut eurer Brüder vergießen. Und vergesst den Geschmack von Menschenfleisch. Seid ihr Fische, die ihre Jungen fressen? Von heute an sollt ihr es besser wissen. Ihr sollt Frieden halten, gemeinsam jagen, gemeinsam fischen – das Land und das Meer bieten Nahrung für alle.‹«
»Aber wenn doch einer dem anderen was wegnimmt?«, wandte Whano ein. Sie mochte immer noch nicht anerkennen, dass ihre Mutter allein sie für den Vorfall tadelte.
»Dann spricht man darüber, und die Ältesten schlichten den Streit«, erklärte Kimi, wozu sie ihre Erzählung unterbrechen musste. Nunuku hatte zumindest in seiner ersten aufrüttelnden Rede keine Gerichtsbarkeit eingesetzt.
»Natürlich wollten die Männer zuerst nicht hören«, fuhr sie schließlich fort. »Es sah fast aus, als wollten sie den Häuptling verlachen. Doch dann rief Nunuku den Zorn der Götter auf alle herab, die seinen Worten zuwiderhandeln würden: Mögen eure Därme verfaulen an dem Tag, an dem ihr nicht gehorcht! Seine Stimme verband dabei Himmel und Erde, und die Krieger waren so erschrocken, dass sie ihre Waffen sinken ließen und sich vor dem Häuptling verbeugten. Seitdem ist der Kampf geächtet beim Volk der Moriori. Sobald auch nur ein Tropfen Blut fließt, greift Nunukus Gesetz. Niemand darf einen anderen verletzen oder gar töten.«
»Und das lernen wir von Kindheit an«, fügte Pourou hinzu, die eben, zwei silberne Fische in einem Korb, vom Bach zurückkam. »Es gilt für Mädchen und Jungen, Mann und Frau. Also bitte deine Schwester um Entschuldigung, Whano, und gib ihr später deinen Teil des Honigs als utu. Dann werden die Götter wohl nicht allzu streng über dich urteilen, sofern du dich nie wieder dazu hinreißen lässt, Blut zu vergießen.«
Whano nickte resigniert, obwohl es sie sicher hart ankam, ihrer Schwester auch noch eine Wiedergutmachung zahlen zu müssen. Kimi wusste nicht, ob ihre Mutter das kleine Mädchen überzeugt hatte, aber es würde nicht weiter widersprechen.
Nakahu blickte triumphierend, nahm die Entschuldigung der Jüngeren jedoch huldvoll an. Kimi beschloss im Stillen, der Kleinen von ihrer eigenen Honigration etwas abzugeben, wenn die Leckereien später verteilt wurden. Sie hatte Verständnis für Whano. Natürlich hätte das Kind warten müssen, bis seine Mutter Recht sprach. Bis dahin hätte Nakahu den Honig allerdings längst gegessen gehabt, und wenn es Kimi und Pourou nun nicht gelungen wäre, weiteren zu erbeuten, wäre Whano leer ausgegangen.
»Aber Tiere dürfen wir töten?«, fragte Whano und wies, wohl mit letztem Aufblitzen von Trotz, auf die toten Fische in Pourous Korb.
Die Weise Frau seufzte. »Tiere müssen wir töten, Tochter, sonst könnten wir selbst nicht überleben. Genau wie wir der Flachspflanze ihre Wurzeln rauben müssen und die Sprossen des Adlerfarns abschneiden und den Vögeln ihre Eier stehlen. Doch wir fragen um Erlaubnis und bitten die Geister um Verzeihung, bevor wir Leben nehmen.«
»Und wenn sie Nein sagen?«, erkundigte sich Whano.
Pourou lächelte. »Das tun sie nicht, solange wir nicht unersättlich sind. Die Götter lieben ihre Geschöpfe, sie wollen, dass wir alle leben. Wenn wir es allerdings übertreiben …«
Pourous Gesicht nahm einen traurigen Ausdruck an, und Kimi wusste, dass sie an die Seehunde dachte, die noch bis vor wenigen Jahren zu Tausenden die Strände von Rekohu bevölkert hatten. Die Moriori hatten sie regelmäßig gejagt, doch stets darauf geachtet, nur ältere männliche Tiere zu erlegen und die Kadaver gleich vom Strand zu entfernen, um die anderen Seehunde nicht zu verschrecken. Dann waren jedoch die Seehundsfänger gekommen, große, seltsame Männer mit weißer Haut und oft hellem Haar. Die Moriori hatten sie willkommen geheißen, wie sie es mit allen Besuchern taten, aber wie die Neuankömmlinge unter den Seehunden gewütet hatten, um ihrer Felle habhaft zu werden, hatte sie aufgebracht. Die Seehunde hatten sich sehr bald andere Plätze gesucht, um ihre Jungen aufzuziehen, die Strände von Rekohu waren nun fast verwaist.
»Heute brauchen wir aber viele tote Tiere, um all die Gäste zu bewirten«, mischte sich jetzt Nakahu ein.
Am frühen Morgen war ein Schiff eingetroffen, bis zum Bersten gefüllt mit Menschen vom Festland, dem fernen Aotearoa. Alle waren in schlechtem Zustand gewesen, hungrig und halb verdurstet nach der Reise. Die Moriori hatten sie in ihr Dorf gebeten, ihre spärlichen Vorräte mit ihnen geteilt, und dann waren ihre Jäger und Sammler ausgeschwärmt, um etwas zu essen heranzuschaffen, mit dem alle Gäste satt gemacht werden konnten. Am Abend würde die Dorfgemeinschaft sie förmlich willkommen heißen.
Pourou nickte. »Ja, heute müssen wir auf die Großmut der Götter und Geister vertrauen«, bestätigte sie. »Und nun sollten wir zurück ins Dorf gehen. Das Essen muss vorbereitet werden und die Zeremonien. Sicher wird man uns schon erwarten.«
Whano und Nakahu brachen bereitwillig auf, doch Kimi zögerte.
»Brauchst du mich bei der Vorbereitung, tohunga?«, fragte sie. »Also jetzt gleich? Ich würde gern …«
Pourou lächelte. »Du würdest gern noch zu dem sonnenhaarigen Mann gehen, der in den Wäldern lebt, und ihm etwas von deinem Honig bringen?«, vervollständigte sie Kimis Satz, bevor das Mädchen noch auf die Idee kam, irgendeine Ausrede zu suchen.
Kimi rieb sich die Stirn. »Er … bringt mir dafür seine Sprache bei«, erklärte sie. »Und lehrt mich, wie man Kartoffeln pflanzt.«
Kartoffelpflanzen gab es noch nicht lange auf den Inseln. Die Seehundsjäger hatten den Moriori Saatkartoffeln geschenkt. In gewisser Weise ein Ausgleich für die Ausrottung und Vertreibung der Seehunde …
Pourou machte eine wegwerfende Handbewegung. Sie interessierte sich wohl nicht für Kimis Erklärungen. »Er ist willkommen«, sagte sie gelassen. »Ich habe in sein Herz gesehen, er ist von sanftem Wesen. Ich fürchte nicht um dich, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Und ich habe auch keine Angst, er könnte dir die Seele rauben, wenn er … auf dünne Blätter graue Farbe zaubert, bis man meint, dein Antlitz zu erkennen.«
Jetzt war es an Kimi zu lächeln. »Zeichnen«, sagte sie in der Sprache der Weißen. »Man nennt das Zeichnen. Und die dünnen Blätter nennt man Papier. Es wird jedoch tatsächlich aus dem Holz der Bäume gewonnen. Insofern ist es gar nicht so viel anders als das, was wir tun, wenn wir Zeichen in die Rinde der Kopi-Bäume schnitzen.«
Pourou runzelte die Stirn. »Er beschwört damit die Geister?«, fragte sie.
Kimi zuckte mit den Schultern. »Ich glaube ja, aber er meint, nein. Er hat kein Gespür für die Geister. Das haben die Weißen alle nicht.«
»Solange ihm die Geister nicht zürnen, ist das nicht wichtig«, meinte Pourou. »Vielleicht kannst du sie ja dennoch eines Tages für ihn sichtbar machen. Also geh, doch sei nicht zu spät zurück. Du wirst ja übersetzen müssen. Außerdem wäre es unseren Gästen gegenüber nicht höflich, wenn die Tochter des Häuptlings der Zeremonie fernbliebe. Du weißt, in deren Volk hat sie eine besondere Stellung.«
Bei den Moriori war das nicht so. Kimis Vater war der gewählte Häuptling. Er stand der Dorfgemeinschaft vor, weil er klug war und sich als Jäger ausgezeichnet hatte. Kimi selbst war deshalb nicht von hohem Rang. Sie verdankte ihr Privileg als Schülerin der Weisen Frau nur ihren eigenen Talenten – Kimi lernte sehr schnell, in fremden Zungen zu reden. Sie hatte die Sprache der Walfänger und Seehundsjäger genauso selbstverständlich aufgefangen wie die der Maori aus Aotearoa, die in Wharekauri im Norden der Insel eine eigene Siedlung hatten. Auch die Gäste, die am Morgen gekommen waren, sprachen diese Sprache. Sie ähnelte dem Idiom der Moriori sehr, aber es würde doch hilfreich sein, wenn Kimi den Ältesten im Gespräch mit den Besuchern zur Seite stünde.
»Ich werde da sein«, versprach Kimi, bevor sie sich von Pourou und ihren Töchtern trennte und verschlungenen, kaum sichtbaren Pfaden in den Wald folgte, in dem ihr Freund Brandon seine Hütte gebaut hatte. Der Wald bot noch weiteren Weißen Zuflucht. Es kam mitunter vor, dass ein Besatzungsmitglied der Walfangschiffe, die in der Bucht von Whangaroa im Nordwesten von Rekohu anlegten, bei seinem Kapitän nicht mehr bleiben wollte. Meistens behagte den Männern der raue Ton an Bord nicht, ebenso wenig wie das harte Leben auf See. Und manchmal, wie bei Brandon, widerte sie auch die Arbeit an – das Töten und Ausweiden der Wale.
Brandon Halloran war ein noch sehr junger Mann, kam von einer Insel, die man Irland nannte und die am anderen Ende der Welt liegen sollte. Er war von dort aus nach Amerika gegangen – noch ein Land in weiter Ferne – und hatte auf einem Walfänger angeheuert. Brandon hatte das Leben an Bord allerdings vom ersten Tag an gehasst, noch nach dem vierten oder fünften Fang hatte es ihm Übelkeit bereitet, die Wale zerlegen und ihr Fett auskochen zu müssen. Lieber hatte er die majestätischen Tiere gezeichnet. Kimi konnte kaum glauben, wie lebensecht sie auf dem Papier aussahen. »Fast, als würden sie gleich herausspringen«, hatte sie einmal beinahe ehrfürchtig bemerkt, doch Brandon hatte nur gelacht. Und dann hatte er Kimi gezeichnet – unter seinen geschickten Händen war das Abbild eines zarten Moriori-Mädchens mit ernstem Gesicht und hüftlangem, glattem Haar entstanden. Kimi hatte es erstaunt angeblickt.
»Wer ist das?«, hatte sie gefragt, was Brandon noch mehr erheitert hatte.
»Das bist du«, hatte er erklärt. »Jedenfalls ist es ein Abbild von dir. So wie die Zeichnungen der Wale nur Abbilder der Tiere sind.«
Als er ihr die Zeichnung dann geschenkt hatte, hatten die Menschen im Dorf verblüfft bestätigt, dass das Mädchen darauf ihr aufs Haar glich. Einige hatten befürchtet, Brandon hätte ihr damit die Seele geraubt, doch Pourou hatte den jungen Mann besucht und die Stammesmitglieder anschließend beruhigt. »Der junge Mann ist von den Göttern gesegnet«, hatte sie erklärt. »Sie haben ihm eine besondere Gabe gegeben – wobei ich nicht sagen kann, wozu sie nützlich sein soll. Er nutzt die Abbildungen nicht für Zauber und erst recht nicht für Verwünschungen. Er sagt, sie dienten der Erinnerung. Er hält die Erinnerung damit lebendig. Daran ist nichts Böses.«
KAPITEL 2
Kimi dachte dankbar an Pourous Worte, als sie den Weg zu Brandons Hütte nahm. Hätte die Weise Frau ihn nicht anerkannt, hätte sie Brandon nicht wiedersehen dürfen. Gegen ein Verbot Pourous hätte sie nicht verstoßen. Dabei hatte sie den jungen Mann sehr gern – nicht nur, weil sie sich mit ihm in seiner Sprache üben konnte, sondern auch, weil er gern redete und ebenso gut zuhörte. Brandon erzählte Geschichten aus seinem Land, das so gänzlich anders sein musste als das ihre, obwohl die Felsen und Bäume natürlich ebenso von Geistern bewohnt wurden. Man nannte sie dort Feen und Leprechauns.
Kimi musste lachen, wenn er sie für sie zeichnete. Von ihren eigenen Geistern hatte sie keine Bilder, die konnte sie allenfalls spüren oder ihre Stimmen hören, die der Wind verwehte. Allerdings manifestierten sie sich oft in Tieren, und deren Abbildungen schnitzten die Moriori dann in die Rinde der Kopi-Bäume, wenn einer der Ihren gestorben war. Sie hofften, dass die Geister darin über seine Seele wachten.
Brandon saß vor seiner Hütte und arbeitete an einer Vogelfalle, als Kimi aus dem Wald trat. Sie hatte ihm vor einiger Zeit erklärt, wie man diese Fallen baute, und seitdem experimentierte er herum. Bislang ohne Erfolg, ihm war leider noch kein Taiko ins Netz gegangen, und so legte er die Arbeit ganz bereitwillig beiseite, als er ihrer ansichtig wurde. Er schenkte ihr ein Lächeln, das sie sofort erwiderte. Brandons Lächeln war ansteckend, seine Augen leuchteten, und auf seinen Wangen wurden kleine Einkerbungen sichtbar, die man in seiner Sprache Grübchen nannte.
»Kimi, wie schön! Komm, setz dich zu mir! Du kannst mir gleich noch mal zeigen, wie man diese Schlinge knüpft. Aus irgendeinem Grund verfängt sich nie ein Vogel in meinen Fallen, obwohl die Bäume voll von den Viechern sind. Manchmal meine ich, sie über mich lachen zu hören.«
Kimi grüßte ihn ebenfalls und näherte sich dann etwas schüchtern der grob gezimmerten Bank, auf die er sie einlud. Sie war Sitzmöbel nicht gewohnt, die Moriori saßen auf dem Boden. Auch auf den Bau ihrer Hütten verwandten sie wenig Anstrengung. Sie waren sehr einfach. Brandon dagegen bewohnte ein recht stabiles Blockhaus. Für dessen Bau hatten allerdings mehr Bäume sterben müssen als für eine Behausung der Moriori. Die anderen Weißen, die versteckt im Wald lebten, hatten ihm geholfen, eine kleine Lichtung zu roden und die Bäume zuzusägen, sie hatten ihn zudem darauf aufmerksam gemacht, die Moriori vorher um Erlaubnis zu fragen. Die Weißen, die in den Wäldern lebten, hatten ein gutes Verhältnis zum Stamm, sie teilten mit den Moriori die Jagdbeute und die Erzeugnisse ihrer Gärten. Kimi hatte übersetzt, als Brandon eines Tages mit einem Korb voller Kartoffeln als Geschenk ins Dorf gekommen war, und sich darüber mit dem jungen Mann angefreundet.
Brandon sprach ein sehr klares Englisch, wie man die Sprache der Weißen nannte. Die meisten anderen Iren – es gab viele von ihnen unter den Walfängern und Seehundsjägern – konnte Kimi dagegen nur mühsam verstehen. Brandon war nach eigenen Angaben gern zur Schule gegangen, was immer man darunter zu verstehen hatte. Er sprach von Dingen wie Büchern, denen man angeblich Geschichten entnehmen konnte, und er vermochte weiter zu zählen, als Kimi auch nur denken konnte. Sie lernte von ihm und er von ihr. Sie brachte ihm bei, wie man Vögel und Fische fing, welche Wurzeln und Beeren essbar waren, und viele andere Dinge über das Leben auf Rekohu, wobei er den Moriori-Namen der Insel erst lernen musste. In Brandons Sprache nannte man Rekohu und seine Nachbarinseln Chathams.
»Die Chatham-Inseln«, hatte er Kimi langsam vorgesprochen, bis sie es akzentfrei hatte wiederholen können. »Der erste Engländer, der hier vorbeikam, hat sie nach seinem Schiff getauft.«
»Sie hatten aber doch schon Namen«, hatte sie protestierend eingewandt. Offenbar war es eine Eigenheit der Weißen, allen Ländern, in die sie kamen, neue Bezeichnungen zu geben. Allerdings hatten die Maori das auch nicht anders gemacht. Die Zuwanderer aus Aotearoa nannten nicht nur ihr eigenes Dorf im Norden, sondern Kimis ganze Heimat Wharekauri.
»Ich habe dir Honig mitgebracht«, sagte Kimi nun, ohne weiter auf die Vogelfalle einzugehen, und zeigte Brandon die Waben in ihrem Korb. Sie freute sich und empfand Stolz, als er über ihre Ausbeute staunte.
»Wie hast du das geschafft, ohne zerstochen zu werden?«, fragte er verwundert und schleckte seinen Finger ab, nachdem er ein Stück Bienenwabe in eine selbst geschnitzte Schüssel gelegt hatte.
Kimi lächelte geheimnisvoll und berichtete von Pourou und ihrer Fähigkeit, die Geister der Bienen zu bannen. Wie immer lauschte Brandon interessiert, wenn auch etwas befremdet.
»Und das ist nun alles für ein Festmahl, das ihr für die Leute von diesem Schiff bereiten wollt«, fasste er dann zusammen, was Kimi ihm von den Neuankömmlingen erzählt hatte. Er hatte das Schiff von den Hügeln aus kommen sehen. »Es sind Maori, sagst du, aus Neuseeland?« Neuseeland war das Wort der Weißen für Aotearoa. »Was wollen die hier?«
Kimi zuckte mit den Schultern. »Das wissen wir noch nicht. Sie waren so ausgehungert und schwach, da wollten wir sie nicht gleich mit Fragen belästigen. Sicher werden sie es uns heute Abend verraten. Jedenfalls sind es viele. In den Zahlen aus deinem Land …«, sie bemühte sich angestrengt, sich zu erinnern, »… um die vierhundert.«
»Was?« Brandon wirkte alarmiert. Die Besorgnis spiegelte sich in seinem Gesicht wider. Seine freundlichen blauen Augen schienen sich zu umfloren, seine Stirn warf Falten, und er strich nervös sein lockiges sonnengelbes Haar glatt. »Vierhundert Leute? Macht euch das keine Angst, Kimi? Was sind das überhaupt für Menschen? Männer, Frauen, Familien?«
»Vor allem Männer«, gab Kimi Auskunft. »Aber auch Frauen und Kinder. Wir denken, dass sie hier siedeln wollen.«
»Hier?«, wunderte sich Brandon. »Wo denn? Auf wessen Land? Gibt es so viel Niemandsland auf den Chathams, dass ihr vierhundert Leute aufnehmen könnt? Und wovon sollen sie leben, bevor sie selbst ihre Dörfer gebaut und ihre Äcker bestellt haben? Werdet ihr sie durchfüttern?« Kimi biss sich auf die Lippen. So weit hatte sie noch gar nicht gedacht. Es gehörte eben zu den Gesetzen ihres Volkes, Fremde freundlich aufzunehmen. Natürlich würden die Ältesten irgendwann Fragen stellen – aber Argwohn hegten sie nicht. »Und wie sind sie hergekommen?«, fragte Brandon gleich weiter. »Das war doch ein englisches Schiff, oder? Sie sind nicht mit Kanus gekommen.«
Kimi schüttelte den Kopf. »Nein. Sie sagten, ein englischer Kapitän habe sie übergesetzt. Ich hab ihn nur kurz gesehen, er ist gleich wieder abgesegelt.«
Brandon rieb sich die Stirn. »Du hättest ihn fragen können, wo die Leute her sind und was sie hier wollen. Er muss etwas gewusst haben. Ich finde das jedenfalls sehr merkwürdig, Kimi, und ich denke, ihr geht ein bisschen zu sorglos damit um. Diese Maori … Tom Peterson, du weißt schon, der Rothaarige, der auf dem Hügel lebt, der war in Neuseeland auf einer Walfangstation. Und er meint, das seien ziemlich ruppige Kerle. Menschenfresser, sagt er. Wie weit man das glauben kann …«
Kimi verzog das Gesicht. »Früher waren die Moriori auch Kannibalen«, erklärte sie ihrem verblüfften Freund und erzählte zum zweiten Mal an diesem Tag die Geschichte von Nunukus Gesetz.
Brandon lauschte fasziniert. »Und daran habt ihr euch tatsächlich jahrhundertelang gehalten? Unglaublich. Na ja, hoffen wir mal, dass eure Gäste genauso friedlich sind.«
Kimi nickte zuversichtlich. »Pourou wird die Stämme heute Abend rituell verbinden«, sagte sie. »Ihre Geister und unsere Geister werden sich vereinigen. Dann können sie nichts anderes mehr als Frieden halten.« Sie blickte ihren Freund an, schien jedoch zu merken, dass er davon nicht überzeugt war.
»Komm einfach mit«, lud sie ihn ein. »Du kannst mit uns essen und feiern und dir die neuen Leute selbst ansehen. Vielleicht sprechen sie ja sogar Englisch. Da drüben in Aotearoa sind doch mehr Weiße als hier, oder?«
Brandon nickte. »Neuseeland ist länger von Europäern besiedelt als die Chathams, es bietet den Zuwanderern mehr Möglichkeiten – unter anderem ein weniger raues Klima.« Auch die Maori, die eigentlich seit Jahrhunderten wissen mussten, wo die Chathams lagen, hatten es bislang größtenteils vorgezogen, in Neuseeland zu leben. Wenn sie nun so zahlreich herüberkamen, konnte das kaum etwas Gutes bedeuten. Brandon teilte seine Gedanken mit Kimi. »Womöglich fliehen diese Menschen vor irgendetwas«, endete er besorgt.
Kimi hob die Schultern. »Mag ja sein. Vielleicht haben sie ihr Land an die Weißen oder an andere Stämme verloren. Es ist möglich, dass sie geradewegs aus dem Krieg kommen und nun den Frieden suchen.«
Brandon rieb sich die Stirn. Er kommentierte ihre Überlegungen nicht, doch Kimi spürte, dass er eine gewisse Skepsis hegte.
Schließlich folgte er Kimi tatsächlich in Richtung Meer zu ihrem Dorf und brachte einen Sack Kartoffeln und andere Feldfrüchte mit, um das Festmahl zu bereichern. Was Ackerbau anging, waren die weißen Siedler dem Stamm weit überlegen, die Moriori waren traditionell keine Bauern. Sie versorgten Brandon und die Männer in den Wäldern dafür mit Fisch und Meeresfrüchten. Die geflohenen Walfänger ließen sich ungern an den Stränden sehen.
»Was ist eigentlich genau der Unterschied?«, fragte Brandon. »Also zwischen Maori und Moriori. Für mich klingt der Name fast gleich …«
Kimi zuckte mit den Schultern. »Wir haben verschiedene Sprachen und verschiedene Bräuche«, erwiderte sie. »Aber du hast recht, die Sprachen ähneln sich, und beide Völker sind keine Ureinwohner, sondern mit Kanus aus Hawaiki gekommen, viele Menschenalter zuvor. Die einen haben auf Aotearoa gesiedelt, und wir eben hier. Wir sehen auch ein bisschen anders aus. Unsere Haut ist dunkler, viele von uns sind größer und dünner …« Sie lachte. »Und unsere Nasen sind spitzer und manchmal ein bisschen hakenförmig. Das ist mir selbst zwar noch nicht aufgefallen, aber die Seehundsjäger und Walfänger behaupten es. Wir hätten Nasen wie Juden, sagen sie. Keine Ahnung, was Juden sind.«
Brandon konnte das nicht so schnell erklären, er ging darüber hinweg. Den Hauptunterschied im Erscheinungsbild zwischen Moriori und Maori erkannte er gleich selbst, als er Kimis Dorf betrat, in dem bereits geschäftiges Treiben herrschte. Besonders im Kochbereich, im Zentrum der Siedlung, wurde eifrig gearbeitet. Die Moriori-Frauen versenkten Speisen in traditionellen Erdöfen, die Männer bereiteten Feuerstellen vor und hoben Kochgruben aus.
Die Gäste hielten sich dagegen eher abseits, sie standen oder saßen in Grüppchen herum und beobachteten ihre Gastgeber – und sie waren auf den ersten Blick als Maori zu erkennen, zierten ihre Gesichter doch zum Teil martialische Tätowierungen. Bei vielen Männern durchzogen bläuliche Linien das ganze Gesicht. Die Frauen trugen die meist spiralförmigen Tattoos lediglich um die Mund- und Kinnpartie.
Brandon hatte nie etwas Vergleichbares gesehen und bat Kimi um eine Erklärung.
»Das ist bei ihnen so Brauch«, meinte Kimi gelassen, als er sie danach fragte. »Ich glaube, die moko, so nennt man die Einkerbungen auf der Haut, bedeuten auch etwas, aber genau weiß ich das nicht. Und warum wir es nicht machen? Vielleicht, weil dabei zwangsläufig Blut fließt. Ich hab dir doch von Nunukus Gesetz erzählt … Jedenfalls gefällt es mir nicht. Dir etwa?«
Brandon schüttelte den Kopf. Er gab zu, dass er die tätowierten Gesichter fast beängstigend fand, hätte sie aber nichtsdestotrotz gern gezeichnet.
Schließlich half er beim Aufschichten von Feuerholz, während Kimi sich beim Kochen und bei der Vorbereitung Pourous auf die Zeremonien nützlich machte.
Die Moriori versammelten sich und ihre Gäste bei Sonnenuntergang auf dem Dorfplatz. Brandon registrierte, dass die Gruppen der Gäste und Gastgeber sich nicht mischten, sondern sich gegenübersaßen, aber vielleicht gehörte das ja zu ihren Bräuchen. Er selbst gesellte sich zu den Moriori-Männern, Kimi begab sich zu ihrer Familie. Ihr Vater stand vor seinem Stamm, hinter ihm saßen seine Kinder. Kimis Mutter war bereits vor Jahren verstorben, doch sie hatte noch zwei Brüder. Festkleidung hatten die Moriori nicht angelegt. Die Männer trugen schlichte Flachsgürtel, um die Scham zu verhüllen, die Frauen Röcke, dazu Umhänge aus gewebtem Flachs oder Seehundfelle um Schultern und Hüften. Die Moriori-Würdenträger hatten sich Albatrosfedern in die Bärte geflochten.
Die Kleidung der Maori war deutlich aufwendiger. Ihre Flachsröcke waren länger und komplizierter gearbeitet, die Frauen trugen gewebte Oberteile. Um die Schultern des Anführers – Brandon ging jedenfalls davon aus, dass es sich bei dem noch relativ jungen, kräftigen und stark tätowierten Mann, der sich jetzt in ähnlicher Manier wie Kimis Vater vor seinen Leuten aufbaute, um den Häuptling handelte – lag ein voluminöser Mantel, in den Vogelfedern eingewebt waren.
Kurz bevor die Zeremonie begann, entdeckte Brandon einen weiteren Weißen unter den Moriori. Tom Peterson, ebenfalls ein ehemaliger Walfänger, stand neben einer jungen Frau namens Raukura, mit der er, wie Brandon wusste, häufig das Lager teilte.
Als er Brandon sah, richtete er ein paar Worte an Raukura und kam dann zu ihm hinüber.
»Na, auch mal ein Auge werfen auf diese Invasion?«, fragte er Brandon. »Oder locken dich nur das kostenlose Essen und die hübsche Häuptlingstochter?« Sein Blick wanderte zu Kimi. Natürlich war den anderen Weißen nicht entgangen, dass Brandon sich häufig mit ihr traf. »Bei denen da …«, Tom wies auf die Maori, »… würdest du übrigens mindestens gevierteilt, wenn nur der Schatten einer solchen Prinzessin auf dich fiele.«
Tom hatte vor seiner Ankunft auf den Chathams eine Zeit lang auf Neuseeland gelebt und die Maori ein wenig kennengelernt.
»Also, wenn man dich so hört, haben die Einheimischen von Neuseeland nichts als Mord und Todschlag im Sinn«, meinte Brandon unwillig. Zwar war auch sein Eindruck von den Neuankömmlingen nicht der beste, aber er wollte doch gern an Kimis friedliche Vision glauben.
Tom schüttelte den Kopf. »Keinesfalls. Im Allgemeinen sind sie ganz umgänglich. Nur gänzlich anders als die Moriori. Geschäftstüchtig zum Beispiel. Die verschenken ihr Land nicht, die verkaufen es. Und kriegen immer schneller mit, was es wert ist. Wobei sie sehr ungemütlich werden können, wenn sie merken, dass sie betrogen worden sind.«
»Hast du eine Vorstellung davon, was sie hier wollen?«, fragte Brandon.