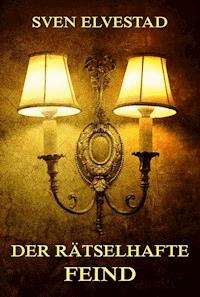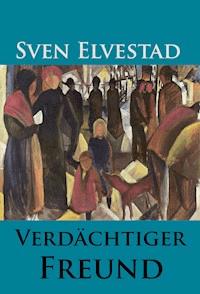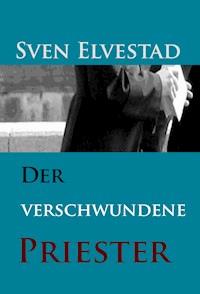Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: idb
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
1920er Jahre in einer Stadt in Skandinavien. Nicht weniger als vier Männer verschwinden innerhalb kurzer Zeit, nachdem sie den augenscheinlich gleichen blauen Brief erhalten haben ... Klassischer Krimi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 251
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Sven Elvestad
Wo sind sie?
Roman
1923
idb
ISBN 9783961502325
Deutsch von Julia Koppel
Direktor Joachim Reismann
Der Direktor des Tanzlokals »Die blaue Eule« war der erste, der verschwand. Es war am Donnerstag, den 29. November, gewesen, abends 11 Uhr 35, als gerade Generaldirektor Hans Jakob Stenesen den Einsatz verdoppelte. Direktor Reismann war Junggeselle, reich, sah gut aus und saß am dritten Pokertisch rechts, im »Unpolitischen freisinnigen Klub« zusammen mit drei anderen bekannten Spielern der Stadt. Der alte Diener Halvar war mit einem Brief hereingekommen, einem ganz gewöhnlichen Brief, in einem hellblauen, viereckigen Kuvert. Reismann las den Brief, und dann verschwand er.
Der zweite, der von demselben seltsamen Schicksal betroffen wurde, war der berühmte schwedische Maler in futuristischem Stil Karl-Erich von Brakel. Er verschwand in der Nacht zum 2. Dezember, einige Minuten nach ein Uhr, bei dem famosen Mittagessen, das der Dichter Harald Oxford in den Fürstenzimmern des Grand Hotel gab. Gerade als der Wirt im Begriff war, unter den Tisch zu fallen, und die Stimmung demzufolge auf ihrem Höhepunkt war, kam der Oberkellner herein und gab Herrn von Brakel einen Brief. Es war ein ganz gewöhnlicher Brief, in einem hellblauen, viereckigen Kuvert. Und dann verschwand von Brakel.
Der dritte, der verschwand, war der bekannte, sehr beliebte und noch mehr gefürchtete Schriftsteller und Kritiker, Doktor jur. Eivind Oedegaard. Es geschah unter höchst seltsamen Umständen, nach einem Fest im Grand Hotel.
Damit man den Zusammenhang richtig versteht, müssen die Ereignisse der Reihe nach berichtet werden. Das Verschwinden von Direktor Reismann machte außerhalb seines Kreises eigentlich kaum Aufsehen. Seine Bekannten und Freunde waren es gewöhnt, daß der Direktor des Tanzlokals sich allerhand exzentrische Handlungen vornahm, die ihre Erklärung erst später fanden. Schon am selben Abend sprach eines der Mitglieder des Klubs das erlösende Wort: »Frauenzimmergeschichten natürlich!«, womit er eine Lösung gefunden hatte, die allgemein anerkannt wurde.
Als aber der Maler Karl-Erich von Brakel zwei Tage später auf dieselbe rätselhafte Weise nach Empfang eines ganz gewöhnlichen hellblauen Briefes verschwand, bekam die Sache ein anderes Aussehen. Diese und jene Zeitung brachte eine Notiz darüber, und die Freunde der Verschwundenen setzten sich in Bewegung, um eine Erklärung des Mysteriums zu finden. Wie diese Affäre sich teils humoristisch, teils tragisch entwickelte, soll hier berichtet werden. Wie bekannt, glückte es den Freunden erst nach langer Zeit, Licht in die Angelegenheit zu bringen, und erst jetzt ist das ganze Drama vollständig aufgeklärt worden. Dieses Drama enthält, wie bereits gesagt, eine seltsame Mischung von Ernst und Scherz. Anfangs war das Humoristische vorherrschend, aber es dauerte nicht lange, da wurden blutige Fäden in das Gewebe verflochten. Tatsächlich begann die Tragödie bereits, als der schwedische Maler von seinem Schicksal ereilt wurde. Die Fäden dieser Geschichte zu entwirren, ist keine geringere Aufgabe, als ein Stück des stets wunderbaren und unberechenbaren Lebens mit seinem spitzfindigen und launenhaften Spiel mit Menschenschicksalen aufzudecken.
Eine genaue Schilderung der Lage, zu dem Zeitpunkt, als die Geschichte mit dem hellblauen Brief ihren Anfang nahm, ist erforderlich. Es ist abends elf Uhr, am 29. November. Es ist Spielabend im »Freisinnigen Klub«, der einen mehr gesellschaftlichen als politischen Charakter trägt, und der Raum bietet den bekannten Anblick, mit seinen vielen Spiel- und Schachtischen. Um die Tische haben sich neugierige Zuschauer gesammelt. Nur an wenigen Tischen sitzen vereinzelte Gäste, bekannte liberale Politiker, die ihre Zeitungen lesen. Die Stimmung ist behaglich und heimlich, wie es sich in einem Klub gehört, der auf einen guten bürgerlichen Ton Wert legt. Hin und wieder wird die Stille von Gelächter und Lärm unterbrochen, wenn das Spiel eine Sensation bringt.
Die meisten Neugierigen haben sich um den Tisch geschart, der gleich rechts neben der Tür steht; dort hat eine Pokerpartie, die mit sehr hohen Einsätzen spielt, während der letzten Stunden die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Man spielt nicht mit Geld, die Regeln des Klubs lassen das nicht zu, aber die verschiedenfarbigen Spielmarken, die in Stapeln oder Häufchen den Tisch füllen, haben höheren Wert. An diesem Tisch sitzt Joachim Reismann, Direktor des Tanzlokals »Die blaue Eule«. Er spielt gegen Generaldirektor Stenesen. Die anderen drei Herren haben ihre Karten hingelegt. Stenesen hat einen hohen Stapel Spielmarken vor sich hingeschoben, die einen Geldwert von dreitausend Kronen vorstellen, und Reismann hat diesen dreitausend Kronen entsprochen und sie noch um zweitausend erhöht. Da das Spiel durch die nachfolgenden Ereignisse große Bedeutung bekam, ist es wichtig, dies zu erwähnen.
Reismann ist ein noch verhältnismäßig junger Mann, reich, und gehört zur besten Gesellschaft, was erstaunlich klingt, wenn man bedenkt, daß er der Leiter eines Tanzlokals ist. Sein Ansehen hat er sich indessen als Violinspieler und Komponist sehr beliebter Operetten erworben. Ein ererbtes Vermögen hat ihn instand gesetzt, als Kunstsammler zu glänzen, und ein angeborenes Geschäftstalent hat ihm rechtzeitig die gute Idee eingegeben, die weniger einbringende Künstlerlaufbahn aufzugeben und statt dessen in Konzertbureaus, Vergnügungsetablissements und dergleichen zu spekulieren. Seine geschäftlichen Unternehmungen behalten dadurch etwas von dem Nimbus der Kunst. Er gehört unbedingt zu der Gesellschaft, wo man sich amüsiert, und seine angenehme Art und lustigen Einfälle haben ihm viele Bewunderer und Freunde verschafft. Er ist eine gesuchte Persönlichkeit, nicht zum wenigsten weil er gern an einem hohen Spiel teilnimmt. Nicht einmal bei dem wildesten Pokerspiel verliert er sein Phlegma und trägt stets ein überlegenes Lächeln zur Schau, ob er gewinnt oder verliert.
Von seinem Gegenspieler, Generaldirektor Stenesen, braucht man eigentlich nichts weiter zu sagen, als daß sein Spitzname »der Grogkönig« ist; damit bezeichnet man ihn am besten. Er ist eine große schwerfällige Gestalt und sagt oder tut ungern etwas, das sich nicht auf das bezieht, womit er im Augenblick beschäftigt ist – in seinen ledigen Stunden meistens Grog und Kartenspiel. Es wird von ihm erzählt, daß er einst in einer Gesellschaft einen Stuhl in Grund und Boden getrunken hat – er hatte ganz still gesessen und einen Grog nach dem anderen hinter die Binde gegossen, beim achten aber brach der Stuhl unter ihm zusammen und der »Grogkönig« sank mit einem Krach zwischen die Trümmer. Jede Unterbrechung des Kartenspiels ist ihm zuwider, und wenn einer der Spieler es wagt, während des Spiels mit einer Anekdote zu beginnen, fährt er aus der Haut. Voraussichtlich wird er eines Tages den Schlag bekommen, wenn ein hübsches junges Mädchen an den Spieltisch tritt, die Karten zusammenschiebt und sagt: »Kommen Sie, wir wollen lieber tanzen!«
Also: Reismann reizt mit zweitausend. Der Grogkönig setzt mit seinen dicken, roten Fingern und sagt:
»Ich doubliere.«
Jetzt sind fünfzehntausend Kronen gesetzt, und zwischen den Neugierigen, die sich um den Spieltisch drängen, herrscht erwartungsvolles Schweigen. Reismann hat seine fünf Karten gelassen mit der Rückseite nach oben auf den Tisch gelegt. Stenesen hielt seine in der Hand. Er trinkt einen Schluck aus seinem Grogglas und grunzt; das ist der einzige Laut, den man von ihm am Spieltisch hört, daraus kann man keine Schlüsse ziehen.
In diesem Augenblick kommt der Oberkellner des Klubs, Halvar, herein, drängt sich bis zum Spieltisch durch und überreicht Reismann das hellblaue Kuvert.
»Es ist eilig,« sagt er.
Unter anderen Umständen hätte Reismann den Brief sicher erst geöffnet, wenn das Spiel entschieden wäre. Als er aber das blaue Kuvert sieht, fährt er zusammen, erbricht es, zieht eine blaue Karte heraus, etwas größer als eine Visitenkarte, und durchfliegt sie hastig. Darauf steht er, ohne ein Wort zu sagen, auf, verläßt den Spieltisch und geht hinaus. Alle Anwesenden machten die Beobachtung, daß weniger der Inhalt des Briefes als sein Erscheinen überhaupt ihn so aus der Fassung gebracht hatte.
Die Spannung am Spieltisch war ungeheuer, denn der Einsatz war sogar für diese Herren ungewöhnlich hoch. Reismann war an der Reihe, zu verdoppeln, und der Einsatz würde auf dreißigtausend Kronen steigen. Bargen seine fünf Karten, die auf dem Tisch lagen, dieses Vermögen?
Man hatte erwartet, daß Reismann sofort zurückkehren würde. Aber eine Viertelstunde verging, und er war noch nicht da. Der Grogkönig wurde furchtbar ungeduldig und grunzte geradezu drohend. Man rief nach Halvar.
Halvar kam.
»Herr Reismann ist fortgegangen,« sagte er.
Es gab einen Aufstand. Man wollte seinen eigenen Ohren nicht trauen.
»Er hat seinen Pelz angezogen und ist fortgegangen,« sagte Halvar erklärend. »Ich fragte ihn, ob er bald zurückkäme, aber darauf hat er gar nicht geantwortet.«
Nachdem noch eine Viertelstunde vergangen war, ohne daß Reismann etwas von sich hatte hören lassen, wurde der Spielinspektor des Klubs herbeigerufen. Nach kurzer Beratung wurde bestimmt, daß die Karten versiegelt werden sollten. Reismanns Karten, die Karten des Grogkönigs und die übrigen Karten wurden je in ein Kuvert getan und versiegelt, worauf alle drei Kuverts in den Geldschrank des Klubs eingeschlossen wurden.
Die Neugierde über den Ausgang des Spieles wurde an diesem Abend nicht befriedigt. Reismann kam nicht zurück. Nachts um zwei Uhr aber versuchte ein Herr, wie bereits gesagt, das seltsame Ereignis zu erklären.
»Frauenzimmergeschichten natürlich. Diese verfluchten Frauenzimmer!«
Der Maler Karl-Erich von Brakel
Wir kommen jetzt zu dem Nächsten, der von demselben Schicksal betroffen wurde: der schwedische Maler Karl-Erich von Brakel, dessen Ausstellung im mondänen Ausstellungslokal der Stadt teils heftigen Widerstand, teils tiefe Bewunderung erweckt hatte. Das umstrittenste Bild der Ausstellung war eine Riesenleinwand, die – ja, was stellte sie eigentlich vor? Man behauptete, daß das Bild den japanischen Admiral Togo vorstellte, der in blauem Pyjama zwischen zweitausend Ratten tanzte. Der Künstler hatte den Ratten eine ganz besonders sorgfältige Ausführung zuteil werden lassen und sich nur widerstrebend dazu überreden lassen, das Kunstwerk auszustellen, weil drei der Ratten noch nicht ganz fertig waren. Er war eigentlich mehr Franzose als Skandinavier, dunkel wie ein Provenzale. Ein langjähriger Aufenthalt im fernen Osten hatte seinem Wesen ein einnehmendes Phlegma und einen gewissen asiatischen Zynismus verliehen, während er gleichzeitig ein echter Vertreter des alten schwedischen Adels war, der durch Verfeinerung und Dekadenz die brutale Kraft der Vorfahren zu ersetzen versuchte. In dem einen Augenblick konnte er über ein unanständiges Wort erröten, während er im nächsten selbst eine Erzählung zum besten gab, bei der ein ganzes Coupé von Handelsreisenden in den Boden versank. Es war klar, daß er als Künstler ein Prophet für das Allerneueste in der Kunst werden mußte. Er versuchte, durch die Malerei ähnliche mystische Visionen wiederzugeben, wie ein Poe ihnen in seiner Dichtung Ausdruck gegeben hatte. Er trank viel und häufig, sein vornehmes Aeußere aber blieb von den plebejischen Wirkungen der Trunksucht unberührt. Bei dem obenerwähnten Mittagessen im Grand Hotel, in der Nacht zum 2. Dezember, war er Ehrengast.
Ein Uneingeweihter würde den Kreis von Herren, die um den reichbesetzten Tisch versammelt waren, sicher als eine sehr gemischte Gesellschaft bezeichnet haben. Sie umfaßte auch eine Menge Kontraste, vom Dichter Oxford bis hinunter zum Grogkönig Stenesen. Die Bekanntschaft des letzteren haben wir bereits gemacht. Was den Dichter Oxford betrifft, so war er fast nicht zu beschreiben – ein junger Geck, nordisch blond, so hell und luftig, daß er in der Landschaft fast unsichtbar wurde. Am besten konnte man ihn durch die Gegenstände charakterisieren, die er besaß oder die mit ihm in Verbindung standen. Wenn er in seinem lackglänzenden Auto lautlos dahinglitt, war er ein Pelzkragen und ein goldenes Armband, ein Band Swinburne in der Westentasche, ein Absinth, ein Browningrevolver, ein liebenswürdiges Lächeln, eine Fahrkarte erster Klasse nach Bombay und ein Korb Champagner. Außer ihm und dem schwerfälligen Grogkönig umfaßte die Gesellschaft eine ganze Reihe älterer und jüngerer Herren, Künstler und Kaufleute. Alle waren verschieden, jeder hatte seine Eigenheiten und Lebensanschauungen, und die verschiedenen Seelenstimmungen brachen sich wie die Farben in einem Spektrum. Und dennoch war die Gesellschaft homogen, denn alle Anwesenden gehörten zu der Sorte Menschen, die in einer Welt von Enge und Trübseligkeit dem Leben sorglose Seiten abzugewinnen versuchten.
Das Mittagessen war zu Ende. Der breite, geräumige, festlich geschmückte Tisch war dicht besetzt mit halbgeleerten Champagnerflaschen, braunen Zigarrenkisten, Zigaretten in silbernen Bechern und vielfarbigen Likörflaschen. Die Kellner gossen die letzten Tropfen aus den Kaffeekannen ein, und von Stenesens Platz erklang bereits das hitzige Zischen des ersten Whisky-Grogs. Das ist der vornehmste Augenblick bei einem Liebesmahl. Der Tisch scheint in einem Zwischenakt noch einmal vom Festbrausen widerzuhallen, während bereits neue Gläser und Flaschen eine kräftigere Melodie anstimmen. Die Unterhaltung bekommt durch den Auftakt gesteigerter Festfreude neuen Glanz, während alle unbewußt unter dem Einfluß des sorglosen Dahinlebens froher Stunden stehen. Niemals und nirgends empfindet man Freiheit so intensiv und bezaubernd, als wenn man sich vor der Fortsetzung eines frohen Festes ein wenig gehen läßt, bei der Aussicht auf eine ungestörte, behagliche Nacht, die die langsame Steigerung des Rausches mit sich bringen wird, und Genüsse, deren Eintreffen niemand bezweifelt und die die Menschen liebevoll gegeneinander stimmen.
Als von Brakel seine Berufung erhielt, war dies Ereignis durch nichts vorbereitet. Es herrschte allgemein ungetrübte Heiterkeit, an der von Brakel eifriger Teilnehmer war. Der Wirt, Herr Oxford, schwirrte in gehobener Champagnerstimmung herum. Ueber dieses Fest hatte er seit Tagen nachgedacht. Besonders hatte ein in Likör gebratener Fasan ihm Kopfzerbrechen gemacht. Als er aber sah, daß sich alles gut abgewickelt hatte, fühlte er sich erleichtert wie nach einer schwierigen Arbeit. Wenn er auf einem der glatten Lederstühle Platz nahm, glitt er immer so merkwürdig wieder herunter. Wenn er sich aber auf den Tisch setzte und gegen eine Jardiniere lehnte, die auf dem Tischtuch stand, fiel es kaum auf, denn er war so klein und zierlich, daß man ihn für einen Teil der Tischdekoration hielt.
An dem Tischende, wo der Grogkönig den stummen und unerschütterlichen Mittelpunkt bildete, wurde von dem Ereignis im »Freisinnigen Klub« vor zwei Tagen gesprochen. Die Partie, der hohe Einsatz, die versiegelten Karten bildeten den Brennpunkt des allgemeinen Interesses. Und das war bezeichnend dafür, wie wenig Aufsehen die Hauptsache, das Verschwinden von Direktor Reismann, eigentlich gemacht hatte. Man hatte ihn nicht wiedergesehen und kaum jemand hatte nach ihm gefragt. Man war an seine Extravaganzen gewöhnt. Er hätte eigentlich an dem Liebesmahl teilnehmen sollen, und mancher von den Gästen meinte, er würde wohl noch kommen.
Der Schriftsteller Eivind Oedegaard, der gern diskutierte und logische Vergleiche anstellte, sagte:
» Wenn die Sache einem anderen passiert wäre – meine Herren, wir alle kennen ja Reismann – wenn die Sache aber einem anderen passiert wäre, einem weniger extravaganten Menschen, dann könnte man sich folgendes vorstellen –«
Trotz der Vorbehaltenheit, die Oedegaard plötzlich an den Tag legte, wollte man seine Meinung gern hören, denn das kleinste Detail dieser geheimnisvollen Pokerpartie interessierte jeden einzelnen der Gesellschaft.
»Also,« fuhr Oedegaard schließlich fort und gestikulierte mit seinen langen Händen, »Reismann versucht zu bluffen, denn eigentlich hat er gar keine guten Karten. Er steigert den Einsatz auf fünftausend Kronen, in der Hoffnung, daß Stenesen seine Karten hinlegt oder Teilung vorschlägt. Stenesen aber verdoppelt das Spiel bis zu zehntausend. Sie müssen zugeben, meine Herren, daß das sogar heutzutage ein hoher Einsatz ist. Da, in dem spannendsten Augenblick kommt der Brief. Reismann legt seine Karten hin und verläßt das Spiel. Vielleicht hat er bei sich gedacht: Es ist eine günstige Gelegenheit, mich zu drücken und meine Zehntausend zu sparen; nachher behaupte ich, daß das Spiel nicht reell zu Ende geführt worden ist.«
Diese Worte riefen allgemeinen Protest heraus.
»Es ist ja nichts weiter als ein Gedankenexperiment von mir,« wandte Oedegaard ein. » Wenn –«
»Das ist Unsinn!« rief man ihm entgegen. »Es war ein ganz korrektes Spiel, das volle Gültigkeit hat. Die Karten sind versiegelt und werden im Klub verwahrt. Außerdem, wer sagt, daß Reismann nicht das Spiel in der Hand hatte?«
»Zugegeben. Vielleicht hat Stenesen geblufft. Welche Karten hattest du, Stenesen?«
Stenesen grunzte, nahm einen tiefen Schluck aus seinem Grogglas und lächelte.
»Das werde ich dir nur für dreißigtausend Kronen verraten,« sagte er.
Da geschah es, daß der Portier des Hotels ins Zimmer trat, sich über von Brakel beugte und ihm etwas ins Ohr flüsterte.
»Ein Chauffeur,« murmelte er erstaunt. »Bringen Sie ihn her.«
»Er will Sie allein sprechen, Herr von Brakel,« sagte der Portier.
Von Brakel erhob sich, aufs äußerste verwundert, und verließ die Gesellschaft.
»Ihr sollt sehen, es ist Reismann,« bemerkte einer.
»Reismann? Weshalb sollte er nicht selbst hereinkommen?« wurde ihm erwidert.
Und damit wurde die lärmende Unterhaltung wieder aufgenommen.
Erst als von Brakel nach wenigen Minuten zur Gesellschaft zurückkehrte, zog er die allgemeine Aufmerksamkeit wieder auf sich.
Er stand plötzlich in der Tür, im Ulster, den Hut in der Hand.
Er war blaß und verwirrt.
»Meine Herren,« sagte er, »ich muß die Gesellschaft verlassen.«
Was war das? Es wurde ganz still um den Tisch herum. Das verstörte Aussehen des Malers machte einen starken Eindruck auf seine Freunde.
»Bist du krank?« fragte einer.
»Nein,« antwortete von Brakel stammelnd, »nein, ich –«
Er tastete mit der einen Hand nach seiner Rocktasche, als ob er seinen Freunden etwas zeigen wollte. Bedachte sich dann aber eines Besseren. Ganz geistesabwesend, als ob er schon weit fort sei, nickte er seinen Freunden zu und ging schnell seines Weges.
Sein Benehmen war so seltsam gewesen, daß die Freunde eine ganze Weile ratlos sitzenblieben.
Dann aber sprang einer auf und rief:
»Teufel noch eins, das müssen wir näher untersuchen.«
Er eilte hinaus. Von Brakel war schon fort.
Als er in die Halle kam, hörte er das Schnaufen eines Autos, das in Gang gesetzt wurde und davonfuhr.
»Die hatten's eilig,« sagte der Portier. »Sehen Sie, die Tür schwingt noch, eben ist er erst durchgegangen.«
»Was war denn eigentlich los?« fragte der Freund.
»Tja, was war los?« wiederholte der Portier. »Wissen Sie, was er sagte, als er durch die Tür eilte: ›Ich bin ein unglücklicher Mensch,‹ sagte er. Er sah ganz verstört aus. Ich möchte wissen, was in dem Brief gestanden hat.«
»Hat er einen Brief bekommen?« fragte der Freund.
»Ja,« antwortete der Portier, »er bekam einen Brief. Dort auf dem Teppich liegt noch das Kuvert.«
Es war ein hellblaues Kuvert.
Gespräch zwischen zwei Herren
Als der Freund zur Gesellschaft zurückkehrte, wurde er von einem Sturzbad von Fragen überschüttet: Was fehlte ihm? Kommt er nicht zurück? War es eine Frauenzimmergeschichte? War er krank?
Der Freund, dessen Name Doktor Ovesen war, einer der bekanntesten Aerzte der Stadt, wehrte alle Fragen mit einer kurzen Handbewegung ab.
»Von Brakel wird sicher im Laufe der Nacht zurückkehren,« sagte er.
»Daß der Ehrengast sich auf solche Weise absentiert?« bemerkte einer.
»Es schien eine sehr wichtige Angelegenheit zu sein,« meinte der Schriftsteller Oedegaard, »der Mensch sah ganz verstört aus. Er war blaß.«
»Ich glaube, er sagte etwas von einem wichtigen Telegramm aus Stockholm,« berichtete Doktor Ovesen. »Aber er drückte sich nicht klar aus, er hatte es so eilig.«
»Hast du ihn noch gesprochen?« fragte Oedegaard quer über den Tisch.
»Nur ganz kurz,« antwortete Doktor Ovesen. »Ich sollte ihn bei sämtlichen anwesenden Herren entschuldigen, er wollte so bald wie möglich zurückkommen.«
»Hat er sonst noch etwas gesagt?«
»Nein.«
»Der Ehrengast ist ein Rindvieh!« sagte Oedegaard mit Ueberzeugung.
Oedegaard scheint betrunken zu sein, dachte Doktor Ovesen und fixierte ihn scharf.
Indessen ließ man den Ehrengast Ehrengast sein und setzte die Unterhaltung fort. Die Mißstimmung war bald vorüber, nach einer halben Stunde fragte keiner mehr nach von Brakel.
Das hatte Doktor Ovesen vorausgesehen. Bereits in der Halle hatte er den Entschluß gefaßt, eine Erklärung über von Brakels Verschwinden zu geben, die niemand aus der Gesellschaft beunruhigen sollte. Vor allem wollte er den seltsamen Umstand mit dem hellblauen Kuvert geheimhalten, der ja direkt auf Reismanns Verschwinden vor zwei Tagen hinwies. Doktor Ovesen legte auch dem Portier unbedingtes Schweigen auf.
Doktor Ovesen war indessen das ganze Fest verdorben. Er konnte seine Gedanken nicht von Karl-Erich von Brakel losreißen. Er hatte das hellblaue Kuvert zu sich gesteckt und benutzte die erste Gelegenheit, um es näher zu betrachten. Es war ein viereckiges, hellblaues Kuvert von gewöhnlicher Größe. Die Aufschrift lautete: Herr von Brakel. Weiter nichts. Keine Adresse. Doktor Ovesen meinte, daß die Tinte mindestens zwei Stunden alt sein müsse. Die Schriftzüge waren steil und hart, ungewöhnlich hart, fand Doktor Ovesen. Die Buchstaben standen so steil und gezwungen, daß sie den Eindruck einer verstellten Handschrift machten.
Als die Uhr gegen drei geworden war, bemerkte Doktor Ovesen, daß einer der Gäste Miene machte, sich in aller Stille zurückzuziehen. Es war ein Herr in den Dreißigern, von energischem Aussehen, mit einem wettergebräunten und sympathischen Gesicht, ein Kapitän z. S. mit Namen Färden. Ovesen folgte ihm.
»Wollen Sie schon gehen, Herr Kapitän?«
Kapitän Färden hatte seinen Pelz über die eine Schulter gelegt. Er nickte. »Ich wohne hier im Hotel,« sagte er. »Ich brauche nur eine Treppe zu steigen. Es ist mir übrigens aufgefallen, daß Sie während der letzten Stunden so still gewesen sind. Ich bin auch etwas müde. Ein Schlummerpunsch oben auf meinem Zimmer würde uns vielleicht gut tun.«
»Ausgezeichnet!« sagte Doktor Ovesen. »Ich wollte Ihnen gerade etwas Aehnliches vorschlagen. Denn ich habe etwas Wichtiges mit Ihnen zu bereden.«
Kapitän Färden sah ihn erstaunt an.
»Mit mir?«
»Mißverstehen Sie mich nicht. Es betrifft nicht Sie persönlich, sondern einen unserer gemeinsamen Freunde. Es ist nur ein Zufall, daß ich mich vertrauensvoll an Sie und nicht an einen anderen wende. Ich kann es nicht verantworten, länger über die Sache zu schweigen. Ich glaube bestimmt, daß etwas sehr Ernstes geschehen ist.«
So leicht ließ Kapitän Färden sich nicht schrecken. Er öffnete eine neue Zigarrenkiste und bot Doktor Ovesen eine leichte delikate Holländer an, die er von seiner letzten Reise mitgebracht hatte. Während er die Whisky-Grogs mischte, sagte er:
»Sie rechnen Herrn von Brakel zu meinen Freunden?«
»Ja, und auch Reismann. Um diese beiden handelt es sich. Beide sind auf vollkommen rätselhafte Weise verschwunden, und es ist die Pflicht ihrer Freunde, ihnen zu Hilfe zu kommen, wenn sie in Gefahr sind.«
»Ich begreife, daß es etwas sehr Ernstes sein muß,« antwortete Kapitän Färden, indem er Doktor Ovesen gegenüber am Tisch Platz nahm, »denn Sie achten nicht einmal auf die Güte der Zigarre, was doch sonst Ihre Spezialität ist. Was war es übrigens mit von Brakel? Ein Telegramm aus Stockholm, nicht wahr?«
»Nein, ich habe ihn gar nicht mehr gesprochen. Es war eine Notlüge, die ich mir ausgedacht hatte, weil ich die Gesellschaft nicht stören wollte. Von Brakel ist fortgegangen, ohne einen Bescheid zu hinterlassen. Der Portier aber hat ihn sagen hören, daß er ein unglücklicher Mensch sei – oder etwas Aehnliches. Er hatte einen Brief bekommen.«
Bei diesen Worten zog Doktor Ovesen das hellblaue Kuvert aus der Tasche. Beim Anblick desselben sprang der Kapitän auf.
»Er auch?« rief er. »Die Herren hier in Christiania scheinen mir etwas exzentrisch zu sein! Das Kuvert ist leer. Was hat in dem Brief gestanden?«
»Ja, wer wüßte, was in diesen verfluchten Briefen steht. Ich habe nur das leere Kuvert gefunden, das von Brakel auf der Treppe verloren hat.«
»Hatte Direktor Reismann einen ebensolchen Brief bekommen?«
»Genau ebensolchen. Ich war im Freisinnigen Klub zugegen, als er ihn bekam. Und ich will Ihnen gestehen, mein lieber Kapitän, daß ich bereits seit gestern vormittag wegen Reismann in großer Sorge bin.«
»Haben Sie besondere Ursache dazu?«
Doktor Ovesen lehnte sich in den Stuhl zurück und legte umständlich seine Handflächen gegeneinander, wie es seine Gewohnheit war, wenn er ein medizinisches Gutachten abgab.
»Ich bin nicht nur Direktor Reismanns Arzt,« begann er, »ich bin auch, wie Sie wissen, sein langjähriger Freund, und außerdem stehe ich in Geschäftsverbindung mit ihm. So bin ich z.B. in der Direktion des Etablissements »Die blaue Eule«. Reismann ist ja in mancher Beziehung eine Künstlernatur. Er hat Boheme-Blut in sich und extravagiert hin und wieder gern etwas. Nichtsdestoweniger aber wurzelt er doch im Bürgerlichen, besonders in geschäftlichen Dingen pflegt er auf dem Posten zu sein. Es ist schon früher vorgekommen, daß er einen sogenannten ›Streifzug‹ unternommen hat, aber nicht ohne Sorge zu tragen, daß er mit seinem Bureau in Verbindung blieb. Diesmal aber hat er nichts Derartiges vorgesehen, und ich muß sagen, daß seine Geschäfte unter seiner Abwesenheit gelitten haben. Ich habe getan, was ich konnte, aber meine Zeit ist knapp, und natürlich konnte ich ihn nicht ersetzen. Was mich besonders beunruhigt, ist, daß die große Wohltätigkeitsvorstellung, bei der er der Hauptmacher ist, ins Wasser zu fallen droht. Sie haben wohl in den Zeitungen gelesen, daß »Die blaue Eule« in einigen Tagen eine Weihnachtsvorstellung geben wird. Reismann hat sich außerordentlich dafür interessiert, und ich weiß, daß er seine Ehre darein setzt, sie so erfolgreich wie möglich zu gestalten. Jetzt droht seine plötzliche Abwesenheit das Ganze über den Haufen zu werfen. Jeder Tag, ja, jede Stunde ist kostbar. Ich bin überzeugt, daß Reismann alles daran setzt, um zu seiner Tätigkeit zurückzukehren. Wenn er nicht kommt, bedeutet es nicht mehr und nicht weniger, als daß jemand ihn daran hindert. Jemand, der stärker ist als er.«
»Frauenzimmergeschichten?« fiel Kapitän Färden ein, indem er sich der Bemerkung des Freundes von neulich abend erinnerte.
»Unsinn!« rief Doktor Ovesen. »Reismann ist kein Jüngling mehr. Nein, ich glaube, daß er sich in einer schwierigen Lage befindet, daß er außerstande ist, sich mit seinen Freunden in Verbindung zu setzen. Keiner von ihnen hat eine Mitteilung von ihm bekommen, ebensowenig sein Geschäft und seine Privatwohnung. Vielleicht ruft er in diesem Augenblick um Hilfe. Wir können uns nicht länger passiv verhalten.«
Der Kapitän überlegte. Augenscheinlich war jetzt auch er von dem Ernst dieses besorgniserregenden Ereignisses überzeugt.
»Warum aber hat er die Gesellschaft verlassen?« fragte er. »Das begreife ich nicht. Warum?«
Doktor Ovesen schlug mit der Faust auf das blaue Kuvert.
»Wenn man wüßte, was in dem Brief gestanden hat,« sagte er.
Der Kapitän schüttelte ratlos den Kopf.
»Mein Verstand steht still,« sagte er. »Wir befinden uns doch glücklicherweise nicht zwischen Verschwörern und heimlichen Verbindungen. Wir sind nicht in dem unterirdischen Rußland oder zwischen irländischen Revolutionären. Sind sonst noch hier in der Stadt ähnliche lichtscheue und geheimnisvolle Dinge vorgekommen?«
»Nicht, daß ich wüßte. Außerdem gehören ja beide Herren einer bürgerlichen, wenn auch ein wenig bohemegefärbten Klasse an, deren Interessen und Leben für einen jeden offen daliegen. Beachten Sie den Fall von Brakel. Den ganzen Abend ist er die Sorglosigkeit in Person. Plötzlich bekommt er diesen Brief und ist im selben Augenblick wie verwandelt, stürzt Hals über Kopf davon, ohne seinen besten Freunden eine Erklärung zu geben.«
Der Doktor sah auf seine Uhr.
»Die Uhr ist vier,« sagte er, »mit jeder Stunde, die vergeht, werde ich besorgter. Von Brakel wohnt im Hotel Savoy, Zimmer Nr. 17. Vielleicht können wir dort eine Spur finden. Kommen Sie mit?«
»Ich komme mit,« sagte der Kapitän.
Ein dritter Herr
Als die Herren in die Halle kamen, hörten sie, wie im ersten Stockwerk, wo das Fest stattfand, gelärmt wurde. Es war offenbar noch immer im vollen Gange. Um keine unnötigen Erklärungen abgeben zu müssen, beschlossen die Herren, daß sie sich unbemerkt aus dem Hotel schleichen wollten. Unten beim Portier aber stießen sie auf den Schriftsteller Oedegaard, der gerade im Begriff war, fortzugehen.
Sie kamen überein, daß sie ihn zu Rate ziehen wollten. Der Schriftsteller Oedegaard war ein praktischer und gerissener Mensch, der gerade in solchen Dingen von großem Nutzen sein konnte. Außerdem war er Romantiker genug, um das Seltsame und Mystische dieser Sache richtig aufzufassen.
Während die Herren sich für einige Augenblicke auf den weichen Sesseln des Lesezimmers niederließen, wurde Oedegaard in die Affäre eingeweiht. Oedegaard nahm die Sache noch ernster, als Doktor Ovesen erwartet hatte.
»Was Direktor Reismann betrifft,« sagte er, »so wäre es denkbar, daß er Feinde hat, die ihm schaden wollen. Reismann ist ja geschäftlich ein Draufgänger und nicht immer sehr rücksichtsvoll in der Wahl seiner Mittel. Wer aber dem liebenswürdigen und vornehmen Künstler von Brakel Uebles will, das begreife ich nicht. Ich bin fast täglich mit ihm zusammen gewesen, seit er seiner Ausstellung wegen hier ist, und soweit ich weiß, hat er sich nur Freunde erworben. Ich bin überzeugt, daß es keinen Menschen in ganz Christiania gibt, der ihm etwas Böses antun will. Im übrigen ist er die ganze Zeit die Sorglosigkeit in Person gewesen und hat nur an sein Vergnügen gedacht. Wie das mit seiner Bemerkung: Ich bin ein unglücklicher Mensch! zusammenhängt, das begreife ich wahrlich nicht. Das muß ganz plötzlich gekommen sein.«
»Sehr richtig,« bemerkte Doktor Ovesen. »Es muß in dem Augenblick gekommen sein, als er sich vom Tisch erhob, oder noch näher bezeichnet, in dem Augenblick, als er den Brief las. Dasselbe Schreiben, das Reismanns Verschwinden veranlaßte, hat auch von Brakel die Furcht vor einem Unglück eingegeben.«
Oedegaard schlug mit der Faust auf die gepolsterte Armlehne.
»Zum Donnerwetter!« rief er. »Was hat in diesen verfluchten Briefen gestanden? Tja, Sie lächeln ganz ratlos, Doktor Ovesen, Sie müssen aber doch zugeben, daß wir hier in unserer kleinen friedlichen Hauptstadt nicht auf derartige sensationelle und mystische Ereignisse eingestellt sind. Besonders auffallend ist, daß weder Reismann, noch von Brakel ihren Freunden den Inhalt der Briefe mitgeteilt haben. Was auch in den blauen Billetten gestanden haben mag, so haben die Adressaten sich jedenfalls gezwungen gesehen, dem Ruf unverzüglich Folge zu leisten. Mit anderen Worten, wenn die Mitteilung unerwartet gekommen ist, so war sie jedenfalls nicht unbegreiflich. Das kann man jetzt schon feststellen. Beide Briefempfänger sind sich sofort darüber klar gewesen, daß es sich um etwas ungewöhnlich Ernstes handelte. Darum haben auch wir, meine Herren, allen Grund, die Sache aufs ernsteste zu betrachten, und wenn wir der Ansicht sind, daß unsere Freunde der Hilfe bedürfen, können wir keinen Augenblick länger zögern.«
Derselben Ansicht waren auch Doktor Ovesen und Kapitän Färden – und Doktor Ovesen erhob sich bereits ungeduldig.
»Lassen Sie uns sogleich aufbrechen,« sagte er.
»Wohin?« fragte Oedegaard.
»Wir wollen uns zu von Brakels Hotel begeben, Savoy, bei der Tordenskjoldsgade. Vielleicht können wir dort etwas erfahren.«
»Er hat Zimmer Nr. 17,« sagte Oedegaard, »mit Telephon. Wollen wir nicht erst anrufen? Es wäre doch immerhin möglich, daß er schon zurückgekehrt ist.«
Oedegaard trat an einen großen Mahagonitisch, wo die Apparate standen, und nahm den Hörer. Als er Verbindung mit dem Nachtportier des Savoy-Hotels bekommen hatte, hörten die beiden Herren ihn sagen:
»Ist von Brakel zu Hause? ... Nicht ... Wann? ... Vor zwei Stunden ... Also ungefähr um zwei Uhr ... Er kam in einem Auto und fuhr mit demselben Auto weiter? ... Hat er nichts hinterlassen? ... Nichts ... Er hatte es sehr eilig? ... Wir kommen gleich ins Hotel, in einer sehr wichtigen Angelegenheit.«
»Er ist im Hotel gewesen,« erklärte Oedegaard. »Er war zwei oder drei Minuten oben auf seinem Zimmer und eilte dann wieder fort. Ich bin im Hotel bekannt, und Sie ja übrigens auch, Doktor Ovesen. Der Nachtportier wird uns ohne Schwierigkeiten einlassen. Vielleicht finden wir etwas, das uns Aufklärung bringt ... Uebrigens, hallo, Jonassen!« rief er. »Jonassen!«
Der Portier kam aus seiner Loge.
»Sie sprachen ja den Chauffeur, der den Brief für Herrn von Brakel brachte?«
»Ja, ich holte Herrn von Brakel heraus.«
»Kannten Sie den Chauffeur?«