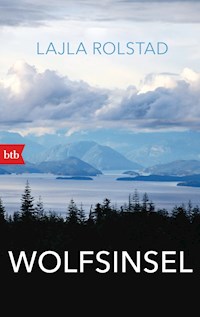
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kraftvoll, persönlich und poetisch - die Erfahrungen einer jungen Frau allein in der Wildnis
»Muss ich so leben, wie ich es bisher getan habe?«, fragt sich Lajla eines Tages – und bucht ein Flugticket nach Kanada. In den folgenden Jahren verbringt sie lange Phasen allein in der Wildnis, trifft Trapper, Hippies, Schamanen und Abenteurer und lernt, dass die Suche nach Freiheit oft mit der Beschränkung aufs Wesentliche beginnt. Eine kraftvolle, wilde und unmittelbare Erzählung, die einen zum Nachdenken zwingt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 370
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Zum Buch
»Muss ich so leben, wie ich es bisher getan habe?«, fragt sich Lajla eines Tages – und bucht ein Flugticket nach Kanada. In den folgenden Jahren verbringt sie lange Phasen allein in der Wildnis, trifft Trapper, Hippies, Schamanen und Abenteurer und lernt, dass die Suche nach Freiheit oft mit der Beschränkung aufs Wesentliche beginnt. Eine kraftvolle, wilde und unmittelbare Erzählung, die zum Nachdenken zwingt.
Zur Autorin
LAJLA ROLSTAD geboren 1978, gehört zu den spannendsten jungen Stimmen Norwegens. Wolfsinsel ist ihr zweiter Roman.
Lajla Rolstad
WOLFSINSEL
Aus dem Norwegischen von Gabriele Haefs
Die norwegische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Ulveøya« im Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Übersetzung wurde von NORLA, Oslo, gefördert.
Der Verlag bedankt sich dafür.
Deutsche Erstausgabe Juli 2019
Copyright © der Originalausgabe 2015 by Gyldendal Norsk Forlag AS. All rights reserved.
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2019 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © Getty Images/Istvan Hernadi photography
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18548-0V002
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Die Insel
Es ist Mitte November, als ich auf die Insel komme. Ich bin zum ersten Mal allein in Kanada. Ich werde nicht bei Bekannten wohnen, werde auf das Haus aufpassen, weit weg von jeder Menschenseele. Das Grundstück gehört einer Familie aus den USA. Sie vermieten es im Sommer als Zentrum für Seminare und Retreats. Niemand wartet am Flughafen auf mich. Ich suche mir einen Bus, schleppe Rucksack und Koffer selbst. In der ersten Nacht im schon vorher per Internet bestellten Hotel schlafe ich wie eine Tote. Die Reise auf die Insel hinaus nimmt den ganzen folgenden Tag in Anspruch, ein Bus, mehrere Fähren, dann stehe ich am Kai. Es dämmert, die Arbutusbäume schimmern im Licht eines einsamen Toyota-Pick-up. Eine Frau mit roten Haaren steigt aus. Sie heißt Sierra. Sie drückt meine Hand. Wir laden mein Gepäck auf die Ladefläche und fahren über eine kurvenreiche Straße. Nach einer guten Viertelstunde biegen wir auf einen holprigen Waldweg ab, dann geht es ein Stück weit in den dunklen Zedernwald hinein, ehe wir auf einer kleinen Lichtung halten.
Von hier aus müssen wir zu Fuß weitergehen, sagt Sierra, ich helfe dir mit dem Gepäck. Sie nimmt meinen Koffer und geht voraus, weist den Weg. Sie schaltet die Stirnlampe ein, die sie über ihrer Pink-Floyd-Mütze befestigt hat.
Wir gehen schweigend weiter, der Weg ist von Austernschalen gesäumt. Du kannst damit im Dunkeln den Weg finden, sagt Sierra, wenn der Mond scheint. Die Schalen spiegeln das Licht.
Der Weg windet sich durch den Wald. Weit draußen über dem Meer, ein Stück weit führt der Weg an einem steilen Abgrund über glitschige Steine, ist fast nicht zu sehen.
Dort hinten liegt die Lavendelinsel, sagt Sierra, und zeigt in die Nacht hinaus. Du kannst sie jetzt nicht sehen, aber im Sommer ist das Wasser um sie herum lila wie Lavendel. Bei Ebbe kannst du hinüberwaten, so dicht liegt sie am Land. Und die Wolfsinsel, die liegt etwas weiter draußen. Dort gibt es eine große Wolfsmeute, du wirst sie hören, vielleicht schon heute Nacht. Es kommt vor, dass sie von der Wolfsinsel zu unserer Insel herüberschwimmen, dass sie nachts auf dem Grundstück am Strand auftauchen, aber du brauchst keine Angst zu haben, eigentlich machen sie um Menschen immer einen großen Bogen.
Ich sehe sie ungläubig an.
Sie ist gestresst, geht schnell, ich glaube, es passt ihr gar nicht, dass ich gekommen bin. Aber als wir das Grundstück und die einzeln stehenden Holzhäuser darauf erreicht haben, und als wir das Küchenhaus betreten, die Gaslampe an der Wand anzünden und einen Kessel mit Teewasser aufsetzen, sehen wir einander in die Augen und lächeln, und ihr Gesicht wird weicher. Sie fährt sich mit der Hand durch die roten Haare. Ihr Gesicht ist hell, und über dem Nasenrücken sind Sommersprossen verspritzt, ein junges Gesicht, ohne die geringste Spur von Schminke. Sie macht Tee, wir trinken aus großen Keramikbechern, sitzen lange da.
Es war dein Glück, dass du heute gekommen bist, sagt sie, ich fahre nämlich übermorgen, bleibe eine ganze Weile weg. Also bist du dann hier allein. Suzanne, die Gärtnerin, kommt zweimal die Woche, sie kann dir erklären, was du zu tun hast. Es sind so ungefähr zehn Stunden Arbeit pro Woche. Suz wird dir die Aufgaben zuteilen, den Rest der Zeit hast du zur freien Verfügung. Richte dich hier ein, wie du willst. Du kannst viele schöne Touren machen, oder wozu du eben Lust hast. Ich kann dir nicht mehr viel zeigen, ehe ich fahre, oben auf dem Hügel gibt es ein paar Felsenmalereien. Man behauptet, früher war das für die Eingeborenen eine heilige Stätte, wie überhaupt die ganze Umgebung. Das hier ist ein besonderer Ort, es ist unser Glück, dass wir hier nicht so viele sind, voriges Jahr hatten sie vier Leute, die aufgepasst haben, glaube ich. Ich war gestresst, als du gekommen bist, sagt sie, es war so viel in letzter Zeit, bitte entschuldige.
Ich schüttele den Kopf, sie braucht sich nicht zu entschuldigen. Ich finde sie sympathisch.
Ich komme irgendwann nach Neujahr wieder, sagt sie dann. In acht Wochen, vielleicht zehn. Kommt jetzt sicher ein bisschen überraschend für dich, dass du ganz allein hier draußen sein wirst. Ich kann dich auch meinen Freunden leider nicht mehr vorstellen. Aber du kannst Sophie’s Café besuchen, das ist ungefähr eine halbe Stunde von hier, du kannst es per Anhalter versuchen, wenn Autos kommen, dann geht es ein bisschen schneller. Da ist es nett. Ein Typ namens Deer, der eigentlich mit uns hier draußen wohnen sollte, hat kurz vor deiner Ankunft aufgehört, er hilft da manchmal aus. Und du kannst wohnen, wo du willst. Während ich weg bin, auch im Haus, da wohne ich sonst – da gibt es Strom, nicht viel, aber eine Leselampe für den Abend und eine Steckdose. Das Aggregat steht hinten beim Bürohaus, es brummt ab und zu ein bisschen. Ansonsten musst du einfach testen, wo du am liebsten wohnen willst. Denn bis zum Frühjahr sind nur wir beide hier. Die anderen schauen ab und zu mal vorbei, aber sie gehen den Weg immer zurück, bevor es dunkel wird. Du musst auf jeden Fall immer eine Stirnlampe bei dir haben, und am besten noch eine Reservelampe oder Ersatzbatterien. Denn jetzt im Winter wird es stockdunkel, und wenn der Mond sich hinter den Wolken versteckt, kannst du nicht mal die Hand vor den Augen sehen. Dann musst du stehen bleiben, verstehst du, wenn die Lampe erlischt, nicht weitergehen, denn du könntest irgendwo abstürzen oder dich verirren, das wäre nicht gut.
*
Ich schlafe allein in Sierras Haus. Sie hat ihr Zeug ins Auto gepackt, ist weggefahren, zurück über den holprigen Pfad, es war auf einmal still im Wald. Eine plötzliche Stille, die nächsten Nachbarn wohnen eine halbe Stunde entfernt, und ich kenne die Leute nicht. Ich liege im Bett und starre aus einem großen Fenster im Schrägdach. Von hier aus kann ich den Sternenhimmel sehen, Glasscherben, die über einem schwarzen Bogen Papier verstreut sind. Die Wölfe heulen auf der Wolfsinsel. Bei Ebbe kommen sie herübergeschwommen, hat Sierra gesagt.
*
Am frühen Morgen klopft es an meine Tür. Suz ist eine lebhafte kleine Frau mit offenem und munterem Gesicht, sie ist ununterbrochen in Bewegung, als ob sie viel zu viel Energie im Leib hätte und nicht für eine Sekunde stillstehen könnte. Sie führt mich über das Grundstück: Außer Sierras Haus und dem Küchenhaus gibt es viele Jurten – runde Leinenzelte nach mongolischem Vorbild auf Holzplattformen –, ein Saunahaus, die Privathütte der Besitzer mit Freiluftbadewanne und Dusche auf der Veranda, das Bürohaus, dann noch den Geräteschuppen, das Waschhaus, das Bootshaus und das Rotkehlchennest; eine kreisrunde Holzhütte, die allein oben auf einem hohen Felsen thront. Meine wichtigste Aufgabe besteht darin, in regelmäßigen Abständen in sämtlichen Häusern einzuheizen, um Feuchtigkeit und Fäule zu verhindern. Zum Dank darf ich gratis hier wohnen. Das meiste ist den Winter über geschlossen, das Waschhaus zum Beispiel funktioniert gerade nicht. Ich muss meine schmutzige Wäsche in eine Wäscherei tragen, die gleich neben Sophie’s liegen soll. Eine Stunde hin, eine Stunde zurück. Ich beschließe sofort, keine Bettwäsche zu benutzen, sondern im Schlafsack zu schlafen. Im Hahn im Küchenhaus, in der Badewanne und an der Dusche vor einem der Häuser gibt es Warmwasser on demand. Ein Propanbrenner heizt es auf, wenn man den Heißwasserhahn aufdreht. Alles hier wird mit Gas betrieben: Heißwasser, Herd, Kühlschrank, sogar die Gaslampen an der Wand des Küchenhauses. Ich bin zu klein, um sie zu erreichen, und muss auf die Küchenbank klettern, um das Rädchen umzudrehen und ein brennendes Streichholz daranzuhalten: die Gasflamme fängt mit einem leisen Zischen an zu brennen. Eine meiner Pflichten ist es auch, den Druck in dem riesigen Propantank zu überprüfen, der ein ganzes Stück von den Häusern entfernt liegt, ganz unten am Ufer.
Es regnet hier fast den ganzen Winter lang, sagt Suz, da wird alles feucht. Du kannst dir aus allen Holzschuppen auf dem Gelände Holz holen, mit Zeitungspapier und Anzündholz Feuer machen. Das Anzündholz musst du zerkleinern, du brauchst dünne Späne. Für das Zeitungspapier bist du übrigens selbst verantwortlich, du kannst im Postamt welches holen, wenn es dir ausgeht. Ansonsten gibt es vor allem Gartenarbeit, Harken, jetzt im Herbst, am Strand angeschwemmtes Seegras sammeln und die Beete damit bedecken. Nach Weihnachten musst du auch jäten und so was, und die Beete fürs Frühjahr fertig machen. Vor dem Werkzeugschuppen steht eine Schubkarre, du brauchst also nicht alles einzeln zu tragen. Es ist ja viel Arbeit für dich, jetzt, wo Sierra nicht da ist, aber du darfst dich natürlich nicht verpflichtet fühlen, mehr zu arbeiten, als ihr abgemacht hattet, das kann so leicht passieren, und du bist ja allein und vielleicht nicht daran gewöhnt … Sie blickt mich fragend an, ich nicke, sage: Ja, das ist eine ganze Menge, aber das schaffe ich schon, meine Familie hat eine Hütte, in Norwegen ist das üblich. Mach dir also keine Sorgen um mich, das geht schon.
Ich sehe, dass sie aufatmet, erleichtert ist, sie lächelt. Und es stimmt ja auch, dass wir eine Hütte haben und ich ans Hüttenleben gewöhnt bin, und warum soll ich Suz Angst einjagen, indem ich erzähle, dass ich dort nur selten allein gewesen bin, und wenn doch, dann immer nur für wenige Tage.
Naja, im Küchenhaus und im Bürohaus gibt es Telefon, sagt sie, ruf unbedingt an, wenn etwas sein sollte. Von den Anschlüssen hier sind nur Ortsgespräche möglich, aber mehr brauchst du ja auch nicht.
Nicht die Familie zu Hause in Norwegen anrufen, mit anderen Worten.
Als Suz sich zum Aufbruch bereit macht, sagt sie: In der Speisekammer sind noch ein paar Lebensmittel, greif einfach zu, und wenn du im Garten etwas Essbares findest, hol es dir. Abgesehen von dem Grünkohl, der den Winter überleben kann, ist das meiste jetzt abgeerntet, aber ich glaube, in einem der untersten Beete stehen noch ein bisschen Spinat und Regenbogenmangold. Pflück das aber jetzt gleich, ehe es zu spät ist. Und ja, wenn du im Garten arbeitest, kannst du gern da hinpissen, also in der Nähe im Gebüsch, der Menschengeruch schreckt nämlich die Wölfe ab. Sie kommen manchmal ziemlich dicht heran, und nur, damit du es weißt: Sie benutzen denselben Weg wie wir, sie lieben diesen Weg, also krieg keinen Schreck, wenn du sie oder ihre Spuren entdeckst.
Sie zieht ihre Mütze über, dicke Wolle, zeigt mir die Geräte im Schuppen – vor allem werde ich jetzt einen Laubrechen brauchen und die Schubkarre –, dann macht sie sich auf den Heimweg, über die Felsen, durch den Wald.
Ein ganzer Tag vergeht beim Säubern des Spinats aus dem Garten. Die meisten Pflanzen sind verwelkt und tot, aber es gibt doch hier und da noch einige grüne Blätter, die ich pflücke und unter dem Hahn hinter dem Küchenhaus abspüle. Die toten Pflanzen landen auf dem Kompost. Als ich endlich fertig bin, sind mein Rücken und meine Arme steif von der mühsamen Arbeit, aber die Belohnung sind drei große Tüten Spinat, die ich in das Gefrierfach im Propankühlschrank lege. In dem kleinen Gefrierfach gibt es nicht viel Platz, aber bei einer Wanderung zum Anleger, wo Sophie’s Café, der Lebensmittelladen und die Gemeindehalle liegen, kaufe ich tiefgefrorenen Fisch, den ich eine Weile aufbewahren kann. Thunfisch und Lachs schmecken wie hier im Meer gefangen. Nach und nach fülle ich zwei Fächer im Küchenschrank mit Fisch, damit ich nicht ganz so oft den stundenlangen Gang zum Laden antreten und die Waren im Rucksack nach Hause schleppen muss. Ich sitze oft in der Wärme der Sonne, die schon bald zum seltenen Anblick wird, auf der Bank vor dem Küchenhaus und trinke Tee.
Ich hacke Holz, bis meine Arme schmerzen, und ich zerspalte die geraden Zedernholzscheite in dünne lange Späne: Zündholz.
*
Ich gehe zu Sophie’s, folge dem kurvenreichen Weg über die Felsen durch den Wald, spaziere über die schlecht instand gehaltene Asphaltstraße, die vom Anleger ins Inselinnere führt. Einige Autos jagen vorbei, ich strecke den Daumen aus. Mitgenommen werde ich erst, als es angefangen hat zu regnen; eine junge Mutter, wir müssen den Sitz von Spielzeug und Windelpackungen befreien. Sie setzt mich vor dem Café ab, bei der niedrigen Mauer. Ich laufe hinein, die schweren Tropfen prasseln auf den Boden.
Als ich einen Latte bestelle, blickt mich die hochgewachsene Frau mit den knielangen blonden Dreadlocks nachsichtig an.
Die Kaffeemaschine hat ihren Geist aufgegeben, sagt sie, schicken Kaffee hab ich nicht, nur normalen schwarzen.
Ich frage, ob sie mir wohl ein bisschen Milch warm machen könnte, auf dem Herd zum Beispiel. Sie hebt eine Augenbraue, schnaubt und rückt ihre Strickmütze in den Rastafarben gerade, schenkt mir einen Kaffee ein.
Wenn du Kaffee willst, dann ist das der, den ich habe. Das macht anderthalb Dollar.
Ich werde rot und gebe ihr zwei Dollar Trinkgeld.
Ich setze mich an einen kleinen Tisch in der Ecke, ziehe Notizblock und Kugelschreiber hervor. Ich arbeite gerade an mehreren Projekten, eins ist ein Nachfolger für meinen ersten Roman. Am Personaltisch sitzt eine ganze Clique, sie lachen und reden, ich schaue ab und zu auf, neugierig, traue mich aber nicht hinüber.
Irgendwann stehe ich auf und gehe hinaus in den Regen. Die dünne Regenjacke, die in einem Supermarkt zu Hause in Østfold einen Hunderter gekostet hat, ist bald triefnass. Ich komme vollkommen durchnässt zu den leeren Gebäuden nach Hause und heize den Holzofen in Sierras Haus ein. Die Borkenkäfer, die in den Wänden hausen, erwachen in der Wärme zum Leben und kriechen über den Boden. Vor den Fenstern, in dem nassen grauen Garten, fällt der Regen, unaufhaltsam, in geschwungenen Kristallfäden.
*
Ich hatte nicht gewusst, dass ich hier draußen allein sein würde. Vor meiner Abreise aus Norwegen hatte ich noch mit Deer geskypt, einem der freiwilligen Hausmeister hier draußen; er ist ein Kumpel von Jay, meinem kanadischen Exfreund. Deer hatte angeboten, mir im Laufe des Winters Autofahren beizubringen. Er habe einen Wagen mit manueller Gangschaltung, eine Seltenheit dort drüben. Ich könnte auch Segeln lernen, sagte er und erzählte mir von Sierra. Er glaube, wir würden uns sehr gut verstehen, und vielleicht würden auch noch andere dazukommen, jedenfalls noch eine Frau, eine, mit der er gerade Dates hatte. Wir können auf dem Grundstück Feste feiern, segeln gehen und Kajaktouren veranstalten. Ich wollte schon lange Meereskajak paddeln lernen, es wäre perfekt gewesen. Doch am Tag vor meinem Eintreffen war Deer mit den Besitzern in Streit geraten, hatte seine Siebensachen gepackt und war weg. Und Sierra sagte, sie werde mindestens für zwei Monate fortbleiben.
Ich gehe zum Strand hinunter, die Wellen spülen über grauweiße Steine und Austernschalen, und wandere zum Schuppen mit dem Zubehör für die auf dem Rasen aufeinandergestapelten Kajaks. Einer hat Risse, einem anderen fehlt das Paddel. Ich kann kein einziges Paddel entdecken und auch keine Sicherheitsausrüstung. Ich kann also nicht allein lospaddeln. Segeln werde ich auch nicht lernen oder Auto fahren, ich werde nicht in einem Meereskajak durch die blaugrünen Wellen gleiten, wie ich es mir in meinem Zimmer in Norwegen so oft erträumt habe. Ich setze mich auf einen Felsbrocken, es fängt an zu regnen, ganz leicht nur, wie ein Flimmern. Ich bin ganz allein, ich kenne hier niemanden.
Was mache ich hier, frage ich mich und presse meine Hände auf die Oberschenkel, um nicht so zu zittern. Was soll das denn eigentlich? Allein hier wohnen, den ganzen Winter, ohne auch nur zu Hause anrufen zu können, dabei für alle möglichen praktischen Dinge verantwortlich zu sein, von denen ich kaum eine Ahnung habe, wo ich doch schon mit zehn Jahren meistens mit einem Buch vor der Nase dagesessen habe. Mein Rückflugticket gilt erst in sechs Monaten, und ich werde total allein sein, im tiefen Wald. Wie soll ich das schaffen? Ich atme jetzt schnell und flach, und ich beuge mich vor, den Kopf zwischen den Knien, versuche, meinen Atem zu beruhigen und mit dem Bauch zu atmen. Die Angst packt mich. Es war schon lange nicht mehr so schlimm.
*
Der freundliche, aber feste Blick des Oberarztes, als er sagt: Sie schaffen das leider nicht ohne Medikamente, aber so ein Typ sind Sie eben, ein verletzlicher Menschentyp. Sie werden Probleme damit haben, mit großen Belastungen fertig zu werden, gefühlsmäßigen Schwierigkeiten, die das hier wieder auslösen, wenn Sie nicht auf Dauer Antidepressiva einnehmen. Wir sprechen hier von einer klinischen Depression, das muss man ernst nehmen. Es bedeutet, dass Ihr Gehirn selbst nicht genug von diesen Stoffen produzieren kann. Sie haben eine genetische Veranlagung, und dann wurde dieses Leiden eben von den Schwierigkeiten ausgelöst, die Sie durchmachen mussten. Deshalb müssen Sie weiterhin diese Medikamente nehmen, um einigermaßen normal zu funktionieren, denn Ihnen fehlen diese Stoffe, und Ihr Körper stellt davon selbst leider nicht genug her.
Was ist mit Tolvon, fragte ich ihn, das kommt noch dazu, das brauche ich doch, um zu schlafen.
Ja, das werden wir sehen. Wir haben doch mehrere Monate hier im Krankenhaus gebraucht, nur, um Sie so weit zu bringen, dass Sie nachts schlafen können, so weit war es gekommen. Sie haben ja so gut wie nichts gegessen. Sie müssen auf diese Verletzlichkeit Rücksicht nehmen, feste Routinen sind das Beste für Sie, und es ist wichtig, dass Sie sich selbst beschützen, regelmäßig schlafen, sich keinen großen Belastungen aussetzen, oder Stress, Enttäuschungen, Sie wissen schon … Vorhersagbarkeit ist wichtig für Sie, für Menschen mit Ihrem Leiden. Routine. Ein beschütztes Leben. Das müssen Sie akzeptieren, dass Ihr Leiden gewisse Begrenzungen mit sich bringt, und dass Sie sich entsprechend verhalten müssen, um nicht wieder krank zu werden.
*
Sechs Monate in der Psychiatrie, wegen Depression und Angst, und es war das zweite Mal. Ich musste mein Studium unterbrechen, mich als Co-Redakteurin von Bøygen zurückziehen, obwohl wir gerade im Endspurt zu einer neuen Nummer waren. Ich hatte das Gefühl, die anderen im Stich zu lassen, fand es peinlich, die Wahrheit zu sagen. Also erwähnte ich vage ein gesundheitliches Problem, weiß aber nicht mehr, was. Eine Art Schuldgefühl kam also dazu. Ich fühlte mich schuldig, weil ich so verletzlich war, mit dem Leben nicht fertigwurde. Und ich schämte mich, weil ich nicht den Mut hatte, ehrlich zu sagen, was Sache war.
Das ist jetzt mehrere Jahre her, mehrere Jahre, seit ich die Tabletten im Klo weggespült habe, in Spanien in einem Meditationslager. Kurz nach meiner Entlassung hatte ich die buddhistische Meditation kennengelernt. Die gab mir neue Perspektiven, einen anderen Umgang mit meinen komplizierten Gedanken und Gefühlen. Aber ich hatte trotzdem eine Sterbensangst davor, die Medikamente abzusetzen. Die Stimme des Oberarztes war wie ein Echo in meinem Kopf: der Glaube, dass ich nicht ohne zurechtkommen, dass ich wieder erkranken würde. Beim Kurs meditierten wir jeden Tag stundenlang. Mir war nicht klar gewesen, dass man diese Art von Medikament nicht mit intensiver Konzentration zusammenbringen darf; ich spürte, dass mit mir etwas passierte, dass ich anfing, abzuheben, die Kontrolle zu verlieren, ein chemisches Brausen im Blut. Also kippte ich die Pillendose noch am selben Tag aus, sah, wie die Pillen im Abfluss verschwanden, weiße, rosa, blaue. Plötzlich hatte ich etwas losgelassen, ließ etwas tief in mir an die Oberfläche kommen und verschwinden, fing an, nachts zu schlafen, ohne deshalb Tabletten nehmen zu müssen. Seither war es noch oft schlimm, aber ich habe es immer geschafft, habe es durchgestanden, habe mich vorwärtsbewegt.
Und jetzt sitze ich hier und spüre sie wieder, die Angst, die mich festhält wie ein Schraubstock, das Gefühl der Leere, das Gefühl, dass mein Leben keinen Sinn hat. Das Meer ist grau, die grauen Steine, meine Kleider sind kalt und feucht. Aber ich will nicht, ich will nicht, dass es so ist. Ich stehe langsam auf, gehe zum Küchenhaus hoch und mache im Kamin Feuer.
*
Es ist still hier, ganz still. Ich gehe jeden Tag von einem Haus zum anderen und heize ein. Klettere den steilen Pfad am Felshang hoch, über einen gestürzten Baumstamm, bis zur obersten Jurte, die Blick auf das Meer hat. Sie hat ihren eigenen kleinen Holzschuppen mit eigenen Äxten, und ich hacke drauflos: Einige Male bleibt die Axt in einem Holzscheit stecken und ich brauche lange, um sie herauszuziehen, dann wieder treffe ich die Kante des Scheites und die Späne stieben nur so, und das Scheit kippt um und ich muss es wieder und wieder aufrichten. Im runden Leinenzelt gibt es ein Bett aus sonnengebleichtem Holz, mit weißer Bettwäsche und einem Schaffell, auf dem Boden liegen gewebte Teppiche, in der Nähe des Holzofens steht ein Tisch mit einem kleinen Propangaskocher, einer alten Konservendose mit Stiften und Streichholzschachteln. Mir gefällt es hier sehr. Ich ziehe ein wenig Zeitungspapier aus der Tasche und fange an, den Ofen vorzubereiten. Zeitungspapier, das äußerst sparsam verwendet werden muss, zwei Pappstreifen von einem Eierkarton, die langen Späne, die ich zurechtgehauen habe, einige dünne Stöckchen. Erst, als diese Garbe ordentlich brennt, lege ich Holzscheite nach, baue im Ofen ein kleines Feuer auf, es knistert und sprüht Funken. Ich sitze vor dem Ofen auf dem Teppich. An der Wand hängt ein Traumfänger mit langen Federn, und ich sitze da und schaue ihn an, denke nach und frage mich, was die Zeit hier wohl bringen wird.
*
Auf dem Weg zum Anleger und zum Laden begegne ich Deer. Er kommt mir auf dem Fahrrad entgegen, war im Postamt und hat seine letzten Briefe abgeholt, eigentlich hat er die Insel verlassen und wohnt jetzt auf einem Segelboot.
Ich tauge offenbar nicht zum Hausmeister, sagt er, aber es ist ja schön, dass du nach Neujahr dann Sierra als Gesellschaft hast, die ist verdammt in Ordnung. Ich fühle mich auf dem Meer am wohlsten, und dann habe ich eine neue Frau kennengelernt, auf einer der anderen Inseln.
Er lächelt, und ich lächele, ich mag Deer nämlich, er hat einen festen Blick, ist einer, der da sein würde, wenn man jemanden braucht.
Aber ehrlich gesagt, meint er nun, musst du ein bisschen vorsichtig sein, musst auf dich aufpassen. Alle hier sind in Ordnung, aber von Phil darfst du dich nicht mitnehmen lassen, der hat arge psychische Probleme und weigert sich, seine Medikamente zu nehmen, das wissen alle. Versuch, ihm aus dem Weg zu gehen, wenn er versucht, sich mit dir bekannt zu machen oder so, er ist wirklich ein seltsamer Typ, man weiß nicht, auf was für Gedanken er kommen kann.
Er beschreibt mir Phils Pick-up, damit ich ihn erkenne und dann nicht den Daumen ausstrecke.
Okay?, fragt er.
Ich nicke, und er klopft mir auf die Schulter.
Ist gut, dann wünsche ich dir alles Gute da draußen im Wald. Es ist phantastisch da, wirklich etwas ganz Besonderes, und die tägliche Arbeit, Holzhacken und im Garten Ordnung schaffen, das ist doch fast meditativ, ein bisschen Zen, du weißt schon. Findest du nicht?
Später denke ich daran, als ich Holz hacke. Die Sonne lugt hinter den Wolken hervor und lässt alles funkeln, und ich folge Deers Rat: sehe vor mir, wie ich Holz hacke, wie die Axt durch das Holzscheit gleitet, und ich ziele nicht auf die Spitze, wo der Hieb zuerst trifft, ich ziele auf den Boden, wo die Axt enden wird, wenn ich das Holzscheit spalte. Ich schließe die Augen, um es mir vorzustellen, öffne sie kurz vorm Hacken – und das Holz singt, als es zerspringt.
*
Ich koche im Küchenhaus. Bohnen, Reis und Fisch. Trage alles hinüber zu Sierras Haus, sitze auf dem Sofa, esse und starre dabei hinaus in die Dunkelheit. Mein eigener Widerschein in den Fenstern. Draußen könnte jemand stehen, und ich würde ihn nicht sehen. Ich denke daran, was Deer über Phil gesagt hat. Die Tür zu Sierras Haus kann nicht abgeschlossen werden. Ich gehe in den Schuppen und suche mir die schärfste Axt. Lehne sie an die Bettkante, als ich schlafen gehe. Das Wetter schlägt um und wird kalt, am Morgen sind Eisblumen an den Fensterscheiben.
*
Das Telefon ist tot. Irgendein Tier hat die Leitung durchgebissen. Jemand von den Sommeraushilfen kommt mir zu Hilfe, folgt der Leitung durch den Wald. Dennoch dauert es Tage, ehe ich wieder jemanden anrufen kann, wenn etwas sein sollte.
*
Nach Sonnenuntergang, der jetzt bereits am frühen Nachmittag einsetzt, wandere ich über das Grundstück. Das Licht der Stirnlampe spiegelt sich in den leeren Fenstern, ich gehe in ein Haus nach dem anderen und heize noch mal ein. Eine Art Angespanntheit, die Schwere der Dunkelheit, die mich umgibt, nicht alle Häuser haben Lampen, die ich anzünden könnte, und ich knie vor den erkalteten Öfen und arbeite im blauweißen Schein der Lampe, die nur das beleuchtet, was ich ansehe, während die Nacht sich um mich herum verdichtet. Ein plötzliches Geräusch, und ich fahre zusammen, aber es ist nur Hanuman, der Kater. Er gehört den Besitzern, sie lassen ihn hier überwintern. Es gehört ebenfalls zu meinen Pflichten als Hausmeisterin, ihn zu füttern. Mein Herz hämmert, und ich fasse mir an die Brust und lache kleinlaut: Du hast mir ja vielleicht einen Schrecken eingejagt, Hanu. Er starrt mich skeptisch an, während ich mich mit dem Feuer im Ofen abmühe.
*
Ich gehe oft ins Sophie’s zum Schreiben, und hier treffe ich Jerrett, der nicht weit vom Anleger entfernt wohnt. Er lädt mich zum Salsakurs ein, den ab der kommenden Woche eine Mexikanerin hier auf der Insel geben wird. Sein Blick hinter den runden Brillengläsern ist freundlich und klar, und obwohl ich dankend ablehne, bleiben wir Freunde. Eines Tages macht er für uns beide in seiner Küche Mittagessen, serviert Arme Ritter mit dickem griechischem Joghurt, Brombeermarmelade, Schlagsahne, Ahornsirup und Speck. Er repariert Boote, bringt alles Mögliche in Ordnung. Auf dem Hof liegen mehrere Boote und Kajaks, Fahrräder, Schrott, den er gekauft hat, um ihn zu reparieren. Das Haus wimmelt von Joghurtbechern und Marmeladengläsern, die gespült und sortiert sind, ganze Stapel davon, alle Schränke sind voll, denn Jerrett kann nichts wegwerfen, für den Fall, dass es noch einmal nützlich sein könnte. Im Kühlschrank hat er kiloweise Spirulina, ein Kumpel hat ihm das aus Hawaii mitgebracht. Es ist ein Pulver aus blaugrünen Algen, die dort im Meer leben. Damit kann man monatelang überleben, sagt er, wenn die Gesellschaft zusammenbricht, denn es enthält alle Nährstoffe, die man braucht, dann ist man nicht auf Versorgung von außen angewiesen. Deshalb hat er auch gern Reserveteile für alles, für alle Fälle, denn wer weiß, was passieren kann, und auf diese Weise ist er von niemandem abhängig.
Ich bin am Wochenende zu einem Potluck eingeladen, sagt er eines Tages zu mir, komm doch auch mit, da kommen ganz viele Leute und dann lernst du alle kennen, die hier wohnen.
Es wird mein erstes, aber nicht mein letztes Potluck auf der Insel, ein Festessen, zu dem alle etwas mitbringen, alles wird geteilt.
*
Nach Jerretts Potluck gehe ich zum ersten Mal im Dunkeln nach Hause. Eine Frau namens Lydia ist gerade in die kleine Hütte auf dem Nachbargrundstück eingezogen, und das Fest ist eigentlich ein Einzugsfest für sie. So lerne ich sie kennen. Sie trägt selbstgemachte Ohrringe mit Türkisen und Hahnenfedern, verwaschene schwarze Jeans und ein schwarzes Trägerhemd. Sie will mir ihre kleine Hütte zeigen, wir stapfen die wenigen Meter den Pfad von Jerretts Haus hoch. Als sie mir zeigt und erklärt, wie sie den Brunnen in Ordnung bringen musste, der bei ihrem Eintreffen verstopft war, sie musste hineinklettern und einen Eimer voll Schlamm nach dem anderen über ihren Kopf stemmen und oben ausleeren, sehe ich, dass sie unter den Armen nicht rasiert ist. Lydia lächelt, hebt die Arme zur Decke, leert einen unsichtbaren Eimer. Und dann habe ich das Moos vom Dach gekratzt, sagt sie, und hier drinnen gestrichen, die Wände.
Es ist jetzt dunkel, am Abend, nur eine Lampe im Raum, eine nackte Glühbirne ohne Schirm, aber später sehe ich die kühle Moosfarbe an den Wänden und die Spiralmuster, die sich in ihrer Kunst wiederholen, in den Darstellungen des sprechenden Raben, des Hundes, der unter der Erde in einer Art Gebärmutter begraben ist, und des Espenwäldchens in West Redonda, grau und gespenstisch, die bleiche Frau und das Kind schweben wie Schatten zwischen den Bäumen. Ich weiß noch nicht, dass sie bald meine Freundin sein wird, dass ich sie unendlich gernhaben werde, dass wir zwei Wochen lang das Café hüten werden, während Reggie auf Jamaika ist und heiratet. Ich weiß nicht, dass ich kurze Texte zu ihren Gemälden schreiben und nach dem Tanz im Lokal im oberen Bett schlafen werde, und dass ihr Hund Sundance, ein Schlittenhund vom Yukon, nachts auf mich springen wird, so dass Lydia und ich kichern wie kleine Mädchen, die freitags abends allein zu Hause sind.
Wir gehen zurück zu Jerretts Haus, das einen Steinwurf entfernt ist. Er hat eines der beiden Rehe zubereitet, die er vor ein paar Tagen hier überfahren hat. Er habe versucht, auszuweichen, sagt er, beide Male, obwohl er das Gewehr griffbereit auf der Ladefläche liegen hatte und er ihnen den Gnadenschuss hätte geben können. Er hat zu dem mürben Fleisch eine köstliche Soße gemacht, ich esse ein Stück vom Rehherz, es schmeckt gut. Ein Typ namens Carthy dreht mir eine Zigarette. Ich habe vor zehn Jahren aufgehört, aber ich nehme sie mit einem Schulterzucken und einem Lächeln, sicher, dass ich nicht wieder mit dem Rauchen anfangen werde. Es ist noch immer November und ich bin gerade erst auf der Insel eingetroffen.
Es ist ein feiner Abend, feine Menschen. Als ich nach Hause gehe, habe ich anfangs keine Angst, obwohl es dunkel ist, so dunkel, dass ich ohne Stirnlampe nicht die Hand vor Augen sehen kann. Die schweren Farnwedel bewegen sich sanft im Wind, sehen fremd aus. In dem scharfen Licht der Lampe schwenken die Blätter wie seltsame unterseeische Gewächse in der Meeresströmung.
Als ich den Parkplatz zwischen den Bäumen erreiche, wo Sierra ihren Pick-up abgestellt hatte, nachdem wir von der Fähre gekommen waren, sehe ich ein einsames gelbes Auge, das mich aus dem pechschwarzen Wald anstarrt. Es ist ein Wolf. Denn ich weiß, dass ein Hirschauge kühl und weiß ist, fast blau, wie ein Wintermond. Das Wolfsauge hat ein gelbes Schimmern, wie eine Ampel, eine Warnung zwischen Stehenbleiben und Gehen, man zögert, unsicher. Die geschmeidigen, fast lautlosen Bewegungen, als er näher kommt. Kein Zweig bricht, kein Blatt raschelt, aber seine Nähe verfolgt mich, als ich über den Weg gehe. Ich hebe einen Stock vom Boden auf, spüre, dass mein Herz schneller schlägt, zu Hause erwartet mich niemand, ich bin allein mit dem Wolf. Eine der Frauen, die vor mir hier waren, ist mitten in der Nacht einem Rudel aus zwölf Wölfen begegnet, sie hat kehrtgemacht und ist zurückgegangen, hat bei den Nachbarn übernachtet, aber zurück ist es jetzt genauso weit wie nach Hause, und Isegrim ist hinter mir. Es verschlägt mir fast den Atem, mein Herz hämmert mir bis in den Hals, meine Kehle schnürt sich zusammen und tut weh, die Panik bringt mich fast zum Stolpern. Dann bleibe ich abrupt stehen, stehe ganz still. Die plötzliche Ruhe, die ich verspüre, überrascht mich total. Ich fürchte mich nicht mehr. Ich kann den Wolf hinter mir fast spüren, er ist neugierig, ich fange an, mit ihm zu sprechen, so, wie Jay mich einmal gelehrt hat, mit den Bären zu sprechen, die zu nah an unser Lager herankamen. Ich komme mir konzentriert und stark vor, bemerke plötzlich alles um mich herum, jeden einzelnen Stein auf dem Weg, die gefrorenen Augen eines Eichhörnchens, das bewegungslos auf einem Ast sitzt und mich anstarrt, ich bin in diesem Augenblick lebendiger, als ich es ohne dieses stumme Zusammensein mit einem wilden Geschöpf jemals sein könnte, einem unberechenbaren Geschöpf, einem sehnigen und starken und schönen Geschöpf mit Zähnen und Klauen. Mein Herz schlägt und schlägt, aber ich höre das Geräusch nicht mehr, um mich wird alles still, ich höre nur den rauschenden Wind, die fast unmerklichen Wellenschläge an den Strand unten am Hang, und ich gehe mit leichten Schritten durch diese Stille, fast wie in einem Tanz, und ich lächele. Ich umklammere noch immer meinen Stock, aber von nun an habe ich nie mehr Angst davor, nachts auf dem Weg Tieren zu begegnen, Wolf, Bergpuma oder Bär. Das Einzige, wovor ich mich von diesem Moment an fürchte, sind Menschen.
*
Ich komme nach Hause und die Tür zu Sierras Haus steht sperrangelweit offen. Sie schlägt im Wind, und dahinter ist nur ein dunkles Loch. Hallo, rufe ich. Ist da jemand? Ich halte noch immer den Wolfsstock in der Hand, klammere mich daran, bis meine Fingerknöchel weiß werden. Viele wissen, dass ich allein hier wohne, eine einsame junge Frau, die Angst ist mit voller Wucht wieder da. Die Axt liegt oben, unter das Bett geschoben. Ich schaue in die Schränke und unter das Bett, schalte die Lampen ein.
Ich habe mir Sierras Haus ausgesucht, weil es eines der wenigen Gebäude hier mit Strom ist, es ist mit dem Aggregat verbunden, das neben der Werkstatt mitten auf dem Grundstück steht und brummt. Aber ich fühle mich hier einfach nicht wohl. Wie alle anderen Türen hier auf dem Grundstück lässt sich auch diese Tür nicht abschließen, doch schlimmer ist es noch, dass sie oft vom Wind aufgedrückt wird, mehrmals nach diesem Vorfall komme ich nach Hause und die Tür steht offen. Und die Borkenkäfer, die aus den Wänden kriechen, wenn ich im Ofen einheize, stören mich, vor allem, weil ich sie nicht töten will, ich lasse sie am Leben, ich fege sie vorsichtig zusammen und bringe sie nach draußen, hoffe, dass sie die Kälte vertragen können, aber ich fühle mich trotzdem schuldig. Und die Wärme ist nie von Dauer, das Erdgeschoss hat viele große Fenster, im Sommer hat man hier sicher eine phantastische Aussicht, aber jetzt im Winter wird die Wärme einfach hinausgesaugt.
In Frostnächten werde ich davon geweckt, dass ich friere, und ich muss zwei Daunendecken auf meinen Schlafsack legen. Aber hier gibt es Strom und elektrisches Licht; eine Lampe im Erdgeschoss und eine im ersten Stock, ich habe eine Leselampe und kann meinen Laptop einschalten. Manchmal, bei gutem Wetter, komme ich sogar ins Internet und kann über YouTube Musik hören. Das kommt nicht oft vor, aber wenn, dann bin ich so froh, dass ich tanze und singe, hier kann mich niemand sehen oder hören, es gibt nur mein eigenes Spiegelbild im Fenster und den dunklen Wald draußen. Im Sommer hätte ich hier Wasser, Wasser im Hahn und in der Dusche, sogar heißes, aber jetzt im Winter ist es abgesperrt. Ich muss in einer Badewanne unter freiem Himmel baden oder zum Küchenhaus gehen und den großen Kessel mit heißem Wasser füllen, ihn zu Sierras Haus hinüberschleppen, mir die Haare in einer Waschschüssel auf dem Boden waschen.
Ich bin bis zur Taille nackt, meine Haare triefen, die kleinen Borkenkäfer kriechen neben mir über den Boden, es ist einer der wenigen Abende, an denen ich Musik hören kann, und ich bin durch und durch glücklich, spüre die Wärme des Wassers, den Seifenschaum zwischen den Fingern, meine Haut leuchtet im flackernden Licht, und die Wassertropfen trommeln gegen den Rand der Schüssel, im Ofen knackt und knistert es, und ich summe leise vor mich hin, ich wohne in einem kleinen Haus mitten im schwarzen Wald, ich bin hier ganz allein, doch so kommt es mir nicht vor, und ich kann hinaus auf die Veranda gehen und den Mond und die Sterne ganz klar sehen, ich kann die eiskalte Luft einatmen, die nach Harz und dem herannahenden Schnee schmeckt, ich kann die Wölfe auf der anderen Seite der seichten Bucht heulen hören, die keckernden Eichhörnchen laufen über den Weg, schauen mich mit schräg gelegtem Kopf an, und die Adler schreien, der einsame Kranich balanciert auf einem Bein im Tümpel vor meinem Haus, grau gekleidet und steif wie ein alter Mann.
*
Als ich eines Morgens Sahne für meinen Kaffee holen will, kommt mir ein schmutzig grauer Wasserstrahl entgegen, als ich die Kühlschranktür öffne. Die kleine Signalflamme, die Gasflamme, die man durch ein Loch in der Schutzwand unten im Kühlschrank sehen kann, ist erloschen, Ich hole einen Schraubenzieher, schraube die Schutzwand ab, liege auf Knien auf den Steinplatten und versuche, das Gas wieder anzuzünden, es gibt ein Rädchen, das man drehen und festhalten muss, und einen Knopf, der die Flamme entzündet. Der ganze Spinat, den ich mit solcher Mühe gepflückt und gesäubert habe, ist aufgetaut, vieles davon ist nicht mehr zu retten, und das gilt auch für den gefrorenen Fisch. Tränen der Frustration treten mir in die Augenwinkel: Ich habe mir mit dem Spinat solche Mühe gegeben. Ich esse zum Frühstück, zu Mittag und zum Abendessen gebratenen Fisch und Spinat, die verdorbenen Fische bekommt der Kater. Ich rufe Suz an, die sagt, die Sache werde schon in Ordnung gebracht werden, und sie versuchen das auch, aber es gelingt ihnen nicht. Deshalb muss ich viel häufiger hin und her laufen, als ich geplant hatte; zum Laden, über den schönen kurvenreichen Weg am Ufer, durch die Wälder aus Zedern und Arbutus, über den verschlissenen Asphalt auf der Straße zwischen Fähre und Hafen, und am Ende die Abkürzung durch den Wald vorbei an Lydias Hütte, wo Sundance mich mit eifrigem Bellen empfängt. Wenn Lydia zu Hause ist, mache ich hier oft Halt, sitze im Schneidersitz auf dem Bett, während sie auf dem einen Stuhl bei dem winzigen Tisch voller Skizzen und Pinsel und Farbtuben sitzt. Ihre Bilder und Zeichnungen sind an den Wänden aufgestapelt, und in den Fenstern hängen Federn und getrocknete Kräuter und Schwänze von Füchsen und Waschbären, sowie ein Paar ausgelatschte mukluks, eine Art hoher Mokassins mit Perlenstickereien. Die Wände sind mit Spiralen und wogenden Mustern dekoriert, wie die Farne im Wald, fächerförmig, unter den winkenden Bäumen, und die Farben sind die Farben der Westküste, sagt Lydia, steingrau und moosgrün, die kühl schimmernden Blautöne des Wintermeeres.
*
Auf dem Weg vor Lydias Hütte finde ich eine riesige Landschnecke mit einem ungewöhnlich schönen schwarzbraunen Schneckenhaus. Die kannst du mitnehmen, sagt Lydia, und sie zum Austrocknen in die Sonne legen. Dann stirbt die Schnecke und du kannst sie aus dem Schneckenhaus holen. Ich nehme die Schnecke mit nach Hause, aber als sie fünf Minuten in der Sonne liegt, seufze ich und stehe auf. Hebe sie vorsichtig hoch und setze sie auf den weichen, feuchten Waldboden. Verzeihung, flüstere ich, ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Du kannst dein Haus behalten. Das kleine Geschöpf lugt vorsichtig heraus, schwenkt die klebrigen Fühlhörner und gleitet mit seinem prachtvollen Haus langsam vorwärts.
*
Seit Wochen gehe ich nun schon zum Schreiben in Reggies Café, sitze allein an einem kleinen Tisch. Die meisten Gesichter kenne ich inzwischen, wir nicken einander zu und lächeln, aber mehr passiert nicht. Ich traue mich noch immer nicht, jemanden anzusprechen. Ich habe mir die Website mit den Lokalnachrichten angesehen, weiß, dass um sechs im Schildkrötenhaus Zen-Meditation ansteht. Ich brauche ungefähr eine Dreiviertelstunde bis dahin, deshalb stehe ich am nächsten Morgen um fünf auf, ziehe mich ganz schnell an und schalte die Stirnlampe ein, der Wald ist schwarz wie Teer und still. Nach einer knappen halben Stunde habe ich die Asphaltstraße erreicht, gehe weiter am Haus der Posthalterin und an der Feuerwache vorbei, einer großen Scheune, die seit dem Weihnachtsfest des Vorjahres noch immer mit einer Girlande aus knallbunten Glühbirnen dekoriert ist. Als ich die Einfahrt erreicht habe und den Weg neben dem Schild mit dem Bild der Schildkröte hochgehe, zeigt der Himmel schon graue Streifen. Ein Reh steht wie erstarrt neben dem Weg und starrt mich an, seine Augen leuchten weiß wie Reflexplättchen. Ich bleibe stehen, gehe erst einmal nicht weiter, wir sehen einander an und mein Atem wird ruhiger, langsamer. Ich gehe vorbei am Garten, der mit Maschendraht eingezäunt ist, an dem baufälligen Werkzeugschuppen mit den undichten Brettern, dem Plumpsklo. Am Ende des Weges sieht das Haus leer aus, hinter den Fenstern brennt kein Licht. Als ich an die Tür klopfe, antwortet niemand. Ich gehe um das Haus herum und schaue durch die Fenster, drinnen ist kein Mensch zu sehen. Im Wohnzimmer liegen die Meditationskissen auf dem Boden bereit, es gibt einen kleinen Altar mit Buddhastatuen und einem wunderschönen Seiden-Thangkaan der Wand, aber nirgendwo ist auch nur ein Mensch zu sehen. Und es kommt auch sonst niemand zum Meditieren, obwohl es nun schon nach sechs ist. Ich gehe über den Weg zur Straße hinunter. Ich kann kehrtmachen und nach Hause gehen oder ungefähr eine Viertelstunde weiterwandern, zu Sophie’s. Mein Magen knurrt, und ich weiß, dass Reggie immer in aller Herrgottsfrühe aufsteht, um alles bereitzumachen, warum also nicht? Ich schlendere die Straße entlang, es ist zu früh, um es bei den Autos von der Fähre per Autostopp zu versuchen, die erste kommt erst gegen acht.
Reggie macht auf. Sie hat einen fetten Joint in der einen Hand. Himmel, du bist das, sagt sie überrascht. Du bist heute aber früh dran, du weißt doch, dass ich noch nicht geöffnet habe? Ich erkläre die Situation. Sie zieht an ihrem Joint und lacht heiser, sagt: Ihr Europäer, vielleicht solltest du endlich mal den Unterschied zwischen a. m. und p. m. lernen, meditiert wird abends! Aber komm rein, dann kriegst du einen Kaffee.
Dann sitzen wir lange am Personaltisch und reden, gleich hinter dem rotglühenden Ofen. Reggie heizt ein, bis jamaikanische Temperaturen herrschen, sie trägt eine dicke Wolljacke, während die Gäste schwitzen und sich eine Kleidungsschicht nach der anderen abpellen. Es liegt nahe, sie zu fragen, ob sie irgendwelche Hilfe braucht, immerhin bin ich gekommen, während sie alles für den Tag vorbereitet. Sie sagt, es wäre nett, wenn du den Boden fegen könntest, also tue ich das, und danach biete ich an, das Klo zu säubern, mit Chlor. Sie starrt mich einen Moment lang misstrauisch an, als könnte sie nicht fassen, dass jemand freiwillig eine solche Aufgabe auf sich nimmt, dann grinst sie zufrieden. Holt die kleine Mühle, in der sie das Ganja in kleine Stücke mahlt, kippt sie auf ein riesiges Blättchen und verschwindet in der Küche, um Blaubeermuffins zu backen. Danach essen wir frisch gebackene Muffins, ich gehe hinaus und hänge das Schild auf, als das Café um neun Uhr öffnet, bleibe auch noch zum Mittagessen, es kommen noch andere Gäste und setzen sich an den Personaltisch, es wird richtig lebhaft. Reggie lacht ihr ansteckendes Lachen, sie strahlt eine gewisse Autorität aus, erinnert an eine Königin, die Hof hält, sie gestikuliert, hat den Kopf stolz erhoben, sie geht auf die fünfzig zu und hat jahrelang unter sengender Sonne draußen im Busch gelebt, aber ihre glatte Haut weist nicht eine einzige Runzel auf. Der alte Plattenspieler läuft im Hintergrund, Reggae, Bob Marley und Peter Tosh, Reggies Lieblinge.
Danach komme ich häufiger morgens früh ins Café. Stehe um fünf auf, ziehe mich an, nehme die Stirnlampe und gehe durch den pechschwarzen Wald, frühstücke zusammen mit Reggie, und nach und nach bringt sie mir bei, die Kaffeemaschine zu bedienen, Muffins und Kuchen und Walnussbrownies mit einer dicken Schokoladenschicht zu backen, und sogar, den Propangasbehälter auszuwechseln, der den Herd antreibt. Ich fege den Boden und mache den Abwasch in dem riesigen Stahlbecken in der Küche, das heiße Wasser reicht meistens bis in den späteren Vormittag hinein. Ich darf in Kanada nicht arbeiten, und Reggie kann es sich nicht leisten, jemanden einzustellen, das ist also perfekt: ich helfe aus und im Gegenzug lerne ich, wie man so ein Café betreibt, und ich bekomme eine Tasse Kaffee, ein Stück Kuchen oder einen Hamburger, ich habe Gesellschaft, lerne die Stammgäste kennen, aber vor allem eben Reggie, und während der Bush Pilot,





























