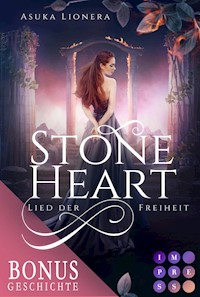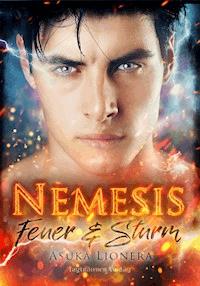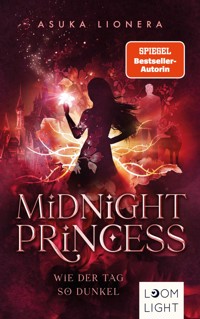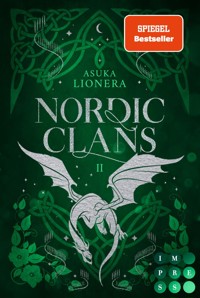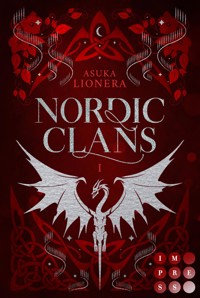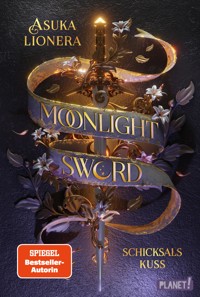5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Carlsen
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
»Sie haben mich gesehen. Sie wissen, was ich bin.« Es gibt Wesen, die das Blut beider Völker in sich tragen. Das der Menschen und das der Elfen. Sie leben im Verborgenen. Genauso wie jene Menschen, die durch den Fluch der Götter gezwungen sind, sich Nacht für Nacht in ein Tier zu wandeln … Fye ist eine Halbelfe. Von den Elfen verachtet und von den Menschen gefürchtet, gibt es für sie keine Heimat – bis sie enttarnt und gefangen genommen wird. Plötzlich befindet sie sich inmitten einer uralten Fehde beider Völker und ihr Herz muss eine Entscheidung treffen: Vertraut sie dem Prinzen mit den goldenen Augen oder dem strahlenden Ritter? //Dies ist der zweite Band der atmosphärisch-romantischen Gestaltwandler-Fantasy von Erfolgsautorin Asuka Lionera. Alle Bände der Buchserie bei Impress: -- Divinitas 1: Falkenmädchen (inkl. Bonusgeschichte) -- Divinitas 2: Wolfsprinz -- Divinitas 3: Löwentochter -- »Divinitas«-Sammelband der königlichen Gestaltwandler-Fantasy//
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impress
Die Macht der Gefühle
Impress ist ein Imprint des Carlsen Verlags und publiziert romantische und fantastische Romane für junge Erwachsene.
Wer nach Geschichten zum Mitverlieben in den beliebten Genres Romantasy, Coming-of-Age oder New Adult Romance sucht, ist bei uns genau richtig. Mit viel Gefühl, bittersüßer Stimmung und starken Heldinnen entführen wir unsere Leser*innen in die grenzenlosen Weiten fesselnder Buchwelten.
Tauch ab und lass die Realität weit hinter dir.
Jetzt anmelden!
Jetzt Fan werden!
Asuka Lionera
Wolfsprinz (Divinitas 2)
Es gibt Wesen, die das Blut beider Völker ins sich tragen. Das der Menschen und das der Elfen. Sie leben im Verborgenen. Genauso wie jene Menschen, die durch den Fluch der Götter gezwungen sind, sich Nacht für Nacht in ein Tier zu wandeln …Fye ist eine Halbelfe. Von den Elfen verachtet und von den Menschen gefürchtet, gibt es für sie keine Heimat – bis sie enttarnt und gefangen genommen wird. Plötzlich befindet sie sich inmitten einer uralten Fehde beider Völker und ihr Herz muss eine Entscheidung treffen: Vertraut sie dem Prinzen mit den goldenen Augen oder dem strahlenden Ritter?
Wohin soll es gehen?
Buch lesen
Vita
Das könnte dir auch gefallen
© rini
Asuka Lionera wurde 1987 in einer thüringischen Kleinstadt geboren und begann als Jugendliche nicht nur Fan-Fiction zu ihren Lieblingsserien zu schreiben, sondern entwickelte auch kleine RPG-Spiele für den PC. Ihre Leidenschaft machte sie nach ein paar Umwegen zu ihrem Beruf und ist heute eine erfolgreiche Autorin, die mit ihrem Mann und ihren vierbeinigen Kindern in einem kleinen Dorf in Hessen wohnt, das mehr Kühe als Einwohner hat.
Kapitel 1
Fye
Ich bin erledigt.
Zu meinen Füßen liegt die kümmerliche Ernte dieses Jahres: Kartoffeln, die nicht einmal halb so groß sind wie meine Faust, und verschrumpelte Rüben, die mich für keinen ganzen Monat satt machen werden.
Der verregnete Frühling, der darauffolgende ungewöhnlich heiße Sommer und die daraus resultierende Hitze haben ihren Tribut gefordert.
Deprimiert lasse ich den Blick über das Feld vor mir gleiten und wische mir den Schweiß von der Stirn. Die Luft ist derart drückend, dass mir das Atmen schwerfällt.
Alles war umsonst. Die ganzen Tage, die ich in der prallen Sonne damit zugebracht habe, die harte, rissige Erde umzugraben. Das letzte Wasser, das ich mir vom Munde abgespart habe, um die zarten Pflänzchen zu gießen, die es irgendwie doch schafften, sich einen Weg an die Oberfläche zu bahnen, nur um kurz darauf in der unbarmherzigen Frühsommersonne zu verbrennen.
Ich kaue auf meiner Unterlippe, während ich zurück zu meiner Hütte schlurfe. Selbst der kleine Bach, der gewöhnlich munter neben meinem Zuhause entlangplätscherte, ist zu einem traurigen Rinnsal verkommen. Zu wenig Wasser, um meine Felder zu bestellen, die mich eigentlich über den Winter hätten bringen sollen. Sogar zu wenig, um mich mit ausreichend Flüssigkeit zu versorgen.
Aber ich darf jetzt nicht aufgeben! Noch gibt es eine Möglichkeit, mich für die kommenden Monate satt zu machen. Es ist Zeit, meine zweite Nahrungsquelle zu überprüfen.
In der Hütte stecke ich schnell die vorwitzigen Strähnen meines langen braunen Haares zurück, die sich aus dem Zopf gelöst haben, und schnappe mir den Weidenkorb samt Messer, ehe ich in den angrenzenden Wald eile, um meine Fallen zu überprüfen. Sogar hier scheint die Luft zu stehen und die kahlen Bäume spenden kaum Schatten.
Es dauert nicht lange, bis ich die erste Schlinge erreicht habe.
Nichts. Wie schon die ganze letzte Woche.
Das trockene Laub unter meinen Füßen raschelt laut, während ich von einer Schlinge zur nächsten gehe, nur um wieder enttäuscht zu werden.
Es ist zwar noch recht früh am Morgen, aber ich habe keine Hoffnung mehr, heute noch einen Hasen oder zumindest ein Eichhörnchen zu fangen. Schließlich habe ich schon die ganze letzte Zeit kein Glück. Es scheint, als hätten sich auch die Tiere vor dieser unnatürlichen Hitze zurückgezogen.
Beharrlich schiebe ich den Gedanken an die Konsequenzen beiseite, doch immer wieder schleichen sie sich zurück in meinen Kopf, setzen sich dort fest wie ein Geschwür. Da ich dieses Jahr keine Ernte haben werde und auch der Jagderfolg ausbleibt, gibt es nur noch einen Ausweg.
Trotz der schwülen Hitze fröstelt es mich, wenn ich nur daran denke, was mir bevorsteht, und ich reibe mir mit beiden Händen über die Arme, um die Gänsehaut zu vertreiben.
Ich will nicht ins Dorf gehen.
Aber ich weiß, dass ich es muss.
Ich sträube mich nicht dagegen, weil ich den Marsch von etwa einem halben Tag scheue. Auch nicht, weil mir bei den dort verlangten Preisen die Galle hochkommt.
Schlimmer als all das zusammen sind die dort lebenden Menschen.
Bis vor etwa einem halben Jahr ist alle paar Wochen ein fahrender Händler in den Wald gekommen. In sicherer Entfernung von meiner Hütte entfernt haben wir uns getroffen und ich habe ihm feines Wildfleisch oder Schmuck verkauft, den ich aus Rehgehörn oder Wildschweinhauern hergestellt habe. Außerdem hat er mir in der Vergangenheit meine Bestellungen aus dem Dorf geliefert – ein Vorgehen, das auch schon meine Ziehmutter so praktiziert hat. So kam ich jedes Mal um einen Besuch im Dorf herum. Der Händler war zuverlässig und diskret, aber bereits alt. Vielleicht kommt er deswegen nicht mehr.
Die Menschen dürfen nicht wissen, was ich bin. Sie dürfen nicht einmal ahnen, dass etwas wie ich so nah an ihrem Dorf lebt.
Diesmal bleibt mir jedoch keine andere Wahl. Ich sollte sofort aufbrechen, dann könnte ich bei Einbruch der Nacht zurück zu Hause sein. Trotzdem ertappe ich mich dabei, wie ich sinnlose Tätigkeiten verrichte oder den Staubkörnern dabei zuschaue, wie sie im Sonnenlicht tanzen. Alles, um den unausweichlichen Aufbruch hinauszuzögern.
Ungehalten fahre ich mir mit der Hand durchs Gesicht und ärgere mich über mich selbst.
Du kannst das, Fye. Du weißt genau, wie du dich verhalten musst. Niemand wird etwas bemerken.
Seit dem Tod meiner Ziehmutter Bryande war ich nur ein einziges Mal im Dorf. Seitdem lebe ich von meinen Feldern, den Lieferungen des Händlers und dem, was der Wald mir gibt. Es waren gute Jahre mit noch besseren Ernten und ich habe keinen Gedanken daran verschwendet, dass es einmal anders sein könnte, was sich nun rächt.
Ich könnte den Besuch im Dorf sicherlich noch ein paar Tage hinauszögern, aber früher oder später werde ich mich auf den Weg ins Dorf machen müssen. Lieber bringe ich es heute hinter mich, als dass ich mich noch weiter ängstige.
Außerdem wird es dann noch einige Tage dauern, bis die Ware geliefert wird, denn alles werde ich nicht auf einmal mitnehmen können. Und ich muss zunächst einen Lieferanten finden, der bereit ist, meine gekauften Waren mit seinem Karren mitten in den Wald zu fahren und dort abzuladen – ohne dabei dumme Fragen zu stellen. Das wird mich einiges kosten …
Nachdem ich ein paar Mal tief ein- und ausgeatmet habe, streife ich die von der Feldarbeit schmutzige Kleidung ab, schlüpfe in eine enge Hose und ziehe eine braune Leinentunika darüber, die mir fast bis zu den Knien reicht. Ich fixiere sie mit einem Gürtel um die Taille, an den ich den Lederbeutel voll klimpernder Münzen hänge. Als Letztes greife ich nach dem grünen Umhang, den ich vorn mit einer silbernen Schließe zusammenhalte.
Bevor ich meine Hütte verlasse, schlage ich trotz der drückenden Hitze die Kapuze über den Kopf, um meine Ohren zu verdecken, sodass sie niemand zu sehen bekommt.
Meine Ohren. Mein Makel. Das Zeichen meiner Herkunft.
Beim Hinausgehen fällt mein Blick auf den Holzstab, der neben der Tür lehnt. Meine Ziehmutter Bryande hat mich im grundlegenden Umgang mit dieser einfachen Waffe geschult, aber ich lasse ihn dennoch zurück. Wenn eine fremde junge Frau wie ich mit einer Waffe im Dorf auftaucht, wird das noch mehr Fragen aufwerfen oder Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Das muss ich unter allen Umständen vermeiden.
Außerdem habe ich noch andere Möglichkeiten, um mich im Ernstfall zu verteidigen. Die Elfen würden das, was ich als magische Kraft bezeichne, nur abfällig Küchenmagie nennen, aber ich komme damit zurecht. Grundlegende Angriffszauber helfen mir dabei, meinen Alltag zu bewältigen. So nutze ich einen schwachen Feuerzauber, um im Winter den Kamin zu entzünden.
Ich hatte noch nie ein herausragendes Talent für Magie, deshalb ging Bryande schnell dazu über, mich im Umgang mit Stöcken und Speeren zu schulen. Trotzdem kann ich auf sie verzichten, ohne mich wehrlos fühlen zu müssen.
Gern würde ich mir den dicken Umhang und die Kapuze ersparen, aber sie sind unumgänglich, wenn ich die Sicherheit meiner Lichtung verlasse. Denn egal, wie ich mein Haar frisiere – ob ich es offen lasse, flechte oder hochstecke –, immer lugen meine spitz zulaufenden Ohren hindurch.
Als ich aus der Hütte trete, schüttele ich alle Zweifel ab. In einigen Stunden werde ich schon wieder zurück sein und über meine Angst lachen können.
Ich lege die Hand um die silberne Schließe knapp unter meinem Kinn, atme tief durch und schlage einen schnellen Schritt in Richtung Dorf ein.
Kapitel 2
Fye
Ist es möglich zu erschwitzen?
Als ich am Nachmittag das Dorf erreiche, bin ich mir fast sicher, dass die Antwort auf diese Frage Ja lauten muss. Schweiß rinnt mir in Strömen den Nacken und Rücken hinunter und die Tunika klebt mir mittlerweile wie eine zweite Haut am Körper.
Trotz der erdrückenden Hitze habe ich nicht gewagt, Umhang und Kapuze abzunehmen, weil ich stets damit rechnen musste, Menschen auf meinem Weg zu begegnen. Doch niemand kreuzte ihn, nicht einmal ein Reh oder Hase. Es ist, als wäre jedwedes Leben vor dem schwülen Sommer geflohen.
Nun stehe ich am Waldrand und schaue hinab ins Tal. Das Dorf Thiras liegt wahrlich idyllisch – direkt an einem See und zu fast allen Seiten von steilen Klippen umringt. Aber der Schein trügt: Thiras ist ein Ort an der äußersten Grenze des Königreichs, vergessen von Herrschern, da es zu nah ans Gebiet der Elfen grenzt.
Vor meiner Geburt muss es schlimme Kriege zwischen Menschen und Elfen gegeben haben und Grenzgebiete wie dieses Dorf wurden dem Erdboden gleichgemacht. Daher ist es nicht verwunderlich, dass die Hütten, die die Straße aus festgetretener Erde säumen, klein und schäbig wirken. Wer konnte, ist von hier geflohen; trotz des idyllischen Fleckchens und der perfekten Bedingungen für Ackerbau wird Thiras früher oder später unbewohnt sein.
Ich denke lieber nicht darüber nach, was das für mich bedeuten wird.
Mit langsamen, menschengerechten Schritten trete ich zwischen den Bäumen hervor und folge der schmalen Straße hinab ins Dorf. Es fällt mir schwer, mein gewohnt schnelles Tempo zu drosseln, doch das würde mich sofort verraten.
Ich komme an vielen Feldern vorbei, auf denen gerade eine Handvoll älterer Menschen damit beschäftigt sind, die trockene Erde umzugraben. Sie würdigen mich keines zweiten Blickes. Ihre Gleichgültigkeit lässt mich aufatmen und der eisige Knoten in meinem Bauch lockert sich etwas.
Wenn diese Menschen wüssten, was gerade so nah an ihren Feldern vorbeiläuft, hätten sie ihren Sündenbock für die letzten Missernten gefunden.
Um diesen beunruhigenden Gedanken zu vertreiben, beschleunige ich meine Schritte etwas, bis ich die Felder hinter mir gelassen habe und in der Mitte des Dorfes angekommen bin. Die hiesigen Hütten sind rund um den See angeordnet. Ich hätte darauf gewettet, bei dieser Hitze einige Einwohner zu sehen, die sich im Wasser abkühlen, aber keine Menschenseele ist zu entdecken.
Stattdessen dringt von der Herberge ein lautes Stimmengewirr zu mir herüber und ich drehe neugierig den Kopf in diese Richtung. Die hohen, zwitschernden Stimmen von jungen Frauen übertönen sich gegenseitig. Diese Laute sind so fremd für mich, dass sie mir beinahe in den Ohren schmerzen. Kichernd drängen sie sich um die Fenster im Erdgeschoss und versuchen einen Blick ins Innere zu erhaschen, schubsen sich gegenseitig aus dem Weg, um den besten Platz zu ergattern. Ich würde zu gern wissen, was dort drin vor sich geht und die jungen Frauen außer Rand und Band geraten lässt.
Ich knirsche mit den Zähnen und schüttele den Kopf. Meine Neugierde wird mich eines Tages ins Grab bringen! Doch ich kann das sehnsüchtige Ziehen in meiner Brust kaum unterdrücken. In einem anderen Leben und gesegnet mit einer anderen Herkunft stünde ich vielleicht auch bei diesen Mädchen, könnte kichern und für einen Moment mein hartes Los hier mitten im Nirgendwo vergessen. Ich könnte unbeschwert sein, hätte Freundinnen und Träume für meine Zukunft.
Doch nichts davon habe ich. Und das wird sich niemals ändern.
Verstohlen reibe ich mir über den Brustkorb, um das dumpfe Ziehen darin zu dämpfen, und wende mich abrupt ab. Ich bin nicht hier, um in Schwermut zu verfallen!
Der Krämerladen, das Ziel meiner Reise, befindet sich am anderen Ende des Dorfes. Mit gesenktem Kopf, immer auf meine Füße schauend und darauf bedacht, nicht aufzufallen, eile ich weiter und verschwende keinen Gedanken mehr an die kreischende Mädchenschar.
Stumm bete ich darum, dass nicht auch der Besitzer des Krämerladens Teil dieser lärmenden Menge vor dem Gasthaus ist. Nichts wäre schlimmer für mich, als ihn dort zwischen all den Menschen suchen zu müssen.
Erleichtert atme ich auf, als ich endlich vor dem gemauerten Laden ankomme, auf dessen Hof Kisten und Stiegen mit verschiedenen Waren stehen. In einer Kiste entdecke ich einige verschrumpelte Äpfel, in einer anderen lagern Kartoffeln, die genauso kümmerlich aussehen wie die auf meinem Feld. Unzählige Fliegen umschwirren das Obst, das bereits einen stechend süßlich Geruch verströmt.
Mein Mut sinkt. Was mache ich nur, wenn auch der Krämer nicht die Waren hat, die ich dringend benötige, um den Winter zu überleben?
Während ich auf das spärliche Angebot vor mir blicke, greift die kalte Hand der Angst nach mir. Nachdem ich tief Luft geholt habe, überprüfe ich den Sitz meiner Kapuze.
Direkt neben dem Laden finde ich einen Mann, der vor einem großen Ochsengespann steht. Mit gesenktem Kopf trete ich zu ihm. »Was kosten Eure Dienste?«, frage ich ihn leise.
Er dreht den Kopf zu mir und mustert mich von oben bis unten, ehe er eine dunkle Flüssigkeit auf den Boden spuckt. »Ein Karren – drei Goldstücke.«
Das ist Wucher!, will ich am liebsten schreien, doch ich beiße mir schnell auf die Zunge. Ich darf nicht wählerisch sein, schließlich habe ich außer ihm keinen anderen Kutscher hier gesehen. Wer weiß, ob ich noch einen anderen finde, wenn ich seine Dienste jetzt ausschlage.
»Ich gebe Euch vier Goldstücke, wenn Ihr meine Waren schnellstmöglich zur Weggabelung nach Eisenfels bringt und keine Fragen stellt. Ich erwarte Euch bei Tagesanbruch in zwei Tagen.«
Um meinen Worten Nachdruck zu verleihen, öffne ich meinen Beutel und ziehe vier glänzende Münzen heraus, die ich in meiner Hand klimpern lasse.
Natürlich weiß er genauso gut wie ich, dass sein Preis von drei Goldstücken überzogen ist, und er hätte nicht damit gerechnet, dass ich ihn bezahlen würde, das sehe ich deutlich. Die blanke Gier lodert in seinen Augen.
»Ein Goldstück jetzt, die restlichen drei gebe ich Euch, wenn Ihr pünktlich zur abgemachten Zeit liefert.«
Meine Stimme vibriert in ihrem melodischen Klang und ich stecke so viel Überzeugungskraft wie möglich hinein. Ich lasse eine Münze in seine ausgestreckte Hand fallen und der Mann nickt ergeben und verspricht, alles zu meiner Zufriedenheit zu erledigen.
Das war einfach. Punkt eins auf meiner Liste kann ich somit abhaken. Dank des Goldes und der Kraft meiner Stimme. »Bezirzen« wird es gemeinhin genannt, eine Fähigkeit der Elfen. Ich verfüge leider nur über einen Bruchteil dieser Kraft und kann nur leichtgläubige Wesen dazu bringen, sich für meine Idee zu erwärmen. Der Mann wollte sowieso das Gold, zögerte aber noch wegen des weiten Weges und meiner Forderungen. Ihn weiter herunterzuhandeln oder gar umsonst arbeiten zu lassen läge weit außerhalb meiner Fähigkeiten, deshalb habe ich es erst gar nicht versucht.
Immerhin habe ich einen wichtigen Punkt bereits erledigt und muss mir um die Lieferung keine weiteren Gedanken machen. Entschlossen betrete ich den Krämerladen und hoffe, im Inneren eine bessere Auswahl als hier draußen zu finden.
Nur zwei kleine Fenster spenden etwas Tageslicht im Verkaufsraum. Ansonsten brennen in den Nischen und Regalen Kerzen, um den Kunden halbwegs Sicht auf die Ware zu verschaffen. Die Luft steht in diesem kleinen Raum förmlich und zusammen mit dem Qualm der Kerzen und dem süßlichen Geruch von altem Obst verschlägt es mir im ersten Moment den Atem.
Misstrauisch beäugt mich der Ladenbesitzer, ein gedrungener Mann mittleren Alters mit rötlichen Haaren und vielen Sommersprossen um die Nase, als ich direkt auf den Tresen zugehe, ohne seine Auslagen eines weiteren Blickes zu würdigen.
»Was darf’s denn sein, junge Frau?«, fragt er mit näselnder Stimme. Wortlos reiche ich ihm meine Liste, woraufhin er eine Brille unter dem Tresen hervorfischt und den Zettel durchgeht. »Hm. Soso«, murmelt er.
Nervös blicke ich mich um und versuche das Zittern zu unterdrücken. Die Muskeln in meinen Beinen vibrieren vor Verlangen, aus diesem verdammten Dorf zu verschwinden und zurück nach Hause zu eilen.
»Bist wohl nicht von hier, was?« Der Krämer hat den Zettel sinken lassen und starrt mich unverblümt an.
Ich hebe das Kinn, sodass er gerade so meine Augen unter der Kapuze aufblitzen sehen kann, und starre zurück. »Nein«, antworte ich leise und senke den Kopf wieder.
Ich spüre dennoch, dass er mich weiterhin mustert, und es ist mir unangenehm. Offenbar kommen noch weniger Auswärtige hierher, als ich dachte, was mich allerdings bei der Auswahl an Waren auch nicht wundert.
Instinktiv umklammere ich die silberne Schließe mit einer Hand – mein altes Ritual, um mir selbst Mut zu machen –, doch diesmal will sich die gewohnte Wirkung nicht einstellen. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass die Wände des kleinen Lädchens immer näher auf mich zurücken. Ich muss hier dringend raus. Mit jeder verstrichenen Sekunde zieht sich mein Hals weiter zu. Der beißende Qualm und der Geruch der überlagerten Waren tun ihr Übriges, um mich kaum noch Atem holen zu lassen.
»Hm«, macht der Krämer erneut und ich tippe ungeduldig mit dem Fuß auf, während ich die verstreichenden Sekunden zähle. »Einiges habe ich da. Das Saatgut und die Kartoffeln kommen allerdings erst morgen mit der Lieferung aus der Stadt.«
Er wendet sich ab und kramt in seinen Regalen nach den Dingen, die auf dem Zettel stehen.
»M-Morgen?«, quietsche ich. »Aber … warum denn erst morgen?«
Er zuckt desinteressiert mit den Schultern. »Die Lieferung verspätet sich. Hatten wohl unterwegs einen Achsenbruch oder was weiß ich, jedenfalls sind sie erst morgen da.«
»Kann der Mann mit dem Karren, der draußen vor dem Laden steht, die Sachen einfach mitbringen und ich zahle sie jetzt schon?«, frage ich hoffnungsvoll.
Doch der Ladenbesitzer schüttelt den Kopf. »Nee, Mädel, das geht so nicht. Ich weiß selbst nicht, was und wie viel die mir morgen liefern. Die Ernte soll ja so schlecht gewesen sein. Wir bauen hier keine Kartoffeln an, deshalb weiß ich’s nicht. Guck da lieber selbst mal drauf. Ich hab auch schon viele Vorbestellungen hier, die noch vor dir dran sind. Du weißt ja, wer zuerst kommt, mahlt zuerst.«
Das hat mir gerade noch gefehlt! Schnell gehe ich die Möglichkeiten durch, die mir bleiben. Der Weg zurück zu meiner Lichtung dauert Stunden. Und morgen früh erneut aufbrechen? Nein, da würde ich eher in Dorfnähe unter einem Baum übernachten, schließlich sind die Nächte mild und ich habe kein Problem damit, unter freiem Himmel zu schlafen. Aber das würde bedeuten, dass ich mich noch länger in Menschennähe aufhalten müsste …
Ohne das Saatgut zurückzugehen, kommt überhaupt nicht infrage. Ich muss noch in dieser Jahreszeit die neue Saat ausbringen, um nächstes Jahr pünktlich mit der eigenen Ernte beginnen zu können.
»Wann kommt die Lieferung morgen?«, frage ich.
»Nun, ähm, die sind mit ihrem Karren immer so gegen Mittag da. Vielleicht etwas später diesmal.«
Ich sehe kurz zur Seite. Wenn ich mittags meine Ware bekomme, habe ich anschließend noch genügend Zeit für den Weg nach Hause. Bei Nacht bepackt mit Waren – denn einige Lebensmittel für die nächsten Tage werde ich gleich mitnehmen müssen – durch einen Wald zu laufen ist keine angenehme Vorstellung. Obwohl mir auf dem Weg hierher kein Waldtier begegnet ist, bedeutet das nicht, dass nicht gefährliche Raubtiere da draußen herumstreifen.
»Einverstanden«, sage ich. »Ich komme morgen gegen Mittag wieder.«
Ich habe mich gerade zum Gehen abgewandt, als sich der Krämer hinter mir räuspert. »Willst du das Dorf verlassen?«
Ich bleibe stehen, drehe mich jedoch nur halb um und nicke.
»Daraus wird wohl nichts. Wir haben heute blaublütigen Besuch bekommen. Das gesamte Dorf wird abgeriegelt. Dürfte schon so weit sein. Die haben irgendwas von Sicherheitsbestimmungen gefaselt. Na, jedenfalls kannst du heute nicht mehr hier weg.«
»Was?«, keuche ich, als ich zu ihm herumwirbele.
Zu mehr bin ich gerade nicht fähig, denn nackte Angst lähmt alles in mir, selbst meine Fähigkeit, klar zu denken. Eingesperrt mit Dorfbewohnern – oder noch schlimmer: Wachen! – und das auf engstem Raum … Das wird nicht gut gehen. Ich muss aus diesem Dorf raus, solange es noch möglich ist!
»Ich glaub, in der Herberge is’ noch ein Zimmer frei. So viel Gefolge soll nicht dabei gewesen sein. Frag doch am besten mal nach.«
Ich bebe am ganzen Leib vor Angst, zwinge mich aber dazu, in Rotschopfs Richtung zu nicken als Zeichen, dass ich ihn verstanden habe, und haste aus dem Laden.
Draußen angekommen atme ich mehrmals durch. Ich stehe kurz davor, vollkommen die Nerven zu verlieren. Pure Panik pulsiert durch mich hindurch und lässt eine schmerzhafte Todesangst nach der anderen vor meinen Augen aufsteigen. Beinahe meine ich bereits die Flammen zu spüren, die an meiner Haut lecken, oder den Strick, der sich zu fest um meinen Hals zusammenzieht.
Beruhige dich, Fye, sage ich zu mir selbst. Du weißt doch gar nicht, ob der Kerl da drin recht hat. Vielleicht kannst du noch immer aus dem Dorf heraus, ehe es abgesperrt wird.
Ich atme noch einmal tief ein und umfasse die silberne Schließe an meinem Umhang. Danach sehe ich mich um. Das Dorf befindet sich in einem Tal, umringt von hohen Klippen. Wenn die Eingänge tatsächlich bewacht werden, habe ich keine Chance, ungesehen zu entkommen. Meine Bergsteigkünste halten sich in Grenzen. Eher würde ich mir den Hals brechen, als unverletzt diese Klippen erklimmen zu können.
Ich gehe schleunigst den Weg zurück, den ich gekommen bin, um mich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, dass der Ausgang aus dem Dorf tatsächlich versperrt ist. Die Sonne sinkt unaufhaltsam und die Hütten werfen bereits lange Schatten, durch die ich husche. Auf halber Strecke bleibe ich erneut stehen und sehe mich um.
Irgendwas stimmt nicht.
Zuerst fällt mir die Stille auf. Wo vorhin noch Mädchen durcheinanderkicherten, herrscht nun Schweigen. Nur der Wind, der an den Ästen der Bäume zerrt, trägt einige Wortfetzen zu mir. Verwirrt blicke ich zur Herberge. Die Menschentraube, die sich noch vor Kurzem davor drängte, ist verschwunden. Gedämpfter Lärm dringt nun vom Inneren der Herberge nach draußen. Anscheinend ist der hohe Besuch, von dem Rotschopf gesprochen hat, bereits eingetroffen.
Ich bin so was von erledigt.
»Hab’s dir ja gesagt.«
Erschrocken wirbele ich herum. Neben mir steht der Krämer. Ich war derart in Gedanken versunken, dass ich ihn nicht habe kommen hören. Beinahe berührt sein Arm meinen und ich mache schnell einen Schritt zur Seite. Eilig setze ich meinen Weg in Richtung Dorfausgang fort.
»Da wirst du kein Glück haben. Ich wart’ in der Herberge auf dich«, ruft der Krämer mir nach.
Ich erschaudere, beschleunige meinen Schritt und muss mich bremsen, um nicht zu rennen.
Leider behält der Krämer recht. Am Pfad, der aus dem Tal zum Wald führt, stehen drei Ritter in voller Rüstung. Zwei tragen lange Schwerter an der Seite, der andere stützt sich auf eine Lanze. Misstrauisch sehen sie in meine Richtung, als ich mich ihnen nähere. Mein Herz klopft so laut, dass sie es garantiert hören müssen.
»Heute geht hier keiner mehr raus oder rein!«, ruft mir der mit der Lanze zu, noch bevor ich den Mund aufmachen kann. »Sicherheitsvorkehrungen!« Er wedelt mit der Hand, die in einem schweren Eisenhandschuh steckt, als wolle er dadurch sämtlichen Protest im Keim ersticken.
Ich versuche dennoch mein Glück.
»Sicherheitsvorkehrungen? Ich will doch nur nach draußen. Und wie sollte jemand wie ich eine Gefahr darstellen?«
Stocksteif stehe ich da, während die drei Wachmänner mich mustern. Meine frauliche Gestalt wird zwar durch den Umhang weitestgehend verborgen, aber sie werden erkennen müssen, dass ich nicht sehr kräftig bin. Zum Glück habe ich darauf verzichtet, meine Waffe mitzunehmen.
»Wir können dich trotzdem nicht rauslassen, Kleine«, brummt einer der Männer. »Da draußen soll ein riesiger schwarzer Wolf sein Unwesen treiben und junge Frauen wie dich mit einem Happs verspeisen.«
»Ein schwarzer Wolf?«, echoe ich. »Ich hätte davon gehört, wenn im Wald …« Schnell beiße ich mir auf die Zunge, um nicht zu verraten, dass dieser Wald mein Zuhause ist. »Es wird mir schon nichts geschehen.«
»Tut mir leid, aber wir haben strikte Anweisungen«, hält der andere Mann dagegen. »Niemand kommt rein, niemand geht raus. Morgen sind wir wieder verschwunden und alles geht seinen geregelten Gang, versprochen!«
Obwohl er versucht, nett zu mir zu sein, schürt es meine Angst nur weiter.
»Bitte«, flehe ich und lege so viel Kraft wie möglich in meine Stimme. »Könnt ihr nicht für mich eine klitzekleine Ausnahme machen? Niemand wird es je erfahren.«
Sie wanken keine Sekunde, sondern schütteln unisono die Köpfe. »Keine Ausnahmen.«
Vor Verzweiflung knirsche ich mit den Zähnen und drehe mich um. Nervös beginne ich nun auch noch am Daumennagel zu nagen, eine Unsitte, die ich nur zeige, wenn meine Nerven blank liegen, und verfluche meine kümmerliche magische Gabe. Als Elfe hätte ich alle drei um den kleinen Finger wickeln und meinen Willen bekommen können.
Der blaublütige Besuch, von dem der Krämer sprach, wird im Gasthaus und der Grund für die Aufregung der hiesigen Damen sein. Die Chance auf ein Einzelzimmer, in dem ich wenigstens halbwegs beruhigt schlafen könnte, ist verschwindend gering. Allerdings ist die Aufmerksamkeit der Menschen hier nur dem Ankömmling gewidmet, sodass es mir nicht schwerfallen wird, mich in eine dunkle Ecke zu setzen und mit den Schatten zu verschmelzen.
Aus den Augenwinkeln nehme ich wahr, dass zwei weitere Soldaten durchs Dorf patrouillieren und hinter Hütten und in Nischen spähen. Also ist es auch keine Option, einfach in einer leer stehenden Scheune oder auf einem Baum die Nacht zu überdauern.
Ich lasse den Kopf hängen und schlurfe hinüber zur Herberge. Meter für Meter wächst mein Unbehagen und alles in mir schreit danach, dass ich mich umdrehen und weglaufen sollte. Ich verschränke die Arme unter dem Umhang, um das Zittern meiner Hände zu verstecken.
Du kannst das, Fye. Immer einen Schritt vor den anderen.
Als ich vor der Herberge stehe, höre ich deutlich den Lärm aus dem Inneren. Die Sonne ist schon fast untergegangen, weshalb der Wirt gerade die Lampen entzündet.
Zaghaft öffne ich die massive Holztür, die mit einem Quietschen aufschwingt.
Kapitel 3
Fye
Die Menschentraube, die einige Zeit zuvor noch den kleinen Garten vor der Herberge niedergetrampelt hat, hat sich nun ins Innere verlegt. Mindestens fünfzehn Menschen – fast alle von ihnen sind junge Frauen – stehen dicht an dicht gedrängt vor der Tür zu einem der hinteren Schankräume. Sie schnattern aufgeregt über die Köpfe der anderen hinweg, stellen sich auf die Zehenspitzen und versuchen einen Blick durch die geöffnete Tür auf … wen auch immer zu erhaschen.
Sofort fühle ich mich unwohl inmitten all dieser Menschen und der Aufregung, die in der Luft flirrt, aber ich bin froh, dass sie sich mit etwas anderem beschäftigen und nicht auf mich achten, als ich mit gesenktem Kopf in den Gastraum husche.
Nur drei Männer sitzen an einem Tisch in der Nähe und halten sich eisern an ihren Bierkrügen fest. Einer davon ist der rothaarige Krämer, der mir nickend zuprostet, ehe er einen kräftigen Schluck nimmt.
Er scheint den fragenden Blick, den ich der Menge zuwerfe, zu bemerken und winkt mich zu seinem Tisch. Zögernd mache ich ein paar Schritte auf ihn zu, bleibe aber in einem sicheren Abstand stehen.
»Warum bist du denn nicht auch so aufgeregt wie der Rest der Mädchen?«, fragt der ältere der beiden anderen Männer am Tisch. Er hat bereits graues Haar und einen dichten Bart.
Anstatt zu antworten, lege ich den Kopf leicht schräg.
»Bist wohl nicht von hier, was? Dann weißte sicher auch nicht, dass der Prinz mit seinem Gefolge hier Rast macht. Das bringt unsere ganzen Mädels um den Verstand! Wie Hühner gackern sie herum.« Brummend wendet er sich wieder seinem Bierkrug zu. »Und viel mehr Verstand haben sie auch nicht.«
Unwillkürlich verziehen sich meine Lippen zu einem kleinen Lächeln, denn genau das habe ich über diesen lärmenden Frauenhaufen ebenfalls gedacht. Aber ich kann es ihnen auch nicht verdenken. In einem anderen Leben wäre ich vielleicht auch eine von ihnen und würde mit Ellenbogen und Fingernägeln um einen Platz in der ersten Reihe kämpfen.
Nun richtet der zweite Mann das Wort an mich. »Einige behaupten, dass der Prinz auf Brautschau ist. Deshalb sind unsere Frauen so aus dem Häuschen. Sogar die verheirateten.«
So wie er die Frauen mustert, ist sicherlich auch seine Angetraute mittendrin und buhlt um die Aufmerksamkeit des Prinzen. Oder zumindest um die eines seiner Gefolgsmänner. Ich kann nicht sagen, dass mich das verwundert. Als arme Bäuerin ist man nicht wählerisch, wenn man die Chance hat, der anstrengenden Arbeit auf den Feldern und dem Leben in einer zugigen Hütte zu entkommen.
Ich entscheide mich, nun doch zu antworten, spreche aber so leise, dass ich fast flüstere. »Aber ist es nicht sehr unwahrscheinlich, dass sich ein Prinz eine bürgerliche Frau nimmt?«
Der Bärtige gibt einen glucksenden Laut von sich und nickt, schaut jedoch weiterhin in seinen Krug. »Natürlich ist es das! Trotzdem träumen diese dummen Gänse davon, in einem Schloss oder zumindest einem feinen Haus zu wohnen, fernab der harten Arbeit in der prallen Sonne und dem Hunger, der sie jede Nacht am Einschlafen hindert.«
Ich nicke, denn das klingt ganz nach dem kurzsichtigen Denken von jungen Menschen. Der Prinz wird sich eine oder mehrere Mädchen herauspicken, um heute Nacht sein Bett zu wärmen; mit auf sein Schloss nehmen und heiraten wird er jedoch keine von ihnen. Warum sollte er auch?
Ich schaue wieder zur Menge, durch die sich gerade der Wirt, ein dicker, untersetzter Mann mit Halbglatze und einer schmierigen Schürze, die anscheinend einmal weiß war, einen Weg bahnt. Er schubst und drängt sich durch die Frauen und streift hier und da wie zufällig über ihre Körper, was seine Augen zum Leuchten bringt, doch die Mädchen sind viel zu aufgeregt, um darüber entrüstet zu sein. Vielleicht merken sie es auch nicht.
Die Menge verstummt abrupt, als der Wirt, der endlich den Weg hindurch gefunden hat, das Wort an seinen hohen Gast richtet.
Ich nicke den drei Männern am Tisch zu und suche mir einen stillen Platz in einer Ecke. Ich setze mich in den Schatten, ziehe meine Kapuze etwas tiefer ins Gesicht und lausche dem Gespräch.
»Was für eine unsagbare Ehre, Prinz Vaan, dass Ihr in meiner bescheidenen Herberge verweilt.«
Ich kann förmlich vor mir sehen, wie der dicke Wirt vor dem Prinzen katzbuckelt und sich die schwieligen Pranken reibt. Durch einen so hohen Besuch mit Gefolge wird er für den Rest des Jahres ausgesorgt haben.
Ein freundliches Lachen dringt aus dem Raum und lässt mich aufhorchen. Der Prinz? Allein dieser Laut genügt, um wieder ein sehnsüchtiges Ziehen in meiner Brust heraufzubeschwören.
»Das freut mich, guter Mann. Doch nun wünschen meine Begleiter und ich etwas Ruhe.«
Wenn es wirklich der Prinz ist, der gerade spricht, hat er eine wundervolle Stimme. Tief und voll und an genau den richtigen Stellen rau. Trotz meiner unterschwelligen Angst könnte ich ihm ewig zuhören.
»Wir haben eine lange und beschwerliche Reise hinter uns.«
»Natürlich, selbstverständlich«, murmelt der Wirt geschäftig. Ich wünschte, er würde dem Prinzen eine weitere Frage stellen, doch leider tut er das nicht. »Ich habe bereits alles veranlasst, damit Ihr einen angenehmen Aufenthalt habt, und werde nun dafür sorgen, dass die übrigen Gäste woanders hingehen.«
Unzufriedenes Murren dringt vom Tisch des Bärtigen zu mir. Anscheinend hatten die Männer nicht vor, ihr Bier in einem hastigen Zug hinunterzustürzen, sondern wollten länger bleiben.
Die schweren Schritte des Wirts hallen über den Holzboden, als er das Zimmer verlässt und die Tür hinter sich zuzieht. Ein erneutes Murren ertönt, diesmal von der Mädchenmenge, denn der Blick auf den hohen Besuch ist nun versperrt.
»Und ihr macht, dass ihr nach Hause kommt!«
Mit einer energischen Handbewegung scheucht der Wirt die Mädchen nach draußen. Nur ein paar bleiben zurück. Wahrscheinlich haben auch sie hier ein Zimmer gemietet. Missmutig drehen sich die Hinausgeworfenen nochmals um, ehe sie die Herberge verlassen. Dennoch steht der Wirt wie ein unverrückbarer Fels mit verschränkten Armen vor der Tür zu seinen hohen Gästen. Hin und wieder höre ich von drinnen das wohlklingende Lachen des Prinzen.
Ich sehe meine Chance gekommen und erhebe mich leise. Niemand beachtet mich, als ich durch die nun leere Gaststube husche. Neben dem Wirt bleibe ich stehen und frage ihn flüsternd nach einem Zimmer. Er nickt nur, ohne mich groß anzusehen, zeigt mit dem Daumen nach oben und öffnet die Hand. Ich fische eine Münze aus meinem Beutel und lasse sie hineinfallen. Ohne in seine Hand zu blicken, schließt der Wirt selbige wieder und verschränkt die Arme.
»Erster Stock, hinterste Tür«, brummt er.
Nachdem die Mädchen gegangen sind, ist es seltsam still und leer geworden. Abgesehen von ein paar schmatzenden Geräuschen der trinkenden Gäste könnte man eine Stecknadel fallen hören.
Ich wende mich vom Wirt ab und richte meine Kapuze. Dann nehme ich die Treppe nach oben in den ersten Stock und steuere auf die hinterste Tür am Ende des Gangs zu, wie es mir der Wirt geheißen hat.
Es haben sich bereits andere Gäste hier eingefunden, doch keiner würdigt mich eines zweiten Blickes. Im Grunde handelt es sich bei diesem Schlafsaal um nichts anderes als einen morschen Dachboden, auf dem in aller Eile einige Strohbetten ausgelegt wurden. In den Ecken hängen Spinnweben, an einer Wandseite steht eine Reihe von Schränken und Fässern. Anscheinend wird hier einiges gelagert, das für die Bewirtung bestimmt ist. Es riecht muffig und Staubkörner tanzen in der Luft.
Ich entscheide mich für das Strohbett in der äußersten Ecke, packe es und schiebe es direkt an die Wand. Anschließend strecke ich mich aus und prüfe erneut den Sitz meiner Kapuze. Hoffentlich rutscht sie mir nicht herunter, während ich schlafe. Sicherheitshalber ziehe ich die Decke höher. Sie ist löchrig und ich will mir nicht vorstellen, welch andere Schlafgäste sich noch in meinem Bettzeug befinden. Außerdem riecht sie stark nach Pferd.
Doch im Grunde bin ich froh, so problemlos einen Schlafplatz gefunden zu haben, da mache ich gern ein paar Abstriche. Alles wird gut. Diese Nacht werde ich auch noch überstehen und morgen schlafe ich wieder in meinem eigenen Bett in meiner Hütte, umgeben von der malerischen Lichtung und begleitet von den Geräuschen des Waldes.
Ich seufze wehmütig. Sosehr ich es auch versuche, ich kann mich nicht erinnern, jemals irgendwo anders übernachtet zu haben als zu Hause in meiner Hütte, doch ehe ich wieder einen Anflug von Angst spüren kann, drehe ich mich auf die Seite und verscheuche diese negativen Gedanken. Ich muss durchhalten! Bald habe ich es überstanden.
***
Ich komme in einem kleinen, mir fremden Dorf zu mir. War ich nicht in Thiras? Aber dieses Dorf … sieht ganz anders aus. Um mich herum brennen die Hütten und Scheunen lichterloh. Eine unnatürliche Hitze, die nicht allein vom Feuer kommen kann, schlägt mir entgegen und meine Augen tränen durch den Rauch, der über den Dächern hängt und sich durch die engen Straßen frisst. Es ist so heiß, dass ich spüre, wie die kleinen Härchen auf meinen Armen versengen.
Die Bewohner um mich herum schreien und die, die es noch können, versuchen zu fliehen.
Bis zu den Knöcheln stehe ich im Matsch; Bäche aus Blut haben die Erde unter mir aufgeweicht. Abgetrennte Körperteile liegen im Gras. Leichen starren mit leerem Blick zu den Sternen empor, die man nur hin und wieder durch die Rauchschwaden erkennen kann.
Ich drehe mich um. Auf einer Anhöhe stehen sie – diejenigen, die dieses Unglück über uns bringen. Einer von ihnen scheint ein Menschenkönig zu sein. Er trägt eine Krone auf seinem Kopf, einen weiten roten Umhang und feine Gewänder. Die schweren Goldketten um seinen Hals glänzen im Schein der unzähligen Feuer. Er lächelt zufrieden, während er das Schauspiel zu seinen Füßen beobachtet.
Neben ihm steht das schönste Geschöpf, das ich je gesehen habe. Sie ist zweifelsohne eine Elfe; das würde ich auch wissen, ohne ihre spitzen Ohren sehen zu können. Ich bin geblendet von diesem Anblick. Alles an ihr ist wunderschön und perfekt, wäre ihr liebreizendes Gesicht nicht von einem Lächeln entstellt, das es zu einer Fratze werden lässt.
Sie hebt beide Hände und beginnt eine Zauberformel zu sprechen, während sie die Finger in der vorgegebenen Weise bewegt. Ich kenne den Spruch nicht, aber allein die Macht, die sie nun zwischen ihren Händen bündelt, lässt mir trotz der Hitze um mich herum das Blut in den Adern gefrieren.
Blitze schießen vom Himmel herab und treffen zielgerichtet die Bewohner, die sich in Sicherheit bringen wollen. Schreiend brechen sie zusammen und rühren sich nicht mehr. Der Geruch von verbranntem Fleisch kriecht mir in die Nase, ich falle würgend auf alle viere und versinke weiter im Schlamm.
Nun hebt der Menschenkönig die Hand und hinter ihm rückt eine Armee von Rittern an. Alle tragen schwarze Rüstungen und lange Schwerter, während ihre Gesichter hinter ebenso schwarzen Helmen verborgen sind. Nachdem die Elfe ihre Hände wieder hat sinken lassen, verschwinden die Blitze, doch nun fallen die Ritter in den schwarzen Rüstungen ins Dorf ein und machen diejenigen nieder, die wider Erwarten noch am Leben sind.
Ihre Schreie hallen über die Ebene. Es sind so viele … Frauen, Kinder, Alte. Die Schwarzen Ritter machen vor nichts und niemandem halt. Sie arbeiten langsam und routiniert. Ohne Eile schreiten sie zwischen den Bergen von Leibern hindurch und lassen ihre Schwerter niedersausen.
Mit schreckgeweiteten Augen sehe ich mich um. In meiner Nähe liegt eine Frau, die tonlos das Wort Hilfe mit den Lippen formt. Ich schlucke angestrengt.
»Ich … kann dir nicht helfen«, hauche ich.
Dann fällt mein Blick auf ihre Ohren und ich erstarre. Sie sehen aus wie meine. Schnell drehe ich den Kopf und zwinge mich dazu, einen anderen Gefallenen anzusehen. Auch seine Ohren sind spitz zulaufend.
Halbelfen … Alle diese Opfer sind Halbelfen, wie ich.
Ich schließe fest die Augen und versuche krampfhaft das Geschehen um mich herum auszublenden. Das Letzte, was ich höre, ist das durchdringend tiefe Lachen des Menschenkönigs und im Kontrast dazu das hohe, beinahe schrille Kichern der Elfe.
***
Ich erwache mit einem unterdrückten Schrei und krampfe mich auf der fremden Bettstatt zusammen. Schweiß steht mir auf der Stirn und mein Herz schlägt viel zu schnell.
Ungeduldig fahre ich mit beiden Händen durch mein Gesicht und wische den Schweiß weg. Ein Traum. Es war nur ein Traum.
Aber … es fühlte sich so real an. Die Hitze um mich herum. Die Angreifer … Ich konnte ihre Gesichter erkennen, als wäre ich ihnen bereits begegnet. Der Gedanke lässt mich frösteln, obwohl ich weiß, dass ich nie einem Menschenkönig oder einer anderen Elfe als meiner Ziehmutter begegnet bin. Und ich war auch nie während der Vernichtung eines Dorfes zugegen.
Ich setze mich auf und stütze den Kopf in die Hände. Als ich aus dem Fenster schaue, ist der Mond noch nicht richtig aufgegangen. Durch den Albtraum fühlte es sich an, als wäre die Nacht schon vorbei, aber sie hat kaum begonnen. Wahrscheinlich ist nicht mehr als eine Stunde vergangen, seit ich mich hingelegt habe.
Die anderen Gäste um mich herum schlafen und schnarchen und auch ich hätte eine Mütze voll Schlaf dringend nötig. Der Weg hierher war anstrengend und der morgige Rückweg wird es auch. Ich muss mich ausruhen.
Rastlos wälze ich mich auf dem unbequemen Strohlager von einer Seite auf die andere. Mein Mund ist wie ausgedörrt. Seufzend gebe ich es auf, gleich wieder schlafen zu können, und fische stattdessen eine Kupfermünze aus meinem Beutel.
Auf Zehenspitzen schleiche ich zwischen den Schlafenden hindurch und steige hinab in die Schankstube, um mir ein Glas Wasser zu holen. Wie erwartet ist von dem Wirt nichts zu sehen, also werde ich die Münze auf dem Tresen liegen lassen.
Ich bin gerade dabei, ein Glas mit Wasser zu füllen, als unvermittelt die Tür zum hinteren Schankraum geöffnet wird. Leise zwar, aber das Geräusch hallt in der Stille so laut, dass ich herumwirbele und dabei fast die Hälfte der Flüssigkeit verschütte.
Jemand kommt aus dem Schankraum – ein Mann, der von Kopf bis Fuß in einen dunklen Umhang mit Kapuze gehüllt ist. Hinter sich schließt er leise die Tür, bleibt aber wie angewurzelt stehen, als er mich entdeckt. Mein Herz macht einen Satz und verfällt dann in einen seltsamen Takt. Nicht ängstlich wie während des Tages. Sondern … anders.
Ich blinzele mehrmals, um wieder im Hier und Jetzt anzukommen und diese Gedanken zu vertreiben. »I-Ich …«, stammele ich. »Ich … habe Geld auf den Tresen gelegt.«
Der Mann neigt den Kopf, bewegt sich abgesehen davon jedoch nicht. Wird er mich an den Wirt verpfeifen? Aber ich habe doch für das Wasser bezahlt, sogar mehr, als es eigentlich wert ist. Trotzdem ängstigt mich der Gedanke, dass der Wirt dadurch auf mich aufmerksam werden könnte.
Ich spüre, wie er mich aus dem Schatten seiner Kapuze heraus beobachtet. Langsam hebt er die Hand und reibt sich über den Brustkorb, als könne er so den darin wütenden Schmerz vertreiben. Dann schüttelt er den Kopf und durchquert mit ausladenden Schritten den Raum, ehe er ohne ein Wort durch die Tür in die anbrechende Nacht hinaus verschwindet.
Was … ist denn mit dem los? Vielleicht muss er sich erleichtern.
Ich zucke mit den Schultern, fülle erneut das Glas und trinke es in einem Zug leer, ehe ich wieder hinauf zu meinem Strohlager schleiche.
***
Nachdem ich etwas getrunken hatte, konnte ich tief und fest – und vor allem traumlos – schlafen. Der Gastraum ist gut gefüllt, als ich am nächsten Morgen nach unten komme. An allen Tischen sitzen Gäste und trinken und essen. Der Geruch von Gebratenem weht zu mir herüber und wie aufs Stichwort knurrt mein Magen. Ich schiebe den Gedanken jedoch strikt beiseite. Das Einzige, was ich will, ist, meine Waren zu bestellen, zu bezahlen und dann nichts wie nach Hause – raus aus diesem Dorf und weg von so vielen Menschen.
Den Gesprächen der Gäste, an denen ich mich Richtung Ausgang vorbeidränge, entnehme ich, dass der Prinz und sein Gefolge bereits beim ersten Sonnenstrahl aufgebrochen sind. Das bringt mich zu der Frage, wie spät es eigentlich ist, aber ich beschließe, mich auf den Stand der Sonne zu verlassen, sobald ich draußen bin, und nicht ein weiteres Gespräch zu beginnen. Bezahlt habe ich meine Übernachtung bereits gestern Abend, daher steuere ich schnurstracks Richtung Ausgang.
Fast bei der Tür angelangt überkommt mich Erleichterung.
Bald ist das alles vorbei.
Bald bin ich wieder zu Hause und alles geht wieder seinen gewohnten Gang.
Nur noch wenige Meter trennen mich vom Ende meines persönlichen Albtraums in diesem Menschendorf und ich beschleunige meine Schritte nochmals.
Als ich gerade den Griff mit einer Hand umschließen will, wird die Tür jedoch von außen aufgestoßen und ein Ritter in kompletter Montur stürmt eilig herein, übersieht mich und rennt mich um. Ich falle unsanft auf den harten Boden und komme mit einer solchen Wucht auf, dass mir die Kapuze vom Kopf rutscht.
Vor Schreck bin ich unfähig auch nur einen Muskel zu rühren. Alles um mich herum scheint stillzustehen. Selbst mein Herzschlag scheint ausgesetzt zu haben.
Wie gelähmt nehme ich wahr, dass die Leute mich anstarren, teilweise mit offenen Mündern und schreckgeweiteten Augen.
Nein, das darf nicht wahr sein!
Als ich ihre ungläubigen Blicke auf mir spüre, kommt endlich wieder Leben in mich. Eilig setze ich mich auf und zerre die Kapuze zurück an ihren Platz, aber es ist zwecklos, denn der Schaden ist bereits angerichtet.
Sie haben sie gesehen. Sie haben meine Ohren gesehen! Sie wissen, was ich bin.
Ein panisches Zittern greift auf meinen gesamten Körper über, als ich mich hochstemme und das Gewicht auf die wackeligen Beine verlagere, die mich wie durch ein Wunder tragen.
Getrieben von Angst zwänge ich mich an dem Ritter vorbei und versuche schnellstmöglich den rettenden Ausgang zu erreichen. Er ist so nah, dass nur noch wenige Zentimeter meine Hand von der Klinke trennen. Auf meinem Gesicht spüre ich bereits den warmen Morgenwind, der durch die offene Tür hereinweht.
Doch der Ritter neben mir reagiert schneller, als ich mich bewegen kann, und packt mich grob am Arm. Ich stöhne auf, als er fester zudrückt, versuche aber dennoch mich seinem Griff zu entwinden. Vergebens. Mein Arm verschwindet förmlich in seinen Pranken und ich keuche vor Schmerz auf, als sich seine Finger in meine Haut bohren.
Die Frau am Tisch neben mir schreit entsetzt auf, nachdem sie sich wieder gefasst hat, und nun kommt Bewegung in die restlichen Gäste im Raum – fast als wäre dieser Schrei der Auslöser. Die Männer springen vom Tisch auf, die Frauen gestikulieren wild in meine Richtung.
Panik kriecht mir die Kehle hoch und ich muss mich fast übergeben. Ich schlage und trete nach dem Ritter, rutsche jedoch ein ums andere Mal an seiner Rüstung ab. Unsanft zerrt er mich zu sich und reißt mir die Kapuze herunter.
»Eine Halbelfe!«, ruft er angewidert und spuckt auf den Boden neben mir. »Ich dachte, die hätte man ausgerottet!«
Die Menschen in der Gaststube scheinen nun gemeinsam mit mir die Luft anzuhalten, als der Ritter laut ausspricht, was ich bin. Er brüllt nach seinen Kumpanen, die offenbar vor der Tür gewartet haben, und stößt mich ihnen in die Arme. Ich pralle mit meinem Körper gegen eine weitere harte Rüstung und versuche erneut zu entkommen, aber nun legen sich zwei starke Hände um meine Arme. Ich winde mich, kratze und trete, doch die Hände packen nur noch stärker zu. Die gepanzerten scharfkantigen Handschuhe der Ritter schneiden mir ins Fleisch und ich schreie auf.
»Bringt sie nach draußen und fesselt sie! Wir werden sie mitnehmen und in den Kerker werfen, bis der König entschieden hat, was er mit dem Abschaum tun will!«
Ich will zaubern, um mich zu retten, doch der eiserne Griff verstärkt sich noch mehr, als die Ritter bemerken, dass ich meine Hände bewegen will. Schmerzvoll verdrehen sie mir die Arme auf dem Rücken, fesseln sie mit einem Seil und stoßen mich anschließend vorwärts. Ich stolpere, habe Mühe, das Gleichgewicht zu wahren, doch der unerbittliche Griff um meine Oberarme hält mich aufrecht.
Grob werde ich in einen Wagen geworfen, der rundherum mit Brettern verkleidet ist. Beim Aufprall wird mir die Luft aus den Lungen gepresst und es dauert einen Moment, bis ich wieder normal atmen kann. Obwohl mein Herz wie verrückt hämmert, höre ich das Zufallen der Wagentür hinter mir so deutlich, dass der Laut mir in den Ohren schmerzt.
Um mich herum ist es düster; kaum ein Lichtstrahl dringt durch die rauen Holzbretter hindurch. Das Seil um meine Hände schneidet sich schmerzhaft in meine Handgelenke und scheint sich bei jeder meiner Bewegungen weiter festzuziehen.
Solange meine Hände zusammengebunden sind, ist es mir unmöglich zu zaubern. Nicht, dass das bisschen Zauberkraft in mir viel hätte ausrichten können, aber vielleicht hätte es genügt, um Verwirrung zu stiften und dadurch entkommen zu können. Doch gefesselt kann ich nicht einmal die einfachsten Zauber beschwören.
Der Holzboden unter meiner Wange riecht modrig und kratzt auf meiner Haut. Als sich das Gefährt ruckelnd in Bewegung setzt, spüre ich jede noch so kleine Unebenheit des Weges in mir nachvibrieren.
Hoffnungslos füge ich mich meinem Schicksal. Es gibt kein Entrinnen für mich.
Mein Leben ist vorbei.
Kapitel 4
Fye
Ich weiß nicht, wie lange wir schon unterwegs sind. Da kaum Licht durch die Bretterwände dringt, kann ich nicht abschätzen, wie viele Stunden ich schon leer vor mich hin starre, ohne etwas zu sehen.
Irgendwann habe ich es geschafft, mich aufzusetzen, was bei dem ständigen Rütteln gar nicht so einfach war. Ich habe den Kopf auf die Knie gelegt und geweint, bis ich keine Träne mehr in mir hatte.
Ich weinte aus Angst, vor Wut über diese Ungerechtigkeit, aus Scham.
Noch immer kann ich die Blicke der Menschen auf mir spüren, kann den Hass fühlen, der mir in dem Moment entgegenschlug, als sie mich als das erkannten, was ich bin. Doch ich gebe mir Mühe, diese Erinnerungen zu vertreiben, und reibe mir die nassen Wangen an den angewinkelten Knien trocken. Ich will stolz und stehend meinem Schicksal entgegentreten, nicht gebeugt und gebrochen, schlotternd vor Angst. Diesen Gefallen werde ich ihnen nicht tun. Meine Ziehmutter Bryande würde sich im Grabe umdrehen, wenn ich zitternd aus diesem Karren aussteige und die Menschen auf Knien um Gnade anflehe.
Der Gedanke an meine Ziehmutter beruhigt mich. Zehn Jahre sind seit ihrem Tod bereits vergangen, doch manchmal meine ich, ihre Gegenwart spüren zu können. Sie war für mich da, so lange ich mich zurückerinnern kann, hat mich aufgezogen und mich alles gelehrt, was ich wissen muss, um als Halbelfe in dieser Welt zu überleben.
Bryande selbst war eine reinblütige Elfe, eine Hochelfe, wenn mich nicht alles täuscht. Genau weiß ich es nicht, da sie nie über sich selbst gesprochen hat und ich auch keine anderen Elfen außer ihr gekannt habe. Ich weiß bis heute nicht, wie es dazu kam, dass sie sich meiner angenommen hat. Immer wenn ich sie nach meiner Vergangenheit gefragt habe, wich sie mir aus. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin oder woher ich kam, doch ich war dankbar, bei Bryande zu sein, sodass ich nie wirklich nach meiner Herkunft suchte.
Aufgrund meines Daseins hatte ich nie Freunde oder – abgesehen von Bryande – Kontakte zu Menschen oder Elfen. Beide Rassen verstoßen mich als unnatürliches Geschöpf, das keine Daseinsberechtigung hat. Schlimmer noch: Die Menschen wünschen mir den Tod, weil es wohl viele Halbelfen gab, die ihre Magie nicht unter Kontrolle hatten und für gefährliche Zwischenfälle sorgten. Während die Elfen nur mit gerümpfter Nase auf mich herabsehen, als wäre ich weniger wert als der Dreck unter ihren Stiefeln, fürchten mich die Menschen. Halbelfen gelten ferner als Unglücksboten und als Grund für schlechte Ernten. Im Grunde sind Halbelfen wie ich an allem schuld, was schiefläuft.
Als ich jünger war und verstand, dass ich anders bin als Bryande, begann ich, mit meinem Schicksal zu hadern. Was war so schlimm an mir, dass mich – bis auf sie – niemand haben wollte, nicht einmal meine eigenen Eltern? Ich hasste mein Dasein, doch Bryande tröstete mich und versprach mir, dass irgendwann der Zeitpunkt kommen würde, an dem ich beide Seiten meiner Herkunft verstehen und anerkennen könnte. Sie versuchte stets meine Existenz nicht als Makel erscheinen zu lassen.
Was würde sie wohl sagen, wenn sie mich jetzt sehen könnte – gefesselt in einem Karren, gefangen von Menschen, auf dem Weg in den sicheren Tod?
Ich zucke zusammen, als die Tür zum Wagen aufgerissen wird. Ein großer Schatten füllt sie aus und bellt mit einer tiefen Stimme Befehle. Ich sehe nur seine Umrisse. Meine Augen brennen nach der langen Zeit in der Dunkelheit wie Feuer, als plötzlich Licht direkt auf mein Gesicht fällt, und ich blinzele gegen die Helligkeit an.
Zwei weitere Schemen tauchen auf und zerren mich aus dem Wagen. Schmerzhaft verdrehen sie meine auf dem Rücken gefesselten Arme, die mittlerweile völlig gefühllos sind. Auch meine Beine sind eingeschlafen und kribbeln unangenehm, während ich versuche mich auf den Füßen zu halten. Immer wieder knicke ich weg, werde aber grob an den Armen hochgerissen, was eine erneute Schmerzwelle durch meinen Körper jagt.
Ich befinde mich nun auf einer befestigten Straße. In wenigen Kilometern Entfernung kann ich eine große Stadt ausmachen. Da die Sonne den Zenit überschritten hat, müssen wir mehrere Stunden unterwegs gewesen sein. Das erklärt meine drückende Blase und den knurrenden Magen.
Der Wagen setzt sich gemächlich in Bewegung – ohne mich darin. Ich bleibe zurück mit einem Ritter, der auf einem stämmigen Ross sitzt, und den beiden Soldaten, die mich je an einem Arm gepackt haben.
Verwirrt blicke ich dem Wagen nach. Was soll ich hier? Angst kriecht in mir auf und lässt mich meine Schmerzen für einen Moment vergessen. Wollen … sie mich etwa hier töten?
Der Ritter auf dem braunen Pferd nimmt seinen Helm ab. Ich erkenne ihn sofort als den, der mich in der Herberge aufgegriffen hat. Er starrt mir ins Gesicht, ehe er mich von oben bis unten mustert. Seine Augen glänzen lüstern und taxieren jeden Zentimeter meines Körpers und mir wird schlagartig speiübel. Unruhig winde ich mich unter seinem Blick, wodurch die Soldaten ihren Griff an meinen Armen nur verstärken.
»Lasst sie ja nicht entkommen!«, knurrt der Ritter seinen Kumpanen zu. »Der nächste Wagen wird sicher gleich kommen.«
Die Minuten verstreichen, doch keiner sagt etwas oder bewegt sich. Es ist zermürbend. Probeweise versuche ich einen meiner Arme zu befreien, wodurch die Soldaten jedoch nur ihren Klammergriff verstärken.
Nervös knetet der Ritter die Zügel, was auch meinen beiden Häschern nicht entgeht. »Hauptmann«, setzt der Soldat zu meiner Rechten an. »Seid Ihr sicher, dass sie kommen? Ich meine, es ist …«
»Sei ruhig, Tölpel! Natürlich kommt der Gefängniskarren! Er kommt immer um diese Zeit. Da werden wir diese Missgeburt wenigstens los.« Er wedelt abwertend mit seiner Hand in meine Richtung. »Sollen sich doch die Wärter mit ihr herumschlagen, bis der König ein Urteil unterzeichnet hat.«
Ich presse die Lippen aufeinander und starre ins Leere, damit keiner von ihnen mein erleichtertes Aufatmen bemerkt. Wenigstens würde es ein Urteil geben – auch wenn ich genau weiß, wie es lauten wird – und ich werde nicht sofort sang- und klanglos niedergestochen. Ein Teil der Anspannung fällt von mir ab. Ich werde weiterleben, zumindest vorerst.
»Mir gefällt der Gedanke nicht, weiter in ihrer Gegenwart zu sein.« Der Soldat spuckt geräuschvoll auf den Boden. Dann grinst er anzüglich. Die Härchen in meinem Nacken stellen sich auf, als ich seinen Blick auf mir spüre. »Aber niedlich ist sie schon.«
Schnell wende ich den Blick ab und starre stur geradeaus, während ich tue so, als hätte ich ihn nicht verstanden. Erneut versuche ich meine mittlerweile völlig gefühllos gewordenen Hände aus den Fesseln zu befreien, doch auch diesmal ohne Erfolg.
Der Soldat an meiner linken Seite gibt ein Grunzen von sich. »Recht hast du. Vielleicht sollten wir erst unseren Spaß mit ihr haben. Schließlich landet sie eh im Feuer. Wäre doch schade drum!« Die beiden grinsen sich über meinen Kopf hinweg verschwörerisch zu.
Mit einem Schlag ist die Panik wieder da und kriecht eiskalt durch meine Glieder. Ich weiß nicht, was mich mehr verstört: hier mitten im Nirgendwo von Soldatenabschaum geschändet oder in naher Zukunft lebendig verbrannt zu werden.
Mit einem Ruck wendet der Ritter sein Pferd und bringt den rechten Soldaten dadurch zu Fall. Er lässt meinen Arm zu spät los und zieht mich ein Stück mit nach unten. Erschrocken schreie ich auf, kann mich jedoch gerade so auf den Beinen halten und gerate nicht unter die Hufe des Gauls. Das Pferd wiehert laut und steigt.
»Nichts da, Männer!«, donnert der Ritter. »Diese Hexe verflucht euch und lässt euer Gemächt abfaulen! Sie wird nicht angerührt, habt ihr mich verstanden?«
Der zu Boden gegangene Soldat rappelt sich auf und klopft sich den Straßenstaub von der Kleidung.
»Sie muss unversehrt bleiben. Zumindest bis zum Beginn der Folter.«
Betreten blicken die Soldaten zu Boden und murmeln eine undeutliche, eher halbherzige Zustimmung.
Mein Herzschlag normalisiert sich wieder. Angesichts der Ironie meiner Situation muss ich an mich halten, dass ich nicht in ein hysterisches Lachen ausbreche. Da verlasse ich einmal im Jahr den Schutz meiner Lichtung und schon sehe ich dem sicheren Tod und einer möglichen Schändung ins Gesicht. Zumindest in dieser Hinsicht leistet meine Herkunft mir gute Dienste; eine normale Menschenfrau hätte sich weder mit Magie noch mit Schauergeschichten diese Kerle vom Hals halten können.
Erst jetzt sickern die Worte des Ritters in mein Bewusstsein und mein Herzschlag gerät abermals ins Stocken. Hat er eben etwas von Folter gesagt?
Rumpelnd nähert sich ein weiterer Wagen. Er wird von zwei schwarzen Ochsen gezogen und ist anders als der erste nicht mit Brettern beschlagen, sondern auf der Ladenfläche komplett mit Gittern versehen.
Ein Käfig auf Rädern. Ich seufze verstohlen. War ja klar, dass es nicht besser werden würde.
Im Käfig selbst kauern bereits drei bemitleidenswerte Menschen: eine Frau und zwei Männer. Sie alle sind abgemagert und tragen nichts als zerschlissene Lumpen, die ihre Körper nur dürftig bedecken. Ich kann sie schon fünf Meter gegen den Wind riechen und Galle steigt mir im Hals hoch.
Ich bäume mich auf und wage einen letzten Fluchtversuch, doch egal, wie sehr ich mich drehe, um mich trete oder den Kopf hin und her werfe, die Griffe an meinen Armen lockern sich nicht.
Als der Wagen neben uns zum Stehen kommt, packt der Ritter mich an den Haaren, während einer der Soldaten mich loslässt und quietschend die Tür zum Käfig öffnet. Auch der zweite Soldat lässt von mir ab und der Ritter auf seinem Pferd stößt mich in den Käfig.
Stöhnend schlage ich mit dem Gesicht voran auf dem Holzboden des Wagens auf. Noch ehe ich versuchen kann mich aufzusetzen, wird die Tür hinter mir zugeschlagen und fällt mit einem lauten Geräusch ins Schloss.
Der Ritter wirft dem vermummten Mann auf dem Kutschbock ein kleines Säckchen zu, das dieser mit einer fließenden Bewegung auffängt und unter seiner Kutte verschwinden lässt. Dann knallt er mit seiner Peitsche und die beiden Ochsen setzen schnaufend ihren Weg fort.
Ich habe es mittlerweile geschafft, mich aufzurichten, und lehne mich keuchend an die Gitterstäbe. Meine Mitinsassen ziehen geräuschvoll die Luft ein, als ich den Kopf hebe. Alle drei drängen sich augenblicklich in die hinterste Ecke des Karrens – so weit weg von mir wie nur möglich.
Die abgemagerte Frau flüstert den Männern etwas zu, während sie auf mich deutet. Dummes Menschenweib! Denkt sie etwa, ich würde sie nicht verstehen, wo sie doch für meine Verhältnisse fast zu schreien scheint? Nun, dann werde ich mal dafür sorgen, dass sie Abstand wahren und mich in Ruhe lassen.
»Ja«, antworte ich, ohne dass mich einer von ihnen direkt angesprochen hat, und gebe mir keine Mühe, meine Stimme zu unterdrücken. Die drei starren mich aus schreckgeweiteten Augen an. »Ich bin genau das, wofür ihr mich haltet. Und wenn mir einer von euch zu nahe kommt, wird er es bereuen.«
Ängstlich versuchen sie noch weiter von mir abzurücken, was aufgrund des engen Käfigs nicht möglich ist. Wimmernd birgt die Frau den Kopf in den Händen.
Ich verdrehe die Augen. Erwarten sie etwa, dass ich sie hier und jetzt in Frösche verwandele? Ich knirsche mit den Zähnen. Natürlich, ich sitze ja auch gefesselt in diesem verdammten Käfig, weil ich sonst nichts anderes zu tun habe. Wären meine Kräfte tatsächlich so groß, wie diese Menschen befürchten, würde ich nicht mit ihnen in diesem Karren meinem Tod entgegenschaukeln.
Dankbar über etwas mehr Platz strecke ich die Beine aus, die bereits wieder kribbeln, und sehe durch die Gitterstäbe hindurch. Wir kommen zügig voran und haben die Stadtmauern fast erreicht.
Schon einige hundert Meter bevor wir die Mauern passieren, höre ich das Krächzen der Raben, die sich um den Leichnam eines Gehängten streiten, dessen halb verwester Körper von einem Baum baumelt und im sachten Wind leicht hin und her schaukelt. Mit ihren Toten scheinen sie hier nicht gerade zimperlich umzugehen …
Werde ich auch als Festmahl für die Raben enden? Oder werden sie mich verbrennen? Ich kenne die Märchen, die sich um die Halbelfen ranken. Unsere Finger sind begehrte Trophäen, ebenso wie unsere Ohren. Vielleicht schneiden sie mir sämtliche wertvollen Körperteile ab, bevor sie mich auf den Scheiterhaufen werfen. So können sie noch Profit aus mir schlagen, nachdem sie mich wie ein exotisches Tier vorgeführt, gefoltert und getötet haben.
Meine Gedanken werden durch das Wimmern der Frau unterbrochen, die wahrscheinlich auch den Schrei der Raben gehört hat. Sie krümmt sich zusammen und ihre Lippen bilden stumme Worte, als würde sie beten.
Mit lautem Poltern passieren wir das Stadttor. Es stinkt erbärmlich, als wir die Straße der Gerber und Abdecker entlangfahren, die direkt vor dem Gemäuer angesiedelt sind. Gelegentlich hat der Karren Schwierigkeiten, dem Unrat auf der Gasse auszuweichen, um nicht stecken zu bleiben.
Ich drehe den Kopf und versuche meine Nase an die Schulter zu pressen, um dem Gestank wenigstens ein bisschen zu entgehen. Aus den Augenwinkeln bemerke ich, dass die ersten Arbeiter die Straße säumen und mit ihren dreckigen Fingern auf mich zeigen.
Als wir über den gepflasterten Marktplatz fahren, in dessen Mitte ein großer, kunstvoller Springbrunnen steht, bildet sich sogleich eine Menschentraube um den kleinen Gefängniskarren. Manche der Schaulustigen werfen mit fauligem Gemüse und Eiern.