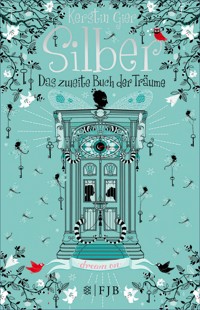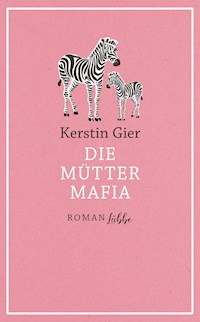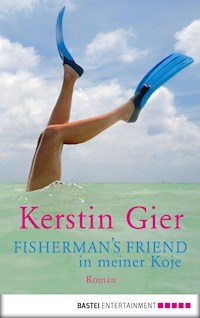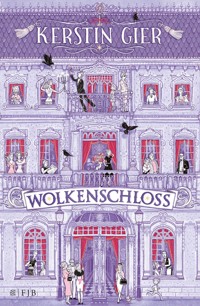
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein magischer Ort in den Wolken. Eine Heldin, die ein bisschen zu neugierig ist. Und das Abenteuer ihres Lebens. Der neue Roman von Bestsellerautorin Kerstin Gier. Hoch oben in den Schweizer Bergen liegt das Wolkenschloss, ein altehrwürdiges Grandhotel, das seine Glanzzeiten längst hinter sich hat. Aber wenn zum Jahreswechsel der berühmte Silvesterball stattfindet und Gäste aus aller Welt anreisen, knistert es unter den prächtigen Kronleuchtern und in den weitläufigen Fluren nur so vor Aufregung. Die siebzehnjährige Fanny hat wie der Rest des Personals alle Hände voll zu tun, den Gästen einen luxuriösen Aufenthalt zu bereiten, aber es entgeht ihr nicht, dass viele hier nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Welche geheimen Pläne werden hinter bestickten Samtvorhängen geschmiedet? Ist die russische Oligarchengattin wirklich im Besitz des legendären Nadjeschda-Diamanten? Und warum klettert der gutaussehende Tristan lieber die Fassade hoch, als die Treppe zu nehmen? Schon bald steckt Fanny mittendrin in einem lebensgefährlichen Abenteuer, bei dem sie nicht nur ihren Job zu verlieren droht, sondern auch ihr Herz.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Kerstin Gier
Wolkenschloss
Roman
Über dieses Buch
Hoch oben in den Schweizer Bergen liegt das Wolkenschloss, ein altehrwürdiges Grandhotel, das seine Glanzzeiten längst hinter sich hat. Aber wenn zum Jahreswechsel der berühmte Silvesterball stattfindet und Gäste aus aller Welt anreisen, knistert es unter den prächtigen Kronleuchtern und in den weitläufigen Fluren nur so vor Aufregung. Die siebzehnjährige Fanny hat wie der Rest des Personals alle Hände voll zu tun, den Gästen einen luxuriösen Aufenthalt zu bereiten, aber es entgeht ihr nicht, dass viele hier nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Welche geheimen Pläne werden hinter bestickten Samtvorhängen geschmiedet? Ist die russische Oligarchengattin wirklich im Besitz des legendären Nadjeschda-Diamanten? Und warum klettert der gutaussehende Tristan lieber die Fassade hoch, als die Treppe zu nehmen? Schon bald steckt Fanny mittendrin in einem lebensgefährlichen Abenteuer, bei dem sie nicht nur ihren Job zu verlieren droht, sondern auch ihr Herz.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Kerstin Gier, Jahrgang 1966, hat 1995 ihr erstes Buch veröffentlicht und schreibt seither überaus erfolgreich für Jugendliche und Erwachsene. Ihre Edelstein-Trilogie, die Silber-Reihe und ihre Vergissmeinnicht-Bände wurden zu internationalen Bestsellern, mehrere Romane von ihr sind verfilmt worden. Die Autorin lebt mit ihrer Familie in der Nähe von Köln.
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
© 2017 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, 60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: bürosüd, München, unter Verwendung einer Illustration von Eva Schöffmann-Davidov
ISBN 978-3-10-490583-9
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung dieses Werks für Text- und Data-Mining im Sinne des § 44b UrhG bleibt explizit vorbehalten.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Widmung]
Prolog
Bienvenue. Welcome. Benvenuto.
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Einige Monate später
Personenverzeichnis
Hotelpersonal
Gäste im Wolkenschloss
Wer sonst noch so vorkommt
Glossar
Dankeschön!
Für Sonja
Hier stand ich also völlig erschöpft im Schnee, während vom Ballsaal Violinenklänge zu uns hinüberwehten. Um meinen Hals trug ich einen Diamanten von fünfunddreißig Karat, der mir nicht gehörte, und in meinen Armen hielt ich ein schlafendes Kleinkind, das mir ebenfalls nicht gehörte.
Irgendwo unterwegs hatte ich einen Schuh verloren.
Es heißt immer, dass man in Notlagen vor lauter Adrenalin weder Schmerz noch Kälte spürt, aber das stimmt nicht. Die Wunde an meiner Schulter pochte wie verrückt, das Blut lief den Arm hinab und tropfte in den Schnee, die Kälte biss schmerzhaft in meinen Fuß. Meine Arm- und Schultermuskeln brannten vom Tragen des Kindes, aber ich wagte nicht, es noch einmal umzubetten, weil es sonst aufwachen und unseren Verfolgern verraten könnte, wo wir uns befanden.
Es heißt auch immer, dass der Verstand in Augenblicken höchster Gefahr am besten arbeitet und einem glasklare Einsichten schenkt. Aber das war bei mir ebenso wenig der Fall. Ich wusste nicht mehr, wer gut und wer böse war. Und die einzige glasklare Einsicht, die ich gerade vorweisen konnte, war, dass Schalldämpfer an Pistolen wirklich den Schall dämpften.
Und dass es ganz sicher bessere Momente für einen Kuss gab als diesen.
Ich hatte keine Ahnung, ob der Junge, der ihn mir gab, zu den Guten oder zu den Bösen gehörte, trotzdem spürte ich, wie meine Kräfte noch einmal zurückkehrten.
»Das wollte ich schon tun, seit ich dich das erste Mal gesehen habe«, flüsterte er.
Bienvenue. Welcome. Benvenuto.
Herzlich Willkommen im
Genießen Sie Ihren Aufenthalt.
1
Mein erster Tag als Kindermädchen drohte, ein totaler Reinfall zu werden.
»Du bist ganz bestimmt das schlechteste Kindermädchen der Welt, Fanny Funke«, meinte auch Don, als ich hektisch an ihm vorbeilief und dabei »Jungs! Das ist nicht komisch! Kommt doch bitte wieder her!« rief.
»Ja, bitte, bitte, bitte!«, äffte Don mich nach. »Sonst werde ich nämlich gefeuert.«
Möglich war das. Und dabei hatte ich nur eine Minute nicht aufgepasst. Zu meiner Verteidigung: Es geht schneller, als man denkt, Kinder im Schnee aus den Augen zu verlieren, wenn sie sich absichtlich wegschleichen und dabei weiße Anoraks, weiße Schneehosen und weiße Mützen tragen. Derartige Kleidung gehörte doch per Gesetz verboten. Weit konnten sie nicht gekommen sein, bergauf war die glitzernde Schneedecke unberührt. Es gab hier auf der Westseite des Hotels allerdings im engeren Umkreis reichlich Verstecke für winzig kleine, schlaue Kinder in Tarnkleidung, sie konnten nicht nur hinter diversen Schneehaufen abgetaucht sein, auch vereinzelt stehende Bäume, Brennholzstapel und Mauervorsprünge boten perfekte Tarnung.
Ich kniff die Augen zusammen, um gegen das Licht anzublinzeln. Für den Abend und über die Weihnachtsfeiertage hatte der Wetterbericht neuen Schneefall angekündigt, aber noch war der Himmel leuchtend blau, und der Schnee funkelte mit den Fenstern und den kupfergedeckten Turm-, Türmchen- und Gaubendächern um die Wette. Unten im Tal hing dagegen schon seit gestern Morgen dichter Nebel. Wetterlagen wie dieser verdankte das Hotel seinen Kosenamen Wolkenschloss.
»Ungewöhnlich still, nicht wahr?« Don Burkhardt junior erinnerte mich daran, dass jetzt keine Zeit war, die Schönheit der Schweizer Berglandschaft zu bewundern. »Nicht, dass die lieben Kleinen schon erfroren sind …«
Don saß auf dem großen Schlitten, mit dem das Feuerholz zum Kellereingang gezogen wurde, baumelte mit den Beinen und leckte an einem Eis in der Waffel, das er sich persönlich in der Küche besorgt haben musste. Das Feuerholz hatte er vor dem »Willkommen im Château Janvier«-Schild einfach in den Schnee gekippt.
Das Eis brachte mich auf eine Idee. »Hey, Jungs! Wollt ihr vielleicht ein leckeres Eis essen?«, rief ich.
Aber es blieb mucksmäuschenstill.
Don kicherte vergnügt. »Du hättest dich nicht durch diesen tschechischen Saisonarbeiter von deinen Pflichten ablenken lassen sollen, Fanny Funke.«
»Heb du lieber das Holz auf, wenn du keinen Ärger bekommen willst«, sagte ich.
Obwohl Don für seine neun Jahre klein und eher schmächtig war und mit seinem Stupsnäschen und den seelenvollen, braunen Augen entzückend harmlos aussah, fürchtete ich mich insgeheim vor ihm. Nichts von dem, was er von sich gab, klang je auch nur ansatzweise altersgemäß, und das war doppelt irritierend, weil er so eine helle Kinderstimme hatte, einen niedlichen Schweizer Akzent und dazu leicht lispelte, und zwar ebenfalls auf die niedliche Art. Seine seltsame Angewohnheit, Menschen grundsätzlich mit Vor- und Nachnamen anzusprechen, manchmal noch ergänzt durch Ortsangaben, Eigenschaftswörter oder das Alter – »Du hast da eine Laufmasche in der Strumpfhose, Fanny Funke, siebzehn Jahre, aus Achim bei Bremen« –, hatte etwas seltsam Bedrohliches an sich, so wie in einem Mafia-Film, wenn jemand »Ich weiß, wo du wohnst«, raunte, um einem dann bei Gelegenheit einen Pferdekopf vor die Tür zu legen. Wenn man Glück hatte.
Don und seine Eltern waren Stammgäste im Hotel, und Don kannte sich hier bestens aus. Den ganzen Tag pflegte er durch das Haus zu stromern, Gespräche zu belauschen und Unheil zu stiften, und dabei benahm er sich, als würde das Hotel mitsamt den Menschen darin ihm gehören. Egal ob Gast oder Personal – Don wusste auf geradezu unheimliche Art und Weise über alles und jeden Bescheid. Selbst wenn er verbotenerweise die Personalakten studiert hatte, wovon ich ausging, war es gruselig, dass er sich das alles bis ins Detail merken konnte. Lastenaufzüge, Büros oder Keller – Don lungerte bevorzugt dort herum, wo Gäste keinen Zutritt hatten, und weil er so klein und süß war, hatte es selten Konsequenzen. Wen er mit seinem unschuldigen Rehblick nicht bezirzen konnte, den schüchterte er ein, indem er ihn beim vollen Namen nannte und wie nebenbei auf seinen schwerreichen Vater, Don Burkhardt senior, und dessen freundschaftliche Beziehungen zu einem der beiden Montfort-Brüder verwies, denen das Hotel gehörte. Jedenfalls machte er das mit mir so. Und auch wenn ich versuchte, es mir nicht anmerken zu lassen, so zeigten seine Mafia-Methoden doch irgendwie Wirkung. Vorgestern erst hatte ich ihn dabei erwischt, wie er seine schokoladenverschmierten Hände an den bestickten Samtportieren im kleinen Vestibül im zweiten Stock abgewischt hatte, ganz bewusst und bedächtig. Meine Empörung darüber hatte er mit einem überlegenen Lächeln quittiert. »Oh, Schulabbrecherin Fanny Funke aus Achim bei Bremen hat offenbar ein Faible für scheußliche Vorhänge!«
Das hatte mich erst recht empört: Alle Vorhänge und Kissen im gesamten Stockwerk waren aus demselben Stoff genäht, wunderschön, tiefrot, bestickt mit Vögeln und Blumenranken in mattem Gold. Man musste kein Fachmann sein, um zu erkennen, wie kostbar sie waren, auch wenn das Rot im Laufe der Jahre vielleicht ein wenig verblasst war. Wenn man vorsichtig mit den Fingern über den Samt strich, dann war es fast so, als würde der Samt einen zurückstreicheln.
»Und überhaupt: Ist es nicht deine Aufgabe, hier alles sauber zu halten, Aushilfszimmermädchen Fanny Funke mit den komischen Sommersprossen?«, hatte Don gefragt. Vorgestern war ich nämlich noch nicht der Kinderbetreuung, sondern dem Housekeeping zugeteilt gewesen. »Was glaubst du eigentlich, wie viel Geld mein Vater jedes Jahr in diesem Hotel lässt? Und was glaubst du, wen sie hier eher rausschmeißen – dich oder mich? An deiner Stelle wäre ich froh, dass es sich nur um Schokolade handelt, und würde mal ganz schnell versuchen, die Flecken rauszukriegen, bevor Fräulein Müller dir wieder die Leviten liest.« (Woher kannte er nur solche Ausdrücke? Nicht mal meine Oma sprach so.)
»Und an deiner Stelle würde ich mal ganz schnell abhauen, bevor ich dir mit dem Staubwedel den Hintern verhaue!«, hatte ich zwar erwidert, aber Don war grinsend davongeschlendert, wohl wissend, dass er gewonnen hatte. Vor Fräulein Müller, der Hausdame, fürchtete ich mich nämlich noch mehr als vor ihm. Und während ich den Schokoladenfleck aus den Samtportieren bürstete, hatte ich tatsächlich ein wenig Dankbarkeit darüber empfunden, dass es sich nur um Schokolade handelte.
»Wenn hier einer Ärger bekommt, dann bist du das«, sagte Don jetzt und leckte an seinem Eis. »Du hast mit Jaromir Novak, achtunddreißig, Schnurrbartträger, geflirtet, anstatt auf die Kinder aufzupassen. Das kann ich bezeugen.«
»Ich habe nicht geflirtet«, stellte ich sofort richtig. »Ich habe Jaromir nur schnell geholfen, diese Lichterkette zu entwirren. Was durchaus zu meinen Aufgabenbereichen gehört.« Ich war ja nicht ausschließlich Kindermädchen, laut Stellenbeschreibung war die Praktikantin im Hotel »Mädchen für alles« und »stets flexibel einsetzbar«.
Don schüttelte den Kopf. »Du hast gelächelt, dir eine Haarsträhne hinters Ohr gestrichen und deine Kehle präsentiert – das alles sind körpersprachliche Merkmale weiblichen Balzverhaltens.«
»Unsinn!«, sagte ich aufgebracht. »Jaromir ist viel zu alt für mich und hat in Tschechien Frau und Kinder, die er sehr liebt.« Und selbst wenn er zwanzig Jahre jünger und Single gewesen wäre, hätte ich niemals mit ihm geflirtet. Ich flirtete grundsätzlich nicht. Ich fand allein schon das Wort »flirten« fürchterlich. »Im Übri…« Ich brach ab. Dons Gesichtsausdruck verriet deutlich, wie sehr er sich darüber freute, dass ich mich so vehement verteidigte. Es bewies ihm einmal mehr, wie ernst ich ihn nahm. Dabei war das bestimmt das Letzte, das ich ihm vermitteln wollte.
»Also, was ist jetzt? Hast du die Zwillinge gesehen oder nicht?«, fragte ich barsch.
Sofort änderte Don seine Taktik. »Ich weiß sogar, wo sie sich versteckt haben.« Er bedachte mich mit einem zutraulichen Augenaufschlag, um den selbst Bambi ihn beneidet hätte. »Ich verrate es dir, wenn du lieb bitte, bitte sagst.«
»Bitte«, sagte ich wider besseres Wissen.
»Zweimal bitte!«, verlangte Don.
»Bitte, bitte«, sagte ich zähneknirschend.
Don lachte erfreut auf. »Ich verrate dir jetzt mal, warum du so ein schlechtes Kindermädchen bist: Du strahlst einfach keine natürliche Autorität aus. Kinder spüren so was.«
»Und ich verrate dir jetzt mal, warum du keine Freunde hast: Du strahlst einfach keine natürliche Nettigkeit aus.« Es war schon aus mir herausgesprudelt, bevor ich merkte, wie gemein es eigentlich war. Beschämt biss ich mir auf die Lippe. Ich musste wirklich das schlechteste Kindermädchen der Welt sein, wenn ich es erstens schaffte, zwei fliegengewichtige Sechsjährige zu verlieren, nur weil ich mich einmal kurz umgedreht hatte, und zweitens das dringende Bedürfnis verspürte, Bambi höchstpersönlich fertigzumachen. Dabei hatte ich den Praktikumsplatz im Hotel vermutlich überhaupt nur bekommen, weil ich meine Erfahrung im Umgang mit meinen zwei kleinen Brüdern ins Feld geführt und so den Eindruck erweckt hatte, besonders patent und kinderlieb zu sein.
»Aua!« Um ein Haar wäre es Don gelungen, mir von seinem Schlitten aus ein Bein zu stellen, aber ich schaffte es, ohne zu fallen, an ihm vorbei. Von wegen kinderlieb! Kinder waren die Pest. Aber es half ja nichts: Zwei davon musste ich jetzt wieder einfangen. Und das dritte würde ich von nun an einfach ignorieren.
»Jungs! Hallo!« Ich versuchte, meine Stimme freundlich und nicht gestresst klingen zu lassen, so, als würden wir einfach nur Verstecken spielen. Nichts rührte sich. Dabei hatten sie vorhin nicht eine Sekunde die Klappe halten können und ununterbrochen in albernen Reimen gesprochen. Wenn mir doch wenigstens ihre blöden Vornamen wieder einfielen! Es war irgendwas Möchtegern-Englisch-Hippes wie … »Josh, Ashley? Wo seid ihr? Wollt ihr den Schneemann denn nicht zu Ende bauen? Ich hab extra eine schöne Karotte für die Nase besorgt.«
Don kicherte wieder. »Nicht mal ihre Namen kennst du, Versager-Fanny. Dein Rüebli kannst du dir sonstwohin schieben. Gib einfach auf!«
Ich tat so, als hörte ich ihn gar nicht. Auf keinen Fall würde ich jetzt aufgeben. In den letzten drei Monaten hatte ich mich schon ganz anderen Herausforderungen gestellt. Und so übel, wie es auf den ersten Blick aussah, lief es hier eigentlich gar nicht. Mein Job war es, die Bauer-Zwillinge (Laramy? Jason?) an der frischen Luft zu bespaßen, während ihre Eltern im Hotel in Ruhe ihre Sachen packen und auschecken konnten, und wenn man es genau nahm, tat ich ja gerade nichts anderes: Diese verdammten Kinder hatten bestimmt einen Heidenspaß, weil es ihnen gelungen war, abzuhauen und sich zu verstecken. An der frischen Luft.
»Schon mal was von Verletzung der Aufsichtspflicht gehört, zukünftige Expraktikantin Fanny Funke?« Don leckte an seinem Eis. »Ich hoffe, du bist gut versichert. An deiner Stelle würde ich beten, dass die beiden nicht in eine Gletscherspalte fallen. Wenn es gleich anfängt zu schneien, können die Suchhunde nicht mal mehr eine Spur aufnehmen.«
Ich widerstand dem Drang, meine Finger in die Ohren zu stecken. Dieses Kind musste der Teufel persönlich sein. Hier gab es meines Wissens gar keine Gletscherspalten, aber ich hörte selber, dass meine Stimme jetzt schrill und ängstlich klang. »Wollt ihr vielleicht zum Abschied noch ein Eichhörnchen streicheln?«
»Darauf fallen die nicht rein.« Don schnippte sein nur halbgegessenes Waffelhörnchen in den Schnee. »Ach, aber ich will mal nicht so sein. Sie sind in die Richtung gerannt.« Er zeigte zur neuen Schlittschuhbahn hinüber, die der alte Stucky und Jaromir in den letzten Tagen neben dem antiken Kinderkarussell gezaubert hatten. »Ich glaube, sie wollen sich im Skikeller verstecken.«
Ganz blöd war ich ja nicht. Anstatt seinem ausgestreckten Zeigefinger zu folgen, stapfte ich entschlossen in die entgegengesetzte Richtung. Und richtig, kaum war ich ein paar Meter gegangen, hörte ich unterdrücktes Kichern und sah einen Zweig der riesigen Halbmondtanne wackeln, in die Jaromir und der alte Stucky in einer waghalsigen Kletterpartie im November Lichterketten gewickelt hatten. Das heißt, Jaromir war geklettert, der alte Stucky hatte die Leiter gehalten. Den Namen Halbmondtanne hatte der Baum, weil die Lichter nur in den dem Hotel zugewandten Ästen verteilt worden waren. Es waren dieselben Lichterketten wie schon vor dreißig Jahren, hatte man mir gesagt, aber da Bäume in dreißig Jahren nun mal wachsen und Lichterketten nicht, reichten sie jetzt nur noch für eine Baumhälfte. Abends strahlte und funkelte deshalb die eine Seite der Tanne mit den Fenstern des Hotels um die Wette, während die zum Tal gewandte Seite dunkel und still mit dem Nachthimmel verschmolz, wie der Mond. Die Halbmondtanne markierte zugleich die Grenze zwischen den gepflegten und beleuchteten Grünflächen und der sich selbst überlassenen Natur. Was aber jetzt, wo alles unter einer dicken Schneedecke lag, ohnehin keine Rolle spielte.
Der Baum war wirklich das perfekte Versteck, wenn man nur einen Meter zwanzig groß war. Die Zweige fächerten sich dicht und ausladend bis über den Boden, darunter war es vermutlich weich und trocken, ein Bett aus Moos und Tannennadeln, das der Schnee bisher nicht erreichen konnte.
Um die Kinder nicht aufzuscheuchen, ging ich nicht direkt auf sie zu, sondern näherte mich in einem unauffälligen Bogen. »Diese superschlauen Bauer-Zwillinge können sich wirklich verdammt gut verstecken«, sagte ich in Bühnenlautstärke. »Zu dumm, dass ich sie nicht finden und ihnen die riesengroße Überraschung zeigen kann, die ich für sie habe. Und die hat nicht nur mit Eichhörnchen zu tun …«
Getuschel unter der Tanne. Ich konnte mir ein Grinsen nicht verkneifen.
Aber die Freude währte nicht lange.
»Lasst euch nicht verarschen, Jayden und Ash Bauer aus Limburg an der Lahn!«, rief Don direkt hinter mir. Er hatte seinen Platz auf dem Holzschlitten verlassen, um mir das Leben weiterhin schwerzumachen. »Sie hat gar keine Überraschung für euch. Und schon gar kein Eichhörnchen! Sie will euch nur einfangen, und dann müsst ihr mit euren Eltern nach Hause fahren, und der Spaß ist vorbei! Haut lieber ab!«
»Jayden und Ash sind so schlau, dass sie niemals auf den doofen Don hören würden«, sagte ich hoffnungsvoll, aber da krabbelten die Kinder schon unter der Tanne hervor und rannten johlend und lachend über den Parkplatz. Don klatschte Beifall. Mir blieb nichts anderes übrig, als ebenfalls loszurennen. Leider liefen meine Schützlinge nämlich in die falsche Richtung, weg vom Hotel hinunter zur Straße. Geschickt sprangen sie über die vom Räumfahrzeug gebildete Barriere aus schmutzigem Schnee und Eis, überquerten die Fahrbahn und kletterten an der gegenüberliegenden Straßenseite erneut über eine Schneewand.
»Nicht! Das ist gefährlich!«, rief ich, während ich hinter ihnen herkraxelte. Es war tatsächlich gefährlich. Die Straße war zwar wenig befahren, weil sie hier oben am Hotel endete, aber sie schlängelte sich wie ein glänzendes, schwarzes Band in abenteuerlichen Serpentinen bis hinab ins Tal und war für sich genommen schon ziemlich steil. Noch viel steiler war der mit Fichten bewachsene Hang, an dem sie sich hochschraubte und den die Kinder nun unter lautem Lachen hinabzuschliddern begannen. Wie kleine schlaue Äffchen hielten sie sich dabei an den tiefhängenden Ästen fest und hangelten sich blitzschnell bergab. Im Gegensatz zu den beiden trug mich die mehrfach angetaute und wieder gefrorene Schneedecke nicht, krachend sank ich bei jedem Schritt mindestens bis zum Knie ein, es war, als ob ich versuchte, über die Karamellkruste einer riesigen, schräg stehenden Schüssel Crème brûlée zu laufen.
»Bleibt stehen«, rief ich verzweifelt. »Bitte!«
»Bitte, Schnitte, Lilaritte, Lilarike, rake, Mitte!«, grölten die Zwillinge fröhlich. Don hatte recht. Ich strahlte absolut keine Autorität aus.
Die Kinder enterten bereits die nächste Serpentine und kletterten erneut über die Fahrbahn.
»Ihr solltet jetzt wirklich stehenbleiben!« Hastig zog ich meinen Fuß aus einem besonders tiefen Schneeloch und versuchte es mit größeren Schritten. »Hier gibt es … Bären!«
»Bären, Schären, Lilamären, Lilarike, rake, huch …« Einer der beiden war hingefallen, rutschte auf seinem Hinterteil mit Schwung gegen den nächsten Baum und lachte sich dabei fast kaputt. Sein Bruder fand das so lustig, dass er sich ebenfalls hinsetzte und versuchte, die Strecke auf seinem Hintern zurückzulegen.
»Macht das nicht!«, schrie ich alarmiert, denn ich sah sie schon ungebremst den steilen Hang hinabsausen, bis sie sich entweder das Genick an einem Baumstamm brachen oder auf der Straße von einem Auto erfasst werden würden. Ich bildete mir ein, bereits ein Motorengeräusch zu hören, und verdoppelte meine Anstrengungen vorwärtszukommen. Dabei verlor ich selber das Gleichgewicht, landete mit dem Bauch im Schnee und verwandelte mich unmittelbar in einen menschlichen Bobschlitten. Die Gewichtsumverteilung und die glatte Oberfläche meines Mantels sorgten dafür, dass ich nun auf der Schneedecke bergab schoss, und weder meine vorgestreckten Arme noch mein Gebrüll – etwas Einfallsloses wie »Naaaaaaaaaaaaiiiiiiin!« – konnten mich stoppen. Ich sauste an den Zwillingen vorbei, mit Schwung über den nächsten Schneewall und landete direkt auf der Fahrbahn. Das alles ging so schnell, dass nicht mal mein Leben in bunten Bildern an mir vorüberziehen konnte.
Die Kinder flogen ebenfalls ungebremst über den Wall und plumpsten auf mich drauf. Ihrem ausgelassenen Lachen nach zu urteilen, hatten sie sich nicht weh getan. Bei mir war ich da nicht so sicher. Aber ehe ich überprüfen konnte, ob ich überhaupt noch lebte, hörte ich Bremsen kreischen. Und kurz darauf eine aufgebrachte Stimme: »Habt ihr den Verstand verloren? Ich hätte euch beinahe überfahren!«
Ich schob eins der Zwillingsbeine aus meinem Gesicht und versuchte, meinen Kopf zu heben. Nur wenig mehr als einen Meter von uns entfernt befand sich die Stoßstange eines Autos. Es war ein dunkelgrüner Kleinwagen mit Züricher Kennzeichen. Die Tür war weit aufgerissen, und der Fahrer, ein Junge nicht viel älter als ich, stand direkt vor uns. Er sah zu Tode erschrocken aus, was ich absolut verstehen konnte.
Vor lauter Schreck begann ich, nachträglich mit den Zähnen zu klappern. Das war wirklich verdammt knapp gewesen.
»Ist jemand verletzt?«, fragte der Junge.
Ich rappelte mich auf und war überrascht, dass das funktionierte. Es war zwar eine harte Landung gewesen, aber der gefütterte Mantel und die dicken Handschuhe hatten mich vor Abschürfungen und Schlimmerem bewahrt. »Ich glaube nicht«, sagte ich und unterzog auch die Zwillinge einer schnellen Musterung. Nirgends Blut, keine verdrehten Gliedmaßen, die Schneidezähne hatten schon vorher gefehlt, nur strahlende Augen und rote Wangen. So sahen glückliche Kinder aus.
»Noch mal!«, riefen sie. »Das war so toll!«
Sicherheitshalber krallte ich meine Hände in die Kapuzen ihrer immer noch blütenweißen Anoraks.
»Das war absolut unsinnig und gefährlich«, schimpfte der Junge. »Ihr könntet jetzt tot sein.«
Oh Gott, ja. »Das ist absolut richtig«, brachte ich unter Zähneklappern heraus. »Es tut mir wirklich leid. Nur, wenn man auf dem Hang einmal ins Rutschen gerät, dann ist es geradezu unmöglich, wieder …«
»Und ich wäre schuld«, fiel mir der Junge ins Wort. Er hatte mir gar nicht zugehört und sprach eindeutig mehr zu sich selber als zu mir. Finster starrte er an uns vorbei ins Leere. »Es gäbe ein Gerichtsverfahren, in dem alle Zeugen tot wären, ich müsste wahrscheinlich ins Gefängnis, mein Führerschein würde eingezogen, und mein Vater …« Schaudernd brach er ab.
Ich räusperte mich. »So gesehen sollten wir uns einfach nur freuen, dass wir alle noch leben!« Weil das Zähneklappern nachgelassen hatte, wagte ich ein Lächeln. Ich hätte ihm auch gern die Hand auf den Arm gelegt, um ihn aus seiner düsteren Parallelweltvision zu holen, aber ich wagte es nicht, die Kinder loszulassen. »Wie gesagt, es tut mir entsetzlich leid, dass wir dir so einen Schreck eingejagt haben. Könntest du uns netterweise in deinem Auto mit nach oben zum Hotel nehmen? Du wolltest doch dorthin, oder?« Natürlich wollte er dorthin, sonst gab es ja hier oben nichts. Wahrscheinlich war er einer der sechs zusätzlichen Servicekräfte, die für die Weihnachtsferien fürs Restaurant angeheuert worden waren.
»Ihr seid Gäste aus Deutschland, ja?«
»Ja, pa, kaderah, kaderlila, lula, schna«, sagte Ash. Oder vielleicht war es auch Jayden. Sie sahen absolut identisch aus. Der Junge nickte, als würde das alles erklären. Er öffnete den beiden Kleinen die Tür zum Rücksitz. Sicherheitshalber ließ ich ihre Kapuzen erst los, als sie angeschnallt waren.
»So! Das wäre geschafft.« Erleichtert schlug ich die Tür zu und lächelte den Jungen dankbar an. »Kindersicherungen! Die beste Erfindung seit der Druckerpresse.«
»Deine Brüder rennen wohl gern weg, was?«
»Oh, das sind gar nicht meine Brüder. Ich bin kein Hotelgast, ich bin die Jahrespraktikantin, und heute ist mein erster Tag in der Kinderbetreuung.« Ich lachte. »Nicht mein bester erster Tag, wie du sicher gemerkt hast. Ich und Kinder – das ist keine gute Kombination. Um ehrlich zu sein, hat es mir sogar in der Wäscherei besser gefallen, obwohl ich mich gleich am ersten Tag an der Heißmangel verbrannt habe. Und eine Serviette mit Monogramm habe ich auch ruiniert.« Normalerweise war ich bei Fremden eher nicht so gesprächig, das mussten der überstandene Schreck sein und die pure Freude, noch unter den Lebenden zu weilen. Außerdem hatte der Junge irgendwie ein vertrauenswürdiges Gesicht. »Erzähl bloß keinem, dass diese Kinder unter meiner Aufsicht fast überfahren worden wären, ja? Die feuern mich sonst.« Ich zog meinen Handschuh ab und streckte ihm meine Hand hin. »Ich bin übrigens Fanny. Fanny Funke.« Es fehlte nicht viel, und ich hätte »Schulabbrecherin aus Achim bei Bremen« hinzugefügt, so sehr hatte Don Burkhardt junior mich schon geprägt.
»Ben.« Der Junge ergriff meine Hand und schüttelte sie. Mein Redeschwall schien ihn ein bisschen entspannt zu haben, denn jetzt lächelte er. »Ben Montfort.«
»Ach, lustig«, sagte ich. »Die Hotelbesitzer heißen auch Montfort mit Nachnamen. Roman und Rudolf Montfort. Sie sind Brüder …«
Oh Gott. Oh. Gott. Ich starrte ihn entsetzt an. »Bitte, bitte sag, dass du nicht mit ihnen verwandt bist.«
Ben hob bedauernd die Schultern an. »Tut mir leid«, sagte er.
2
Mir tat es auch leid. Oder besser gesagt: Ich tat mir leid. Und zwar sehr. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre, mit zwei Kindergartenkindern, die man meiner Obhut anvertraut hatte, auf die Straße zu rutschen, nein, es musste natürlich ausgerechnet der Sohn des Hotelbesitzers sein, der uns um Haaresbreite überfahren hatte.
Während ich bedrückt um das Auto herumging, um auf der Beifahrerseite einzusteigen, ließ ich meinen Wortschwall noch mal Revue passieren. Gut, ich hatte ihm zwei Kündigungsgründe in weißen Kapuzen mitsamt einer ruinierten Monogrammserviette auf dem Silbertablett serviert, aber es hätte noch schlimmer sein können. Wenn ich beispielsweise gesagt hätte: »Montfort – wie die Hotelbesitzer? Rudolf und Roman, oder wie ich sie nenne: den rückgratlosen Rudi und den reizbaren Roman.«
Auf dem Beifahrersitz lag eine Papiertüte voller Möhren, die ich auf den Schoß nahm, bevor ich mich hinsetzte.
Ben musste der Sohn vom reizbaren Roman sein, dem Älteren der beiden Brüder. Ich wusste, dass er einen Sohn aus erster Ehe hatte, der bei seiner Mutter in Zürich lebte, aber ich hatte mir eher einen kleinen Jungen vorgestellt, keinen fast erwachsenen Mann. Der rückgratlose Rudi hatte keine Familie, er wohnte ganz allein in einem kleinen Apartment unterm Dach im fünften Stock des Hotels. Denise von der Rezeption hatte mir erzählt, es sei allgemein bekannt, dass er in der Jugend unter tragischen Umständen seine große Liebe verloren habe und seitdem wie ein Mönch lebte. Welche tragischen Umstände das waren, wusste Denise leider nicht, doch die Geschichte passte zu Rudolf Montforts kraftloser, nach vorn geneigter Haltung und seinem bekümmerten Blick. Er nickte aber immer freundlich, wenn man ihm begegnete, und schenkte jedem ein melancholisches Lächeln.
Das Lächeln seines Bruders Roman hingegen war ausschließlich für die Hotelgäste reserviert, als Angestellter wurde man von ihm im besten Fall komplett übersehen, im schlimmsten Fall zur Schnecke gemacht, manchmal aus den nichtigsten Gründen. Bis jetzt hatte er mich immer geflissentlich ignoriert, aber ich fürchtete mich schon seit September vor dem Tag, an dem ich das Opfer eines seiner Wutanfälle sein würde.
Möglicherweise war dieser Tag ja heute gekommen. Wenn Roman Montfort Leute wegen eines Zahnpastaflecks auf der Uniform eine Viertelstunde lang anbrüllte und einen Angestellten feuerte, weil er Kippen vor der Hintertür fallengelassen hatte, was würde er erst mit jemandem tun, der Gäste-Kinder vor das fahrende Auto seines Sohnes warf?
Während Ben den Motor startete, betrachtete ich ihn von der Seite. Eine gewisse Familienähnlichkeit war nicht zu leugnen, blaue Augen, hohe Stirn, kräftige Nase, energisches Kinn, dichtes, braunes Haar – alles wie bei seinem Vater. Nur in jung. Und in nett. Sogar im Profil hatte er ein vertrauenswürdiges Gesicht.
Trotzdem – oder gerade deswegen – war Vorsicht angesagt. Ich würde mich hüten, ihn nur wegen seines netten Gesichts harmlos zu finden. Er konnte mich immer noch bei seinem Vater verpetzen. Der Apfel fiel ja bekanntlich nicht weit vom Stamm …
Vielleicht vergaß er, was eben passiert war, wenn ich ihn in ein lustiges Gespräch verwickelte. Ich knisterte mit der Möhrentüte. »Wirklich vorausschauend von dir, ein paar Schneemannnasen mitzubringen. Wo es doch heute Abend frischen Schnee geben soll.«
Prompt lächelte er wieder. »Die Schneemannnasen sind für Gäschdi und Wäschdi.«
Ach, herrje, er machte es einem wirklich schwer, vorsichtig und misstrauisch zu bleiben. Jetzt war er auch noch tierlieb!
»Gäschdi« und »Wäschdi« waren die hoteleigenen Pferde, zutrauliche Kaltblüter der Rasse Noriker, die mit vollständigem Namen »Große Geste« und »Weiße Weste« hießen. In den Sommermonaten pflegten sie mit ihren wehenden, hellen Mähnen über die Almwiesen zu galoppieren und den glockenbehängten, flauschigen Kühen in Sachen klischeehafte Alpendekoration die Show zu stehlen, im Winter zogen sie (angeblich mit Begeisterung) den altmodischen Schlitten, den der alte Stucky für die Gäste auf Hochglanz poliert hatte. Ich hoffte immer noch, dass das Praktikum auch eine Zeit im Pferdestall vorsah, denn Große Geste und Weiße Weste waren die freundlichsten Pferde, die ich bisher kennengelernt hatte.
»Oh, da werden sie sich freuen«, sagte ich. »Der alte Stucky hat ihnen eine Diät verordnet, weil sie im Stall angeblich zu viel Fett angesetzt haben.« Daran war ich vermutlich nicht ganz unschuldig, denn ich hatte den beiden ab und zu Bananen vorbeigebracht, die sie sehr liebten. Und mich liebten sie jetzt auch. Sie schnaubten immer fröhlich, sobald ich den Stall betrat, und ich kam mir schäbig vor, wenn ich nichts für sie dabei hatte. »Dabei müssen sie in den nächsten Wochen noch genug arbeiten, bei Monsieur Rocher sind schon zig Schlittenfahrten-Reservierungen eingegangen.«
»Und es sind immer die dicksten Leute, die sich ziehen lassen.« Ben seufzte. »Als ich klein war, konnte ich das nur schwer ertragen, am liebsten hätte ich den Schlitten geschoben.« Er steuerte das Auto bergauf durch die Serpentinen, so langsam, dass die Zwillinge auf dem Rücksitz: »Schneller, Keller, Kaderrella, kaderlila, lula, Teller!« riefen, um dann kichernd die Köpfe zusammenzustecken.
»Du besuchst also deinen Vater?«, fuhr ich etwas mutiger fort. »Soviel ich weiß, ist er heute gar nicht im Haus.« Roman Montfort wohnte nicht im Hotel, sondern – das wusste ich ebenfalls von Denise – mit seiner Freundin in Sion, etwa eine dreiviertel Stunde Autofahrt entfernt. Da er sich nicht an feste Arbeitszeiten hielt, wusste man nie, ob und wann er im Wolkenschloss auftauchen und wie lange er bleiben würde. Heute hatte ich ihn auf jeden Fall noch nicht gesehen. Ein weiterer Grund, dankbar zu sein: Ich hätte ja auch ihm vors Auto fallen können.
»Das ist nicht schlimm. Ich bin die ganzen Ferien hier«, sagte Ben.
»Hier? Aber doch nicht im Hotel!«, entfuhr es mir.
»Tag und Nacht.« Er warf mir einen kurzen Seitenblick zu. »Was dagegen?«
Nein, natürlich nicht. Ich fragte mich nur, wo er schlafen würde. Vielleicht bei seinem Onkel? Über die Ferien war das Hotel restlos ausgebucht, jedes der fünfunddreißig Zimmer und alle Suiten waren bis auf das letzte Bett besetzt, in 212 und 213 hatten wir sogar noch ein Zusatzbett geschoben. Und auch die Schlafplätze in den Personalquartieren waren durch die Aushilfskräfte voll belegt.
»Hast du ein festes Zimmer im Hotel?«, fragte ich vorsichtig nach.
Ben lachte auf. »Ja, klar, ich hab die Herzoginnen-Suite gebucht«, sagte er höhnisch. »Keine Sorge, bisher hab ich noch jedes Mal einen Platz zum Schlafen gefunden. Schließlich bin ich nicht zum Schlafen, sondern zum Arbeiten hier, wie mein Vater sagen würde.«
»Zum Arbeiten?«, wiederholte ich.
»Ja, zum Arbeiten, stell dir mal vor.« Ben klang jetzt ein bisschen gereizt. »In meinen Schulferien. Wie immer. Das hier sind meine letzten Weihnachtsferien vor der Matura, oder vor dem Abitur, wie ihr in Deutschland sagt. Alle anderen dürfen ausschlafen und feiern und werden von ihren Eltern verwöhnt, nur ich werde jeden Tag um halb sechs aufstehen und krieg nicht mal Geld dafür.«
»Wem sagst du das?«, murmelte ich, doch Ben hatte sich so in Rage geredet, dass er mich gar nicht hörte.
»Du bist vielleicht die Jahrespraktikantin, aber ich bin hier so was wie ein Lebenspraktikant. Onkel Rudolf hat mich dieses Mal als Vertretung für Denise an der Rezeption vorgesehen, ich könnte allerdings genauso gut das Schwimmbad chloren oder Betten beziehen. Eine Heißmangel kann ich auch bedienen, sogar die dicke Trulla.«
»Oh«, sagte ich beeindruckt. Die dicke Trulla hatte Walzen mit einem Durchmesser von einem Meter sechzig und war neben der müden Berta, einer Waschmaschine aus dem vorigen Jahrhundert, in deren Trommel eine Kleinfamilie hätte wohnen können, das Heiligtum der Wäscherei. »Dann muss Pavel wirklich große Stücke auf dich halten.«
»Das tut er.« Ben lächelte stolz, und jetzt war er mir endgültig sympathisch, Sohn vom reizbaren Roman hin oder her. Ein warmes Gefühl der Verbundenheit ergriff mich. Wenn er ein Freund von Pavel war, dann war er auch mein Freund.
Pavel war der Herr über die Waschmaschinen, Trockner, Mangeln und Faltmaschinen im Keller des Hotels, ein riesiger, muskelbepackter, bärtiger Glatzkopf mit Tattoos von Totenköpfen, Schlangen und Drudenfüßen auf den Armen, den man sich gut als Türsteher in einem zwielichtigen, satanischen Nachtclub vorstellen konnte. Jedenfalls bis man ihn hingebungsvoll den Kragen einer Zimmermädchenuniform bügeln sah und dazu »Ave Maria« singen hörte. Pavel hatte einen wunderbaren, klaren Bariton, und seine Kantaten und Opernarien waren legendär. Man konnte entweder zuhören oder mitsingen. (Hier hatte sich das Musiktheater-Abo, das meine Großeltern mir zu meinen Geburtstagen zu schenken pflegten, endlich mal als nützlich erwiesen.) Am Ende meiner Zeit in der Wäscherei hatten wir das Duett von Papageno und Pamina aus Mozarts Zauberflöte, begleitet von sechs Waschmaschinen im Schleudergang, ziemlich gut drauf. Auch wenn Pavel anstatt »Die süßen Triebe mitzufühlen, ist dann der Weiber erste Pflicht« in seinem gebrochenen Deutsch immer sang: »Die süßen Tiere mitzuführen, ist dann der Weber Äste Ficht«, was ich persönlich auch viel hübscher fand, rätselhaft und tiefsinnig.
Ben nahm die letzte Serpentine mit etwas mehr Schwung, und wir verließen den schattigen Wald. Vor uns, auf dem von der Mittagssonne beschienenen Hochplateau, lag das Wolkenschloss in seiner ganzen Schönheit, mit seinen zahlreichen hohen Fenstern, den Türmen und den steinernen Simsen und Balustraden. Wie immer bei diesem Anblick musste ich kurz Luft holen, und ich hatte den Eindruck, Ben ging es genauso. Aber vielleicht hatte sein tiefer Seufzer auch andere Gründe.
Er steuerte an der Einfahrt zur Tiefgarage vorbei, und anstatt die gewundene Auffahrt bis zum Portal zu nehmen, hielt er auf dem vorgelagerten Parkplatz. »Ich kann euch natürlich auch direkt bis vor die Drehtür fahren.« Er grinste mich von der Seite an.
Ich grinste zurück. »Sehr nett, aber wir gehen von hier aus zu Fuß, nicht wahr, Jungs?«
»Da vorne ist der doofe Don.« Die Zwillinge zeigten auf Don Burkhardt junior, der mit verschränkten Armen vor der Halbmondtanne in der Sonne stand und auf etwas zu warten schien.
Auf uns, um genau zu sein.
Ich stöhnte. »Dem dürft ihr gern die Zunge rausstrecken«, sagte ich, was die Zwillinge sofort ausgiebig taten. Ein bisschen leckten sie dabei auch die Scheiben von Bens Auto ab.
»Du hast es pädagogisch echt drauf.« Ben kniff die Augen zusammen, um Don näher in Augenschein zu nehmen. »Ist das etwa der kleine Psycho von den Burkhardts?«
»Genau der.«
Don hatte uns entdeckt und schlenderte neugierig näher.
»Die sind schon seit fast drei Wochen hier, weil ihre Villa in Bern renoviert wird. Ich frage mich die ganze Zeit, wie sie es angestellt haben, das Kind so lange aus der Schule zu nehmen. In Deutschland würde das nicht so leicht gehen.«
Ben zuckte mit den Achseln. »Wahrscheinlich hat der alte Burkhardt den Direktor bestochen. Und wenn das nicht reicht, dann kauft er einfach die ganze Schule. Er kauft doch alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist.«
Es klang ein bisschen bitter, und ich hätte liebend gern nachgefragt, aber die Kinder hatten sich schon abgeschnallt und stiegen aus dem Auto. Ich beeilte mich, hinterherzuspringen und griff reflexartig nach den weißen Kapuzen. »Auf Donni reimt sich übrigens Pony und Mülltonni«, sagte ich.
Ich hörte Ben laut auflachen. »Du bist wirklich extrem kinderlieb.«
Ich steckte den Kopf noch mal zurück ins Auto. »Dafür hab ich aber ein Händchen für die müde Berta. Frag Pavel!« Wieder hätte ich Ben gern die Hand geschüttelt, doch meine Finger waren ja in die Kapuzen gekrallt, deshalb senkte ich nur meine Stimme und sagte ernst: »Vielen Dank. Dafür, dass du uns nicht überfahren hast. Und dafür, dass du mich nicht verpetzt.«
Für einen Moment schaute er genauso ernst zurück. »Das tut man nicht, so unter Praktikanten«, erwiderte er.
Ich strahlte. Hatte ich es doch gewusst: Jemand, dem Pavel die dicke Trulla anvertraute, konnte einfach kein schlechter Mensch sein.
»Ich bin froh, dass du nett bist, obwohl du so einen oberfie…«, begann ich überschwänglich, aber dann stockte ich. Vielleicht war es bei aller Sympathie doch noch ein bisschen zu früh, ihm zu sagen, wie froh ich darüber war, dass er nicht nach seinem oberfiesen Vater zu kommen schien. »… so einen Schreck gekriegt haben musst, vorhin«, beendete ich den Satz ein wenig lahm und ließ die Tür zufallen.
»Ach, sieh an. Hat Fanny Funke aus Achim bei Bremen etwa die Kinder, die sie beaufsichtigen sollte, ohne Kindersitz in der Schrottkarre eines Fremden transportiert?« Don war in der Zwischenzeit bei uns angekommen. Er sah Bens Auto nach, das in den Weg abbog, der zum Pferdestall führte. Offenbar wollte Ben das mit den Möhren sofort erledigen.
Don drehte sich um. »Ob das Herr und Frau Bauer aus Limburg an der Lahn gut finden? Willst du sie fragen, oder soll ich das tun? Da kommen sie nämlich schon.«
Mit einem schadenfrohen Grinsen zeigte er auf den schneeweißen Mercedes der Bauers, der soeben auf den Parkplatz rollte und neben uns stehen blieb. Frau Bauer stieg aus und wedelte aufgekratzt mit ihrer weißen Dolce & Gabbana-Tasche. »Huhu! Da seid ihr ja, meine kleinen Schneeflöckchen. Das passt ja perfekt. Hattet ihr denn Spaß mit dem netten Kindermädchen?«
»Von wegen nettes Kindermädchen! Seien Sie lieber mal froh, dass die beiden überhaupt noch leben«, sagte Don, aber Frau Bauer konnte ihn nicht verstehen, weil der eine Zwilling laut »Donni, Pony, kaderonni, kaderike, rake, Mülltonni!« krähte und der andere: »Ich will noch maaaaaal!«
Herr Bauer war ebenfalls ausgestiegen und drückte mir jovial einen zusammengekniffenen Geldschein in die Hand. »Vielen Dank, dass Sie sich so gut um unsere kleinen Wildfänge gekümmert haben.«
»Hahaha«, sagte Don. »Das ist ja so, als würde man sich bei einem Hai dafür bedanken, dass er einem nur den kleinen Zeh und nicht gleich das ganze Bein abgebissen hat.«
Herr Bauer beachtete ihn glücklicherweise gar nicht, weil sich seine Söhne an seine Beine hängten und irgendwas von einer megasteilen Superrutsche plapperten.
»Das hab ich doch gern getan«, versicherte ich, und in diesem Moment meinte ich es sogar ernst. Voller Zuneigung sah ich zu, wie – verdammt, wie hießen sie denn jetzt noch gleich? – mit ihren Eltern ins Auto stiegen und winkend davonfuhren.
Als sie talwärts um die Kurve verschwunden waren, stieß Don einen enttäuschten Seufzer aus. »Du hast übrigens einen Tannenzapfen im Haar, Fanny Funke, und das sieht echt bescheuert aus«, sagte er dann.
Ich zwang mich, mir nicht in die Haare zu greifen, sondern entrollte stattdessen den Geldschein, den Herr Bauer mir zugesteckt hatte. Es waren einhundert Schweizer Franken. Ich schnappte nach Luft.
»Gibt’s doch nicht«, sagte Don.
Gab es doch. Ha! »Ach, so übel hat sich mein erster Tag als schlechtestes Kindermädchen der Welt gar nicht entwickelt.« Obwohl ich genau wusste, dass es dumm war, diesen kleinen Moment des Triumphes so auszukosten, konnte ich nicht widerstehen, Don sanft mit der Hand über den Scheitel zu streicheln. »Oder was meinst du, kleiner Donni?«
Don kniff kurz seine Lippen zusammen (selbst das sah bei ihm niedlich aus), dann lächelte er. »Glücklicherweise fangen die Ferien ja erst an«, sagte er und lispelte noch ein bisschen stärker als üblich. Ich wollte es nicht, aber ich spürte, wie meine Arme sich mit Gänsehaut überzogen. Dons Lächeln vertiefte sich. »Weißt du was? Ich sage meinen Eltern, dass ich ab morgen auch ein bisschen Kinderbetreuung brauche. Bestimmt macht ihr ganz tolle Spiele mit uns.« Und mit einem besonders treuherzigen Blick aus feuchten, braunen Rehaugen fuhr er fort: »Irgendwie habe ich das untrügliche Gefühl, dass du in den nächsten Tagen noch einige unerfreuliche Dinge erleben wirst, Fanny Funke.«
Es war wie verhext, aber dieses Gefühl hatte ich nun leider auch.
3
Ich schlich mich durch den Skikeller ins Hotel und huschte über die Hintertreppen hinauf zu meinem Zimmer, in der Hoffnung, niemandem zu begegnen, der mein derangiertes Äußeres bemängeln würde. Am allerwenigsten wollte ich von Fräulein Müller erwischt werden. Das antiquierte »Fräulein« passte ganz und gar nicht zu ihrer imponierenden, schlanken und makellosen Erscheinung, und sie war mit Anfang vierzig eigentlich auch viel zu jung, um sich noch an eine Zeit zu erinnern, in der man unverheiratete Frauen ungestraft »Fräulein« nennen durfte. Trotzdem bestand sie mit Nachdruck auf dieser Anrede, und was eigentlich lächerlich und unemanzipiert hätte klingen müssen, wirkte bei ihr respekteinflößend und einschüchternd. Assoziationen zu »Fräulein Rottenmeier« aus Heidi waren sicher gewollt, sie war genauso unerbittlich.
Einmal hatte sie mich zurück in den Waschraum geschickt, nur weil die Haargummis in meinen Zöpfen unterschiedliche Farben gehabt hatten.
»Wir sind hier doch nicht bei den Hottentotten«, hatte sie mit angewiderter Stimme gesagt. »Was sollen denn die Gäste denken? Das ist ein ehrwürdiges Haus.«
Obwohl ich nicht wusste, wer oder was die Hottentotten überhaupt waren, hatte mich tiefe Scham ergriffen, und um die Ehre und Würde des Hauses nicht noch einmal zu gefährden, hatte ich sofort alle Haargummis außer den schwarzen aussortiert.
Eins davon musste ich vorhin bei meiner Rutschpartie im Wald verloren haben, mein ordentlicher Pferdeschwanz hatte sich aufgelöst, die Haare hingen wirr und voller Fichtennadeln über meine Schultern. Ich musste nicht in den Spiegel schauen, um zu wissen, dass selbst die Hottentotten bei meinem Anblick tadelnd mit der Zunge geschnalzt hätten.
Aber ich hatte Glück. Ich traf unterwegs lediglich die Verbotene Katze, die sich vor mir auf den Boden drapierte, um am Bauch gekrault zu werden. Die Verbotene Katze hieß so, weil es sie eigentlich gar nicht geben durfte. Haustiere waren im Hotel generell untersagt, aber weil Roman Montfort Katzen hasste, waren Katzen eben ganz besonders verboten. Niemand wusste, woher die Verbotene Katze gekommen war, Monsieur Rocher, der Concierge, der alle Geheimnisse des Hotels kannte, behauptete jedenfalls, sie sei schon immer da gewesen. Und so benahm sie sich auch: als gehöre ihr das ganze Haus. Sie selber aber gehörte scheinbar niemandem. In der Küche holte sie sich Futter ab, und wenn sie Streicheleinheiten brauchte, so wie jetzt, dann suchte sie sich eben jemanden, der sie kraulte. Ansonsten pflegte sie höchst dekorativ auf Fensterbänken, Stufen und Sesseln herumzusitzen oder -liegen und sich malerisch ins Ambiente einzufügen. Obwohl sie sich frei durch das Haus bewegte und durchaus exponierte Schlafplätze aufsuchte, hatte Roman Montfort sie merkwürdigerweise noch nie zu Gesicht bekommen. Manchmal, das hatte ich schon mit Staunen beobachtet, verpassten sie sich nur um wenige Sekunden, als ob die Verbotene Katze genau wüsste, wann der Hotelbesitzer auftauchen würde und sie geruhsam davonschlendern musste. Weil ihn ab und an auch Gäste auf die hübsche braunrotgetigerte Katze ansprachen, die sie angeblich im dritten Stock gestreichelt oder im Ballsaal auf dem Flügel schlafen gesehen hatten, hegte Roman Montfort immer wieder mal den Verdacht, jemand vom Personal könne sein Verbot missachtet und heimlich eine Katze angeschafft haben. Er besuchte dann unangekündigt die Personalquartiere und drohte demjenigen, der es wagte, sich seinem Katzenverbot zu widersetzen, »etwas viel Schlimmeres als nur die Kündigung« an. (Was das sein konnte, darüber gingen die Spekulationen weit auseinander.) Aber da er noch nie eine Katze im Hotel gesehen hatte, fühlte er sich sicher auch ein wenig paranoid. Ich an seiner Stelle hätte jedenfalls geglaubt, meine eigenen Leute würden Katzenattrappen aufstellen, um mich zu ärgern und in den Wahnsinn zu treiben. So oder so war es das reinste Wunder, dass in all den Jahren noch niemand vom Personal darauf gekommen war, die Verbotene Katze an den Chef zu verraten, denn bestimmt würde er dafür eine Beförderung springen lassen.
Nach der kleinen Streichelpause gelangte ich über Schleichwege hinauf in die Personalquartiere im Südflügel, ohne Fräulein Müller über den Weg zu laufen.
Schleichwege und Hintertreppen, sogar versteckte Aufzüge gab es im Wolkenschloss reichlich, ich hatte Wochen gebraucht, sie zu entdecken, und obwohl ich mich jetzt bestens auskannte, war ich sicher, es gab immer noch jede Menge unerforschtes Terrain, vor allem im Keller, der wie ein mehrstöckiges Labyrinth tief in den Fels hineingebaut worden war. Es hielt sich hartnäckig die Legende, dass es im Hotel spukte, und ich war nur allzu bereit, das zu glauben. Voller Begeisterung hatte ich mir jede Gespenstergeschichte angehört, die man mir erzählt hatte. Neben einem dubiosen »Bäärggeischt«, den der alte Stucky immer dann gesehen hatte, wenn er zu viel vom selbstgebrannten Birnenschnaps seines Schwagers getrunken hatte, gab es die Weiße Dame, die nachts durch das Haus schweben und die Kronleuchter zum Klirren bringen sollte, auf der Suche nach einer verwandten Seele. Die Weiße Dame war ein Gast im Hotel gewesen, so die Legende, eine unglücklich verheiratete junge Frau, die sich mit gebrochenem Herzen aus dem obersten Turmfenster gestürzt hatte. Und nun gab es zwei verschiedene Versionen: Die eine besagte, dass die Weiße Dame erst dann Ruhe finden würde, wenn es ihr gelänge, eine unglückliche Seele dazu zu verführen, ebenfalls aus dem Turm zu springen, in der anderen (deutlich sympathischeren) Version wollte sie lediglich die Tränen trocknen, die aus Liebeskummer vergossen wurden. Weil kein Mann es wert sei, sich seinetwegen aus dem Fenster zu stürzen.
Denise von der Rezeption schwor Stein und Bein, dass sie mal Streit mit ihrem Freund hatte und dann mitten in der Nacht etwas Durchscheinendes, Weißes durch das Foyer hatte schweben sehen, das ihr zugewinkt hatte. Aber sie gab zu, dass sie kurz eingenickt war, als das passierte. Die anderen kannten immer nur jemanden, der jemanden kannte, der der Weißen Dame schon mal begegnet war.
Nur Monsieur Rocher, der Concierge, sagte, die Legende sei völliger Unsinn, es habe sich in diesem Hotel noch nie jemand aus dem Turmfenster oder irgendeinem anderen Fenster gestürzt, egal aus welchem Grund.
Wahrscheinlich hatte er recht – Monsieur Rocher hatte meistens recht –, aber schade war das trotzdem. Ich wäre viel lieber einem waschechten Geist begegnet als so mancher lebenden Person in diesem Haus.
Der Korridor in den Personalquartieren war menschenleer. Zufrieden zog ich die Tür mit der Aufschrift »privée«, »Nur Personal« und »Durchgang verboten« hinter mir zu und hastete zu meinem Zimmer. Ich hatte jetzt offiziell drei Stunden Freizeit, bevor ich um 18 Uhr die Abendschicht im Wellnessbereich antreten musste. Wenn ich mich mit dem Umziehen beeilte, schaffte ich es, Pavel seine geliebte Apfel-Zimt-Torte in die Wäscherei zu bringen und rechtzeitig wieder im Foyer zu sein, um mit Monsieur Rocher in der Concierge-Loge den Nachmittagskaffee zu trinken und dabei möglichst viel über die anreisenden Gäste zu erfahren. Wann immer es ging, versuchte ich, meine Pause bei ihm zu verbringen, denn danach war ich nicht nur mit wunderbaren Anekdoten und nützlichen Informationen versorgt, sondern – keine Ahnung, wie er das jedes Mal anstellte – mit Zuversicht und guter Laune erfüllt. Monsieur Rocher war für mich so etwas wie die Seele des Wolkenschlosses. Gleich an meinem ersten Tag hatte er mich getröstet, meine verbrannte Hand behandelt und mir versichert, dass ich erstens keine Versagerin sei und Pavel und ich zweitens ganz bald beste Freunde werden würden. Egal, was er mit seiner leisen, sanften Stimme sagte, man musste es ihm einfach glauben. Und von seinem unglaublichen Wissen über das Hotel und die Gäste profitierte ich nur zu gern.
Am neugierigsten war ich auf den alten britischen Schauspieler (bei dessen Name bisher alle außer mir »ach der!« gerufen hatten) und auf die Familie eines Textilmoguls aus South Carolina, für die wir sechs Zimmer und Suiten mit insgesamt sechzehn Betten (sogar siebzehn, wenn man das Babybett in Nummer 210 dazuzählte) hergerichtet hatten. Außerdem wollte heute schon die berühmte ehemalige Goldmedaillengewinnerin im Eiskunstlauf anreisen, die die Moderation des Silvesterballs übernehmen würde. Sie war das erste Mal im Château Janvier und hatte darauf bestanden, ihre beiden Zwergpudel mitzubringen.
»Ach, da bist du ja, Prakti!« Zu früh gefreut. Es war zwar nicht Fräulein Müller, die plötzlich aus den Waschräumen geschossen kam und sich vor mir aufbaute, bevor ich meine Zimmertür erreichen konnte, doch Hortensia war beinahe genauso schlimm. Wenn nicht noch schlimmer. Sie war erst seit zwei Tagen hier, aber offenbar hatte sie schon in der ersten Minute beschlossen, mich zu hassen, warum auch immer. Sie und ihre drei Freundinnen Camille, Ava und Namevergessen waren Studentinnen einer Hotelfachschule in Lausanne, die Fräulein Müller zur Verstärkung ihres Etagenteams angefordert hatte. Bisher hatte ich noch nicht herausfinden können, ob ihre Arbeit fürs Studium gewertet wurde oder ob sie einfach nur gut für diesen Ferienjob als Zimmermädchen bezahlt wurden, – auf jeden Fall schienen sie zu denken, sie stünden in der Hierarchie meilenweit über der Praktikantin, und das gebe ihnen das Recht, mich herumzukommandieren und -schubsen.
»Siehst du das, Prakti?« Hortensia hielt mir ein langes kupferrotes Haar unter die Nase. »Das habe ich gerade im Waschbecken gefunden. Und das ist ekelhaft.« So wie sie es aussprach, schrieb sie das Wort mit Ä und CK und zwei F. »Schlimm genug, dass wir in diesem fürchterlichen alten Kasten unter unzumutbaren Bedingungen hausen müssen! Wenn du dir weiterhin mit uns diese vorsintflutlichen Waschräume teilen willst, dann mach gefälligst hinter dir sauber! Hast du das verstanden?«
Ich schluckte kurz. Da hier niemand sonst lange rote Haare hatte, musste es wirklich eins von meinen sein. Haare im Waschbecken fand ich selber nicht so schön und achtete deshalb immer darauf, möglichst keine zu hinterlassen. Allerdings gab es auch einen Grund dafür, dass mir das dieses Mal nicht gelungen war.
Ich holte tief Luft. »Vielleicht erinnerst du dich noch daran, dass ihr mich heute Morgen aus dem Waschraum geworfen habt, damit ihr euch alle vier nebeneinander die Zähne putzen konntet? Deshalb hatte ich keine Chance …«
»Blablabla! Ich will nie wieder so was Ekelhaftes von dir wegmachen müssen, verstanden, du Schlampe?« Hortensia schnippte das Haar von sich und musterte mich angewidert. »Oh Gott, sind das etwa Tannennadeln in deinen Zotteln?«
Ich schluckte noch einmal. Es war das erste Mal, dass mich jemand »Schlampe« nannte und es wirklich so meinte, und für einen Moment war ich aus dem Konzept gebracht. Für Situationen, in denen man spontan nicht weiter wusste, hatten meine Freundin Delia und ich ein Spiel entwickelt, das »Was würde Jesus tun?« hieß, wobei man anstelle von Jesus – das Spiel hatten wir in einer sehr langweiligen Religionsstunde erfunden – jede x-beliebige Persönlichkeit einsetzen konnte. Als praktisches Vorbild war Jesus ja auch unerreichbar, nicht nur, weil er übers Wasser gehen und Wasser in Wein verwandeln konnte. Er an meiner Stelle würde Hortensia jetzt einfach die Hand auflegen und sie spontan von ihrer biestigen Gemeinheit heilen. Das konnte ich natürlich versuchen, bestimmt würde sie nicht schlecht staunen, wenn ich eine Hand auf ihren Kopf legen und so etwas wie »Weiche von ihr, Dämon!« murmeln würde. Aber wahrscheinlich würde sie mir danach eine scheuern. Und ich müsste ihr auch noch die linke Wange hinhalten …
»Was ist? Hat es dir die Sprache verschlagen, Prakti?«
Ich überlegte noch. Was würde … äh … Mahatma Gandhi an meiner Stelle tun? Ach verdammt. Ich war heute echt nicht so gut. Andererseits – hatte Gandhi nicht gesagt: Lasst uns nie aus Angst verhandeln, aber lasst uns auch nie Angst vor Verhandlungen haben?
Also gut. Sanft lächelnd rückte ich eine imaginäre Gandhibrille auf meiner Nase zurecht. »Wir können doch über alles reden, liebe Hortensia. Wenn ihr wollt, dass ich hinter mir sauber mache, dann dürft ihr mich nicht beiseiteschubsen, solange ich noch nicht fertig bin. Wollen wir das morgen einfach mal ausprobieren?«
Aber ich sah sofort, dass Hortensia nicht beeindruckt war, im Gegenteil, Gandhi schien sie erst recht aggressiv zu stimmen.
Vielleicht sollte ich einfach tun, was sie tun würde, überlegte ich, während sie wieder »Blablabla!« sagte. Die meisten Menschen entspannten sich ja, wenn man sie spiegelte. Ich stemmte also meine Hände in die Hüften, kniff drohend meine Augen zusammen und sagte mit unangenehm näselnder Stimme: »Selber blablabla! Und wage es nicht noch einmal, mich Schlampe zu nennen. Oder Prakti. Verstanden?«
»Sonst was?« Hortensia schob ihr Kinn noch ein Stückchen weiter vor als ich meins. »Verpetzt du uns bei der Müller? Kannst du ja gern versuchen, ich fürchte nur, uns mag sie lieber als dich. Prakti.« Mit einem triumphierenden Lächeln fügte sie hinzu: »Zu deiner Information: Camille ist zufällig die Nichte von der Müller. Ihre Lieblingsnichte!«
Aha. Das erklärte natürlich einiges.
Es war eindeutig ein Zeichen, dass ich mich zu viel mit dem kleinen Teufelsbraten beschäftigt hatte, aber in diesem Moment fragte ich mich, was wohl Don Burkhardt junior an meiner Stelle tun würde. Und schon hörte ich mich sagen: »Zu deiner Information, Hortensia Hochnäsig, Aushilfsputzkraft aus Lausanne: Ich bin schon viel länger hier als du und habe einige Freunde im Hotel.« Oh, das war gut! Ich klang genauso gefährlich freundlich wie Don, wenn er die Beziehungen seines Vaters ins Spiel brachte. Nur ohne den Schweizer Akzent und das niedliche Lispeln natürlich. »Freunde, die es gar nicht gern sehen, wenn man mich schlecht behandelt«, fuhr ich fort. »Oder wenn man dieses ehrwürdige Haus einen fürchterlichen alten Kasten nennt.«
Hortensia öffnete den Mund, um etwas zu erwidern, aber in diesem Moment fegte ein Windstoß durch den Korridor, und die Tür zum Waschraum fiel mit einem lauten Knall ins Schloss.
Wir zuckten gleichermaßen erschrocken zusammen, aber während sich Hortensia verwundert umsah, fühlte ich mich auf seltsame Art in meinen Worten bestätigt.
»Dann haben wir uns also verstanden«, sagte ich und stolzierte an Hortensia vorbei zu meinem Zimmer am Ende des Ganges. Es war zwar bedenklich (und es tat mir auch leid um Jesus und Gandhi), dass ich mir die garstigen Methoden eines psychopathischen Neunjährigen abgeschaut hatte, aber man musste sagen, sie funktionierten einwandfrei.
Mit Nachdruck schloss ich die Zimmertür hinter mir ab, zog meinen Mantel aus und begann, mir die Fichtennadeln aus den Haaren zu zupfen.
Als ich im September im Wolkenschloss angekommen war, hatte ich freie Auswahl bei den Betten gehabt – unter dem Jahr waren die Personalquartiere in der Regel nicht mal halb belegt. Einzelzimmer gab es zwar keine, schon gar keine mit eigener Toilette, aber das Kämmerchen, das ich mir ausgesucht hatte, konnte fast als Einzelzimmer durchgehen, so klein war es. Keiner hatte darin schlafen wollen, weil die Heizung kaputt war und sich in der Wand eine angeblich tote Leitung befand, die genauso angeblich ein gruseliges Stöhnen von sich geben sollte. (Und vielleicht, sagte Denise von der Rezeption, sei es auch gar nicht die Leitung, sondern die Weiße Dame, die die Seelen hinauf auf den Turm locken wolle.) Mir war das egal, Hauptsache, ich hatte ein Zimmer für mich allein. Und ich war immer noch der Ansicht, eine gute Wahl getroffen zu haben. Ich mochte die verblichene, fliederfarbene Streifentapete und das Gaubenfenster in der beginnenden Dachschräge, das den Blick freigab auf Obergabelhorn, Dent Blanche und Zinalrothorn, die Viertausender gegenüber. Es war genau derselbe Blick, für den die Gäste in der Panorama-Suite im Stockwerk unter mir ein Vermögen ausgeben mussten. (Dort bekam man allerdings auch gleich zehn Meter Panorama-Fenster für sein Geld, und die Panorama-Terrasse dazu.)