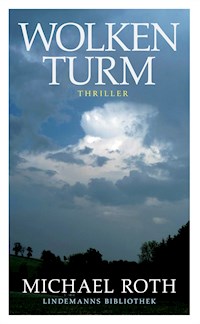
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INFO Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Lindemanns Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Silvesternacht 1899, Berlin. Max Morgenthau wird in den ersten Sekunden des 20. Jahrhunderts als Sohn einer reichen Fabrikantenfamilie geboren. Ein Jahrhundertkind nennt ihn die Mutter stolz, ein Glückskind, dem die Türen in eine unbeschwerte Zukunft offen stehen. Max besucht eine private Kunstschule als der Erste Weltkrieg entflammt. Riskante Geldgeschäfte des Vaters treiben die Morgenthaus in den Ruin. Die Familie zerbricht. Max verschlägt es in den Süden der Republik. Hart am sozialen Abgrund gelingt es ihm, sich durch seine Malerei über Wasser zu halten. Eines Abends erhält er einen mysteriösen Malauftrag. Noch ahnt Max nicht, welches Unheil ihm droht. Er sieht den mächtigen Wolkenturm nicht, der sich düster über ihm ausbreitet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 272
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Michael Roth
Wolkenturm
Thriller
Für meine Frau Christiane,
meine Tochter Simone,
Henning und meinen Enkel Jonah
und alle, die durch ihr aufrichtiges Denken
und Handeln meine Tage bereichern
1. Teil
1
Die Silvesternacht war frostig. Das Jahr 1899 lag in seinen letzten Atemzügen. In der Küche unserer Villa hatte sich unser Personal versammelt und sich um die mächtige Tischplatte aus weißem Marmor geschart. Sie war ein Ungetüm und der Block, aus dem man sie herausgesägt hatte, musste mindestens vier unendliche Meter lang gewesen sein.
Unsere Bediensteten erfüllten den Raum mit ausgelassenem Palaver. Der eine oder andere blickte mit einem Hauch von Wehmut drein und schwieg versonnen. Auf dem Tisch standen drei Champagnerflaschen und Schalen mit Gebäck. Die Korken waren durch den Raum geschossen und endlich ergoss sich der kostbare Tropfen aus meines Vaters Weinkeller in die Gläser, die man dem Einschenkenden ungeduldig entgegenhielt. Die Wangen unserer beiden Köchinnen glänzten speckig rot. Wie jedes Jahr hatten sie ein exzellentes Mahl zubereitet. Jetzt, wo die letzten Kessel gespült, die Tische gewischt, die Herdplatten mit Speckschwarten poliert waren und alles edel blitzte, konnten auch sie ihren langen Arbeitstag als beendet betrachten. Karl, unserem Chauffeur, war es vorbehalten, laut von zehn abwärtszuzählen. Bei fünf stimmten die Haushälterinnen, unsere Diener und die Köchinnen inbrünstig mit ein und gemeinsam verabschiedeten sie die letzten Sekunden des Jahres. Dann schmetterten sie sich im Chor fröhlich das Prost Neujahr entgegen. Augenblicke später ergriff jeder einen der kupfernen Töpfe und Kessel, hämmerte leidenschaftlich mit einem Löffel darauf herum und schrie übermütig etwas Unverständliches hinaus. Mit diesem Ritual begrüßte unser Personal jedes neue Jahr.
Auch im übrigen Berlin klopfte man sich voller Glückseligkeit auf die Schultern, wildfremde Menschen umfassten sich freudetrunken und legten sich darauf fest, dass das soeben aus der Taufe gehobene zwanzigste Jahrhundert dazu auserkoren sei, besonders segensreich zu werden.
Natürlich begann unser Mädchen Irma wieder herzerweichend zu heulen und jeder durfte staunend ihre Gänsehaut auf den Armen betrachten, die sie, jedenfalls behauptete sie dies, immer vor Rührung bei feierlichen Glockenschlägen bekam.
Just in jenem Moment trockneten die beiden Hebammen den Schweiß vom glühenden Gesicht meiner Mutter.
„Wir haben es geschafft, gnädige Frau“, sagte eine der beiden, „ein prachtvoller Junge!“
Mein Vater indes soff sich zur gleichen Zeit mit den Herren seines Clubs und in Gesellschaft einiger alberner, leicht bekleideter Damen in dieses Jahrhundert hinein. Er hielt sich sorgsam an diese Tradition. Einen Grund, im Moment meiner Geburt davon abzuweichen, gab es für ihn nicht.
Es würde einige Zeit dauern, bis man es in Briefen richtig schrieb: 1900! Doch an solche bevorstehenden Gewohnheiten dachte in jenem Augenblick niemand. Ein Mensch zweier Jahrhunderte war man. Und diese Tatsache, die nur der Hälfte aller Erdbewohner beschieden war, genügte, um den Kopf zumindest ein winziges bisschen höher zu tragen. Ich gehörte nicht dazu und dennoch war der Zeitpunkt meiner Geburt außergewöhnlich.
Tante Apolonia, meines Vaters jüngere Schwester, wurde in späteren Jahren nie müde zu berichten, wie der Busen meiner Mutter vor Glück gewogt habe, als man anlässlich meiner Taufe meinen Namen und die Zahl 1900 feierlich in unsere riesige Familienbibel eintrug. Gelesen wurde in diesem reichlich verzierten Buch nie. Es verschwand tief in einer Schublade und blieb dort für alle Zeit.
Auch meine Mutter pflegte hin und wieder in Erinnerung zu rufen, dass ihr Sohn ein Jahrhundertkind sei. Die Damen, mit denen sie an Sonntagnachmittagen ihr Kaffeekränzchen abhielt, nickten dabei stets artig. Sie wiegten vielsagend die gepuderten Köpfe und schenkten den Worten meiner Mutter ein höfliches Lächeln: „Sie Glückliche, wie aufregend, ein Kind in ein neues Jahrhundert hineingeboren zu haben!“
In jenen Jahren waren wir wohlhabend. Allein für die Verwaltung unseres Reichtums hatte mein Vater zwei erfahrene Geldfachleute eingestellt. Wer die Gunst unserer Familie besaß, durfte sich glücklich preisen.
1907 bezogen wir unsere neu erbaute Villa, ein stattliches Gebäude am Rande Berlins. Wir Kinder liebten das Labyrinth unzähliger Räume und Gänge, in dem sich wunderbar Verstecken spielen ließ. Mein besonderes Geheimversteck, einen kleinen Verschlag, eingelassen in eine Wand der Wäschekammer, entdeckten meine Geschwister nie. Oft kroch ich erst nach einer halben Stunde hinter dem kaum wahrnehmbaren Türchen hervor. Bis dahin hatten meine Geschwister die Suche längst entnervt aufgegeben.
Von meinem Versteck aus beobachtete ich auch einige Male meinen Vater. Durch einen schmalen Schlitz sah ich, wie er mit rotem Kopf das Kleid unseres französischen Hausmädchens Chantal ungeduldig nach oben zerrte. Ich erinnere mich, wie ich es komisch fand, dass sie keine Unterhose trug. Vater drückte sie auf den Tisch, der direkt vor meinem Versteck stand, und vergrub sein Gesicht in dem schwarzen Geflecht, welches sie ihm mit aufreizendem Lachen entgegenhielt. Eines Tages entdeckte sie mich, wie ich durch den Spalt lugte. Sie verriet mich nicht. Sie lächelte mir nur zu und schob ein Wäschestück vor den Spalt.
Um die Villa herum erstreckte sich ein Park von unermesslicher Weite. Nie habe ich wirklich herausgefunden, wo unser Besitz endete. Honorige Persönlichkeiten gaben sich bei uns die Klinke in die Hand. Mein Vater kannte jeden Geschäftsmann, der in Berlin Macht und Einfluss besaß. Sie handelten mit Metallen, stellten Justiergeräte oder Bajonette her oder sie arbeiteten an der Verfeinerung von Zündern für Schusswaffen. In der Fabrik meines Vaters entstanden modernste Gewehre. Man belieferte damit Kasernen in ganz Deutschland. Das Geschäft blühte. Mein Vater beschäftigte über hundert Arbeiter in seiner Fabrik. Wir Kinder, meine vier Geschwister und ich, durften die teuersten Privatschulen besuchen. Mich, ihren Liebling, ihr Jahrhundertkind, steckte meine Mutter gegen den Widerstand meines Vaters auf eine Kunstschule. Ich lernte malen, zeichnen und wie man Drucke fertigt. Mein Vater, der für solchen Quatsch keinen Sinn hatte, begann, mich zu verspotten. Künstler schalt er mit Farben herumschmierende Spinner und Taugenichtse. Ein Mann, der nicht auf Profit und Macht abzielte, war in seinen Augen kein Mann. Mathematik, Physik, Wirtschaftswissenschaften und Französisch erschienen ihm kommod. Meine beiden älteren Brüder mussten diese Fächer auf den Gymnasien büffeln. Dass das Unternehmen von ihnen weitergeführt werden sollte, stand für meinen Vater schon seit ihrer Geburt fest. Ich spielte keine Rolle in seinen Plänen. Genau genommen war ich ihm gleichgültig.
2
Der Krieg, der sich ab August 1914 wie ein Unwetter über die Nationen wälzte, veränderte unser Leben. Vater hatte sich mit unseriösen Geschäftemachern eingelassen. Auch verfiel er, wie zahlreiche andere Opportunisten dem Wahn, durch raffiniertes Spekulieren auf den sensibel gewordenen Geldmärkten gutgläubige Geldanleger übertölpeln zu können. Selbst durch den massenhaften Ankauf von Kriegsanleihen glaubte er, satte Gewinne einstreichen zu können.
Das Ende unseres Reichtums kam schnell und erbarmungslos. Als meinem Vater bewusst wurde, dass sowohl unsere Fabrik als auch unsere Familie vor dem Ruin standen, setzte er sich seine großkalibrige Pistole an die Schläfe. Das Geschoss riss beim Austritt ein riesiges Loch in seinen Schädel. Ein Teil des Gehirns klatschte auf seinen Abschiedsbrief. Darin stand etwas von Schande, die er nicht ertragen könne. Der Rest war durch das Gehirn nass und unleserlich geworden.
Nie habe ich verstanden, warum mein Vater für den selbstverschuldeten Niedergang nicht einstand. Seine Selbsthinrichtung pries man in der kläglichen Runde seiner verbliebenen Freunde als ehrenhaft. Nicht mehr viele Männer gebe es in diesem Deutschland, so war zu hören, die bereit seien, edel und großmütig zu handeln wie mein Vater.
Im Winter von 1917 auf 1918 wurden wir geplündert. Die kostbaren Möbel zerbarsten unter den Äxten unserer wütenden Arbeiter und wanderten als Brennholz in die Öfen der kargen Stuben. Vater hatte sie um ihren Lohn geprellt. Wer im vierten Kriegsjahr das Feuer an unsere Villa legte, konnte nie ermittelt werden.
Unsere Familie zerfiel. Bereits 1917 waren meine beiden Brüder an der Somme heldenhaft gefallen, verwest und von Ratten aufgefressen. Die ältere Schwester hatte ohne unser Wissen geheiratet, zog mit ihrem Mann nach Hamburg und ward nie wieder gesehen. Unser Käthchen verkaufte ihre Reize, nachdem sie von uns abgehauen war, in einem Berliner Nachtclub. Als man sie dort wegen Diebstahls hinauswarf, geriet sie in die Fänge eines Luden. Die Straße wurde ihr zum Verhängnis. Kaum hatte sie eine Syphilis überstanden, fing sie sich etwas Neues ein. Mit 21 Jahren trat sie von dieser Erde ab.
Meine Mutter begann zu trinken und machte sich zum gefügigen Werkzeug eines um zehn Jahre jüngeren Hausierers. Er stammte aus Karlsruhe und verbrachte seinen Tag damit, den Leuten Laugen und Kurzwaren aufzuschwatzen. Mit seinen Wundermitteln sei das Putzen, versicherte er mit unterwürfigem Augenaufschlag jedem, der so dumm war, ihm überhaupt die Türe zu öffnen, ab sofort ein Kinderspiel. Kaum jemand interessierte sich für sein Geschwätz. Die Menschen hatten andere Sorgen.
Nach Kriegsende folgten wir ihm in den Süden. In Mannheim bezogen wir eine schmutzige Zweizimmerwohnung in einer eben-so heruntergekommenen Arbeitersiedlung am Rande der Stadt. Meine Mutter ließ sich regelmäßig von dem Hausierer verprügeln. Auch ich erhielt Schläge. Ich war schmächtig, hatte ihm nichts entgegenzusetzen. Dennoch schmetterte ich ihm eines Tages mit all meiner Kraft eine leere Flasche ins Gesicht. Die Flasche zerbrach nicht. Das hässliche Krachen aber, mit dem sein Kiefer zersplitterte, blieb mir Monate lang im Ohr. Die Hälfte seines Gesichtes verlor jegliche Straffheit und sank nach unten. Während ich aus der Haustüre stürzte, raffte ich seinen Mantel an mich. Seine Brieftasche war darin mit ein paar Münzen. Tagelang irrte ich ziellos durch die Straßen. Ich schlief auf Parkbänken, die Kälte wollte mich zermürben. Als das Geld verbraucht war, kletterte ich heimlich in einen der wenigen Züge, die in Deutschland noch fuhren. Ich gelangte nach Karlsruhe. Wochenlang drückte ich mich in der Nähe des Bahnhofs herum. Zum ersten Mal in meinem Leben erfuhr ich, was es bedeutete, quälenden Hunger zu haben. Als eine Frau die Pelle einer Wurst in einen Abfallkübel warf, wühlte ich sie gierig wieder heraus. Von da an war alles Essbare aus dem Müll meine Mahlzeit. Anfangs spie ich alles hinaus, dann ließ der Ekel nach.
Eines Tages stand eine Gruppe verwilderter Gestalten hinter mir. Sie packten mich an den Haaren und zerrten mich aus dem Bahnhof nach draußen. Mit ihren Tritten in meinen Unterleib machten sie mir unmissverständlich klar, zu wessen Revier die Abfalleimer im Bahnhofsgelände gehörten. Während ich mich noch vor Schmerzen krümmte, tauchten zwei Schupos auf. Ob ich eine Anzeige gegen die Burschen machen wolle, wurde ich gefragt. Ein Unbekannter habe mich angegriffen, log ich. Die Obdachlosen seien nur herbeigeeilt, um mir zu helfen. Alles sei nicht der Rede wert. Ich hatte Glück, Papiere wollten sie nicht sehen. Die Berber klopften mir mit ihren schmutzigen Pranken anerkennend auf die Schulter. Dann forderten sie mich auf, ihnen zu folgen. In einem stillgelegten Tunnel, ein gutes Stück abseits des Bahnhofs, hausten sie. An seinem Eingang wucherten dornige Hecken. Sie machten den Zugang ins Innere beschwerlich. Normale Bürger wagten sich nur selten in die Nähe dieser Höhle. Selbst die Polizei machte respektvoll einen Bogen um dieses Loch.
Die heruntergekommenen Kerle reichten mir etwas Essbares. Ich wusste nicht, was es war, aber ich bemühte mich, es hinunterzuwürgen. Einen knochigen, hochgewachsenen Typen nannten sie Attila. Attila schien der Anführer dieses stinkenden Haufens zu sein. Er teilte Gruppen ein, die auf Beute gehen mussten, er bestimmte, wer den Stollen säuberte, er brüllte denjenigen an, der zu nahe am Lagerplatz pisste.
Durch Attila lernte ich, wie Überleben funktionierte.
„Man muss es wollen, das Überleben“, pflegte er zu sagen, „wenn du dich aufgibst, ist es besser, du verreckst gleich und ersparst dir eine quälende Leidenszeit.“
Er nahm mich mit auf seine Streifzüge, eine tiefe Freundschaft entstand. Attila zeigte mir, wie man richtig bettelt. Ich lernte, welches mitleidsvolle Gesicht man dabei machen musste, welche devote Körperhaltung man einzunehmen hatte und bei welchen Leuten es von vornherein zwecklos war, die Hand aufzuhalten.
„Die Welt ist voller skurriler Typen. Die Hochnäsigen, die arroganten Pinkel, das sind die Schlimmsten“, belehrte mich Attila.
„Oder die verwöhnten und verweichlichten Muttersöhnchen. Die haben noch nie wirklich mit Dreck und Elend zu tun gehabt. Am liebsten würden sie auf dich spucken. Frauen dagegen sind edler, am meisten mag ich die um die Fünfzig, das sind die besten. Sie geben dir ein paar Pfennige, weil sie vielleicht einen Sohn hatten, der im Krieg für Kaiser und Vaterland opferwillig und gern gestorben ist und an den du sie erinnerst. Oder sie werfen etwas in den Hut, weil ihnen meine dunklen Zigeuneraugen gefallen.“
Attila grinste schelmisch und schlug mir mit seiner sehnigen Hand auf die Schulter. „Vielleicht aber haben sie auch Angst, dass der finstere Zigeuner mit dem bösen Blick über sie herfällt, wenn sie ihm nichts geben oder dass er sie mit einem Fluch belegt.“
„Ich glaube, ich bin auch ein Muttersöhnchen“, wagte ich einen zaghaften Vorstoß.
„Das brauchst du mir nicht zu erklären, ich habe es an deinen Händen gesehen. Schwer gearbeitet hast du nie. Mag sein, dass es nicht deine Schuld ist. Aber keine Angst, ich bewerte Menschen nicht nach solchen oberflächlichen Dingen. Wie du mir begegnest, das ist entscheidend für mich.“
Wieder legte er ein breites Grinsen über sein gebräuntes Gesicht. Erleichtert nickte ich.
An Attilas Seite fühlte ich mich sicher. Er war beinahe einen Kopf größer als ich, hatte ausgeprägte Schultern und kräftige, sehnige Hände. Sein Haar reichte weit in seinen Nacken hinunter und schimmerte bläulich schwarz, als sei es eingeölt. Sein markant geschnittenes Gesicht barg eine faszinierende Wildheit. Ich stellte mir vor, dass Frauen ihn sehr attraktiv fanden. Wie alt er war, wusste er selbst nicht. Ich schätzte, dass er doppelt so alt sein musste wie ich. Als ich ihn danach fragte, sagte er: „Sie werden sich bei einem Zigeuner keine Gedanken machen, welche Jahreszahlen sie nach seinem Tod in den Grabstein ritzen. Ob du dabei ein Jahr älter oder jünger bist, welche Rolle spielt das schon in dieser dekadenten Welt. Sie werfen den Zigeuner in eine Grube und sorgen sich höchstens, dass sie sich am Leichnam angesteckt haben könnten. Grabsteine sind nur für die feine Gesellschaft, nicht für die Elenden dieser Welt.“
3
Das Jahr 1923 taumelte düster seinem Ende entgegen. Während die Inflation in einen Milliardenwahn wucherte, verendeten in Karlsruhe und anderen Städten Deutschlands Menschen im Minutentakt. Kaum hatte der Hunger ein Leben ausgelöscht, vernichteten Rachitis oder Tuberkulose das nächste. Unterernährte Kinder stellten das Wachstum ein, waren zu klein für ihr Alter und starben jammervoll. Mütter mit leeren Gesichtern blieben zurück.
Von den Obdachlosen, mit denen ich seit vier Jahren im Tunnel hauste, waren nur noch neun am Leben. Fünf Männer aus unserem Haufen hatte sich der Tod bereits ohne große Mühe gegriffen. Männer? Nein, sie waren Skelette, nichts anderes, Skelette, über die eine lederne Haut gespannt war.
Karl Bernauer war der Erste, der krepierte. Auf einer Müllhalde hatte er versucht, einer Ratte etwas abzujagen. Das Tier war nicht gewillt, seine Beute zu teilen. Urplötzlich schnellte es Karl entgegen und vergrub die messerscharfe Kante seiner Schneidezähne tief in dessen Wange. Karl brüllte auf und warf seinen Schädel hin und her. Aber die Ratte fiel nicht ab. Immer tiefer, so schien es, wollte sie sich in der verdorrten Gesichtshaut ihres Feindes verbeißen. Dabei gab sie schrille quiekende Laute von sich. Endlich gelang es Karl, die Ratte zu packen. Mit einem heftigen Ruck riss er sie aus seinem Gesicht. Ein Fetzen Haut hing in ihren Zähnen. Zurück blieb ein hässliches Loch in Karls Gesicht, aus dem jetzt ein dunkler Blutschwall schoss. Angewidert quetschte Karl den kleinen Leib in seiner Faust so fest zusammen, dass die feinen Knochen splitterten und das Gedärm zwischen seinen Fingern hervorquoll. Dann schleuderte er den nassen Klumpen zu Boden und stampfte wie von Sinnen immer wieder mit dem Stiefel darauf. Als sein Blick auf seine Hand fiel, übergab er sich. Er warf sich auf die Knie und scheuerte seine mit kleinen blutigen Därmen verklebten Finger über den sandigen Boden.
Fünf Tage später lag er morgens plötzlich tot zwischen uns. Die Wunde hatte sich entzündet und war bedrohlich angeschwollen. Karls rechtes Auge war völlig hinter einem eitrigen Wulst verschwunden. Dann war das Fieber gekommen. Für einen Arzt, wenn man überhaupt einen hätte auftreiben können, war es zu spät.
Wilhelm III. hieß in Wirklichkeit Helmut Bergenhoff. Da er dem verflossenen Kaiser verblüffend ähnlich sah, ernannten wir ihn zu dessen Thronerben und so erhielt er seinen Namen. Wir fanden ihn auf Geleisen ein paar hundert Meter von unserem Unterschlupf entfernt. Das Rad eines Zuges hatte seinen Kopf sauber vom Rumpf getrennt. Fast beneideten wir ihn. Um keinen Ärger mit der Polizei zu haben, verscharrten wir ihn sofort neben den Schienensträngen.
Zoltan, den Ungarn, raffte eine Lungenentzündung hinweg. Als er in die andere Welt hinüberdämmerte, röchelte er wiederholt den NamenAngelika.Er hatte von ihr erzählt. Wir wussten, mit wie vielen Kerlen sie ihn betrogen und wann sie ihn endgültig verlassen hatte. Über Nacht, hatte sich Zoltan ereifert, sei sie abgehauen, damals, mit dem Hannes vom Nachbarhof. Nie wieder habe er sie gesehen. Vielleicht hatte er in den letzten Minuten seines kümmerlichen Daseins doch noch seinen Frieden mit ihr gemacht.
Alois Stürmer, genannt der Maikäfer, weil er fortwährend vor sich hin brummte, quälte sich noch endlos lange mit seinen Hautkrebsgeschwüren herum, bis er schließlich am Ende jeglicher Widerstandskraft in unseren Armen verendete.
Dieter D, der schweigsame Langweiler, war nur verhungert. Nichts weiter. Mit weit aufgerissenem Mund lag er eines Tages neben einem der Mülleimer am Bahnhof und schwieg für immer. Seinen Nachnamen haben wir nie erfahren.
Damit waren wir nur noch neun. Die Verluste machten uns nicht betroffen. Schon seit geraumer Zeit hatte sich in den meisten Köpfen eine sonderbare Gleichgültigkeit ausgebreitet. Wir waren da angelangt, wo die letzte Flamme an Lebenswillen zu ersticken schien. Es war egal geworden, ob einer starb, ob man vielleicht bald selbst verendete oder wer der Nächste sein würde, den man verscharren musste. Einschlafen wollten wir. Nur nicht mehr mit diesen quälenden Schmerzen aufwachen müssen!
Ich klammerte mich trotz meiner Verzweiflung immer noch an Attilas Worte. Ich wollte überleben. Und Attila wollte es auch. Er würde nicht aufgeben und sich bereitwillig zum Sterben hinlegen. Aber auch der eiserne Wille dieses zähen Burschen, so fürchtete ich, konnte eines Tages ins Wanken geraten. Ohne Attila war ich verloren, das wusste ich. Noch immer hielt er schützend seine Hand über mich, gab mir von seiner mickrigen Ration immer wieder einen Teil ab und bewahrte mich vor Übergriffen der anderen. Längst aber genoss er nicht mehr jene uneingeschränkte Autorität wie zur Zeit unserer ersten Begegnung. Der Hunger zersetzte die Gehirne und trieb die Vernunft aus den Köpfen. Hatten wir bisher unsere Beute, erbetteltes Geld oder erbettelte Lebensmittel zusammengetragen und dann gleichmäßig verteilt, hatte sich nun eine Gruppe gebildet, die auf eigene Faust Streifzüge unternahm. In dieser Gruppe hatte Kuno Kolaschke die Führung an sich gerissen. Kuno war skrupellos und unberechenbar. Außerdem hasste er Attila und beschimpfte ihn wiederholt als dreckigen Zigeuner, der den anständigen Deutschen das Brot wegfresse.
Attila reagierte nicht darauf.
„Es hat keinen Sinn, unnötige Kraft für eine Schlägerei zu vergeuden“, erklärte er mir. „Lass diesen Narren reden. Es wird ihm nicht gelingen, mich zu kränken. Dafür bin ich zu stolz. Wenn er aber jemals seine schmutzigen Hände an mich legt, werde ich diese Kanalratte abstechen, verlass dich drauf.“
Trotz meiner Wut wegen der Demütigungen gegen meinen Freund verstand ich Attilas Zurückhaltung. Attila war klug. Er wusste, würde sich Kolaschke mit seiner Bande auf uns stürzen, bedeutete das unser Ende. Sie würden uns totschlagen, daran bestand kein Zweifel. So war ich erleichtert, als Kolaschke eines Tages mit seinen Leuten den Tunnel verließ und in eine ehemalige, halb zerfallene Waffenfabrik übersiedelte. Doch nun entbrannte ein erbitterter Kampf um die Vorherrschaft über die Kioskmülleimer. Kolaschke war es gelungen, noch weitere Leute um sich zu scharen. Mit diesen Schergen baute er ein beinahe lückenloses Überwachungsnetz auf und zwang uns, Plätze an den Rändern der Stadt aufzusuchen, die weit von unserem Tunnel entfernt lagen. Wieder nahte der lange Winter. Unser Ende schien gekommen.
4
Im Sommer 1919 hatte ich geglaubt, dass der Ausstieg vom Leben auf der Straße lediglich eine Frage der Zeit sei. Einem Jahrhundertkind wie Max Morgenthau musste, allein schon aufgrund des außergewöhnlichen Zeitpunkts seiner Geburt, Glück beschieden sein. So vertraute ich darauf, in absehbarer Zeit Arbeit zu finden und in ein bürgerliches Leben zurückzukehren.
Beinahe sechs Jahre waren seitdem vergangen. Ich hatte aufgehört zu träumen. Mit jeder hereinbrechenden Nacht pressten sich Kälte und Nässe enger an das klägliche Überbleibsel meines Körpers und furchtbare Hungerkrämpfe ließen mich nicht mehr in einen seligen Schlaf sinken. Als gegen Ende des Jahres 1924 der Winter viel zu früh einsetzte, fand ich mich endgültig damit ab, dass für den schmalen Rest meines kümmerlichen Lebens die Gosse mein Zuhause sein sollte. Arbeit zu suchen hatte ich längst aufgegeben. Ich war bis auf die Knochen heruntergemagert und für nichts mehr zu gebrauchen.
Deutschland lag erschöpft am Boden. Die Forderungen des Versailler Vertrags erstickten selbst die zaghafteste Zuversicht unter den Elenden. Jeder Tag im Sumpf fühlte sich endlos an. Meine Energie war aufgezehrt. Nichts mehr in mir wollte sich gegen das jämmerliche Dasein sträuben. Wie viele Tage würde ich die Schmerzen, die beißende Kälte und das Leben im Dreck mit all seinen Krankheiten noch ertragen können, bevor ich tot dalag?
Auch Attila war dort angekommen, wo ich um sein Leben bangte. Tiefe schmutzige Furchen hatten sich in sein Gesicht eingegraben. Dieses stolze Gesicht, das mir seit unserer ersten Begegnung auf ewig unerschütterlich schien, war jetzt übersät mit hässlichen Geschwüren. Dreck und Kälte hatten seine Lippen gesprengt, aus den Rissen blutete es oder sie eiterten. Ich wusste, dass ich genauso aussah. Jeder im Tunnel hatte die gleiche ekelerregende Visage, den gleichen nach Pisse und Scheiße stinkenden Leib.
Sollte Attila sterben, würde ich keine zwei Tage weiterleben. Umso verzweifelter registrierte ich seinen unaufhaltsamen Verfall. Die Angst vor dem jammervollen Sterben peinigte mich, die Angst, dort im Tunnel zu verfaulen. Noch immer hoffte ich, wenigstens im Schlaf sterben zu dürfen. Bloß nicht bei Bewusstsein, nicht mit diesen furchtbaren Schmerzen!
Attila teilte selbst das Geringste, was er an Essbarem fand, mit mir. Noch immer tat er das. Ich war kaum noch in der Lage, aus eigener Kraft den Tunnel zu verlassen.
An einem frostigen Novembertag raffte ich mich dennoch auf, um Attila zu begleiten. Auch aus Dankbarkeit meinem treuen Freund gegenüber wollte ich bei ihm sein. Vielleicht waren es unsere letzten gemeinsamen Stunden. Die Sonne schleuderte ihre Strahlen auf die Dächer und Plätze der Stadt, aber ein unbarmherzig eisiger Ostwind fegte durch Karlsruhes Straßen und färbte die Gesichter blau. Viel war zwischen hochgezogenen Mantelkragen und mehrfach um den Hals gewickelten Schals von ihnen nicht zu sehen. Nur blaugraue Nasen ragten triefend aus der Vermummung hervor.
Attila und ich schleppten uns ziellos in der Nähe der Kaiserstraße umher, immer auf der Hut vor Kolaschkes Bande. Die Kaiserstraße selbst durften wir nicht betreten. Auch der Marktplatz um die Pyramide herum war für uns Sperrgebiet. Kolaschke beherrschte die halbe Stadt. Unsere Hände hatten wir mit Fetzen von Jutesäcken umwickelt. Abwechselnd ließen wir uns eine Minute lang auf dem kalten Bürgersteig zum Betteln nieder. Nicht länger. Jetzt eine Blasenerkrankung und der Tod war nur noch eine Frage von Stunden.
Nach einer geraumen Zeit erfolglosen Bettelns fingen wir an, Abfallkübel zu durchwühlen. Alles, was uns irgendwie brauchbar oder lebensrettend erschien, nahmen wir mit. Zunächst entdeckten wir Zeitungen und Stoffreste. Vorwiegend hofften wir jedoch, Teller aus Papier zu finden, die es jetzt neuerdings an Kiosken gab. Wenn darauf eine Wurst gelegen hatte, konnte man sie in kleine Stücke reißen, im Mund aufweichen lassen und die Fettreste heraussaugen.
Plötzlich hielt Attila mit bitterem Grinsen einen kleinen Karton hoch.
„Schau, Max, wären wir beim Wolf mit seinen sieben Geißlein, könnten wir diese Kreide hier fressen. Wenigstens unsere Stimme würde dann etwas davon haben.“
Mürrisch warf er den Karton wieder in den Kübel und wühlte weiter. Ich führte meine Hand in das stinkende Innere und zog den Karton heraus. Nachdem ich den Deckel abgenommen hatte, blickte ich auf etwa zwanzig farbige, kaum benutzte Kreidestücke. Bestimmt hatten sie einem Kind reicher Eltern gehört, einem verwöhnten Zögling, den man in Spielsachen ertränkte. Niemand kannte das besser als ich.
In der windgeschützten Nische neben einem Hotel ließen wir uns auf den eroberten Zeitungen nieder. Hier fühlte sich die Sonne warm an. Wir beschlossen, bis zu deren Verschwinden hier zu verharren.
Ich betrachtete die Kreiden und begann, zaghaft auf dem Pflaster des Bürgersteiges kleine Striche zu zeichnen. Allmählich setzten sich die Striche zusammen zu Flächen, die kleinen Flächen verbanden sich zu einem Ganzen und eine halbe Stunde später blickte ich auf ein leidendes Jesusgesicht. Ich war so sehr in meine Arbeit vertieft, dass ich alles um mich herum vergaß. Selbst die Kälte nahm ich kaum noch wahr. Während ich an einigen Stellen zu kleinen Korrekturen ansetzte, hielt ein schwerer Wagen vor dem Eingang des Hotels. Ein Paar schwarz lackierte Frauenstiefel mit teurem Fellbesatz klapperte der goldverbrämten Drehtür aus Glas entgegen, dann verharrte es plötzlich und kam auf mich zu.
Hinter mir blieb die Frau stehen und ich hörte eine klare Stimme sagen: „Wunderbar, dieser Ausdruck! Dieses sensible und doch so expressive Leiden.“
Noch bevor ich aufsehen konnte, klimperte ein rundes Metall vor mir auf den Boden. Ich erschrak. Vor mir lag tatsächlich ein Geldstück, ein Adler darauf, links davon eine fünf und am Rande die Worte Reichs und Mark. Ich blickte ungläubig den Stiefeln und dem wippenden Nerzmantel hinterher. Unter einer breiten Pelzmütze quoll ihr dunkles Haar hervor. Mehr sah ich nicht von ihr. Attila bückte sich, streckte seine Hand aus und nahm den Fünfer mit glänzenden Augen an sich.
„Lotta! Das war Lotta de Cameron. Früher hieß sie Schröder, Lotta Schröder.“
„Woher weißt du, wer sie ist?“, fragte ich.
„Hab’ sie schon gelegentlich auf Plakaten und in Zeitungen gesehen. Sie singt an der Staatsoper, ist oft in Berlin, da wo du herkommst. Hat einen steinreichen südamerikanischen Schafzüchter geheiratet. Schätze, sie ist so mein Alter, aber ich war ihr leider zu arm, sonst hätte sie ja mich genommen, weil ich so feurig aussehe. Du musst die Zeitungen, die die Leute wegschmeißen, auch lesen, dann weißt du, was in der Welt geschieht.“
„Ist es denn wichtig, das zu wissen? Zeitungen machen mir den Magen nicht voll.“
„Aber das hier!“ Grinsend klatschte Attila ein paar Mal auf seine zerschlissene Manteltasche, in der er die Münze hatte verschwinden lassen.
„Zeig mal her! Ich kann es wirklich kaum glauben. Hat sie uns das gegeben wegen dem Jesus?“
Attila grinste wieder und nickte.
„Mensch, Max, warum sind wir nicht früher auf das gekommen? Du mit deinen künstlerischen Fähigkeiten! Bleib unten, nimm die Kreide wieder in die Hand und tue so, als würdest du noch weiterzeichnen. Ich besorge uns inzwischen eine Wurst. Heute ist ein Feiertag. Geht es noch mit der Kälte?“
Ich nickte schwach. Attila formte aus einem Stück Papier einen kleinen Behälter und stellte ihn vor meine Zeichnung hin.
„Das ist für unsere Einnahmen“, raunte er mir zu. „Wenn zwei drin sind, nimm immer einen raus und steck ihn ein. Dann geben sie mehr.“
Mit diesen Worten machte er sich rasch davon. Ich tat, wie er mir aufgetragen hatte, setzte hier noch einen Kreidestrich, dort noch einen, ohne jedoch das Bild zu verändern. Dann bemerkte ich, dass ich steifgefroren war. Ich kauerte mich noch mehr zusammen und versuchte durch schwaches Bewegen meiner Gelenke, diese wieder zu beleben. Jetzt, wo die Aussicht auf eine kleine Mahlzeit bestand, spürte ich meinen Hunger quälend wie nie. Ich krümmte mich und versuchte, es niemanden merken zu lassen. Als mein Blick auf meine Zeichnung fiel, stellte ich fest, dass das Gesicht des Jesus eine Ähnlichkeit mit dem Attilas hatte. Meine unbeweglich gewordene Hand klammerte sich an das Kreidestück. Eine Frau von etwa dreißig Jahren näherte sich. Auf dem Arm trug sie ein Kleinkind, das völlig in eine Decke eingemummt war. Sie sah auch ärmlich aus. Sie war in Begleitung eines etwa achtjährigen Jungen. Schweigend beobachteten sie mich, dann flüsterte der Junge der Mutter etwas zu, worauf diese zögerlich eine Geldbörse aus der Tasche zog. Schüchtern näherte sich der Junge und ließ ein Zweipfennigstück in das Schälchen aus Papier fallen. Sofort rannte er zu seiner Mutter zurück. Nach einem Moment des Zögerns strahlte er mich an. Dankbar versuchte ich ein Lächeln.
„Vielleicht kann er uns doch noch helfen in dieser Zeit“, sagte die Frau gedankenverloren. Sie meint Jesus, dachte ich. Nachdenklich schaute ich auf das Gesicht vor mir.
5
Ich erinnere mich gut daran, wie ich ehrfürchtig auf die Bratwurst starrte, die Attila mir in die Hand drückte. Zaghaft, beinahe ängstlich berührte ich die Pelle mit meinen wunden Lippen. Noch heute spüre ich den salzigen Geschmack, weiß noch, wie mir das warme Fett nach dem Anbeißen in den Mund sickerte und über mein Kinn lief.
„Iss langsam!“, mahnte Attila. „Behalte die Uhr der Kirche im Auge! Du solltest dir für die Scheibe Brot und die Wurst etwa zwanzig Minuten Zeit lassen. Sonst wirst du üble Schmerzen haben oder du kotzt alles wieder raus und deine Wurst fressen die Straßenköter, kein Luxus, den wir uns erlauben können.“
Ich tat genau das, was mir Attila riet. Genau genommen folgte ich immer seinen Ratschlägen. Nie war ich damit schlecht gefahren.
Ich spürte, wie mich das Essen anstrengte. Meine Kaumuskeln schmerzten. Aber dennoch, welch segensreicher Tag war das! Alles Geld wollte ich heute noch ausgeben und überlegte, was man sich noch für den Rest kaufen konnte. Zu den fünf Mark von Lotta de Cameron waren noch zweiunddreißig Pfennige hinzugekommen. Attila jedoch schwieg, als ich ihm meinen Wunsch unterbreitete. Auch behielt er wortlos das restliche Geld ein. Zum ersten Mal, seit wir uns kannten, war ich verunsichert und begann an ihm zu zweifeln.
Wie konnte er es zulassen, dass der Hunger uns selbst diese Nacht wieder quälte? Eine Wurst und eine Scheibe Brot, eine lächerliche Mahlzeit für jemanden, der restlos ausgezehrt war wie wir. Wollte er gar einen Teil des Geldes auf die Seite bringen? Außerdem hatte ich das Geld erwirtschaftet, ich hatte in der Kälte auf dem Boden gekauert und mit halb erfrorenen Fingern gezeichnet. Doch ich sagte nichts. Aus Angst, ich könnte sein Wohlwollen verlieren, blieb ich auch in den folgenden Tagen stumm.
Erst zwei Wochen später sollte ich erfahren, warum Attila von dem Geld, das ich für meine Zeichnungen bekam, immer einen Teil zurückbehielt. Und ich schämte mich für meine Kurzsichtigkeit und auch dafür, dass ich Attila misstraut hatte. Obwohl ich stets darauf achtete, die Kreidestücke möglichst sanft auf das Pflaster aufzusetzen, war nun doch der Moment gekommen, wo sich nur noch ein paar kümmerliche Stummel in der Schachtel verloren. Attila beobachtete mich wie immer schweigend. Ich wagte kaum, zu ihm aufzusehen. Meine Zeichnung vom Heiligen Abendmahl war erst zu Hälfte fertig. Verzweifelt versuchte ich, noch sparsamer die winzigen Kreidestückchen einzusetzen, aber es war mehr als eindeutig, dass ich damit das Bild nicht zu Ende bringen konnte. Es war erst kurz vor Mittag. Wenn ich jetzt schon aufhörte, würde es bei siebzig Pfennigen für den heutigen Tag bleiben. Und morgen würde es nichts geben und übermorgen...
Attila, der meine Ratlosigkeit mit einem spöttischen Grinsen quittierte, erhob sich und sagte: „Probiere mal diese, Max! Der Verkäufer musste mir schwören, dass die Qualität viel besser ist, als jene, die wir fanden. Ist für meinen besten Freund, hab ich ihm gesagt, da dürfe er mich nicht betrügen.“
Mit diesen Worten legte er eine kleine Holzkiste mit zwanzig verschiedenfarbigen Kalkkreiden neben mich. Verlegen sah ich ihn an.
„Hast gedacht, ich bescheiß dich.“
Beschämt nickte ich.
Attila legte mir seine sehnige Hand auf die Schulter.
„Uns geht es momentan etwas besser unter den Elenden. Das sollten wir auf alle Fälle erhalten.“
Als ich immer noch betroffen schwieg, fügte er hinzu:
„Weißt du, Max, manchmal ist Erfahrung ganz gut fürs Überleben. Nur wenn wir es schaffen, von deinem Geld täglich eine Mark oder ein paar Pfennige zu sparen, werden wir den Winter überleben. Wenn Schnee liegt, brauchen wir Reserven. Und vielleicht haben wir eines Tages doch die Möglichkeit, uns aus dem Dreck herauszuarbeiten, wer weiß.“
Wieder grinste er.
„Und jetzt mach endlich die Kiste auf. Spätestens um drei Uhr will ich die restlichen Jünger Jesu sehen.“
Mehr als ein Jahr war vergangen, seit Attila den Kreidekasten aus dem Müll gezogen hatte. Nie hätte ich damals geglaubt, dass diese wenigen bunten Klötzchen mir eine zweite Lebenschance geben sollten.
Den Winter 1925 erlebte ich nicht mehr auf der Straße. Ich, das verhätschelte Jahrhundertkind, bändelte zu meinem Erstaunen wieder mit dem Glück an. An einem nasskalten Dezembertag, ich hatte gerade beschlossen, meine Kreiden einzupacken und in den Tunnel zurückzukehren, trat eine etwa fünfzigjährige Frau zu mir, die mich schon eine ganze Zeit aus ein paar Metern Entfernung beobachtet hatte.
„Sie malen wundervoll“, raunte sie mir zu.
„Gefällt es Ihnen wirklich?“, fragte ich. Gleichzeitig dachte ich, sie möge doch endlich ihre Börse aufmachen und wenn möglich einen Schein herausziehen.
Sie ignorierte meine Frage. Eine Zeit lang schwieg sie. Dann sagte sie kühl: „Ihrer Kleidung nach zu urteilen leben Sie auf der Straße.“
Blöde Kuh, dachte ich. Wenn sie es ohnehin sieht, warum muss sie es noch kommentieren.





























