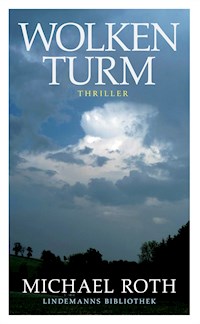5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Gütersloher Verlagshaus
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Eine bestechende Phänomenologie des Glücks – verständlich und unterhaltend geschrieben
Was hat die Theologie zum Glück zu sagen? Eine Frage, die sofort misstrauisch macht: Hat sie dazu überhaupt etwas zu sagen? Geht es in Glaube und Theologie nicht vor allem um Moral, um die »Freude am Gutsein« – ganz lustlos und unspaßig?
Keineswegs! Michael Roth erschließt den Glauben als einen Lebensvollzug, der den Menschen befähigt, sich im Hier und Jetzt ganz von der Wirklichkeit bestimmen zu lassen – und gerade so Glück zu erleben.
Bestechend!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 475
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Gütersloher Verlagshaus. Dem Leben vertrauen
Inhaltsverzeichnis
Vorbemerkung
Glück, ein interessantes Thema – Theologie, eine uninteressante Perspektive?
Das Thema »Glück« ist allgegenwärtig. Bereits ein flüchtiger Blick auf den populären Zeitschriften- und Büchermarkt verdeutlicht, dass dieser sich konstant seit einigen Jahren dem Thema »Glück« widmet. So stellt beispielsweise die Zeitschrift »P.M. Fragen und Antworten« 2/2005 auf ihrer Titelseite die Frage: »Kann man Glück lernen?«, der Fokus 32/2005 kündigt in seinem Titel – in Anspielung auf den Titel des Buches von Paul Watzlawick1 – eine »Anleitung zum Glücklichsein« an und der »Spiegel« 23/2009 verspricht zu klären, »was Glück ist«. Die Regale in den Buchhandlungen sind gefüllt mit Glücksratgebern aus den unterschiedlichsten Bereichen, seien es Lebenshilfen aus dem Bereich der Esoterik, die mit den richtigen Regeln und Lebenseinstellungen zur Erlangung des Glücks vertraut machen wollen, seien es ganz säkulare Ratgeber zum Essen, zum Sport oder zur Freizeit allgemein. Die glückliche Partnerschaft findet Aufmerksamkeit, ebenso Glück im Beruf, ja, selbst in der Diät wird Glück zu finden gesucht. Das Buch »Glück kommt selten allein« des Mediziners und Kabarettisten Eckhart von Hirschhausen stand im Jahr 2009 wochenlang auf Platz 1 der Sachbuch-Bestsellerlisten2. Noch nie zuvor – so diagnostiziert Thomas Müller-Schneider in einer kultursoziologischen Zeitdiagnose bereits im Jahre 2002 – haben sich so viele Menschen so intensiv auf die Suche nach Glückserlebnissen begeben3. Angesichts der Flut von Büchern zum Thema »Glück« werden bereits kritische Stimmen laut. So konstatiert Wilhelm Schmid: »Viele Menschen sind plötzlich so verrückt nach Glück, dass zu befürchten ist, sie könnten sich unglücklich machen, nur weil sie glauben, ohne Glück nicht mehr leben zu können. Fluten von Diskursen brechen über die Menschen herein, um ihnen zu sagen, was das Glück denn sei und was der richtige Weg dazu wäre«4.
Dass Bücher, die sich den Fragen nach Möglichkeiten und Gefährdungen menschlichen Glücks widmen, interessierte Leser finden, kann nicht ernsthaft überraschen. Bereits Aristoteles und Augustin erkannten: »Alle Menschen wollen glücklich werden«5. Wer ein Buch zum Glück ankündigt, kann daher damit rechnen, auf Interesse zu stoßen. Wie sieht es aber mit einem theologischen Buch zum Thema »Glück« aus? Glück, ein interessantes Thema – Theologie, eine uninteressante Perspektive?
Es fällt sicherlich nicht schwer, sich vorzustellen, dass sich der eine oder die andere aus dem Raum von Kirche und Theologie für eine theologische Reflexion zum Glück interessiert, um in Erfahrung zu bringen, was – beziehungsweise ob überhaupt etwas – »aus der Perspektive des Glaubens« zum Thema gesagt werden kann. Aber kann eine theologische Reflexion zum Thema »Glück« auch außerhalb des Raums von Kirche und theologischer Wissenschaft mit Interesse rechnen? Vorzustellen ist doch eher, dass ein solches Projekt auf erhebliche Zweifel stößt. Es ist durchaus denkbar, dass kritisch gefragt wird, ob theologische Reflexionen nicht zu hohe Prämissen besitzen und voraussetzen (etwa das »Für-wahr-Halten« der Existenz Gottes, eventuell auch bereits das »Für-wahr-Halten« einer bestimmten Sicht der Verfassung der Wirklichkeit) und gerade daher allgemein nicht vermittelbar sind. Bei dem Versuch, vernünftig Stellung zu beziehen, erscheint das Unternehmen Theologie als wenig hilfreich, wenn man erwartet, dass hier statt mit Hilfe der Vernunft durch den Verweis auf Gott und seine Offenbarung argumentiert wird6. Sind theologische Reflexionen zum Thema »Glück« nur etwas für »Eingeweihte«? Müssten alle anderen bestimmte Prämissen schlucken, bestimmte Behauptungen akzeptieren, um theologischem Nachdenken überhaupt folgen und etwas mit ihnen anfangen zu können?
Neben diesem methodischen lässt sich auch ein inhaltlicher Einwand denken, der bezweifelt, dass die Theologie inhaltlich etwas Weiterführendes zum Thema Glück beizutragen hat. Bei der Frage nach dem Glück kommt man eigentlich nicht auf die Idee, einen Theologen zu konsultieren, weil Glück nicht zu seinen Kernkompetenzen zu gehören scheint. Eher schon ist er gern gesehener Gast bei Gesprächsforen, die moralische Fragen erörtern. So formuliert Friedrich Wilhelm Graf: »Das Selbstverständnis beider Großkirchen in der Bundesrepublik ist vom Anspruch geprägt, in besonderem Maße für die öffentliche Sitte und individuelle Moral zuständig zu sein. Beide Kirchen verstehen sich als die zentralen Institutionen für gesellschaftliche Wertbildung und Propagierung moralischer Normen«7 beziehungsweise als »Institutionen, die Moral predigen«8. Nun braucht an dieser Stelle nicht diskutiert zu werden, ob es empfehlenswert ist, dass sich Theologie und Kirche häufig so ungeniert an der moralischen Rede beteiligen und diese durch Hinweise auf die Bergpredigt oder das Heiligkeitsgesetz religiös überhöhen9. Fest steht, dass Kirche und Theologie als »Institutionen, die Moral predigen«, nicht die erste Adresse für die Frage nach dem Glück sind; denn Glück und Moral scheinen zwei unvereinbare Größen zu sein. So wird nicht selten das moralische Handeln, das – in einer wie auch immer bestimmten Weise – dem Wohlergehen anderer verpflichtet ist, einem Handeln entgegengesetzt, das an dem eigenen Wohl interessiert ist und damit nach dem eigenen Glück fragt10. Ist der Theologe als Anwalt der Moral also nicht ungeeignet, wenn es um die Frage nach dem Glück geht? Kann man hier etwas anderes erwarten als die Diskriminierung unseres Strebens nach Glück, etwa indem der gegenwärtige Glücksdiskurs als Verfallserscheinung diagnostiziert wird, der die wesentlichen Fragen nach einem pflichtgemäßen Leben ausblendet?
Ich nehme an, dass – selbst wenn der Theologe versichert, das Glück nicht diskriminieren zu wollen – der eine oder die andere misstrauisch bleibt hinsichtlich des Glücks, von dem er sprechen wird. Wird hier vielleicht von einem Glück geredet, das mit den Erwartungen der Menschen an das Glück nichts mehr zu tun hat? Kommt hier eventuell zur Darstellung, was (entgegen unseren Wünschen) unser Glück sein sollte? Kommt damit womöglich ein Glück zur Sprache, das so gar nicht attraktiv ist? Wer will schon von einem Glück wissen, das ganz uns gar lustlos und unspaßig ist?
Es ist nicht Aufgabe der Einleitung, diese beiden Einwände zu entkräften. Dennoch möchte ich – entgegen einem möglichen Verdacht – betonen, dass es nicht darum geht, ein (episodisches) Glücksgefühl gering zu schätzen und ihm das wahre und eigentliche Glück entgegenzuhalten, etwa, indem eine bloße »Lust«, die »durch Kontakt mit dem äußerlichen Gut zustande kommt«, von einer hehren »Freude«, die »direkte Wirkung einer vortrefflichen Tätigkeit«11 ist, unterschieden und ihr untergeordnet wird. Im Gegenteil: Es geht um die Frage, wie ein solcher »Kontakt« mit äußeren Gütern zustande kommt, der uns glücklich macht. Wie ist es uns möglich, von den Anmutungsqualitäten der Gegenwart in einer lustvollen Weise bestimmt zu werden?
Einen weiteren Hinweis erlaube ich mir hinsichtlich des Adressaten der folgenden Denkversuche zum Thema »Glück«. Ich möchte nicht bestreiten, dass es ein Verständnis der Theologie gibt, das diese als Wissenschaft für ein internes Forum versteht, auf dem »[u]nbefangen theologische Begriffe […] gebrauch[t]«12 werden können. Dies ist aber nicht das Verständnis des vorliegenden Buches, in dem davon ausgegangen wird, dass auch der Theologe nicht einfach nur auf Offenbarung und Glaube verweisen kann, statt zu argumentieren. Weil auch der Theologe vernünftig Rechenschaft ablegt, indem er methodisch nachdenkt, Gründe für seine Überlegungen angibt und argumentativ um Zustimmung wirbt, sucht er keinen internen Zirkel, der seine Aussagen abnickt, weil er bestimmte (theologische) Reizworte fallen lässt. Die Gefahr eines solch internen Zirkels, in dem die Theologie »unbefangen« ihre Begriffe gebrauchen kann, ist jedoch groß: Sie besteht darin, dass die Theologie dann » in dogmatischen Sprachspielen kommuniziert, denen selbst für professionelle Insider die Aura des Immerschon-Unverständlichen eignet«13. Mein Anliegen ist stattdessen, Einsichten des Glaubens innerhalb des allgemeinen Diskurses zur Geltung zu bringen und darin auch den christlichen Glauben als »denkende Religion«14 zu verantworten. Es ist zu hoffen, dass dieses Vorgehen eine neue Perspektive auf den christlichen Glauben zu werfen vermag und ein Verständnis dafür wecken kann, um was es im Glauben geht: nicht um ein Für-wahr-Halten von Aussagen über die Welt und Gott, sondern um einen »Lebensvollzug«15, der den Menschen befähigt, in der Gegenwart zu leben und sich von den Anmutungsqualitäten der Wirklichkeit bestimmen zu lassen – und gerade so Glück erleben zu können.
Kapitel 1
Klärungen im Vorfeld
Bevor wir damit beginnen, methodisch über das Glück nachzudenken, werde ich einige »Klärungen im Vorfeld« unternehmen, die wesentliche Aussagen der Einleitung bezüglich der Bedeutung der Glücksthematik in der Gegenwart, der Möglichkeit einer theologischen Beschäftigung mit dem Glück und der Absicht der vorliegenden Denkversuche aufgreifen und näher entfalten. Beginnen werde ich dabei mit einer Frage, die bereits beantwortet ist, wenn man sich bemüht, über das Glück nachzudenken. Vorausgesetzt ist bei einem solchen Unternehmen nämlich, dass sich das Glück überhaupt dazu eignet, zu einem Gegenstand des Nachdenkens zu werden.
1.1 Nachdenken über das Glück?
Das Nachdenken über das Glück muss sich rechtfertigen1. Zunächst hat sich ein solches Unterfangen die Frage gefallen zu lassen, ob das Glück überhaupt Thema des disziplinierten Nachdenkens werden kann. Ist das Glück nicht eine »reine Geschmackssache«, wie schon die unterschiedlichsten Vorstellungen von dem, wovon Menschen sich Glück versprechen, zeigen? Jeder scheint in etwas anderem das Glück zu sehen. So zeigt Thomas Bargatzky, dass »Glücksvorstellungen […] immer mit den je kulturspezifischen Ansichten über das gute Leben zusammen[hängen], wobei bestimmte Themen stets wiederkehren« 2. Bereits in der Antike zählt Varro 288 verschiedene Glücksvorstellungen auf. Verbietet daher die Regellosigkeit des Glücks eine methodische Beschäftigung mit dem Glück? Kann man überhaupt etwas Allgemeingültiges über das Glück sagen?
Immanuel Kant bestreitet die Möglichkeit eines disziplinierten und methodischen Nachdenkens über das Glück entschieden: Er hält das Glück für einen sehr unsicheren Kandidaten; denn keiner wisse, was Glück eigentlich sei. Man kann nach Kant »nicht nach bestimmten Prinzipien handeln, um glücklich zu sein, sondern nur nach empirischen Ratschlägen […], von welchen die Erfahrung lehrt, daß sie das Wohlbefinden am meisten fördern«3. Worin das Glück besteht, ist eine »reine Geschmackssache«, so dass sich keine allgemeine Gültigkeit beanspruchende Theorie daraus ableiten lässt (und in der Konsequenz das Glück nicht als Grundlage der Moral fungieren kann). Es gibt nach Kant – so betont Ernst Tugendhat – »keine objektiven, allgemeingültigen Verhaltensregeln für das Erreichen von Glück. Welches Handeln schlechthin gut, das heißt moralisch gut ist, läßt sich objektiv begründen, hingegen läßt sich nicht objektiv, allgemeingültig begründen, welches Handeln gut für mich ist, mein Wohl fördert« 4. Kant macht ferner darauf aufmerksam, dass nicht nur zwischen unterschiedlichen Subjekten die Vorstellungen differieren, was denn als Glück bezeichnet zu werden verdient, sondern schon innerhalb eines Subjektes keine Klarheit besteht. So formuliert Kant, »daß der Begriff der Glückseligkeit ein so unbestimmter Begriff ist, daß, obgleich jeder Mensch zu dieser zu gelangen wünscht, er doch niemals bestimmt und mit sich einstimmig sagen kann, was er eigentlich wünsche oder wolle«5.
Neben diesem methodischen Einwand taucht ein zweiter Einwand gegen das Glück auf: ob denn das Glück Gegenstand menschlichen Nachdenkens werden solle. Die Frage nach dem Glück sowie einer genießenden Existenzweise scheint der Frage nach der Ehrwürdigkeit der Pflicht nicht gewachsen zu sein. Dies ist der inhaltliche, genauer gesagt: moralische Einwand gegen das Glück. Auch dieser Einwand begegnet uns bei Kant. Das Streben nach der eigenen Glückseligkeit wird von Kant als »Selbstliebe«6 identifiziert: Der nach Glückseligkeit strebende Mensch will »alles bloß nach seinem Sinne richten«7 und ist damit gerade nicht an der Wirklichkeit des anderen Menschen interessiert. Weil »ein jeder […] das seinige«8 im Sinne hat, kommt es unweigerlich zu Konfliktsituationen: »Denn der Wille aller hat alsdenn nicht ein und dasselbe Objekt, sondern ein jeder hat das seinige (sein eigenes Wohlbefinden) […]. Es kommt auf diese Art eine Harmonie heraus, die derjenigen ähnlich ist, welche ein gewisses Spottgedicht auf die Seeleneintracht zweier sich zu Grunde richtenden Eheleute schildert: O wundervolle Harmonie, was er will, will auch sie etc., oder was von der Anheischigmachung König Franz des Ersten gegen Kaiser Karl den Fünften erzählt wird: was mein Bruder Karl will (Mailand), das will ich auch haben«9. Daher kann das eigene Glücksstreben nach Kant nicht zur Grundlage unseres Handelns werden: Nicht das eigene Glücksstreben darf unsere Handlungen bestimmen, sondern nur eine einzige Maxime hat als handlungsleitende alle anderen Maximen unseres Handelns zu orientieren: »[H]andle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, daß sie ein allgemeines Gesetz werde«10. Mit dieser Maxime als Grundlage allen Handelns will Kant den Widerstreit zwischen unterschiedlichen Neigungen und Vorlieben ausschließen und dadurch einen universellen Geltungsanspruch erheben: Wenn wir jede unserer Maximen daraufhin prüfen, ob sie ein allgemeines Gesetz werden kann, machen wir uns unabhängig von unseren Wünschen, Neigungen und Trieben und damit nicht nur von dem Widerstreit der unterschiedlichen Neigungen und Triebe in uns, sondern auch von der Konkurrenz mit den Wünschen, Neigungen und Trieben anderer Subjekte.
Sowohl der erste als auch der zweite Einwand gegen das Glück lassen sich nicht a priori, gleichsam im Vorfeld methodischer Überlegungen zum Glück entkräften. Vielmehr kann nur das Nachdenken über das Glück selbst diese Einwände widerlegen. Wenn die folgenden Überlegungen den Einwand, der die Regellosigkeit des Glücks gegen die Möglichkeit des methodischen Nachdenkens über das Glück ausspielt, zu entkräften suchen, so tun sie dies, indem sie eine deskriptive Strategie verfolgen und damit das Nachdenken über das Glück als Nachdenken rechtfertigen, das heißt sich methodisch ausweisen. Allerdings bedeutet ein methodisches Nachdenken keineswegs, dass sich eine endgültige Definition des Glücks finden lässt11. Schon gar nicht führt methodisches Nachdenken zwangsläufig zur Etablierung eines Systems, in dem sich alles umstandslos reimt und in dem alles Sperrige und Widerspenstige in einer höheren Einheit aufgehoben ist. Methodisches Nachdenken kann sich durchaus bescheiden, indem es einzelne Verstehensbewegungen initiiert, die weder den Kontext leugnen, aus dem sie entstammen, noch das konkrete Problem und die konkrete Fragestellung verdrängen, durch die sie motiviert werden und die daher auch nicht vorschnell auf ein in sich stimmiges System drängen.
1.2 Die Bedeutung der Glücksthematik in der Gegenwart
Bereits in der Einleitung wurde darauf hingewiesen, dass schon ein flüchtiger Blick auf den populären Bücher- und Zeitschriftenmarkt die Präsenz des Themas »Glück« verdeutlicht. Die Behandlung des Themas »Glück« ist jedoch keineswegs auf den populären Bücher-und Zeitschriftenmarkt beschränkt. Auch hinsichtlich der Humanwissenschaften kann man geradezu von einer Konjunktur der Glücksthematik sprechen, ohne freilich damit zu behaupten, dass das Glück von den einzelnen humanwissenschaftlichen Disziplinen erst neu »entdeckt« werden musste. Dies zeigt sich beispielsweise in der Pädagogik: Bereits Jean-Jacques Rousseau wusste, dass das Ziel der Erziehung sei, »sich selbst zu erkennen, sich selbst zu entfalten, wirklich zu leben und glücklich zu werden«12. Und in den 1960er-Jahren konnte schon Alexander S. Neill darauf hinweisen, dass »die Heilung eines unglücklichen Menschen […] die einzige Heilung [ist], die erlaubt ist«13. Zu erinnern ist auch an Hartmut von Hentig, der in seinem Essay über Bildung die »Wahrnehmung des Glücks«14 zu den Maßstäben zählt, an denen sich die Bildung eines Menschen zu messen hat. »Bildung« – so von Hentig – »soll Glücksmöglichkeiten eröffnen, Glücksempfänglichkeit, eine Verantwortung für das eigene Glück«15. Im Unterschied zu solchen einzelnen Verweisen auf das Glück versucht der Kölner Pädagoge Gerhard Mertens in seinem im Jahr 2006 erschienenen Buch »Balancen – Pädagogik und das Streben nach Glück«, in einem bildungsphilosophischen Ansatz die Glücksthematik explizit zu machen und systematisch zu entfalten16. Das Streben nach Glück wird bei ihm ins Zentrum der Überlegungen gestellt und fungiert als Orientierungspunkt der Pädagogik.
Ebenfalls der systematischen Erforschung des Phänomens »Glück« hat sich die Psychologie angenommen. Wenn Sigmund Freund noch behauptet, dass das Programm des Strebens nach Glück »überhaupt nicht erfüllbar [ist]«17, so befindet er sich ganz in Übereinstimmung mit Artur Schopenhauer, der formuliert: »Es gibt nur einen angeborenen Irrtum, und es ist der, daß wir da sind, um glücklich zu sein«. Und: »Alles im Leben gibt kund, daß das irdische Glück bestimmt ist, vereitelt oder als eine Illusion erkannt zu werden«18. Im Unterschied zu Freud stellt sich seit geraumer Zeit die Psychologie als so genannte »Positive Psychologie« der Frage nach den Möglichkeiten menschlichen Glücks und den Wegen seiner Realisierung19. Hervorzuheben sind hier vor allem die Arbeiten des amerikanischen Psychologen Mihaly Csikszentmihalyi, der der Frage nachgegangen ist, wann sich Menschen am glücklichsten fühlen und der mit dem Konzept des »flow« bis in den populären Zeitschriftenmarkt vorgedrungen ist20. Wie die Psychologie hat auch die Soziologie dem Thema »Glück« in den letzten Jahren verstärkt Beachtung geschenkt. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf das im Jahr 1990 von dem Soziologen Alfred Bellebaum gegründete »Institut für Glücksforschung«21 oder auf den Titel der seit 1999 erscheinenden Zeitschrift »Journal of Happiness Studies. An Interdisciplinary Forum of Subjective Well-Beeing« 22.
Besonders bemerkenswert ist, dass das Thema Glück auch wieder expliziter Gegenstand der Philosophie geworden ist, was für uns von besonderem Interesse ist. Zwar ist das Thema in der Philosophie nie verschwunden. So betont Joachim Schummer, dass es schwierig sein dürfte, einen Philosophen zu benennen, der die Behauptung, dass alle Menschen nach Glück streben, jemals ernsthaft bestritten hätte23. Und Dieter Thomä unternimmt in seiner Arbeit aus dem Jahre 2003 »Vom Glück in der Moderne« den Versuch aufzuzeigen, dass die Glücksthematik auch dann, wenn sie in der Geschichte der philosophischen Auseinandersetzung nicht direkt zutage trat, häufig den Hintergrund der philosophischen Überlegungen bildete. Von daher gilt es nach Thomä, »das Glück als geheimes Zentrum der Moderne zu identifizieren« 24. In den letzten Jahren ist das Thema Glück jedoch darüber hinaus auch explizit zum Thema der Philosophie gemacht worden, wie bereits die Arbeit von Thomä eindrucksvoll bestätigen. Es wäre heute wohl nicht mehr so ohne weiteres denkbar, dass – wie im Jahre 1967 – ein Buch mit dem Titel »Antworten der Philosophie heute«25 auf 444 Seiten das Wort »Glück« nicht erwähnt. Angesichts der Fülle der aktuellen Publikationen sei exemplarisch auf einige Arbeiten verwiesen. Erwähnt sei beispielsweise das Buch von Francesco und Luca Cavalli-Sforza »Glück auf Erden« aus dem Jahr 2000, das sogar von einer »Wissenschaft vom Glück« spricht. Das Buch ist von der Überzeugung getragen: »Wir haben das Zeug, um glücklich zu werden, und brauchen dazu keine speziellen Fähigkeiten«26. Die Glücksthematik steht auch im Zentrum des Buches von Wilhelm Schmid »Philosophie der Lebenskunst«: Schmid ermittelt die Grundstrukturen, die allgemeinen und besonderen Bedingungen, die das Leben des Individuums bestimmen; denn dieses Vorgehen »erlaubt im Gegenzug die Bestimmung der Wahlmöglichkeiten, die den Raum der Freiheit für die individuelle Lebensgestaltung markieren, und die Wahl des Lebens, das den selbst gesetzten Ansprüchen genügt und Vortrefflichkeit und Glückseligkeit realisiert«27. Dabei intendiert Schmid keineswegs, eine inhaltliche Festlegung der Lebenskunst zu betreiben, sondern »ihre quasi-transzendentale Grundlegung« zu privilegieren. Es geht Schmid daher um eine »theoretische Auseinanderlegung all dessen, was Lebenskunst überhaupt beinhalten kann und welche ihrer Bestandteile aller Erfahrung nach als grundlegend zu bezeichnen sind«. Im Hinblick auf ihre Konkretisierung kann es in keinem Fall darum gehen, »Regeln vorzuschreiben und Rezepte zu liefern, sondern allenfalls, optativ, Vorschläge zu formulieren, die im besten Falle Plausibilität für sich beanspruchen können«28. In dieser Richtung urteilt Schmid auch in seinem Büchlein »Glück« aus dem Jahre 2007: »Es gibt keine verbindliche, einheitliche Definition des Glücks. Was darunter zu verstehen ist, legen letztlich Sie selbst für sich fest. Die Philosophie kann lediglich etwas behilflich sein bei Ihrer eigenen Klärung der Frage: Was bedeutet Glück für mich?«29. Bemerkenswert sind in diesem Zusammenhang auch die immer zahlreicher entstehenden »Philosophischen Praxen«, in denen »methodisch-rationale Sinn- und Glückskonzepte entworfen« werden. Dabei betont Urs Thurnherr, selbst Inhaber einer Philosophischen Praxis, dass ein philosophischer Praktiker keine »philosophische Anleitung zum Glücklichsein« besitzt, er vielmehr »nur mit dem Besucher zusammen dessen Gedankenwelt neu zu ordnen [vermag], so dass sich Sinn, so dass sich Glück einstellen kann«30.
Es wäre nun aber vorschnell, wenn der Theologe – quasi einer Hermeneutik des Verdachts verpflichtet – der gegenwärtigen Philosophie insgesamt unterstellen würde, dass sie einem Machbarkeitswahn verfallen sei, bei dem die Gefährdungen des Glücks, zu denen Krankheit, Gebrechlichkeit wie auch die Sterblichkeit des Menschen gehören, außer Acht gelassen werden. Dies ist nämlich keineswegs der Fall: So werden etwa bei Wolfgang Janke Liebe und Tod als spannungsvolle Grundbestimmungen unseres Glücks offengelegt31, und Herrad Schenk analysiert kritisch den Mythos der Machbarkeit: Neben dem »Gestalten« erblickt er daher in dem »Geschehen-Lassen« eine entscheidende Fähigkeit, die zu besitzen für ein glückliches Leben unabdingbar ist32. Der Frage, welche Sicht des gelingenden Lebens es uns erlaubt, unsere Krankheit und Gebrechlichkeit annehmen zu können, widmet sich Alasdair MacIntyre in seiner Studie »Die Anerkennung der Abhängigkeit«33.
Bedeutsam ist, dass auch in der philosophischen Ethik die Frage nach dem Glück erneut in das Zentrum gerückt wurde. Dies überrascht besonders; denn bekanntlich hat die Ethik mit der Geburt der Moderne ihren Gegenstand gewechselt: Die von der Antike her maßgebliche Frage, wie ein Leben aussehen muss, wenn es – im Sinne der eudaimonia (Glückseligkeit) – gelingendes oder glückliches Leben sein soll, wurde abgelöst durch die Frage, welche Pflichten ich gegenüber dem anderen habe und was ich in Bezug auf den anderen tun soll. Aus einer Strebensethik wurde eine Sollensethik34. Exemplarisch zeigt sich dies bei Immanuel Kant, dessen Ethik dem Glück jede Begründungsfunktion innerhalb der Ethik abgesprochen hat35. Neben seinem methodischen Einwand ist hier vor allem sein inhaltlicher Einwand zu bedenken: Das Streben nach Glück wird von Kant als »Selbstliebe« identifiziert, da der nach Glückseligkeit strebende Mensch – wie bereits erwähnt – nach Kant »alles bloß nach seinem Sinne richten« will und damit gerade nicht an der Wirklichkeit des anderen Menschen interessiert ist.
Gegenüber Kants Verdikt gegen das Glück lässt sich eine »Rehabilitierung« der Glücksthematik innerhalb der philosophischen Ethik konstatieren36. Zum einen lässt sich eine erneute Hinwendung zur antiken, besonders aristotelischen Ethik beobachten. Der Unterschied zwischen antiker und neuzeitlicher Ethik ist vor allem durch die Einwände der so genannten Neuaristoteliker37 gegen die universalistischen Spielarten der Sollensethik wieder ins Bewusstsein gebracht worden38. So nehmen die ethischen Grundsatzüberlegungen von Alasdair MacIntyre39, Martha C. Nussbaum40 oder Thomas Nagel41 das Glück und das menschliche Glücksstreben in den Blick und erheben von hier aus (gerade auch unter Rückgriff auf die antiken Konzeptionen) das »gelingende Leben« zum Thema der Ethik. Eine größere Reserve hinsichtlich der Versöhnung von Glück und Moral lässt sich hingegen bei den kontinentalen Ethikern beobachten: So betont Hans Krämer, dass »fast alle namhaften kontinentalen Ethiker […] sich heute darin einig [sind] dass eine Einheitsethik antiker Art, die die Identität von Glück und Moral annimmt, nicht überzeugt und dass hinter die moderne Differenzierung zwischen beiden Gesichtspunkten nicht zurückgegangen werden kann«42. Ihr Anliegen besteht daher nicht darin, hinter den von Kant erreichten Reflexionsstand zurückzulenken, sondern von ihm ausgehend nach dem Recht der antiken Tradition und der Möglichkeit philosophischer Rede von Glück zu suchen. So kann es beispielsweise nach Martin Seel nicht darum gehen, den Widerstreit zwischen Glück und Moral vorschnell aus der Welt schaffen zu wollen; vielmehr muss die Möglichkeit der Moral aus diesem Widerstreit zu verstehen gesucht werden. Nur so kann sich ein Verständnis der Einheit des guten und gerechten Lebens ergeben; denn »die Wahrheit einer Ethik der Identität lässt sich allein auf dem Boden einer Ethik der Differenz formulieren«43. Andererseits hält Seel den Gegensatz zwischen Eudämonismus und Kantianismus für künstlich: »Der moralisch gute Wille, den Kant zum ethischen Angelpunkt erhebt, ist darin gut, daß er das Glücksstreben der anderen als gleichberechtigtes Streben respektiert«44. Im Anschluss an Seel bringt Peter Fischer innerhalb seiner »Einführung in die Ethik« das Glück im »außermoralischen Sinne«45 zur Sprache. Für Fischer gilt: »Insofern das Streben nach der eigenen Glückseligkeit im Rahmen des moralisch und rechtlich Erlaubten erfolgt, darf jeder nach seiner eigenen Fasson selig werden«46. Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auch auf Ernst Tugendhat, der einen Begriff von Glück bemüht, einerseits um die Frage nach der Motivation zum Guten zu klären, andererseits um bei Gerechtigkeitsfragen das »wohlverstandene Interesse eines jeden« 47 zu berücksichtigen; ebenso auf Malte Hossenfelder48, der die allgemein geltenden Normen nicht im unbedingten Sollen, sondern im eigenen Wollen begründen will, das immer auch ein Wollen des glücklichen Lebens ist, oder auf Robert Spaemann49, der in der Fähigkeit zum Wohlwollen gegenüber anderen gleichermaßen den Grund für ein glückliches Leben und eine moralische Lebensführung erblickt.
Dieser kurze Überblick verdeutlicht, dass das Thema »Glück« in den Humanwissenschaften zwar nicht neu entdeckt werden musste, es aber in den letzten Jahrzehnten aus dem Schattendasein ans Licht getreten ist und eine zentrale Stellung erhalten hat. Diese Konjunktur des Glücks kann kaum überraschen. Norbert Hinske ist zuzustimmen, wenn er formuliert: »Die Vorstellung vom Glück ist unaufhebbar mit der Existenz des Menschen verknüpft«50. Eine Wissenschaft, die den Menschen zu verstehen beansprucht, wird daher das menschliche Glücksbedürfnis nicht übergehen können. Es ist daher konsequent, wenn das Thema »Glück« nicht nur am Rande vorkommt und sich auf einige Bemerkungen beschränkt, sondern in den Fokus der einzelnen Wissenschaften rückt. Dass sich das menschliche Bedürfnis nach Glück nicht übergehen oder gar diskriminieren lässt, zeigt sich vor allem in der Ethik. Die Frage, was der Mensch tun soll, kann nicht absehen von dem, was der Mensch tun will, das heißt davon, wonach der Mensch in seinem Wollen letztlich ausgerichtet ist. Eine Beschreibung des menschlichen Sollens, das dem menschlichen Glücksbedürfnis nicht Rechnung trägt, wird von dem Subjekt immer nur als äußere Zumutung erfahren werden können, weil sich Menschen mit dem Inhalt der Forderungen nicht identifizieren können. Wenn das Gute keine Beziehung zum Menschen besitzt, für den das Gute gut ist51, dann kommt es zu der unbeantwortbaren Frage, warum ich das Gesollte wollen soll. Nun geht es in diesen Bemerkungen nicht darum, die These zu unterstützen, dass die Frage »Why be moral?« sich durch den Hinweis auf das eigene Glück beantworten lässt. Ich bin hinsichtlich dieser These skeptisch52. Deutlich ist aber, dass wir die Frage nach der Moral nicht unabhängig von der Frage nach unserem wirklichen Wohl erörtern und beantworten können. Dies gilt im Grunde für alle Humanwissenschaften: Je stärker das autonome Subjekt in das Zentrum rückt, desto drängender wird die Frage, was das Subjekt eigentlich will.
Angesichts der Konjunktur des Themas »Glück« überrascht es nicht, dass auch innerhalb der protestantischen Theologie das Bedürfnis entsteht, sich der Frage nach dem Glück zuzuwenden. Für einen Theologen ist die Anknüpfung an die Glücksthematik verlockend. Zu Recht formuliert Johann Hinrich Claussen, dass inzwischen viele theologische Begriffe »ihre Verbindung zum Allgemeinmenschlichen weitgehend verloren« haben und dass demgegenüber der Reiz des Wortes »Glück« darin besteht, dass es »die Bindung an das alltägliche Leben wie an elementare Erfahrungen wahrt«. Daher prophezeit Claussen: »Eine Theologie, die einen eigenverantworteten Glücksbegriff zu bilden vermag, wäre neu und anders in der Lage, die christliche Religion als eminente Lebensangelegenheit auszuweisen«53. Das Thema Glück bietet sich dazu an, dogmatische Begriffe aufzuschließen und in ihrer Bedeutung für konkretes Leben hier und heute durchsichtig zu machen. Allerdings stellt sich die Frage, ob die protestantische Theologie so ohne weiteres auf die Glücksthematik einschwenken kann. Dieser Frage werde ich im nächsten Kapitel nachgehen.
1.3 Protestantische Glücksfeindschaft?
Im Jahr 2004 konstatierte Jörg Lauster, dass es »gegenwärtig keine Diskussion zum Thema Glück in der Theologie [gibt], an die anzuknüpfen wäre«54. Diesem ist sicherlich im Großen und Ganzen zuzustimmen, wenn auch nicht vergessen werden darf, dass einige essayistische Monographien55 und einige Aufsätze aus dem Bereich der Praktischen Theologie seit langem vorliegen56. Ebenso findet sich das Glück bereits als Thema der Religionspädagogik (vornehmlich im katholischen Bereich)57, wie auch einiger Einzeluntersuchungen58. Die Theologie beginnt also, die Glücksthematik als Bezugspunkt zu entdecken 59, auf den hin sie ihre Einsichten artikulieren muss, wenn sie an gegenwärtigen Fragestellungen teilnehmen und in Bezug auf die Gegenwart sprechen will. Blickt man auf dieses Anliegen, wird es kaum verwundern, dass gerade die Religionspädagogik das Thema »Glück« aufgegriffen hat. Allerdings ist – wie der Religionspädagoge Franz W. Niehl deutlich macht – die Religionspädagogik auf eine systematische Theoriebildung angewiesen60. In der Tat: Es reicht nicht aus, das Thema »Glück« im Religionsunterricht zum Thema zu machen, indem man Schülerinnen und Schüler befragt, was sie sich unter Glück vorstellen, ohne dies zur christlichen Tradition in Beziehung setzen zu können61.
Nun scheint ein ganz unproblematisches Aufgreifen der Glücksthematik gerade innerhalb der protestantischen Theologie schwierig zu sein. Mit den Begriffen »Glück« und »Kreuz« können geradezu zwei entgegengesetzte Denktraditionen charakterisiert werden62: Aristoteles auf der einen Seite, der die eudaimonia als letztes Ziel menschlichen Handelns begreift und daher der Frage nachgeht, wie dieses Ziel zu erreichen ist, und Martin Luther auf der anderen Seite, der das Glücksstreben des Menschen als ein sündhaftes Streben anprangert, weil der Mensch hier »nur das Seine« sucht. In seiner berühmten Auslegung des 7. Bußpsalms diagnostiziert Luther, dass derjenige, der Glück sucht, sich an seinen eigenen Bedürfnissen orientiert und daher ›eyngekrumet auff sich selb‹63 ist64. »Eyn krumer geyst ist … der yn allen dingen sich ynn sich selbst boget, das seyne suchet«65. Es wäre aber zu oberflächlich, Luthers Votum ausschließlich als eine Auffassung zu verstehen, die dagegen polemisiert, dass Menschen in oberflächlichen Dingen Glück suchen, nicht aber die Tiefe des Glücks intendieren, wie sie etwa in der betrachtenden und sich versenkenden Schau Gottes zu finden ist. Luthers Kritik richtet sich nämlich keineswegs bloß gegen das triviale oder banale Glücksstreben66. Diejenigen, die sich zugute halten, dass sie nicht »in fleyschlichen Dingen lust suchen«, sondern in »yren geystlichen gutern, weysheyt unnd vornunfft und frumickeyt«, stecken nach Luther sogar »tiffer yn lust der selben«67. So formuliert Luther gegen das »höhere Glücksstreben«: Der Sünder ist »so sehr in sich verkrümmt, daß er nicht nur die leiblichen, sondern auch die geistlichen Güter auf sich zurückbiegt und sich in allem sucht«68. Luther zeigt damit, dass »es kein Refugium eines sündlosen Glücksstrebens gibt«69. Selbst in dem edelsten Streben biegt der Mensch doch alles nur auf sich selbst zurück und sucht sich selbst.
Luthers Kreuzestheologie (theologia crucis), wie er sie in der »Heidelberger Disputation«70 vorträgt, ist die kritische Antwort auf seine Einsicht in das menschliche Streben, das in allem nur das Seine sucht, und der Versuch, die Frage zu beantworten, wie sich die Macht des verkehrten Willens brechen lässt, der in allem nur sich selbst will71. Luther sieht das Aneignungsstreben des Menschen überwunden, wenn Gott dem Menschen im Gegensatz dazu (sub contrario) – in der Ohnmacht, Torheit und der Schande (dem malum) des Kreuzes – begegnet: »So, dass es keinem mehr genügt und nützt, der Gott in der Herrlichkeit und Majestät erkennt, wenn er ihn nicht erkennt in der Niedrigkeit und Schande des Kreuzes«72. Der, dem Gott in seiner Schwachheit begegnet, der »weiß, dass es ihm genügt, wenn er leidet und zerstört wird durch das Kreuz, um immer mehr zunichte zu werden«73. Wer durch das Leiden zunichte geworden ist, rühmt sich nicht selbst. Er weiß, dass Gott es ist, der in ihm seine Werke tut74. Theodor Dieter bringt es auf den Punkt, wenn er Luthers theologia crucis als »Programm einer konsequenten ›Frustrierung‹« des auf sich selbst gerichteten Menschen begreift; die theologia crucis »leitet dazu an, dieses Streben im malum crucis sich buchstäblich totlaufen und in der Vergeblichkeit seiner Suche zugrunde gehen zu lassen«75. Der Mensch soll von sich selbst weggerissen und außerhalb seiner, das heißt außerhalb seiner Möglichkeiten und Fähigkeiten – außerhalb seiner Selbstverwirklichung – gestellt werden76. Was die Unterbrechung des Strebens nach Selbstverwirklichung mit Glück zu tun hat, wird von Luther in diesem Zusammenhang nicht beantwortet; eher scheint es sich nahe zu legen, dass für Luther mit der Verabschiedung des Strebens nach Selbstverwirklichung auch das Glück verabschiedet wird. In dieser Weise hat Karl Holl Luther verstanden und sogar gerühmt: »Schärfer als irgendeiner vor ihm hat er den Zusammenhang von Glücksstreben und Selbstsucht und damit auch den Gegensatz zwischen Seligkeitsverlangen und wirklichem Gottesdienst erkannt«77. Holl geht sogar noch einen Schritt weiter, wenn er Luther als Verkünder einer Religion einer »auf das eigene Glück verzichtende[n]«78 Gottesliebe versteht.
Angesichts dieser Frontstellung von Glück und Kreuz mag es auf den ersten Blick nicht überraschen, dass die Frage nach dem Glück innerhalb der protestantischen Theologie keine große Tradition besitzt, ihr sogar skeptisch begegnet wird. Das Bedürfnis nach Glück scheint etwas zu sein, das es zu bekämpfen gilt; nicht im Glück, sondern im Leiden scheint man Christus nahe zu sein. Typisch mag der Satz Heinrich Müllers sein, der in seiner im Jahr 1644 entstandenen Schrift »Geistliche Erquickungsstunden« formuliert: »Lieber mit Jesu geweint als mit der Welt gelachet. Beym Lachen wird man Jesum nicht finden. Wo liest du, daß er gelacht hätte? Den Tränen ist er aber sehr nahe«79.
Ganz offenkundig ist es hinsichtlich der Glücksthematik in der katholischen Tradition wesentlich besser bestellt, die mit Thomas von Aquin über die Jahrhunderte hinweg eine stabile Bezugsgröße für Reflexionen über das Glück besitzt. So gehört es nach Thomas zur menschlichen Natur (ist somit keineswegs Zeichen sündhafter Existenz), ein Gut zu begehren, von dem der Mensch sich diejenige Vervollkommnung verspricht, in der sein Sehnen und Begehren gestillt wird und in dem er diejenige Geborgenheit findet, die ihn zur Ruhe kommen lässt80. Indem »die Begehr in dem erlangten Gut zur Ruhe kommt«, wird »Freuung« verursacht81. Für Thomas gilt es daher zu fragen, welche Qualität demjenigen Gut eignen muss, in dem der Mensch seine Glückgeborgenheit findet, genauer: was »das vollkommene Gut ist, das die Begehr vollständig in Ruhe versetzt«, so dass nichts »zu begehren übrig«82 bleibt. Zwar begehrt nach Thomas jeder Mensch diese Glückgeborgenheit, denn »Glückgeborgenheit begehren ist nichts anderes, als begehren, dass der Wille satt wird«; die Menschen unterscheiden sich allerdings in ihrer jeweiligen Antwort auf die Frage, »worin diese Glückgeborgenheit besteht«. Dies zeigt für Thomas, dass nicht alle wissen, »welchem Ding das Berede von Glückgeborgenheit zukommt«. Daher »lernen nicht alle die Glückgeborgenheit kennen«83. Gerade daher ist es für Thomas die vornehmste Aufgabe der theologischen Reflexion, in dieser Frage zu orientieren. Thomas versucht zu zeigen, dass dasjenige, von dem sich die meisten Menschen Geborgenheit und Glücksruhe versprechen, gerade nicht in der Lage ist, das Begehren des Menschen in Ruhe zu versetzen84, und versucht, von hier aus zu fragen, welchem Gut diese Qualität eignet.
Für Thomas besteht das letzte und vollkommene Glück in der Schau der göttlichen Wesenheit85; er unterscheidet somit zwischen einer »unvollkommenen Glückseligkeit, die in diesem Leben zu haben ist«, und einer »vollkommenen Glückseligkeit, die in der Schau Gottes besteht«86. So nähert sich der Mensch nach Thomas schon in diesem Leben der letzten Vollendung, und zwar partizipierend in dem Maß, in dem seine Tätigkeit ihn mit Gott verbindet. Allerdings kann diese mit Gott verbindende Tätigkeit in diesem Leben immer nur bruchstückhaft und ohne durchgehende Kontinuität sein87. In der vita contemplativa, dem betrachtenden Leben, sieht Thomas die Verbindung des Menschen mit Gott in höherem Maße gewährleistet als im tätigen Leben: »Deswegen ist im tätigen Leben, das sich um vieles kümmern muss, das Glück in geringerem Maße zu finden als im betrachtenden Leben, das sich nur mit einem beschäftigt, nämlich mit der Betrachtung der Wahrheit«88. Dabei – so hebt Hermann Kleber hervor – ist für Thomas das »Glück des betrachtenden Lebens […] keine graduelle Steigerung des Glücks des tätigen Lebens, sondern ein qualitativ anderes Glück«89. Das Glück des tätigen Lebens wird bei Thomas vor allem in seiner Dienstfunktion gegenüber dem Glück der Kontemplation verstanden.
Gerade der letzte Punkt lässt es fraglich erscheinen, ob Thomas in der Lage ist, das Glück in der Zeit tatsächlich angemessen zu erfassen. Es stellt sich nämlich vor allem die Frage, inwiefern es ihm gelingt, die »Verbindung mit Gott« nicht neben, sondern im Erleben des Glücks des tätigen Lebens zur Sprache zu bringen, das heißt von einem Glück zu sprechen, das sich dem Ergreifen der Anmutungsqualitäten der Dinge des Daseins verdankt. Ich werde dieser Frage im Folgenden nicht nachgehen, ebenso wenig wie der Frage, inwiefern das »betrachtende Leben« dem Verdikt Luthers gegen das »höhere Glücksstreben« verfällt, das nicht »in fleyschlichen Dingen lust« sucht, sondern in »yren geystlichen gutern, weysheyt unnd vornunfft und frumickeyt« und damit sogar tiefer in der Selbstsucht steckt, weil auf ganz sublime Weise die Dinge »auf sich selbst gebogen« und »sich in allem gesucht wird« (siehe oben). Mir geht es an dieser Stelle nicht um eine Auseinandersetzung mit Thomas, sondern ausschließlich darum zu verdeutlichen, dass – im Unterschied zur protestantischen Theologie – die katholische Tradition mit Thomas von Aquin immer einen Anknüpfungspunkt für die Glücksthematik besessen hat, unabhängig von der Frage, ob dieser Anknüpfungspunkt kontinuierlich genutzt wurde. So macht Servais Pinckaers darauf aufmerksam, dass – während die Ethik bis ins Mittelalter als Antwort auf die Frage nach dem Glück verstanden wurde – seit dem 14. Jahrhundert die Frage des Glücks vernachlässigt wurde, so dass sich die Sittenlehre mehr und mehr auf Verpflichtungen konzentrierte, die dem Menschen vom Sittengesetz auferlegt werden. So betrachten die Handbücher der Moraltheologie zwar Thomas von Aquin als die wichtigste Autorität, doch im Unterschied zu dessen »Summa theologiae« enthalten sie keinen Traktat mehr über das Glück90.
Fasse ich unsere bisherigen Überlegungen zusammen, dann zeigt sich die offene Frage, vor der wir stehen: Dass die protestantische Theologie die Glücksthematik als Bezugspunkt zu entdecken beginnt, auf den hin sie ihre Einsichten artikulieren muss, wenn sie an gegenwärtigen Fragestellungen teilnehmen und in Bezug auf die Gegenwart sprechen will, überrascht nicht. Fraglich aber ist, wie sie dies tun kann. Besteht die Aufgabe darin zu zeigen, dass für die christliche Existenz das Glück ein unernstes Thema ist, das sich zutiefst fragwürdigen (weil egoistischen) menschlichen Interessen verdankt und der Frage nach einem pflichtgemäßen Leben nicht gewachsen ist? Diese Bestimmung würde übersehen, dass das Glück alles andere als ein unernstes Thema ist und sich das menschliche Bedürfnis nach Glück nicht einfach diskriminieren lässt. Ist dann – im Interesse einer Anknüpfung an den allgemeinen Glücksdiskurs – Luthers Einspruch gegen das menschliche Glücksstreben zu widersprechen? In diese Richtung argumentieren etwa Rochus Leonhardt91 und Johannes Fischer 92, wenn sie empfehlen, die Glücksfeindschaft des Protestantismus durch eine Neubelebung der aristotelischen und thomistischen Traditionen zu überwinden. Zu Recht fragt Johann Hinrich Claussen in Bezug auf diese Empfehlung, ob »es für die protestantische Theologie nicht angemessener und produktiver [wäre], die eigenen Traditionen […] auf ihre glückstheologischen Möglichkeiten hin zu befragen« 93. Allerdings stellt sich sofort die Frage, ob dies angesichts Luthers scharfer Kritik an Aristoteles und seiner Kritik am menschlichen Glücksstreben ein aussichtsreiches Unterfangen ist. Hat die protestantische Theologie überhaupt »glückstheologische« Möglichkeiten? Oder hat Immanuel Kant hier das letzte Wort gesprochen, wenn er das menschliche Glücksstreben gerade nicht zum Zuge kommen lassen will? Es sei daran erinnert, dass Kant häufig gerade auf Grund seines Antieudämonismus als der Philosoph des Protestantismus 94 verstanden wurde!
Das allzu runde Bild vom protestantischen Antieudämonismus von Luther bis Kant bekommt jedoch Risse, einiges Widersprüchliche will sich nicht so ganz fügen. So stellt sich im Blick auf Kant die Frage, ob dieser tatsächlich so bruchlos mit Luther vermittelt werden kann. Nun darf sicherlich nicht unterschätzt werden, wie wirkmächtig Kant innerhalb der protestantischen Ethik war und immer noch ist. Allerdings gibt es ganz unterschiedliche Auffassungen von Kants tatsächlicher Nähe zur (lutherischen) Reformation. Diese reichen von der Auffassung, Kants theologischer Hintergrund sei mehr pietistisch als reformatorisch95, über die Auffassung, Kant stehe dem Katholizismus näher als der Reformation96, bis hin zu dem von Heinrich Vogel vertretenen Urteil, Kant sei weniger Philosoph des Protestantismus als Philosoph des Judentums97. Diese Spur nimmt auch Micha Brumlik in der WELT wieder auf, wenn er zu begründen versucht, warum jüdische Philosophen und Theologen Kant, der »persönlich ein Juden gegenüber ressentimentgeladener […] Antisemit war«, als einen der ihren erkannten98. Kants Zuordnung zum Protestantismus ist also durchaus nicht unumstritten; ganz offensichtlich gibt es auch auseinanderstrebende Tendenzen, die Misstrauen gegenüber einer allzu widerspruchslosen Vermittlung angebracht sein lässt. Misstrauisch macht nicht nur die Tatsache, dass Luther eine ganz andere Persönlichkeit als Kant ist. So bezeugen unter anderem Luthers Briefe, dass er das Eheleben, Freundschaften, das Zusammensein mit seinen Kindern durchaus zu genießen vermochte, wie er auch ganz leiblichen Genüssen alles andere als abgeneigt war, sondern ihre Anmutungen zu schätzen wusste99. Dies ist keineswegs als bloße Inkonsequenz zwischen Theorie und Praxis zu werten, denn Luther kann von einem Vertrauensglauben sprechen, der sich von den Dingen des Lebens berühren und bestimmen lässt100. Misstrauisch macht vor allem auch, dass anders als bei Kant Luther nicht von einem Handeln »aus Pflicht« redet, sondern das christliche Ethos geradezu als ein Handeln »aus Neigung« zu verstehen scheint101. So findet sich die für Luthers reformatorische Entdeckung so wesentliche Unterscheidung zwischen dem fordernden Gesetz (»Du sollst«) und dem bedingungslosen Zuspruch des Evangeliums (»Dir ist gegeben«) bei Kant nicht102. Im Unterschied zu Kant ist für Luther das Gesetz gerade kein Bestimmungsgrund des menschlichen Willens103.
Ganz unabhängig von der Skepsis gegenüber einer Traditionslinie Luther-Kant zeigt sich, dass Luther ganz anders über den Glauben zu reden vermochte, als er dies in der »Heidelberger Disputation« getan hat. Erscheint in dieser Disputation der Glaube als Anleitung zur Selbstverachtung, so spricht Luther in späteren Zusammenhängen offensichtlich eine ganz andere Sprache. »[D]er ynnerliche mensch ist mit gott eyniß, fro(e)lich und lustig, umb Christus willen«104, ja, Luther kann sogar von einer »lieb und lust zu gott«105 sprechen. »Got macht uns seine lieb sast susz und freuntlich, in dem, das Christus fur uns gestorben ist, da wir noch sunder warenn«106.
Mit der »Heidelberger Disputation« haben wir offenkundig einen Text vor uns, der vor Luthers reformatorischer Wende zu datieren ist, in der er den Glauben als Vertrauen auf Gottes bedingungslose Zusage zu verstehen lernt107. Die Glücksthematik ist daher erneut von dem Freispruch des Evangeliums her zu bedenken. Erst hier wird das Freiwerden von mir selbst durch Gottes bedingungslosen Zuspruch deutlich: Der Gläubige läuft fort »von ym selb, und leufft zu got«108 und erfährt die »freud und lust«109, »gotte gunstig«110 zu sein. Allerdings dürfen dabei Luthers Einsichten in der »Heidelberger Disputation« und seine Kritik am menschlichen Glücksstreben nicht ausgeblendet werden. Vor allem ist zu bedenken, dass Luther sich in der Disputation nicht gegen das Glück wendet, sondern gegen das Streben nach Glück. Die Frage muss daher offen bleiben, ob Luthers Negation des menschlichen Glücksstrebens gar dem menschlichen Glück dient111.
1.4 Theologische Denkversuche zum Wohlbefinden und Sein-Lassen
Wenn im Folgenden vom »Glück« gesprochen wird, dann ist natürlich nicht das Glück im Sinne von Zufall gemeint. Dies zu betonen ist im Deutschen notwendig; denn das Wort »Glück« kann bekanntlich im Deutschen – anders als in anderen Sprachen wie dem Englischen, das zwischen »luck« und »happiness«, oder dem Lateinischen, das zwischen »fortuna« und »beatitudo« und dem Griechischen, das zwischen »eutychia« und »eudaimonia« unterscheidet – sowohl den »günstigen Zufall« (»luck«) als auch den »Zustand des Wohlergehens« (»happiness«), das »Glücklichsein« bezeichnen. Wir können »Glück haben« oder »glücklich sein«. Wenn wir im Folgenden von »Glück« sprechen, dann im Sinne von »happiness« (also »Glücklichsein«), wenn auch beide Begriffe durchaus aufeinander verweisen. So kann der günstige Zufall zum Zustand des Wohlergehens führen, wie umgekehrt der Zustand des Unglücklichseins nicht selten von dem Gefühl begleitet ist, »vom Pech verfolgt« zu sein.
Glück im Sinne von »Wohlergehen« (im Unterschied zum Glück im Sinne von »Zufall«) muss nicht unbedingt »Wohlbefinden« bedeuten. Mit einer Analyse des »Zustands des Wohlbefindens« fragen wir nach einem Gefühlszustand und unterscheiden uns damit von der Denkrichtung der antiken Tradition, die nach der eudaimonia fragt. Zwar wird der griechische Begriff »eudaimonia« im Deutschen häufig mit »Glück« übersetzt, doch sind mit eudaimonia nicht in erster Linie Gefühlszustände gemeint, sondern das gute und gelingende Leben, das letztes Motiv des menschlichen Handelns und damit des menschlichen Selbstinteresses ist. Die eudaimonia wird durch dasjenige Leben und Handeln erlangt, das der menschlichen Natur angemessen ist. Entscheidend für unseren Zusammenhang ist, dass dieses gelingende Leben nicht identisch ist mit dem subjektiven Wohlbefinden der Individuen 112. Im Gegenteil: Das »bloß« subjektive und vor allem »bloß« vereinzelnd vorkommende Wohlbefinden scheint dem »gelingenden Leben« gegenüber trivial zu sein, so etwa bei dem Diktum von Aristoteles: »[W]ie eine Schwalbe und ein Tag noch keinen Sommer macht, so macht auch ein Tag oder eine kurze Zeit noch niemanden glücklich oder selig«113.
Nun darf aber nicht verkannt werden, dass auch die antike Theorie des gelingenden Lebens auf die Frage nach dem subjektiven Wohlbefinden eine Antwort zu geben versucht. Die griechische Philosophie nimmt ihren Ausgang bei der Frage nach der angemessenen – der menschlichen Natur entsprechenden – Lebensführung, um von hier aus auch die angemessene Form des Wohlbefindens zu bedenken, während wir im Folgenden ausgehen werden von dem Zustand des Wohlbefindens (dem »Glücksgefühl«) und dabei im Unterschied zur griechischen Philosophie keineswegs voraussetzen, dass dieser Zustand seinen rechtmäßigen Ort nur in einer solchen Lebensführung hat, in der der Mensch es sich zur Aufgabe macht, ein »gelingendes Leben« zu verwirklichen114. Vielmehr wird der Erörterung der Frage Raum gegeben, ob der Mensch sich in einem solchen Projekt vielleicht gerade der Möglichkeiten des Glücklichseins beraubt. Damit kann auch nicht von vornherein ausgeschlossen werden, dass ein als Kritik an der eudaimonia-Lehre verstandener Antieudämonismus dem Glück geradezu dient. Der Ausgangspunkt beim »Wohlbefinden« bewahrt unsere Reflexionen zum Thema »Glück« zudem davor, über Glück etwas zu ersinnen, was mit unseren Erwartungen vom Glück gar nichts zu tun hat, die wir in erster Linie unter Glück »Wohlbefinden« verstehen. Von vornherein das Wohlbefinden als das nicht »wahre« oder nicht »eigentliche« Glück zu diskriminieren – als etwas, das die wahre Höhe nicht erreicht hat –, scheint ein Weg zu sein, der unseren lebensweltlichen Bezogenheiten immer äußerlich bleibt.
Mit dem Begriff »Sein-Lassen« lässt sich die These dieses Buches umreißen: Glück – so möchte ich zeigen – erleben wir, wenn wir nicht danach streben, die Dinge des Daseins auf einen Zweck beziehungsweise auf ein Ziel hin zu bestimmen, sondern wenn wir ergriffen sind von ihrer Anmutungsqualität und uns von ihnen bestimmen lassen. Mit anderen Worten: Glück erleben wir, wenn wir in unserem alltäglichen Streben und Sorgen für dies oder das unterbrochen werden und ganz bei der Sache sein können.
Abschließend sei darauf verwiesen, dass es sich bei diesem Buch um theologische Denkversuche handelt. Mit dem Adjektiv »theologisch« ist die Richtung der folgenden Überlegungen angedeutet. Auffallend mag sein, dass ich erst im letzten Kapitel ausführlich auf die theologische Tradition zu sprechen komme. Dies mindert nichts daran, dass es sich insgesamt um theologische Denkversuche handelt; denn die Theologie kann den Glauben nur innerhalb der unterschiedlichen Verstehensbewegungen zur Sprache bringen.
Der Grund für dieses Verständnis von Theologie liegt im Wesen des Glaubens, den die Theologie zu verantworten hat115. Mit dem Begriff »Glaube« ist nicht das »Für-wahr-Halten« von bestimmten Aussagen über die Wirklichkeit bezeichnet, sondern ein bestimmter »Lebensvollzug«116. Um es pointiert zu sagen: Christen sind nicht dadurch ausgezeichnet, dass sie bestimmte Aussagesätze für wahr halten, die andere bestreiten, sondern dadurch, dass sie in einer bestimmten Lebensbewegung stehen, die ihr Leben orientiert. Man würde den Glauben fundamental missverstehen, wenn man ihn als Besitz eines theoretischen Wissens auffasst. Im Glauben wird keine Weltsicht erschlossen, sondern eine Lebensbewegung ermöglicht.
Diese als »Glaube« bezeichnete Lebensbewegung wird in den verschiedenen Dimensionen menschlichen Lebens aktuell: im Fühlen und Erleben, im Wollen und Handeln, im Denken und Entscheiden. Die Lebensbewegung muss daher vom Verstehen und Denken an immer neuen Orten und in Bezug auf immer neue Fragen ergriffen werden. Der Glaube wird aktuell und relevant in wechselnden Verstehenskontexten, in denen Menschen immer schon versuchen, sich ihre Lebenswelt verstehend anzueignen. An dieser Struktur des Glaubens haben auch »Theologische Denkversuche« Anteil: Sie stehen nicht neben oder über den unterschiedlichen Verstehens- und Kommunikationszusammenhängen, in denen wir uns immer schon befinden, sondern sie werden in, mit und unter ihnen aktuell.
Aufgrund ihres Verständnisses des Glaubens unterscheidet sich Theologie von jeder Form einer esoterischen »Wissenschaft«, die von einem bestimmten Verständnis der Wirklichkeit im Ganzen geleitet wird, weil ihr ein »höheres Wissen« erschlossen ist. Aufgrund ihres vorgängigen Erschlossenseins der Wirklichkeit (in einer Erschließungserfahrung oder ähnlichen) intendiert die Esoterik, eine umfassende Weltdeutung zu leisten. Esoterische Systeme besitzen daher ein in sich stimmiges Konzept von Welt, Gott und Mensch, von dem aus der Einzelne sein Leben verstehen und dieser Einsicht in seinen Ort in der Welt entsprechend leben kann117. Es macht aber einen erheblichen Unterschied, ob man – wie bei esoterischen Systemen – davon ausgeht, dass im Glauben eine bestimmte Weltsicht erschlossen wird, oder ob man den Glauben als eine bestimmte Lebensbewegung versteht, die in, mit und unter unseren Verstehensbewegungen aktuell wird und erst so im Verstehen an immer neuen Orten, in Bezug auf neue Fragen, in immer anderen Sprachgebilden, Vorstellungshorizonten und weltanschaulichen Deutungskategorien ergriffen werden kann. Im letzten Fall hat der Glaube auch Teil an der Komplexität unserer Verstehensbewegungen.
Aufgabe der Theologie ist es daher nicht, ein System zu erstellen, in dem sich alles umstandslos reimt, indem ein geschlossener Horizont etabliert wird, der Andersheit und Fremdheit reduziert und Kontingenz leugnet. Wenn die Theologie an den konkreten Verstehensbewegungen teilnimmt, in denen wir immer schon stehen, dann initiiert sie spannungsreiche und durchaus nicht in eine Einheit zu bringende Verstehensbewegungen, die weder den Kontext leugnen, von dem aus sie unternommen werden, noch das konkrete Problem und die konkrete Fragestellung, durch das sie motiviert werden, und die daher auch nicht vorschnell auf ein in sich stimmiges System drängen. Theologie ist daher so konfliktreich wie das Leben selbst. Nicht in abgegrenzten Zirkeln, sondern innerhalb konkreter Kontexte und konkreter Fragestellungen, wie der nach dem Glück, wird die Lebensbewegung des Glaubens im Verstehen und Denken ergriffen; erst hier wird (immer neu) gelernt zu verstehen, wie die Freiheit zu denken ist, zu der Gottes Zusage befreit.
Kapitel 2
Beobachtungen zum Glück
Ein Buch zum Thema »Glück« kann bei seinen Leserinnen und Lesern nicht bloß ein wie auch immer begründetes Interesse voraussetzen, sondern auch Vorkenntnisse. Jeder hat schon einmal über das Glück nachgedacht und mit anderen über Fragen diskutiert, die das Glück in einem weiteren oder engeren Sinne betreffen. Insofern spricht der Autor als Wissender zu Wissenden oder als Fragender zu Fragenden. Die hier unternommenen Reflexionen über das Glück enthalten daher nichts grundsätzlich Neues. Wo es um Fragen des glücklichen Lebens geht, könnte nur Falsches wirklich neu sein. Es geht daher nicht darum, völlig neue Sachverhalte zu präsentieren, sondern unterschiedliche Gedanken, Lebenserfahrungen und Beobachtungen, mit denen wir immer schon vertraut sind, in den Blick zu nehmen, sie behutsam miteinander zu verknüpfen und zu kombinieren, so dass bisher vielleicht verborgene Zusammenhänge und Linien aufscheinen, ohne dass damit der Anspruch besteht, alle Fragen hinsichtlich des Glücks in einem in sich geschlossenen System zu beantworten.
Wenn wir in diesem Kapitel beginnen, über das Glück nachzudenken, so erscheint es sinnvoll, zunächst einige mehr oder weniger zusammenhanglose Beobachtungen hinsichtlich des Glücks namhaft zu machen, um so verschiedene Facetten des Phänomens in den Blick zu bekommen, die sich uns beim ersten Nachdenken über das Glück zeigen.
2.1 Das Glück als etwas Selbstverständliches
Ein erstes Nachdenken über das Glück wird durch die Beobachtung herausgefordert, dass Menschen im Leben auf der Suche nach Glück sind. Mag die große Präsenz des Themas »Glück« in den Wissenschaften auch neu sein, so doch nicht die Einsicht, dass das Glücksstreben wesentlich zum Menschsein des Menschen gehört. Bereits Augustin erkannte: »Alle Menschen wollen glücklich werden«1. Dies ist auch für einen »Glückskritiker« wie Immanuel Kant selbstverständlich2, wenn er auch aus dem Glücksstreben andere Konsequenzen zieht als beispielsweise Aristoteles. Das Glücklichseinwollen scheint zu den Konstanten menschlichen Daseins zu gehören.
Habe ich zu allgemeingültig formuliert, wenn ich das Glücklichseinwollen zu den Konstanten menschlichen Daseins zähle? Wollen tatsächlich alle Menschen glücklich sein oder glücklich werden? Auch dies scheint man offenbar in Zweifel ziehen zu können. So findet sich bei Friedrich Nietzsche ein großes Unbehagen mit dem Glück, wenn er formuliert: »Der Mensch strebt nicht nach dem Glück, nur der Engländer thut das«3. Nietzsche wendet sich damit gegen die Rede von der Glücksmaximierung und dem Glückskalkül der Utilitaristen in Gestalt der Anhänger Jeremy Benthams4. Er polemisiert gegen »comfort« und »fashion« und spricht abfällig vom »erbärmliche[n] Behagen« und dem »Glück der Meisten«5. Auch Nietzsche weiß darum, dass die meisten Menschen nach Glück streben. Er kann darin aber nur eine »gründlich mittelmäßige Art von Mensch«6 erblicken. Gilt also für ihn, das Glücksstreben des Menschen zu überwinden? Nietzsche kann aber auch positiv von Glück und Genuss sprechen, etwa wenn er von der »Liebe zum Leben«7 oder »der höchsten Seele […] die ins Werden verliebt ist«8 spricht. Wenn er daher in seiner »Genealogie der Moral« die »volle[n], mit Kraft überladene[n], folglich nothwendig aktive[n] Menschen«, die entschlossen sind, »von dem Glück das Handeln nicht abzutrennen – das Thätigsein wird bei ihnen mit Nothwendigkeit ins Glück hineingerechnet«, den »Ohnmächtigen« entgegenstellt, bei denen das »›Glück‹ […] als Narcose, Betäubung, Ruhe, Frieden, ›Sabbat‹, Gemüths-Ausspannung und Gliederstecken, kurz passivisch auftritt«9, dann zeigt sich, dass seine Einwände nur einem bestimmten Glück gelten, nämlich dem passiven, während er einem anderen Glück, nämlich dem aktiven, zugetan bleibt10. Das Glück kommt nicht »als äußeres Ziel durch tätige Leistungen zustande […], sondern so, dass es in dieser Tätigkeit selbst liegt«11. Damit ist auch bei Nietzsche die Frage virulent, was das wahre Glück im Unterschied zu einem Schein des Glückes ist. Dies könnte – ohne einen ausführlichen Nachweis an dieser Stelle führen zu können – auch für andere Einwände gegen das Glück zu gelten: Sie betreffen nicht das Glück selbst, sondern eine bestimmte Vorstellung vom Glück, die sie jeweils durch eine andere zu ersetzen suchen.
Weil das Glücklichseinwollen zu den Konstanten menschlichen Daseins gehört, können wir zwar davon reden und uns darüber streiten, was Glück ist, wie wir unser Glück finden, aber doch wohl kaum, ob sich das Glück überhaupt lohnt. Eine Aussage wie »Glücklichsein lohnt sich nicht« würde uns entwaffnen. Dies verdeutlicht trefflich ein jüdischer Witz von einem Sohn, der seinem Vater eröffnet, dass er Fräulein Katz heiraten wolle. Der Vater widerspricht: »Fräulein Katz bringt nichts mit!« Der Sohn erwidert, er könne nur mit Fräulein Katz glücklich sein. Darauf entgegnet der Vater: »Glücklich sein, und was hast du schon davon?« Ein Witz – so erklärt Robert Spaemann – ist diese Anekdote deshalb, »weil ›etwas von etwas haben‹ soviel heißt wie: damit glücklich sein. Vom Glücklichsein kann man nicht noch einmal ›etwas haben‹. Man müßte dann antworten: ›Ja, was verstehst du denn unter: Was hast du davon?‹«12 Das Glücklichsein ist daher nach Spaemann in gewissem Sinne ein »Letztes«13.
Auf die Frage »Warum soll ich glücklich sein wollen?« könnten wir argumentativ kaum reagieren. Insofern ist Max Horkheimer zuzustimmen, wenn er das Streben nach Glück als eine »natürliche, keiner Rechtfertigung bedürftige Tatsache«14 versteht. Mit dem Glücksbedürfnis haben wir etwas Selbstverständliches vor uns, das sich von selbst und nur von selbst versteht. Was sich von selbst versteht, kann aber nicht durch anderes erklärt werden, was noch besser verständlich wäre. Dass jedoch das Selbstverständliche auch verstanden wird, dies macht Eberhard Jüngel – freilich in einem anderen Zusammenhang – deutlich, »ist alles andere als selbstverständlich«15. Das Selbstverständliche kann man nicht begründen, man kann auf das Selbstverständliche nur hinweisen und es entdecken16. Und indem wir es entdecken, verstehen wir das, was selbstverständlich ist.
2.2 Die Unverfügbarkeit des Selbstverständlichen
Das Glücksbedürfnis – so habe ich gesagt – ist etwas Selbstverständliches, das sich als Selbstverständliches von selbst und daher auch nur von selbst versteht. Man kann nicht erklären, was der Vorteil vom Glücklichsein ist. Als etwas Selbstverständliches kann man auf das Glück nur hinweisen, es entdecken. Wie aber sieht es aus mit der Entdeckung dieses Selbstverständlichen?
In seinem bekannten Buch »Anleitung zum Unglücklichsein« versucht Paul Watzlawick eine notwendige »Einführung in die brauchbarsten und verläßlichsten Mechanismen der Unglücklichkeit«17 zu bieten. Auf humorvolle Weise entlarvt Watzlawick die unterschiedlichen Techniken und Mechanismen, die wir immer wieder anwenden, um uns den Alltag unerträglich zu machen. Am bekanntesten dürfte die »Geschichte mit dem Hammer«18 sein: »Ein Mann will ein Bild aufhängen. Den Nagel hat er, nicht aber den Hammer. Der Nachbar hat einen. Also beschließt unser Mann, ihn auszuborgen. Doch da kommt ihm ein Zweifel: Was, wenn der Nachbar mir den Hammer nicht leihen will? Gestern schon grüßte er mich nur so flüchtig. Vielleicht war er in Eile. Aber vielleicht war die Eile nur vorgeschützt, und er hat etwas gegen mich. Und was? Ich habe ihm nichts angetan; der bildet sich da etwas ein. Wenn jemand von mir ein Werkzeug borgen wollte, ich gäbe es ihm sofort. Und warum er nicht? Wie kann man einem Mitmenschen einen so einfachen Gefallen abschlagen? Leute wie dieser Kerl vergiften einem das Leben. Und dann bildet er sich noch ein, ich sei auf ihn angewiesen. Bloß weil er einen Hammer hat. Jetzt reicht’s mir wirklich. – Und so stürmt er hinüber, läutet, der Nachbar öffnet, doch noch bevor er ›guten Tag‹ sagen kann, schreit ihn unser Mann an: ›Behalten Sie sich ihren Hammer, Sie Rüpel‹«. Wenige Techniken – so Watzlawick – eignen sich besser »zur Erzeugung von Unglücklichkeit als die Konfrontation des ahnungslosen Partners mit dem letzten Glied einer langen, komplizierten Kette von Phantasien, in denen er eine entscheidende, negative Rolle spielt«19. Watzlawick will mit diesen Beispielen zeigen, »daß wir die Schöpfer unseres eigenen Unglücklichseins sind«20. Wir scheinen unserem Glück selbst im Wege zu stehen, ja, geradezu das Glück zu meiden.
Auf einen scheinbar entgegengesetzten Weg werden wir gewiesen, wenn wir uns Schilderungen des Glücks ansehen – unter Umständen, von denen wir nie erwartet hätten, dass sich hier so etwas wie Glück finden lässt. In seinem Buch »… trotzdem Ja zum Leben sagen« beschreibt der Psychiater und Psychotherapeut Viktor E. Frankl sein Erleben des Konzentrationslagers21: »Lange, nachdem ich wieder ein geordnetes Leben beginnen konnte, also lange nach der Befreiung aus dem Lager, zeigte mir jemand eine Photoreproduktion in einer illustrierten Zeitung, darstellend Häftlinge im Konzentrationslager, die auf ihren Stockbetten zusammengepfercht herumliegen und aus ihren Bettkojen stumpf dem Betrachter entgegenblicken. ›Ist das nicht schrecklich, diese entsetzlichen Gesichter, das alles …?‹ ›Wieso?‹ frage ich – und begreife wirklich nicht. Denn in mir entsteht in diesem Augenblick ein Bild. Fünf Uhr morgens. Draußen ist noch finstere Nacht. Ich liege auf den harten Brettern einer Erdhütte, in der etwa siebzig Kameraden ›in Schonung‹ sind, das heißt, wir sind krankgeschrieben und müssen nicht das Lager verlassen, um zur Arbeit hinauszumarschieren. Wir müssen nicht einmal Appell stehen. Den ganzen Tag dürfen wir auf unserem schmalen Platz in der Baracke herumlungern, dahindösen – und auf die einmal tägliche Ausgabe der für die ›Schonungskranken‹ natürlich reduzierten Brotration und die einmal tägliche Austeilung der für diese Kategorie extra verwässerten und extra kleinen Suppenrationen warten. Aber wie zufrieden sind wir; ja wie glücklich, trotz allem! Während wir unsere Körper aneinanderpressen, um jeden unnötigen Wärmeverlust zu vermeiden, während wir zu apathisch und zu träge sind, um buchstäblich nur ein Glied zu rühren, sofern es nicht unbedingt nötig ist, hörten wir von draußen, vom Appellplatz, schrille Pfiffe und Kommandotöne hineintönen, von draußen, wo gerade die ins Lager zurückgekehrte Nachtschicht aufmarschiert ist. Da wird die Tür aufgerissen, der Schneesturm braust ins Innere der Baracke, und eine verschneite Gestalt, ein erschöpfter Kamerad schwankt herein, um sich für wenige Minuten auf einem der Bretter niederzulassen. Aber der Blockälteste wirft ihn hinaus, weil es während der Zählappelle strengstens verboten ist, einen Nichtzugehörigen in die Schonungsbaracke einzulassen! Wie leid tut mir da dieser Kamerad! Wie froh bin ich in diesem Moment, nicht in seiner Haut zu stecken, sondern ›in Schonung‹ zu sein und in der Schonungsbaracke weiter dahindösen zu können. Welche Lebensrettung bedeutet es doch, in der Ambulanz des Krankenreviers zwei Tage Schonung zu bekommen und dann noch weitere zwei Tage angestückelt zu erhalten.«
Eine ganz ähnliche Passage befindet sich in Imre Kertész’ »Roman eines Schicksallosen«, einem autobiographischen Roman eines Jungen, der Auschwitz und Buchenwald überlebt hat: »Ich werde mein nicht fortsetzbares Dasein fortsetzen […]; es gibt keine Absurdität, die man nicht ganz natürlich leben würde, und auf meinem Weg, das weiß ich schon jetzt, lauert wie eine unvermeidliche Falle das Glück auf mich. Denn sogar dort, bei den Schornsteinen, gab es in der Pause zwischen den Qualen etwas, das dem Glück ähnlich war. Alle fragen mich immer nach den Übeln, den ›Greuln‹: obgleich für mich vielleicht gerade diese Erfahrung die denkwürdigste ist. Ja, davon, vom Glück der Konzentrationslager, müsste ich ihnen erzählen, das nächste Mal, wenn sie mich fragen«22.
Wie sind diese doch unterschiedlichen Zeugnisse vom Erleben des Glücks zu verstehen? Sahen wir bei Watzlawick, dass er die Mechanismen aufzeigt, das Glück (unter äußerst günstigen Umständen) zu meiden, so verdeutlichen die eindrücklichen Passagen bei Frankl und Kertész, »dass Glück in einer bestimmten Hinsicht ›unvermeidlich‹ ist«23