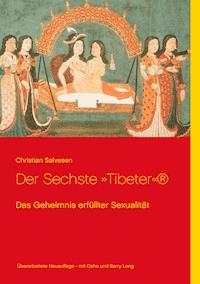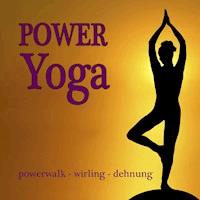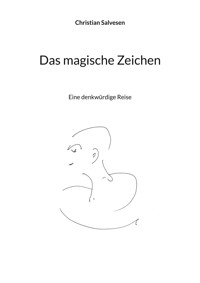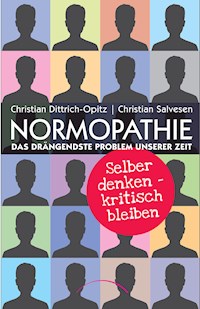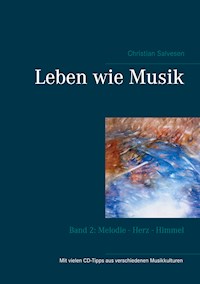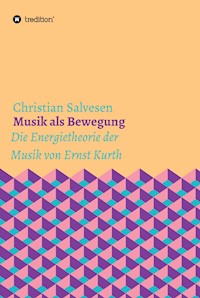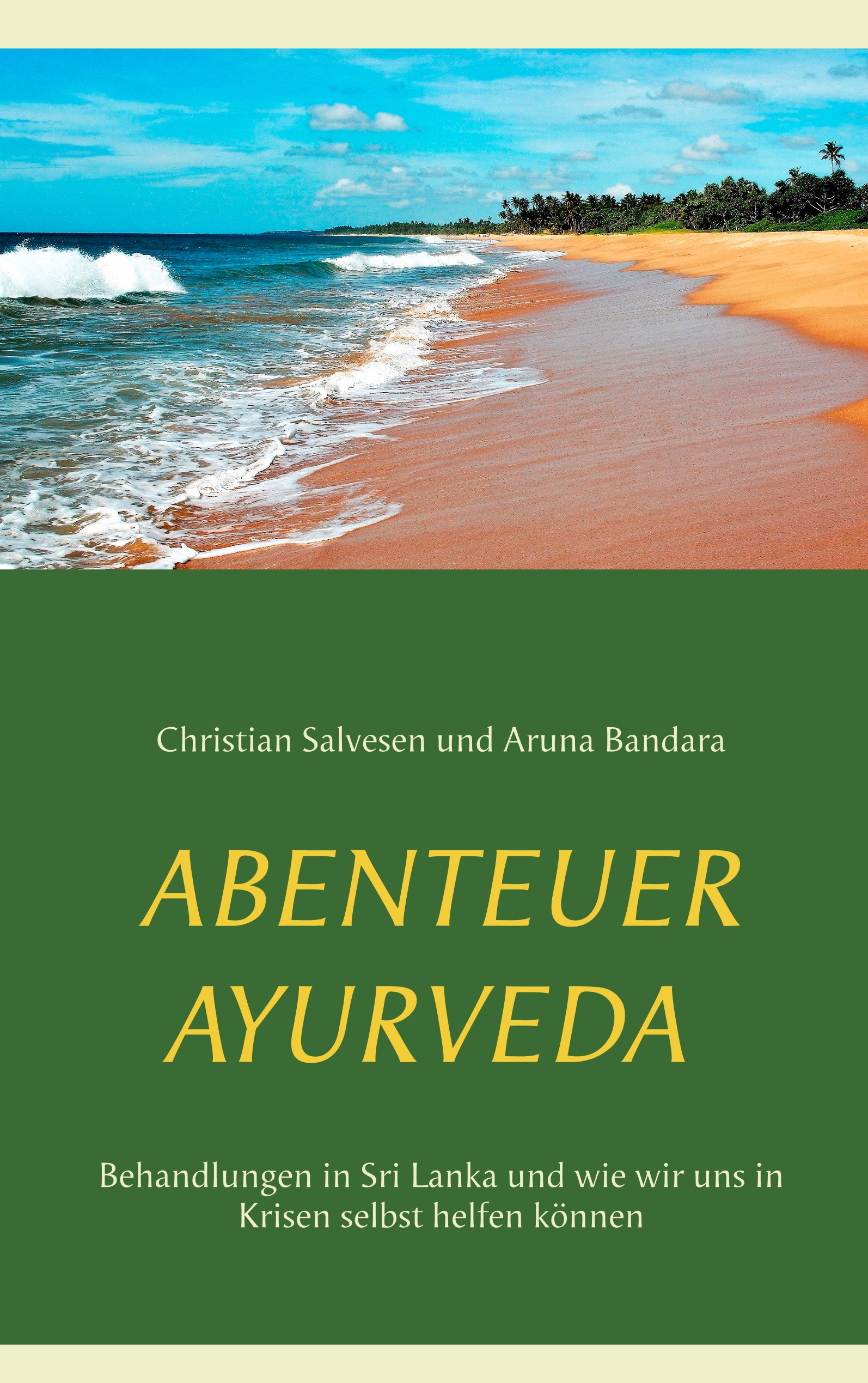15,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es geht in meinem Buch um Fragen aus vielen Bereichen des Lebens, die unsere Werte, Überzeugungen und Sinngebung betreffen. Dazu kommen auch Philosophen wie Epikur und Kant, heute lebende Weisheitslehrer wie der 14. Dalai Lama und Eckhart Tolle zu Wort. Aktuelle Autoren wie der Theologe Tilman Haberer, der Epigenetiker Bruce Lipton, sowie Mediziner, ehrenamtliche Sterbebegleiter, Musiker, Künstler, Psychologinnen teilen in Interviews ihre Einsichten und Erfahrungen mit uns. Im 2. Teil werden Werte und Tugenden von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zuversicht vorgestellt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Christian Salvesen
Worum geht es eigentlich?
Werte – Sinnfragen - Gespräche
Mit Vorworten von Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow und Dirk Michael Steffan
© 2025 Christian Salvesen
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Christian Salvesen, Reußische Strasse 4, 95138 Bad Steben, Germany .
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordnung: [email protected]
ISBN 978-3-384-65002-3
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
VORWORT Von Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow
VORWORT von Dirk Michael Steffan
Einleitung: Was sind Werte?
Was bedeutet Ethik für uns heute?
Nutze den Tag!
Was sind Gefühle?
„Was mich im Wesen ausmacht, geht nicht verloren“
Haiku: Kleines Gedicht mit großer Wirkung
Die Heilung des verlorenen Ichs – Rezension eines Buches von W.A.Schultz
Holi – Das Fest der Farben
Hospiz: Wie Sterben erträglich wird – mit Ulrich Rützel
Mitgefühl in der buddhistischen Ethik – mit Christof Spitz
Kommunikation: Vom richtigen Umgang mit Worten
Vom Geist der Weihnacht
Wenn der Mensch „gehackt“ wird
Superintelligenz und Weisheit
Normopathie: Macht Anpassung krank?
Ritual und Rausch
Vom Stress zur Gelassenheit
In Würde altern
Ich werde gesund bleiben – der Valebo-Effekt
Geist und Gene – mit Bruce Lipton
Interview mit Bruce Lipton
Schein oder Sein?
Eckhart Tolle: Wer bin ich wirklich?
Der Goldene Wind
Aufklärung und Erleuchtung
Teil 2. WERTE UND TUGENDEN VON A-Z
Achtsamkeit
Autorität
Barmherzigkeit
Einfachheit
Freiheit
Frieden
Gerechtigkeit
Glück
Großherzigkeit
Kreativität
Liebe
Mut
Stille
Treue
Weisheit
Wissen
Würde
Zuversicht
Danksagungen
ANHANG
Literatur
ANMERKUNEN
Worum geht es eigentlich?
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
VORWORT Von Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow
ANMERKUNEN
Worum geht es eigentlich?
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
VORWORT
Von Prof. Dr. Erhard Meyer-Galow
Das Buch von Christian Salvesen trifft genau zum richtigen Zeitpunkt das Dilemma unserer Zeit und zeigt Lösungswege auf. Es löst bei mir Begeisterung aus, als hätte ich schon lange darauf gewartet. Dabei schöpft er aus einem reichen Fundus an Erfahrung, Weisheit und Wissen. Andere Autoren haben immer nur Teilaspekte bearbeitet.
In dieser jetzigen Transformation sollten wir mit Achtsamkeit, Mut und Optimismus das aus den alten Weisheitslehren geborene Neue wagen und nicht in den Negativismen steckenbleiben. Dabei weist Salvesen uns den Weg.
Im ersten Teil geht er den Ursachen nach. Das Kollektiv ist in kontinentalen Machtverschiebungen verstrickt und das Individuum leidet an Burn-out, Depression und Angststörungen. Werte sind verloren gegangen und die Führenden dieser Welt erleiden ständig ihren selbst veranlassten Autoritätsverlust. Die praktizierte Projektion gibt immer den anderen die Schuld und verstellt damit den Blick nach innen. Die Veränderung aber wächst immer vom Individuum aus ins Kollektiv.
Im zweiten Teil zeigt Salvesen Ankerpunkte von A wie Autorität bis Z wie Zuversicht auf. Diese Werte und Tugenden gilt es zu leben.
So empfehle ich sehr, dieses Buch nicht nur zu lesen, um dann so weiterzumachen wie bisher, sondern es zu leben. Unter dem Schirm der Achtsamkeit und Gelassenheit kann das gelingen. Dazu gehört immer auch die tägliche Übung. Wir sind alle verpflichtet „Das Lebende lebendiger werden zu lassen“, wie das Credo von Hans-Peter Dürr lautet. Die Evolution wird durch Kooperation getrieben und nicht durch das ständige Gegeneinander. In diesem Sinne ist das Buch von Salvesen ein Wake-Up-Call und eine Aufforderung zum Handeln.
VORWORT
von Dirk Michael Steffan
Einen Diskurs darüber zu führen, was Werte sind, was sie ausmacht und ob es nicht nur sinnvoll, sondern auch wertvoll sein kann darüber nachzudenken, erscheint mir gegenwärtig dringlicher denn je. Leben wir doch in einer Zeit, in der von vielen Seiten ein allgemeiner Wertverfall beklagt wird. Unabhängig von der Frage, ob dies eine objektivierbare Realität darstellt, so scheint es zumindest eine gefühlte Realität zu sein: Jene Werte des Menschseins und des Miteinanders, die über Jahrzehnte und Jahrhunderte tradiert und für Generationen zu Leitplanken ihres Handelns wurden, verlieren zunehmend ihre Bedeutung und damit ihren gefühlten Wert. Neue Werte treten stattdessen, von vielen unbemerkt, in den Vordergrund. Menschsein wird im digitalen Zeitalter gemessen an Parametern wie Effizienz und Kompatibilität. Ständige Erreichbarkeit und sozialmediale Verfügbarkeit sind mittlerweile zu einem neuen, eigenen Wert geworden. Längst ist unser Leben und sind wir selbst teildigitalisiert, ohne dass wir hierzu eine eigene, bewusste Entscheidung treffen könnten. Umso wichtiger scheint mir die Rückbesinnung auf das, was uns als Menschen im Innersten ausmacht. Das vorliegende Buch von Christian Salvesen kann uns dabei wichtige Aspekte in Erinnerung rufen, um zu reflektieren und vielleicht auch neu zu entscheiden, nach welchen Kriterien wir den Kompass unseres Lebens ausrichten wollen, vielleicht auch korrigieren wollen. Das wünsche ich allen Lesern dieses aus meiner Sicht ebenso werthaltigen wie wert-vollen Buches.
Einleitung: Was sind Werte?
Was ist mir am meisten wert? Mein eigenes Leben? Meine Familie? Mein Haus? Meine Überzeugung? Mein sozialer Status? Wofür würde ich all meine Kraft auch unter großem Verzicht einsetzen? Beispiel: Ich setze alles daran, dass mein Partner zu mir zurückkommt. Ich habe ihn als überaus wertvoll erkannt. Andere mögen sagen: Ich verstehe nicht, was du an dem (der) findest!
Es gibt auch so genannte „objektive“ Werte. Ein Haus, eine Firma oder ein Kunstwerk hat einen bestimmten Marktwert, sagen wir 300.000 €. Bei einer Versteigerung werden unterschiedliche Gebote gemacht, doch meist herrscht Übereinstimmung über den ungefähren Wert des Objekts. Sehr genau nehmen es Wissenschaftler mit ihren Messwerten. Oder auch Mediziner: Die Werte des Patienten sind bedenklich! Hier geht es oft um Leben und Tod.
Und dann sprechen wir auch von allgemeinen ethischen Werten. Die vielen Kulturen und Gemeinschaften auf unserer Erde haben zum Teil recht unterschiedliche, ja gegensätzliche Wertvorstellungen entwickelt. Schönheit ist ein Wert, oder? Nun, in den meisten afrikanischen Ländern gilt ein Mensch als schön, wenn er besonders viel Leibesfülle aufweist. Das Schönheitsideal in Europa ist von der griechischen Antike geprägt und bevorzugt schlanke, athletische Körper.
Güte oder Gutsein ist ein Wert, doch die Maßstäbe dafür, wer gut und richtig handelt, scheinen je nach Kultur und Situation ganz unterschiedlich. Der indische Feldherr Arjuna lässt sich von Gott Krishna überzeugen, gegen seine Verwandten und Freunde in die Schlacht zu ziehen. In der „Bhagavadgita“ gilt seine Einsicht und Entscheidung zum Krieg und Töten als richtig, weise und gut. Der Dalai Lama wiederum plädiert stets für eine friedliche Verständigung mit den chinesischen Besatzern, sogar um den Preis der Autonomie seines Landes und um die Erhaltung seiner Titel. Viele seiner (jüngeren) Landleute warten dagegen nur auf sein Zeichen zum Aufstand.
Oder nehmen wir das Beispiel der Hitlerattentate. Wer damals auch nur daran dachte, den „Führer“ umzubringen, galt als böse. Heute wird jedes bekannte versuchte Attentat auf den „Unmenschen Hitler“ als Heldentat gefeiert.
Es ist nicht so leicht, verbindliche Werte zu finden, die für alle Menschen gelten können. Doch es gibt sie. Sie liegen tief in unserem Inneren. Manche nennen diesen Bereich „Herz“, andere „Gewissen“. Ich möchte hier lieber von Weisheit und Bewusstheit sprechen. Ethik ist die Lehre von dem, was jenseits aller unterschiedlichen Moral, den Gebräuchen und Sitten, als das „wahre Gute“ von jedem Menschen zu jeder Zeit-(Epoche) und Kultur erkannt und gefühlt werden kann.
Ich habe in diesem Buch Texte zusammengestellt und überarbeitet, die zumeist als Artikel in der Zeitschrift VISIONEN erschienen, vor allem in der Zeit zwischen 2010-2014, als ich dort als Redakteur arbeitete. Werte und Tugenden wie Gerechtigkeit, Frieden, Freiheit, Mut und Mitgefühl sind stets mit dem aktuellen gesellschaftlich-politischen Geschehen verbunden. Heute, für mich als Verfasser dieser Worte im Sommer 2025, sind Themen wie Krieg und Polarisierung, das Aufrechterhalten von Demokratie, Freiheit und Würde noch näher und drängender an uns in Deutschland und Europa herangerückt als vor gut 10, 15 Jahren.
Es wird ein allgemeiner Werteverfall beklagt. Das gab es allerdings auch schon vor 2.500 Jahren in der Antike. Ich bin kein Moralapostel. Ich möchte allgemeinverständlich und nicht ausufernd traditionelle Werte und Tugenden darstellen: Aus welchem Geist sie entstanden sind, wie sie von Philosophen, Theologen und anderen Experten interpretiert und diskutiert wurden. Und dabei können wir uns fragen, ob und wie sie unser Leben mitbestimmen.
Es gibt heute unvergleichlich mehr Publikationen, Bücher, Filme, Interviews usw. zu den hier angesprochenen Themen als vor 20 oder 30 Jahren. Das Interesse an Ethik und der Frage: Wie kann ich gut und richtig leben? ist erfreulich stark gewachsen.
In meiner Lieblingssendung, der „Sternstunde“ im SRF (Schweizer Radio Fernsehen). sind Frauen und Männer als Gesprächspartner zu Gast, die über die philosophische Expertise hinaus auch menschlich berührend ethische Fragen nahebringen. Bereits Ende 2023 mahnte der Schweizer Theologe und Ethiker Prof. Dr. Peter Kirschläger an, dass die Künstliche Intelligenz (KI) Menschenrechte verletze und forderte eine globale Überwachungsbehörde zum Schutz aller Menschen.1 Was ist der Mensch im Vergleich zur Künstlichen Intelligenz? Das ist eine wirklich neue Frage in der alten Ethik-Diskussion – worauf ich auch in diesem Buch eingehe.
In der „Sternstunde“ habe ich u.a. die Diskussion über Eigenverantwortung mitverfolgt. „Jeder trägt Mitschuld an der Klimakatastrophe – ist das die neue Erbsünde?“ fragt Wolfram Eilenberger seine und Kollegin Barbara Bleischs Gäste im Studio. Die Publizistin Ann-Kristin Tlusty, Jahrgang 1994, Herausgeberin des kürzlich erschienenen Buches „Selbst schuld“, setzt sich eloquent und lebhaft sprudelnd für mehr Solidarität statt Eigenverantwortung ein. Die liberale Gesellschaft, für die in dieser kleinen Runde Stefan Manser-Egli, Philosoph und Co-Präsident der Operation Libero zu stehen scheint, überlässt dem Individuum die Verantwortung - mitsamt der Freiheit, und dem „selbst-schuld-sein.“ 2 Gibt es einen Mittelweg?
Im öffentlichen Diskurs über Ethik kommt die klassische Philosophie, etwa Immanuel Kants Kritik der Urteilskraft, zunehmend in Kontakt mit Einsichten aus indigenen Kulturen. Aktionskünstlerinnen wie Marina Abramovics kommen ins Spiel, wenn sie sich ihrem Gegenüber im Augenkontakt derart öffnen, dass offensichtlich eine Transformation des Menschen geschieht. Der spirituelle Aspekt gehört wesentlich zur Ethik und zu einem „wertvollen“ Leben. Wie würde sich die buddhistische Einsicht, dass ich als Person in Wahrheit nicht existiere, konkret auf mein Verhalten auswirken? Wer oder was entscheidet zwischen richtig und falsch, wenn es weder einen Entscheider noch die Gegensätze von Gut und Böse gibt?
Solche und andere grundsätzliche Fragen werden mich, der ich jetzt diese Worte wahrnehme, in verschiedenen Kontexten in den folgenden Texten ansprechen. Auch wenn die Idee einer vom Ganzen unabhängigen Person eine schwerdurchschaubare Täuschung sein sollte: In jedem Moment gelangen Informationen in eine Art inneren Bereich, „Seele“, „Bewusstsein“, „Vernunft“, „Gewissen“ oder „Gehirn“ genannt, wir können auch „Black Box“ sagen – doch in jedem geschieht da eine Art von Empfang, eine Resonanz. Stimmt doch, oder nicht?
Die Tugenden und Werte von A wie Achtsamkeit bis Z wie Zuversicht mögen altbacken und unzeitgemäß, die Auswahl willkürlich erscheinen. Doch sie sind als Begriffe im Umlauf. Sie werden im Alltag verwendet, sind mit Gefühlen verbunden und haben eine Wirkung.
Im ersten Teil des Buches geht es um den sozialen Raum, in dem die Werte wirken. Dazu gibt es Gespräche mit Menschen aus verschiedenen Bereichen wie dem christlichen, buddhistischen, psychologischen oder dem der Sterbebegleitung. Diese Sammlung von Texten ist gemeint wie ein Bild aus Farbtupfern, nicht systematisch oder in sich geschlossen, vielmehr improvisatorisch, offen und ohne irgendeinen Anspruch von Belehrung. Wenn die eine oder andere Bemerkung eine Art „Aha“ oder „Ach-so“ auslöst – wunderbar!
Was bedeutet Ethik für uns heute?
Seit Jahrtausenden gibt es Gesetze, Vorschriften für richtiges Denken und Handeln. Ethik bedeutet darüber hinaus zu fragen, ob und warum wir den Vorschriften und Normen folgen sollten. Sei herzlich eingeladen zu einem Streifzug durch die klassische praktische Philosophie, die moderne Neuroethik und die Ethik der Religionen.
Sollen, müssen, dürfen…wo immer diese Worte verwendet werden, geht es um Ethik. Soll ich dem Bettler Geld geben? Muss ich wirklich helfen, wenn jemand auf offener Straße verprügelt wird? Darf ich das Fleisch von Tieren essen? Die Beispiele lassen sich beliebig auf alle Bereiche des Lebens ausweiten: Dürfen Menschen auf eigenen Wunsch von schwerem Leiden erlöst werden? Wie weit soll Deutschland im Kampf gegen Terroristen oder bei der militärischen Unterstützung der Ukraine oder Israels gehen? Auf welcher Grundlage könnten Asylanträge abgelehnt werden? Welche Richtlinien sollen für einen humanen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gelten?
Manch einer sagt sich vielleicht: Was interessieren mich Ethik und Moral, ich tue, was ich tun muss, das ist sowieso durch Gene, Erziehung und die aktuellen Umstände festgelegt, gleichgültig, ob ich darüber nachdenke oder nicht. Eine Haltung, die bereits von antiken Philosophen in ihrer Ethik berücksichtigt und respektiert wurde. Oder man ist überzeugt, in jedem Moment völlig spontan zu handeln, oder von Gottes Willen gelenkt. Auch das ist ein ethisches Konzept.
Es gibt wenig in unserem Leben, was nicht Gegenstand der Ethik ist. Ethik im Sinne der traditionellen „praktischen“ Philosophie und ihrer Spezialisierungen auf Bereiche wie Rechtsprechung, Gemein- und Gesundheitswesen, und andererseits die Ethik der Religionen.
Ethik ist ein sehr großes Gebiet. Wer mag, folge mir ein kleines Stück hinein. Es könnte spannend und lehrreich sein.
Was die Vernunft uns rät
Unsere westlich-abendländische Kultur ist einerseits durch die Bibel, die zehn Gebote des Moses und das christliche Gebot der Nächstenliebe geprägt, und andererseits durch die Philosophie der Antike, die Ethik des Aristoteles und die Moralphilosophie des Cicero. Ein gemeinsamer Nenner der ansonsten unterschiedlichen Werte-Vorstellungen, die im Mittelalter koordiniert wurden, ist: Der Mensch ist für sein Handeln verantwortlich. Er kann – normalerweise – frei entscheiden und weiß, was er tut. Er strebt von Natur aus das Gute an, das höchste Gut, was in den drei monotheistischen Religionen Gott ist, während die großen Philosophen von Sokrates bis Sartre jeweils etwas anderes darunter verstanden: ein glückliches Leben (eudemonia) oder Freiheit (liberté).
Wäre der Mensch durch Sitten und Gewohnheiten festgelegt, bräuchte es keine Ethik, wie sie Aristoteles erstmals als Wissenschaft in die Philosophie eingeführt und etabliert hat. Selbstverständlich wussten die Menschen seiner Zeit zwischen guten und schlechten, rechten und unrechten Taten oder auch Absichten zu unterscheiden. Recht und Gesetz waren in allen Hochkulturen seit Jahrtausenden festgeschrieben. Den Juden hatte Gott selbst seine zehn Gebote gegeben. Die Herrscher in Ägypten, Babylon, Indien und China hatten schon einige Zeit zuvor Gesetze erlassen, die jeder einzuhalten hatte – zugunsten eines funktionierenden Gemeinwesens und unverrückbarer Herrschaftsstrukturen.
Die Demokratie in Athen war ein bis dato einmaliges Experiment. Der Bürger durfte nicht nur in der Politik seine Stimme einbringen, sondern war sich bewusst, dass er im alltäglichen Leben frei entscheiden konnte. Damit eröffnete sich eine neue Dimension des Fragens und Verstehens: Was ist das Ziel meines Handelns, ganz grundsätzlich? Wie kommt es zur Entscheidung, so und nicht anders zu handeln? Welche Kräfte stecken dahinter? Werde ich durch die Götter gelenkt? Aristoteles baut auf Logik und Vernunft. Es geht nicht darum, dass alles in Ordnung ist, wenn sich jeder an die Gesetze hält. Der Einzelne soll in der Lage sein, selbst zu entscheiden, was in einer gegebenen Situation am besten zu tun ist. Wenn ich zum Beispiel gegen ein Gesetz verstoßen muss, um einem anderen zu helfen. Oder wenn ich mich an jemanden rächen will, kann die Einsicht in eine größere Wahrheit einen Mord verhindern? Ausnahmen von der Regel sind immer möglich, doch in Aristoteles‘ Ethik ist die Vernunft Trumpf. Übermächtige Emotionen, Rausch oder göttliche Einflüsterung gelten nicht als Entschuldigung für ein Verhalten, das andere und die Gemeinschaft schädigt und verletzt.
Ich in der Gemeinschaft
Nicht nur Philosophen und Weise können sehen, dass ich selbst – als Person - in vieler Hinsicht das Problem für ein ausgeglichenes, glückliches Leben bin. Wünsche ich mir nicht manchmal, so leicht dahin zu schwimmen wie ein Delphin in seiner Gemeinschaft? Auch Tiere sind intelligent und fühlen womöglich ganz wie wir Menschen, doch sie leben ohne jede Moral oder Ethik. Es heißt, sie haben kein Ich. Sie empfinden sich selbst nicht als getrennt von der Natur. Wir Menschen haben dagegen ein Ego, und das mache alles kaputt! Das Selbstbewusstsein habe uns aus dem Paradies vertrieben.
Dies ist ein starker Mythos. Es liegt an jedem selbst zu überprüfen, inwieweit er in der eigenen Erfahrung zutrifft. Fühle ich mich manchmal getrennt vom Ganzen? Sehne ich mich nach einer tiefen Verbindung, nach einem Verschmelzen, wo einfach alles gut ist wie es ist? Kein Nachdenken, keine Sorgen, nur geschehen lassen in tiefem Einverständnis?
Doch da höre ich, wie jemand schlecht über mich redet. Mein Name fällt. Schon bin ich auf Lauerstellung, wie ein …Tigerhase? Der Kampf geht los. Ist das normal? Ja. Wie würde wohl bei uns der Alltag ohne Recht und Gesetz verlaufen? Als das mittelalterliche Weltbild mit Gott im Zentrum zerbröckelte und der Mensch zum Maß aller Dinge wurde, arbeiteten etliche Philosophen an einer neuen Ethik. Was ist der Mensch in seinem Urzustand, ohne moralische Einschränkung, Recht und Gesetz? Ist er von Natur aus gerecht? Der englische Philosoph Thomas Hobbes (1588-1679) befand: Nein. Er sah im Menschen einen Wolf, der durch eine Institution bzw. einen Vertrag zu einem sozialen Verhalten geradezu gezwungen werden müsse. So entstand der „Gesellschaftsvertrag“, der bis heute gültig ist.
Der freie Wille
Was die Hirnforschung in den vergangenen Jahrzehnten herausfand, ist geeignet, unser gesamtes Rechtssystem auf den Kopf zu stellen. Während dieses System und die bisherige Ethik vom Menschen als einem Individuum, einer Person, einem Ich ausgeht, das Entscheidungen treffen und dementsprechend auch zur Verantwortung gezogen werden kann, zeigen die wissenschaftlichen Tests und Forschungen, dass ein bewusstes Ich erst ins Spiel kommt, nachdem das Gehirn praktisch alle Prozesse in Gang gesetzt hat, die zur Handlung führen.
Einerseits erscheint der Mensch als ein bewusstes Wesen mit Gefühlen und freiem Willen, andererseits als ein komplexes System von Prozessen, die aus naturwissenschaftlicher Sicht festgelegt, determiniert sind. Immanuel Kant und David Hume haben über dieses Problem schon vor über 200 Jahren diskutiert, und diese Diskussion ist heute aktueller als je zuvor. Hirnforscher wie Wolf Singer und Gerhard Roth plädieren für ein Umdenken in allen Lebensbereichen, vor allem in der Justiz. Eine frei entscheidende Person sei nur ein Konstrukt und entspreche nicht der Wirklichkeit.
An der Schnittstelle von Hirnforschung und Ethik werden heute die spannendsten Fragen aufgeworfen. Thomas Metzinger, Professor für theoretische Philosophie an der Universität Mainz und führender Vertreter einer neuen Disziplin namens Neuroethik, behauptet in einem Aufsatz in der Universitätszeitung „Frontiers of Psychology“, dass der größte Teil aller „mentalen Handlungen“, also der Gedanken, nicht kontrolliert und bewusst stattfindet. Damit ist auch fraglich, inwieweit wir Menschen überhaupt für unser Handeln verantwortlich sind bzw. zur Verantwortung gezogen werden können. Eine andere Frage, die er in einem Beitrag über die Neuroethik aufwirft, betrifft die Verwendung von Mitteln (Medikamenten, elektronische Beeinflussung), die die Leistung des Gehirns enorm steigert. Zu welchem Zweck? Das ist eine ethische Frage.
„Der Versuch, die eigene geistige Leistungsfähigkeit zu verbessern, ist eine uralte Menschheitstradition und für sich genommen auch eine durchaus positive ethisch-zivilisatorische Wertvorstellung. Trotzdem ist in modernen Wettbewerbsgesellschaften eine neue Qualität entstanden, und zwar nicht nur durch Fortschritte in der Hirnforschung und ein immer besseres Verständnis möglicher Wirkmechanismen, sondern insbesondere auch durch neue kommerzielle Zielsetzungen wie der Optimierung und effizienteren „Bewirtschaftung“ des gesunden menschlichen Geistes.“ 3
Ethik der Religionen
Eine andere Frage, die heute leider wieder erschreckend aktuell ist: Warum bekämpfen sich Menschen unterschiedlichen Glaubens so erbittert und grausam? Sind es nicht gerade die Religionen, die Frieden und Mitgefühl verbreiten wollen? Oder gibt es da doch unüberbrückbare unterschiedliche ethische Vorstellungen? Im Prinzip nein. Der Hass scheint ausgerechnet innerhalb einer Religion besonders stark, so etwa zwischen Schiiten und Sunniten im Islam. Der Fanatismus erhält sein zerstörerisches Feuer nicht aus den Grundwerten der Ethik, sondern aus eher äußerlichen Gewohnheiten, Vorschriften und Ritualen, die zugleich mit Machtinteressen und sozialen, historischen Konflikten verbunden sind.
Offensichtlich kämpfen die islamistischen „Krieger“ darum, in Staaten wie Pakistan, Syrien, Irak etc. die Scharia einzuführen, die Ausübung der Justiz auf der Grundlage des Korans. Dieben werden die Hände abgehackt, Frauen bei Ehebruch gesteinigt usw. Die Scharia widerspricht in vielen Punkten, vor allem, was die Behandlung von Frauen betrifft, unserer westlichen Ethik. Eine Lösung dieses Konfliktes ist zurzeit kaum in Sicht. Doch allgemein wäre eine Umorientierung hin zum Kern der Ethik nötig.
Andererseits ist die Vernunft kein Maßstab in der Ethik des Islams. Ausschließlich der Wille Allahs zählt, und der ist oft nicht so leicht zu durchschauen. Allerdings haben die Moslems in der "Deklaration des Weltparlaments der Religionen– Die Weltethos-Erklärung" von 1993 der Goldenen Regel als "unverrückbare, unbedingte Norm für alle Lebensbereiche" zugestimmt. Diese auch im Koran empfohlene Regel ist einfach: Was du willst, dass man dir tut, das tue auch den anderen!
Im Juden- und im Christentum gibt Gott ebenfalls die Regeln vor, doch zwischen Gott und Mensch ist der Dialog möglich und sogar erwünscht. Auf die Nächstenliebe wird besonderer Wert gelegt, bereits in den Büchern Moses.
Die asiatischen Religionen sind ganz anders ausgerichtet. Hinduismus, Buddhismus und Taoismus kennen zwar eine verbindliche Lehre (Dharma, Tao/Natur) und es gibt eine soziale Ordnung (Kastenwesen, Mönchsregeln) sowie eine Erklärung, warum jeder gut sein sollte (Karma), doch das ist nicht gebunden an die Vorstellung eines allmächtigen Gottes.
Glücklichsein
Die Zahl der Ratgeber zu einem erfüllten, glücklichen Leben dürfte sich in den vergangenen zehn Jahren verhundertfacht haben. Sind wir deshalb nun alle glücklicher? Wer weiß? Wir können schon beim Lesen eines Satzes prüfen, ob sich etwas in uns regt. Zum Abschluss einige Zitate als Kostprobe:
Nicht die Glücklichen sind dankbar. Es sind die Dankbaren, die glücklich sind.
Sir Francis Bacon
Glücklich ist nicht, wer anderen so vorkommt, sondern wer sich selbst dafürhält.
Seneca
Und allgemeiner zur Ethik:
Alles Können muss gelernt werden, so auch das sittliche Können.
Johann Wolfgang von Goethe
Was aus Liebe getan wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse.
Friedrich Nietzsche
Wir sind nicht für uns allein geboren.
Cicero
Nutze den Tag!
Warum man Lebensfreude nicht aufsparen oder verschieben kann
„Die Freude am Leben ist der Anfang der Tugend“
Niklaus Brantschen, Jesuit und Zenmeister
Seit der Antike gibt es zwei verschiedene Grundeinstellungen zum Leben: Die eine konzentriert sich auf den Augenblick, die andere sieht die wahre Erfüllung in der Zukunft. Welche erscheint euch sinnvoller?
Zur Lebensfreude gehören Lebenskraft, Sinnfindung, im Jetzt sein, Ekstase, Glück. Es scheint zunächst selbstverständlich, dass jedes Lebewesen und erst recht der vernunftbegabte Mensch sich eher für die Freude als für das Leid entscheiden, sofern es da eine echte Wahlmöglichkeit gibt.
Schauen wir uns heute um auf dieser Welt und blicken zudem zurück auf vergangene Jahrhunderte, dann drängt sich jedoch der Verdacht auf, dass die Menschen überwiegend ein leidvolles und trostloses Dasein gefristet haben und immer noch erdulden. In den überlieferten Schriften wie auch in den aktuellen Nachrichten herrschen Berichte über Kriege, Gräueltaten, Krankheiten und Schmerzen vor. Echte Freude kommt selten zum Ausdruck, ist jedenfalls in den Geschichtsbüchern und Nachrichten kaum Thema. Woran liegt das? Ist das Leben tatsächlich so schrecklich? Oder haben wir Menschen eine zu negative Grundeinstellung? Sind wir vielleicht sogar von bestimmten Doktrinen und Ideologien manipuliert bzw. auf Elend programmiert worden? Wie kann ich Freude in mein Leben bringen? Wir wollen diesen Fragen, die durchaus nicht neu sind, im Folgenden nachgehen.
Griechische Antike: Dionysos und Epikur
Die Philosophie der Griechen unterschied Naturwissenschaft, Logik/Erkenntnis und Ethik. Die Frage nach der Lebensfreude fiel in den Bereich der Ethik. Wie kann der freie Bürger ein glückliches Leben führen? Es gab dazu sehr unterschiedliche Auffassungen. Auf der einen Seite ist da Dionysos - die Römer nannten ihn Bacchus - der Gott der Freude und des Weines mit seinen rauschhaften Festen und Gelagen. Um ihn, den Sohn von Göttervater Zeus, ranken sich unzählige Mythen. Zum Beispiel soll er als Jüngling von Wahnsinn getrieben durch ferne Länder gewandert sein. Zu seinen vielen Beinamen gehören: Der Rufer, der Fuchshafte, der Lärmer, der Sorgenbrecher, der Unterirdische, der Vielnamige. Er soll im Wechsel mit seinem Gegenpart, dem Gott Apollo, der für Klarheit und Vernunft stand, das Orakel von Delphi beaufsichtigt haben. In den alten, streng geheimen Mysterienkulten von Eleusis wurde er in Verbindung mit der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter als „das Kind“ angerufen. Einige Forscher sehen heute in Dionysos einen Repräsentanten des Matriarchats an der Schwelle zum Übergang ins Patriarchat, der Vorherrschaft männlicher Rationalität. Der Altphilologe Friedrich Nietzsche erklärte im 19. Jahrhundert das Dionysische und das Apollinische zu den beiden alternativen Grundhaltungen des Menschen.
Auf der anderen Seite gab es aber auch das Ideal der Disziplin, der Askese, der kriegerischen Ertüchtigung und der sportlichen Leistung. „Spartanisch“ ist bis heute ein bekannter Begriff für diese Einstellung. Zumindest im sportlichen Wettkampf kann das durchaus mit Lebensfreude verbunden sein. Der Philosoph Epikur (341 – 270 v. Chr.) vertrat eine Lehre der gemäßigten Mitte zwischen Ausschweifung und Entsagung. Um ein glückliches oder freudvolles Leben zu führen, sollte man sich nicht von äußeren Luxusgütern abhängig machen, sondern in den einfachen Dingen Befriedigung und Zufriedenheit finden. Von Demokrit übernahm Epikur das materialistische Konzept, dass alles, selbst die Seele und die Götter, aus Atomen zusammengesetzt ist. In der epikureischen Philosophie macht jegliche Vertröstung auf eine bessere Zukunft oder gar ein Jenseits keinen Sinn. Mach das Beste aus diesem Moment: „carpe diem“, wie Horaz einige Jahrhunderte später formulierte. „Nutze den Tag!“
Um anhaltenden Seelenfrieden (ataraxia) zu realisieren, muss der Mensch allerdings seine Ängste und Begierden überwinden und Schmerzen so gelassen wie möglich ertragen. Epikur, der durch die sehr schmerzhaften Nierensteine starb, war darin selbst ein Vorbild. In seinem Abschiedsbrief an Idomeneos heißt es: „Den seligen und zugleich letzten Tag meines Lebens verbringend, schreibe ich euch diese Zeilen. Ich werde von Harn- und Ruhrbeschwerden verfolgt, die keine Steigerung der Größe mehr zulassen. All dem aber steht gegenüber die Freude der Seele über die Erinnerung an die von uns geführten Gespräche.“ Und an Menoikeus schrieb er: „Das schauerlichste aller Übel, der Tod, hat also keine Bedeutung für uns; denn solange wir da sind, ist der Tod nicht da, wenn aber der Tod da ist, dann sind wir nicht da.“ Im christlichen Mittelalter galt „Epikureer“ als Schimpfwort im Sinne von „Schwein“ und Lüstling“. Erst im Zeitalter der Aufklärung erhielt diese so lange verleumdete Lehre ihre verdiente Anerkennung.
Indien: Yoga und Tantra
Yoga wird hierzulande eher mit Disziplin und Durchhalten, Tantra mit sinnlichem Genuss und freizügiger Lebensfreude verbunden. Ganz so eindeutig und simpel ist die Sache nicht. Im Unterschied zur Philosophie und Kunst der griechischen Antike zielte in Indien etwa zur selben Zeit das geistige Streben der Elite, der Brahmanen-Kaste, auf die Vereinigung mit dem Höchsten und Unsterblichen, Brahman genannt. Stand zunächst noch die Beschwichtigung der Götterwelt durch Opfergaben im Vordergrund, kam es ab 600 v. Chr. verstärkt zu einer Bewegung individueller Wahrheits- und Erleuchtungssucher, die meist unter Anleitung eines Gurus bzw. Rishis die Befreiung von irdischem Leid und ewige Glückseligkeit (Moksha, Nirwana) verwirklichen wollten.
Dabei galt es, Selbstsucht, Begierden, Ängste, ja, letztlich sich selbst, die individuelle Begrenzung zu überwinden. Die Suche des Prinzen Gautama, der zum Buddha wurde ist wohl das bekannteste Beispiel. Seine spirituelle Suche war gewiss nicht von Lebensfreude bestimmt, sondern von härtester Entsagung. Wer die wahre Freude, Glückseligkeit jenseits der Gegensätze von Lust und Schmerz finden will, der muss alles irdische Glück, das heißt auch die Lebensfreude aufgeben. Dies ist eine Grundformel jeder Religion: Verzichte auf irdische, vergängliche Freuden, um irgendwann – vielleicht – ewige Freude zu erlangen.
500 Jahre vor der Entwicklung des Hatha-Yoga, also etwa im 4. Jahrhundert n. Chr. kehrten die sogenannten „Tantriker“ die längst ausgehöhlten Werte der Askese einfach um und erklärten „Bhoga“, den sinnlichen Genuss, zum Yoga. Tantra, die Kunst, den eigenen Körper und den des sexuellen Partners bewusst zu genießen und zu achten, wurde – wie Mircea Eliade in seinem Buch Yoga - Unsterblichkeit und Freiheit schreibt - zur „panindischen Mode“. Damit wurden zugleich die alten, männlichen Götter entthront. Shakti, die weibliche Urkraft, erschien mindestens gleichberechtigt neben dem höchsten Gott Shiva.
Im Hatha-Yoga geht es wie im Tantra darum, diese weibliche Urkraft im eigenen Körper zu erwecken, über die sieben Energiewirbel „nach oben“ zu lenken und so den göttlichen Ursprung allen Lebens zu erfahren, mit ihm eins zu werden. Ein Hatha-Yogi unterscheidet sich jedoch von einem Tantriker in seiner gesamten Lebenseinstellung. Die beiden repräsentieren zwei verschiedene Menschentypen. Gezielt vereinfachend erklärte Osho: „Yoga ist der Weg des Kriegers. Auf dem Weg des Tantra kommt Kämpfen überhaupt nicht in Frage. Im Gegenteil, hier muss man alles zulassen – mit Bewusstheit“. 4 Eines wird man jedoch beiden Richtungen zugestehen: Es ist Achtsamkeit und Gegenwärtigkeit gefordert, ein möglichst bewusstes Wahrnehmen des Augenblicks. Das ist nur möglich, wenn das Leben und damit auch die Lebensfreude bejaht wird.
Die „Frohe Botschaft“ der Kirche
Unser abendländisches Erbe ist allerdings vor allem durch eine Ideologie bestimmt, die das irdische Leben als Jammertal hinstellt und darüber hinaus noch mit einer ewigen Verdammnis und Höllenqualen droht, wenn die Gebote und Regeln ihrer Doktrin nicht befolgt werden. In diesem geistigen Kontext des Christentums bzw. der Kirchen ist es kaum verwunderlich, dass „Lebensfreude“ wie ein Fremdwort wirkt. Die sinnliche Lust am Leben, lateinisch voluptas, für die etwa Epikur stand, wurde von der katholischen Kirche als eine der sieben Todsünden gebrandmarkt – im wörtlichen Sinne, denn die meisten der Hexen und Ketzer, die auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden, waren wegen Wollust verurteilt.
Die himmlische Freude, die seelische Verzückung in der Liebe zu Gott und Christus wurden dagegen bei einigen später heiliggesprochenen Menschen zumindest geduldet, wenn auch skeptisch beäugt, ob da nicht womöglich doch der Satan mitmischt. Mechthild von Magdeburg (1207-1282) zum Beispiel schrieb Zeilen wie: „Die Braut ward trunken beim Anblick des edlen Antlitzes. In der größten Stärke kommt sie sich selbst abhanden.“ Oder: „Wie die Seele Gott empfängt und lobt Eia, selige Schau! Eia, inniger Gruß! Eia, süße Umarmung!“5 Wer sich so äußerte, musste auf jeden Fall jeden Verdachts erhaben sein, auch nur annähernd irdische, gar sexuelle Lust zu meinen oder erfahren zu haben.
Was die Kirche mit ihrer Verteufelung der Lebensfreude seelisch angerichtet hat, ist schon oft und ausführlich dokumentiert worden. Ich möchte mich hier stärker auf das beziehen, was die Lebensfreude in uns fördert. Und da gibt es auch im Christentum einige positive Beispiele. Zum einen stellt der Glaube an den auferstandenen Christus eine enorme Kraft dar, die vielen Menschen allen äußeren schrecklichen Umständen zum Trotz geholfen hat: Von den frühen Christen in Rom bis zu einem Pfarrer Bonhoeffer bei der Hinrichtung im Naziregime.
Zum anderen gibt es immer wieder wortgewaltige Stimmen, die sich für die eigentliche und ursprüngliche frohe Botschaft Jesus stark machen. So etwa der amerikanische Pater Matthew Fox, der zu einer neuen Schöpfungsspiritualität aufruft, in der Gott nicht straft, sondern bedingungslos liebt. Freude und Kreativität seien die Merkmale der christlichen Botschaft, verkündet Fox seit Jahrzehnten in Büchern und Vorträgen weltweit. Zu Pfingsten 2005 heftete er wie Martin Luther Jahrhunderte zuvor 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Die Inquisition unter Kardinal Ratzinger hatte ihm schon lange zuvor die theologische Lehrerlaubnis und die Mitgliedschaft im Dominikanerorden entzogen.
Fazit
Verstehen wir unter Lebensfreude einen natürlichen, spontanen Zustand, wie er sich im Lachen und Strampeln eines Kleinkindes ausdrückt, dann scheint es für den Erwachsenen gar nicht so leicht, einen solchen Zustand zu erleben. Sobald durch eine Religion oder Doktrin Lebensfreude als zu gering eingestuft und stattdessen etwas Höheres gesetzt wird – unvergängliche, ewige Wonne und Glückseligkeit – was es unter Verzicht und Erfüllung von Geboten zu erreichen gilt, entstehen Leid und Elend. Sinnlicher Genuss einschließlich sexueller Leidenschaft gehört wesentlich zur irdischen Lebensfreude. Wird er moralisch verurteilt, kann das Leben ja nur noch unglücklich sein.
Von den hier kurz vorgestellten Philosophien erscheint mir Epikurs Lehre zur Steigerung und zum Erhalten der Lebensfreude besonders einleuchtend und praktikabel. Sie wird auch „Philosophie des Augenblicks“ genannt. Konsequent dabei ist, dass die Hoffnung auf ein Jenseits zusammen mit der Furcht vor dem Tod sowie göttlicher Bestrafung keine Nahrung erhalten. Es bleibt im Grunde nur das Auskosten dieses Moments mit allem, was er bzw. das Leben selbst zu bieten hat. Für diese Konsequenz wurde Epikur schon von seinen eher idealistisch ausgerichteten Zeitgenossen kritisiert und erst recht von den Ideologen der Kirche verdammt. Dennoch bekannten sich zu Epikur sogar große Staatsmänner wie König Friedrich II. von Preußen und Thomas Jefferson (1743-1826), der 3. Präsident der Vereinigten Staaten.
Über den Weisen in Epikurs Lehre sagte Marcus Tullius Cicero (106-46 v. Chr.) eher kritisch: „Er ist gleichgültig gegen den Tod; er hat von den unsterblichen Göttern, ohne sie irgendwie zu fürchten, richtige Vorstellungen; er nimmt keinen Anstand, wenn es so besser ist, aus dem Leben zu scheiden. Mit solchen Eigenschaften ausgerüstet, befindet er sich stets im Zustand der Lust. Es gibt ja keinen Augenblick, wo er nicht mehr Genüsse als Schmerzen hätte.“6
Was sind Gefühle?
Eine Spurensuche von der Philosophie, Psychologie und Religion bis zur Musik und Dichtkunst
Gefühle sind oft schwer zu beschreiben. Sie wollen uns irgendwie entwischen, obwohl sie in unserem Leben eine so zentrale Rolle spielen. Es fordert Achtsamkeit und Mut, sie wirklich wahrzunehmen.
Wie fühlst du dich? Eine häufig gestellte Frage. Meist antworten wir knapp mit „gut“, seltener mit „schlecht“, denn da wird bereits eine Begründung erwartet. In jedem Fall geben wir, ohne viel nachzudenken, eine Bewertung in angenehm oder unangenehm. Manchmal wird die Frage auch mit einem Achselzucken beantwortet. Keine Ahnung. Weder gut noch schlecht. Normal. Wie immer.
Wie fühlst du dich? fragt nicht nach einer detaillierten und aufrichtigen Durchleuchtung aller momentanen Empfindungen, Emotionen und Gefühlsregungen. Doch mit einer spontanen Antwort wie „gut“ oder „heute nicht so doll“ bestätigen wir, was Philosophen und Seelenforscher von Epikur bis Sigmund Freud als eine Grundeigenschaft des Fühlens feststellten: Gefühle sind entweder angenehm oder unangenehm.
Antworte ich, dass ich mich nicht gut fühle, wird mich der andere in der Regel fragen: „Warum, was ist los?“ Dann könnte ich sagen: „Mir wurde gerade gekündigt“ oder auch „Wieder diese Migräne!“ oder „Ich muss dauernd an meine Mutter denken (die vor einem Jahr gestorben ist)“. Ich gebe Gründe für meine Frustration oder Wut, Schmerzen, Traurigkeit. Das sind Zustände, die wir nicht gerade herbeiwünschen – im Unterschied zum Verliebtsein, zur Freude oder zur Bewunderung.
Die Philosophie der Gefühle
Fragt man genauer nach, was Gefühle eigentlich sind, erweist sich das Terrain als recht unübersichtlich und vielschichtig. „Was ist ein Gefühl? Man sollte vermuten, dass die Wissenschaft darauf längst eine Antwort gefunden hat, aber dem ist nicht so, wie die umfangreiche psychologische Fachliteratur zum Thema zeigt.“ Schreibt der amerikanische Philosoph Robert C. Solomon in seinem Werk: Gefühle und der Sinn des Lebens.7 Inwieweit spielen körperliche Vorgänge und Empfindungen eine Rolle? Sind Gefühle Emotionen? Welche Bedeutung haben sie für unsere Selbst-Erkenntnis? Wann laufen sie außer Kontrolle und werden für uns selbst und andere gefährlich?
Große abendländische Philosophen wie Plato, Aristoteles, Epikur, Descartes, Spinoza, Humes, Kant, Hegel, Schopenhauer und Nietzsche haben sich mit Pathos und Affekt – dem griechischen und dem lateinischen Begriff für Leidenschaft (inklusive Emotion und Gefühl) auseinandergesetzt. Meist wurden dabei Verstand (ratio) und Gefühl (affect) gegenübergestellt. Für die Erkenntnis galten die Ratio bzw. der Intellekt als maßgebend, und die Affekte eher als störend. Im Bereich der Ethik und der Ästhetik erschienen sie aber stets zentral. Im 20. Jahrhundert tendierte die Philosophie zur analytischorientierten Wissenschaftstheorie, doch in den vergangenen Jahrzehnten befassen sich Philosophen wieder verstärkt mit dem Thema Emotionen, und zwar vor allem in ihrer Bedeutung für unser Verhalten (Ethik) und ihrem Erkenntniswert. So glaubt Sabine Döring, Professorin für Philosophie an der Universität Tübingen, dass es in der gegenwärtigen Philosophie eine „Renaissance der Gefühle“ gibt, und zwar bezogen auf die Emotionen, die für unsere Erkenntnis wichtig sind:
„Emotionen wie Furcht, Ärger, Empörung, Neid, Trauer, Bewunderung, Scham oder Stolz sind keine reinen Gefühle, sondern repräsentationale und damit kognitive mentale Zustände. Furcht vor einer zähnefletschenden Dogge zum Beispiel erschöpft sich demnach nicht in dem »Wie-es-ist«, sie zu erleben. Vielmehr ist sie auf den Hund gerichtet und (re)präsentiert ihn als gefährlich. Indem damit die Möglichkeit eröffnet ist, dass eine Emotion ihren jeweiligen Gegenstand korrekt repräsentiert (wie in dem Beispiel den Hund als gefährlich), kann sie ihrem Subjekt möglicherweise Wissen über die Welt vermitteln.“8
Gefährliche Gefühle
Philosophen und Psychologen zählen ebenso wie Theologen, Mystiker und Religionsstifter gerne einige Emotionen auf, die sie für grundlegend halten. Der Philosoph David Hume unterschied Furcht, Ärger, Empörung, Neid, Trauer, Bewunderung, Scham oder Stolz als »Eindrücke der Selbstwahrnehmung« von »Eindrücken der Sinne« wie hell, warm, rot etc. Der Emotionspsychologe C. E. Izard geht von zehn unterschiedlichen Gefühlen aus, die auf der ganzen Welt und in jeder Kultur vorkommen: Interesse, Leid, Widerwillen, Freude, Zorn, Überraschung, Scham, Furcht, Verachtung und Schuldgefühl. Und Buddha benannte drei „Geistesgifte“ oder „Wurzeln des Unheilsamen“, nämlich Gier, Hass und Unwissenheit. Das Hauptgegenmittel seien Liebe und Mitgefühl.
Auch wenn wir in unserer westlichen technik- und verstandesorientierten Kultur von klein auf vermittelt bekommen und gerne glauben, dass wir durch unseren Geist, logisches Denken und Reflexion alles kontrollieren können, wissen wir doch ganz gut aus eigener Erfahrung, dass dem oft und gerade in entscheidenden Situationen nicht so ist. Ein Wort, ein Satz, eine Geste, eine Handlung, unwillkürlich entstanden aus Wut oder Eifersucht kann viel Leid verursachen, kann Hass, Schuldgefühle und Scham, Feindschaft und sogar Krieg nach sich ziehen. Die meisten oder sogar alle Konflikte und Kriege werden durch Emotionen ausgelöst. Selbst wenn ein Krieg von Herrschern kaltblütig geplant wird – auch da ist Verblendung durch Herrschsucht, Stolz und Machtgier ausschlaggebend.
Der traditionelle philosophische Begriff der Affekte findet heute eigentlich nur noch in einem Bereich Anwendung, nämlich im juristischen. Jemand handelt, tötet im Affekt. Heißt: Er wurde von Leidenschaft, meist Wut oder Eifersucht, überwältigt und war „außer Kontrolle“. Das Strafmaß wird dann niedriger angesetzt als bei einem kaltblütigen Mord bzw. einer Straftat aus Berechnung. Ein Sonderfall ist der Psychopath, der die scheußlichsten Verbrechen begeht, ohne etwas dabei zu empfinden. Die Unfähigkeit, Gefühle zu empfinden gilt dabei fast schon als Strafe in sich.
Gefühle und buddhistische Meditation
Die Motivation für unser Handeln ist selten rein rational. Unsere Gefühle bestimmen unser Verhalten und uns als Person stärker, als wir vielleicht zugeben mögen. Die meisten heutigen Therapeuten und spirituellen Lehrer raten dazu, sich den eigenen Gefühlen stärker zuzuwenden als bisher. Bereits C. G. Jung sah in den Gefühlen eine der vier Hauptfunktionen, mit denen sich ein Mensch in der Welt orientiert und zum Handeln veranlasst wird. Psychotherapeuten wie Arthur Janov (1924-2017) entwickelten emotionale Therapieformen, bei denen Verletzungen des Gefühls aufgearbeitet werden sollen. Und David Goleman stellte in seinem Bestseller "Emotionale Intelligenz" die These auf, dass es nichts nutzt, intelligent zu sein, "wenn man ein emotionaler Trottel ist". 9
In der buddhistischen Psychologie spielen Emotionen bzw. Gefühle eine zentrale Rolle. Dr. Armin Gottmann, ein Lehrer in der Tradition von Lama Anagarika Govinda, der sich nach einem berühmten indischen Yogi Asanga nennt, schreibt:
„Wenn nun Verdrängung von Gefühlen zu neurotischen Störungen führt, Unterdrückung zur Verkrampfung und das unkontrollierte Ausleben uns nur weltlicher werden lässt, so stellt sich die Frage, wie wir mit unseren Gefühlen umgehen können. Der entscheidende Dreh- und Angelpunkt, um mit Gefühlen gut umgehen zu können, beginnt mit der Bewusstwerdung der Gefühle, so wie es bereits der Buddha im Prozess des Satipaţţhana - insbesondere im Zusammenhang mit der Atemmeditation - angedeutet hat. Wir sollten lernen, sowohl in der Meditation wie auch im täglichen Leben uns unserer Gefühle bewusster zu werden, den Strom des Entstehens und Vergehens von Stimmung und Gefühlen wahrzunehmen, zu beobachten und zu erleben (die westliche Psychologie nennt dies: Metakognition der Gefühle).