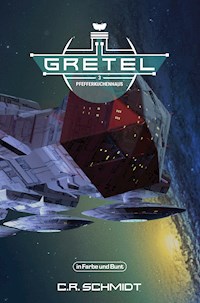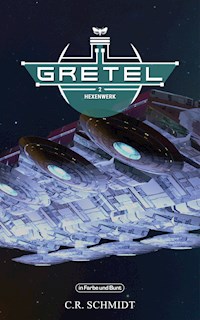Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Michelle schläft seit geraumer Zeit nicht mehr. Stattdessen schleppt sie sich ziellos durch die Straßen einer verwüsteten Erde. Notdurft treibt sie in die Arme ihrer entfremdeten Schwester, die in einem bizarren Kult haust. Dort betet man eine geheimnisvolle Droge an, die denjenigen, die sie einnehmen, gemeinsame Träume beschert. Eine Reihe von Todesfällen erschüttert bald das Traumkollektiv. Als Michelle tiefer in die Rätsel der Traumwelt eintaucht, merkt sie, dass ihnen allen ein Albtraum bevorsteht, der seine Wurzeln auch tief in der echten Welt geschlagen hat.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
TEIL I: DIE KNOSPE
1. KAPITEL
2. KAPITEL
3. KAPITEL
4. KAPITEL
5. KAPITEL
6. KAPITEL
7. KAPITEL
8. KAPITEL
9. KAPITEL
10. KAPITEL
11. KAPITEL
12. KAPITEL
13. KAPITEL
14. KAPITEL
15. KAPITEL
16. KAPITEL
TEIL II: DER ZWEIKÖPFIGE STIER
17. KAPITEL
18. KAPITEL
19. KAPITEL
20. KAPITEL
21. KAPITEL
22. KAPITEL
23. KAPITEL
24. KAPITEL
25. KAPITEL
26. KAPITEL
27. KAPITEL
28. KAPITEL
29. KAPITEL
30. KAPITEL
31. KAPITEL
TEIL III: DAS MONSTER IN KETTEN
32. KAPITEL
33. KAPITEL
34. KAPITEL
35. KAPITEL
36. KAPITEL
37. KAPITEL
38. KAPITEL
39. KAPITEL
40. KAPITEL
41. KAPITEL
42. KAPITEL
43. KAPITEL
DANKSAGUNG
TEIL I:
DIE KNOSPE
1. KAPITEL
Sie konzentrierte sich auf das Licht, klammerte sich an den Trost, hielt den Schlaf in Schach. Ab und zu spürte sie, wie ihre Unachtsamkeit sie zurück in den Abgrund des Schlafes schubste, gefolgt von dem unangenehm rücksichtslosen Gefühl, wieder unsanft in der Realität zu landen.
Sich nur auf das Licht zu fokussieren half nicht immer. Am Fensterbrett hing ihr kleines Nachtlicht, das sie mit einer Klammer an der Heizung befestigt hatte. Sie hatte es mal von einem Scrapper an den Toren der Stadt stibitzt. Das blaue Licht wurde schwächer, und sie wusste nicht, ob sie den Akku dafür laden konnte. Ihre Gedanken kreisten um die Frage nach einem Ersatz. Welchen Markt könnte sie aufsuchen, welchen Kontakt nutzen? Würde sie noch einmal erfolgreich etwas stehlen können? Waren ihre Finger nach so langer Zeit ohne Schlaf so träge wie ihr Geist?
Das Licht half, doch es war kein Allheilmittel. Ab und zu ließ ihr Unterbewusstsein es zu kaltem Mondlicht werden, die dreckigen, löchrigen Holzdielen zu Tonerde, ihre uralte Matratze zu einem Beet aus Gras und Blumen, ehe sie sich wieder in die Realität zurückkrallte.
Durch das Fenster über ihr kamen seichte Lichttöne dazu, alle Farben des Werbespektrums, von den Reklametafeln gegenüber. Durch die offene Tür drangen Geräusche. Smokey saß nebenan, war noch immer wach, warf sich mit willkürlicher Brutalität Substanzen ein. Madelyn hatte einen nächtlichen Gast, und sie versuchte, möglichst leise zu stöhnen, doch jeder hörte es. Es interessierte so oder so niemanden.
Sie wälzte sich umher, in der Hoffnung, den Schlaf von ihr zu schütteln, ihm Einhalt zu gebieten. Ihre Wolldecke war schweißgetränkt. Der Muff in der Wohnung war altbekannt, und sie wusste nicht, zu welchem Teil er von ihr stammte. Zigarettenqualm, altes Essen, Rost, Schimmel.
Jede Nacht mit dem Schlaf zu kämpfen hatte ungeahnte Konsequenzen. Die sieben, acht Stunden, die sie ansonsten damit verbrachte, mussten überbrückt werden. Zuallererst hatte sie versucht, sich mit sinnloser Feierei abzulenken, doch die eiserne Faust der Erschöpfung hatte sie nach ein paar Tagen übermannt. Sie schaute Filme, versuchte es mit allerlei Drogen, mit Sex, doch am Ende wollten andere irgendwann schlafen, nur sie nicht. Seit einer Woche zog sie sich resigniert auf ihre Matratze zurück und kämpfte mit dem Schlaf, gönnte ihrem geschundenen Körper etwas Ruhe, und stand nach einigen Stunden wieder auf, um sich über den Tag zu bringen.
Michelle reckte sich nach oben und stöhnte. Ein Blick nach draußen an die Werbetafel verriet ihr, dass es halb sechs Uhr morgens war. Bald würde sich das Tageslicht über alles legen, und sie würde darin baden.
Sie stand auf, genoss dabei das Knacken ihrer Knochen, und warf sich ihren viel zu großen Mantel über.
Einige Nachtschwärmer waren noch auf der Straße. Eine Gruppe junger Kerle pfiff ihr von der anderen Straßenseite zu. Sie ignorierte es.
Sie schwitzte. Ihre Augenringe waren nicht nur spürbar, sondern schienen mit ihren Augen verschmolzen. Alles war schwer.
Ihr Mund war trocken, ab und zu überkam sie das Zittern. Wie viele Tage mochte ihr letzter Trip her sein? Neun? Zehn? Es war ihr egal. Sie ging noch immer instinktiv die alten Wege ab. Da, neben einer überquellenden Mülltonne, stand Saul. Er hielt ein kleines Tütchen mit Pulver hoch, bot es ihr an. Sie verneinte, huschte an ihm vorbei und hörte seinen Satz darüber, was ihr entging.
Hier und da flogen Drohnen durch die Luft, oder imperiale Einsatzschiffe. Die Rekrutierungsposter an den Wänden waren zerschlitzt und mit obszönen Botschaften bekritzelt. Sie machten einen heiß, boten den Ausstieg an, doch im Endeffekt wurde man nur ein Glied in der Kette, die sich immer enger um die Kehlen der Menschen hier zog.
Tosender Lärm erfüllte die Luft. Einige Hälse, auch ihrer, drehten sich um. Ein Koloss aus Stahl hob ab, blaues Feuer umgab ihn. Ein imperiales Kolonieschiff brach auf zu ungeahnten Weiten. Nicht gut genug ausgestattet, da Hyperbetten rar und teuer waren. Die zweibis dreitausend Schlucker, die auf dem Schiff festsaßen, würden auf dem Schiff sterben, und ihre Kinder, und deren Kinder, und deren Kinder auch. Irgendwann würden sie auf einem kargen Fels landen, eine Fahne setzen, die anderen imperialen Schiffe würden kommen, und in mehreren tausend Jahren würden ihre Nachfahren nicht frei sein, sondern alles würde so sein wie hier.
Die Silhouette des Schiffes war bald nicht mehr im braunen Dunst der Atmosphäre zu sehen. Es war aber noch lange zu hören. Für Michelle war es nichts anderes als ein fliegendes Gefängnis mit Todesurteil. Rationierte Mahlzeiten, kein Freigang, strenge Regeln und Populationskontrolle.
Mittlerweile hatte sie sich weit von ihren normalen Wegen entfernt. Einige der Straßen erkannte sie nicht mehr. Mit der Zeit kam sie der Stadtmitte näher, wo die Menschen versuchten, den Anschein der Normalität zu erwecken. Luftreinigungssäulen säumten ihren Weg. Ab und zu waren Pendler unterwegs. Man erkannte sie daran, dass sie Waffen trugen und nicht schmutzig waren. Die Straßen waren frei, nicht mit verbrannten Karosserien besetzt, und manche trauten sich, Auto zu fahren. Hier und da sah sie waschechte Anzüge. Manch einer beobachtete sie vorsichtig, wechselte vielleicht die Straßenseite.
Und schon war es kurz vor Mittag, wie sie an einer Tafel erkennen konnte. Sie nahm auf einer freien Parkbank Platz und ruhte sich aus. Hunger und Durst waren neben ihr gewandert, und der Spaziergang hatte sie ein wenig abgelenkt, doch nun appellierten beide lautstark an sie. Michelle raffte sich auf und fand einen Rationsterminal, an dem einige Schlucker Schlange standen. Nach einer guten Viertelstunde war sie dran. Sie wählte am Terminal eine große Flasche Wasser sowie Proteinbrot aus, hielt den Chip in ihrem Handgelenk an die Maschine und nahm ihr Essen entgegen. Fast schon sarkastisch bedankte sich eine elektronische Stimme bei ihr. Sie riss im Gehen die Verpackung an einer Ecke ab und biss in das klamme Brot. Ihr Magen bedankte sich bei ihr.
Zwei patrouillerende Sicherheitstruppler kamen um die Ecke und wurden auf sie aufmerksam. Sie seufzte. Es war jetzt schon zu spät. Die beiden uniformierten und maskierten Männer schritten auf sie zu.
»Morgen«, sagte Michelle unvergnügt. Sie streckte ihr Handgelenk aus.
Einer der beiden scannte sie. »Guten Tag. Ihr Name ist Michelle D'Arby?«
Sie nickte.
Der eine Imperiale hielt subtil, aber wirksam eine Hand an seiner Waffe, der andere las vom Scanner ab. »Wohnhaft in … aha, obdachlos. Keine Arbeit … Und dies ist Ihre fünfte Kontrolle, inklusive Hinweis. Sie wissen, was das bedeutet?«
Sie zuckte mit den Schultern. Sie hatte Schwierigkeiten, sich auf den genauen Wortlaut zu konzentrieren.
»Miss D'Arby, eine fünfte Auffälligkeit ohne veränderten Arbeitsstatus hat einen verpflichtenden Statuswechsel zur Folge. Sie erhalten nun eine persönliche Empfehlung auf Basis Ihrer Diagnostika-Ergebnisse.« Der Scanner in seiner Hand piepte kurz. Der Imperiale studierte den Bildschirm für einige Sekunden. »Sie zeigen hohe Intelligenz in den Bereichen Soziales und Musik. Ihnen werden Stellen wie Sozialarbeit oder ein Lehrberuf empfohlen. Sie haben zwei Monate Zeit, um sich mit einem Arbeitsnachweis bei einem Terminal zu melden, sonst wird die Teilnahme an einer dreimonatigen Berufsorientierungs-Diagnostika verpflichtend. Haben Sie das verstanden?«
Sie nickte.
»Ich muss das hier zu Protokoll geben. Würden Sie bitte laut bestätigen, dass Sie verstanden haben, was ich Ihnen mitgeteilt habe?«
»Verstanden. Ich hab's verstanden.«
»Ihre übermittelten Blutwerte weisen auf einen Drogenentzug hin … aha. Da waren also Pillen im Spiel. Offenbar … Gack-12. Ihre Entscheidung gegen die Pillen war eine gute, da muss ich Sie aufrichtig loben, Miss D'Arby. Benötigen Sie ärztliche Hilfe?«
»Nein«, murmelte sie.
»Ihre Werte weisen darauf hin, dass es Ihnen nicht allzu gut gehen sollte, so viel steht fest. Schlaflosigkeit, trockener Mund, Unruhe, Schmerzen …«
»Da musste meine Cousine auch durch«, warf der andere ein. »Scheißzeug.«
»Die schlimmsten Schmerzen sind schon vorbei«, sagte Michelle.
»Hin oder her, Miss D'Arby, auch, wenn Sie gutes Verhalten an den Tag legen, das Imperium sieht dennoch vor, dass Sie sich an die Vorgaben halten. Haben wir uns verstanden?«
»Ja«, sagte sie.
»Nach Vorlage eines Arbeitsnachweises innerhalb der nächsten zwei Monate wird von Ihnen in einer sechsmonatigen Periode ein regelmäßiger Nachweis verlangt. Haben Sie das verstanden?«
Nicken.
»Nun denn: Sie wurden belehrt. Auf Wiedersehen. Wissen ist Macht.« Er klopfte ihr unsanft auf die Schulter. »Und schlafen Sie mal wieder, Sie sehen beschissen aus.« Der Imperiale ging davon.
»Durchhalten, Kiddo«, sagte der andere im Vorbeigehen. »Wissen ist Macht.«
Madelyn kannte jemanden, der einem einen Arbeitsnachweis geben konnte. Zumindest glaubte Michelle, sich daran zu erinnern. Man klopfte an eine Tür, stellte sich vor, und schon bekam man einen Nachweis. Das war nicht ganz ohne Preis: Ihr Körper gehörte dann ein halbes Jahr ihm, so war Maddy zumindest da rausgekommen.
Entweder das, oder die Zwangisdiagnostika. Arbeitscamps. Geschorene Haare, rationiertes chemisches Essen aus Tuben, fünfzig Mann in einem Raum, drei Monate lang, im Anschluss lebenslanger imperialer Dienst, mit Pech auf einem Kolonieschiff. Sie kannte die Horrorgeschichten.
Was war wohl besser?
Sie saß auf einer Parkbank und ging ihre Optionen durch. An einen ehrlichen Job zu kommen würde alles andere als leicht sein. Die imperial registrierten Jobs waren rar, und die, die man einfach bekam, waren Maloche, die sie in ihrem Zustand nicht lange durchhalten würde, zumindest nicht für ein halbes Jahr.
Was auch immer geschah: Sie würde verlieren.
Ihr war danach zu heulen, aber sie fühlte sich einfach innerlich leer. Es ist, als würde ihr ein essenzielles Ersatzteil fehlen, das es ihr ermöglichen würde.
Stattdessen stand sie auf und schlenderte weiter durch die Stadt. Altbekannte Gesichter boten ihr Pulver und Pillen an, aber sie lehnte stillschweigend ab, gefolgt von Buhrufen und Obszönitäten.
Sie legte sich wieder hin, um über die Nacht wach zu bleiben. Ihr Nachtlicht drohte auszugehen, die Werbetafeln zeigten heute überwiegend Grün und Fuchsia. Smokey schlief, oder er war weg. Madelyn weinte in ihrem Zimmer, aber sie tat es wieder leise.
Ihre Gedanken überschlugen sich. Wohin konnte sie gehen? Welcher offizielle Job war das geringste Übel? Sie betrachte alles aus einigen Winkeln, doch die Nüchternheit und der Entzug ließen nur wenige klare Gedanken zu. Scrapper war keine Option, keinesfalls anerkannt. Die riskierten sowieso jederzeit im Niemandsland von imperialen Schiffen auf Streife aufgelesen zu werden. Die meisten von ihnen starben früh, zerfressen von Krebs, wenn sie nicht genug Blei zur Abschirmung trugen. In den Fabriken tropfte der Schweiß von der Decke, und die Schichten gingen zwar offiziell acht Stunden, doch sie zogen sich weitaus länger, wenn man sechs Monate bleiben wollte, ohne gefeuert zu werden. Mutter war damals oft spät nach Hause aus den Fabriken gekommen, roch nach Schnaps und Sterilium aus der Kolonieschiffmanufaktur.
Ihre Mutter war aber tot, ihr Vater auf einem Kolonieschiff auf dem Weg ins Nirgendwo. Dann war da noch Andrea. Sie hatten sich letztes Jahr gesehen, auf der Beerdigung. Einige Drinks und Pillen später waren sie wieder Schwesterherzchen gewesen. Sie lebte jetzt in irgendeiner Wohngemeinschaft, ein Wort mit K, eine Kommune, New Age-Nonsens-Religion, Heilsbringer. Sie war ein Hippie, ein Weltverbesserer, ein Realitätsflüchtling. In ihrem Rausch hatte Michelle nur die Hälfte verstanden, aber es war genug um zu raffen, dass sie ihr aus dem Weg gehen musste. Religionen und Sekten sprangen wie Pilze aus dem Boden, und auch, wenn das Imperium Sapiens nicht viel davon hielt, duldete es sie. Es war ein einfacher Ausweg, eine Lüge, die man fröhlich pfeifend hinter sich herzog.
Manche flüchteten sich in Drogen, manche in den Glauben, aber im Endeffekt waren es für Michelle zwei Seiten derselben Medaille. Sie wusste, für welche sie sich entschieden hatte, und sie war zufrieden damit.
Doch jetzt kamen die Erinnerungen zurückgeflutet, Stück für Stück. Diese Kommune war offiziell geduldet. Andrea arbeitete dort, und sie konnte damit leben. Sie hatte ihren Arm mit dem Chip hochgehalten und freudig verkündet, dass sie einen Arbeitsnachweis hatte. Sie hatte ihre Schwester ausgelacht, verpönt, im Nachhinein noch mit sich selbst darüber verhandelt, wie idiotisch sie all das fand.
Ihre Augen weiteten sich. Sie richtete sich langsam auf, schnappte sich ihren Beutel und warf alles hinein, was man als Ihres identifizieren konnte: Dreckige Wechselkleidung, ihre Leselampe, einem Schundroman, den sie einmal bei einem Scrapper geklaut und schon zu oft gelesen hatte.
Sie warf sich ihren Mantel über, knotete ihn an der Taille zusammen. Sie schlich aus ihrem Zimmer heraus und zu Smokeys Tür herüber. In Zeitlupe und so leise wie möglich öffnete sie sie und blickte vorsichtig hinein. Ein ekelerregend süß-saurer Geruch kam ihr entgegen. Der Boden war übersät mit halb gegessenen Rationen, hier und da lagen Pfützen Erbrochenes. Ein Schweifblick reichte: Smokey war nicht da.
Sie ging hinein, rang mit ihrem Würgereflex, und sie brauchte nicht lange, um unter seiner Matratze etwas Schmuck zu finden: Zwei, drei Ringe, eine Kette, wahrscheinlich Gold oder vergoldet, einige besetzt mit Steinchen, von denen manche vielleicht echt waren. Das würde sie möglicherweise für etwas Guthaben auf ihrem Chip tauschen können. Eine Schachtel Zigaretten nahm sie sich ebenfalls mit.
Hastig steckte sie alles ein und verschwand aus dem Zimmer. Nachdem sie die Tür schloss, atmete sie erleichtert durch. Sie ging durch die Haustür, vorbei an der leise schluchzenden Madelyn, und sie schwor sich, nie wieder zurückzukehren.
2. KAPITEL
Ihre Schwester zu finden erwies sich als überraschend schwierig. Ein Terminal, das sie natürlich darauf hinwies, dass sie einen Job finden musste, spuckte nicht viel hilfreiche Informationen aus. Sie hatte nur wenige Anhaltspunkte, anhand derer sie Andrea finden konnte. Ihren Namen einzugeben reichte nicht, und das Verlangen nach Auskünften über Familienmitglieder war kein Grund, den ein Terminal akzeptierte.
Ihr Zustand nagte an ihr. Ab und zu verschwammen die Lichter des Terminals vor ihren Augen.
Sie suchte nach religiösen Einrichtungen und ließ die Kirchen ausblenden. Andrea lebte noch immer in New Chicago, zumindest hatte sie das letztes Jahr gesagt, aber die Stadt war gigantisch. Religiöse Einrichtungen, minus Kirchen, gab es noch immer über 100 Stück. Andrea glaubte, dass die KI bei all den Suchbegriffen an ihre Grenzen kommen würde, aber sie hielt stand.
Eine Schlange bildete sich zum Glück nicht hinter ihr, immerhin war es tiefste Nacht. Einzelne verlorene Seelen schlichen umher, aber sie ließen Michelle in Frieden. Terminals zeichneten alles auf, und wer hier Ärger machte, den sackten die Imperialen Minuten später ein. Das hier war einer der sichersten Orte, an dem sie sein konnte.
Die Suche wurde eingegrenzt, und jede Option, jede bekannte Vokabel mit religiösen Konnotationen, die auch nur annähernd passte, wurde in Betracht gezogen. Keine Tempel, keine Moscheen, keine Pilgerorte, aber große Kommunen sollten es sein, imperial geduldet. Der Terminal ließ sogar einen kleinen Hinweis darüber fallen, dass die Behauptungen dieser Kirchen nicht empirisch bewiesen werden konnten, und dass von einem Besuch abgeraten wurde, was ihr ein schnaubendes Lachen entlockte. Und nach einer guten Viertelstunde stand es fest: Fünf Ziele kamen in Frage, und diese waren stellenweise zehn Meilen von ihr entfernt. Sie las sich die Namen gut durch und ließ sie sich auf ihren Chip laden.
Neo-Buddhistische Kommune New Chicago, Metaphysisch-Lebensbejahende Freibürger New Chicagos, Sub-Interkonnektives Kollektiv New Chicago, Gaias Kinder New Chicago, Deistisch-Sozialistische Vereinigung New Chicago. Ein waschechter Brei von Wahnsinnigen, fand sie, und für einen kurzen Moment kamen ihr Zweifelsgedanken dazwischen. War es das wirklich wert, eine potentielle Hirnwäsche, mit neuen Drogen, ein Kult, eine Sekte, devotes Verhalten gegenüber einem Anführer, eine Bleibe, die sie nie würde verlassen können? War das besser oder schlechter als ihre Alternativen?
Sie schluckte und ließ sich eine Route zur nächsten Kommune berechnen. Gaias Kinder. Fünfeinhalb Meilen, zu Fuß, dem Sonnenaufgang entgegen.
Es drohte schon wieder Abend zu werden. Ihre Füße waren ein knochiger Brei Schmerzen. Der Beutel über ihrer Schulter schien sich langsam aber sicher in ihre Schulter zu schneiden.
Gaias Kinder stellten sich als Niete heraus. Man wollte sie schon beinahe mit einem Plastikblumenkranz um den Hals begrüßen, doch sie verlangte nur nach Andrea D'Arby. Man gab seinen Namen ab, wenn man sich in die Arme der Kinder begab, und man musste sich seinen neuen Namen auf den Hals tätowieren lassen, so hatte man es ihr dargestellt. Andrea hatte kein Tattoo gehabt, also war sie schnell wieder gegangen. Man hatte versucht, an ihrem Arm zu zerren, aber Michelle war bereit gewesen, zu schreien und zu beißen, und sie hatte es ihnen lautstark mitgeteilt.
Nach den viel umgänglicheren Neo-Buddhisten machten sich in ihr noch mehr zehrende Gedanken breit. Suchte sie überhaupt nach den richtigen Kommunen? Was, wenn sich alle fünf Ziele als Nieten herausstellten? Die Neo-Buddhisten gaben sich als einen sicheren Zielhafen aus, und sie wirkten deutlich sympathischer als der letzte Kult, doch auch, wenn man hier seinen Namen behalten durfte, war keine Spur von Andrea.
Die Metaphysisch-Lebensbejahenden Bürger waren Freaks in Weiß, die Michelle nur mit Kind ansprachen. Die Auskunft war nicht vonnöten, da die kleine Kommune nur neunzehn Bewohner hatte, die sich ihr alle persönlich vorstellen wollten. Sie schüttelte freundlich einige Hände, machte dann aber schnell kehrt.
Nun erschien am Horizont das Gebäude, das sie offenbar korrekt als das Sub-Interkonnektive Kollektiv identifizierte. Ihr Chip im Handgelenk teilte ihr die Ankunft durch Vibrationen mit. Es war ein Hochhaus, ein ganzer Häuserblock, und im Gegensatz zu den restlichen Kommunen alles andere als feierlich oder erhaben inszeniert. Der Eingang lag hinter zwei schweren Eisentüren, wie sie aus der Entfernung erkannte. Zwei Gestalten standen davor, rauchten Zigaretten und plauschten dabei. Über dem Eingang war ein großes Schild mit einem Symbol angebracht:
Es dauerte nicht lange, bis die Aufmerksamkeit der beiden Wachen von ihrem Gespräch auf die Frau im viel zu großen Mantel überging. Sie kam langsamen Schrittes näher, und sie hörte noch, wie das unterhaltsame Gespräch der beiden verstummte.
Ihre Füße waren fleischgewordener Schmerz, und sie humpelte beim Gehen. Der letzte Stopp bei einem Rationenterminal war schon etwas her, und die Flasche Wasser, die sie in eine ihrer Manteltaschen gestopft hatte, war schon längst leer. Wenn dies nicht die letzte Station war, dann würde sie direkt vor den Toren dieses grauen Giganten von einem Haus zusammenbrechen und schlafen, völlig egal was diese Wachen dazu sagten.
Ihre Sicht war etwas verschwommen, doch nun erkannte sie Details bei den beiden Wachen. Ein Mann, eine Frau, zumindest vermutete Michelle das, beide trugen Jeans und T-Shirt. Die Frau, sportlich, muskulös, struppige, braune Kurzhaarfrisur, trug einen Tonfa an ihrer Seite. Die geholsterte Schusswaffe am Gürtel des bulligen Kerls neben ihr entging Michelle auch nicht.
Diese Sekte war bewaffnet. Das war neu, und es machte ihr nicht gerade Mut. Sie wusste, was passieren konnte, wenn sich Fanatiker bewaffneten, aber andererseits gab es schlimmere Probleme in dieser Stadt.
Als sie vielleicht nur noch zwanzig Meter von dem Gebäude trennten, begannen die beiden Wachen sich einige Schritte vom Gebäude zu entfernen und sich aufzustellen.
»N'Abend«, sagte Michelle, die möglichst versuchte, zu vertuschen, wie nahe sie der Erschöpfung und einem Nervenzusammenbruch war. Eigentlich hätte ihr Herz wild pochen müssen, doch sie war zu müde, um sich zu fürchten.
»Was können wir für dich tun?«, fragte die Frau. Ihr Gesicht war kantig und hager. Ihr Tonfall reflektierte nicht die höfliche Formulierung.
Michelle kam nun näher und machte einige Meter vor den beiden halt. Sie stemmte sich kurz in die Oberschenkel und atmete durch. »Ich will nicht stören, aber ich glaube, meine Schwester wohnt hier. Ich muss sie dringend sprechen.«
Die beiden tauschten einen Blick aus. »Schöner Mantel«, sagte die Frau. »Wie siehst du ohne aus?«
Michelle verzog ihr Gesicht. Sie streifte sich den Beutel von ihren Schultern, warf ihn auf den Boden und warf den Mantel hinterher, nachdem sie ihn ausgezogen hatte. »Was auch immer ihr denkt: Ich will nur meine Schwester sprechen.«
Noch ein Blick wanderte zwischen den beiden umher. »Wer ist deine Schwester?«, fragte die Frau. Ihre kalten Augen reichten aus, um doch etwas Furcht in Michelle aufkommen zu lassen.
»Andrea. Andrea D'Arby. Ich bin Michelle. Selber Nachname.«
Blicke wurden ausgetauscht. »Blume, glaube ich«, sagte der bullige Kerl. Seine Glatze spiegelte sich im Licht der untergehenden Sonne.
Die Frau holte ein Funkgerät hervor, aber nicht, ohne ihre Augen von der beinahe bibbernden Michelle zu nehmen. »Eric«, sagte sie. »Haben wir eine Andrea …?« Sie streckte ihre Hand aus und wedelte sie.
»Andrea D'Arby.«
»D'Arby. Andrea D'Arby.«
Nach einer kurzen Pause kam ein knarzendes Geräusch aus dem Funkgerät. »Sekunde, Sekunde«, eine krächzende Männerstimme, gefolgt von dem Klackern eines Keyboards, hier ein geflüsterter Seufzer, da ein Klick. »Das ist Blume.«
»Danke.« Die Frau pausierte kurz, musterte Michelle weiterhin, wie sie dort in einem Tanktop und löchriger, viel zu großer Jeans stand, vollgeschwitzt, miefend, ihr gesamter Besitz vor ihren Füßen. »Hör mir zu. So wird das jetzt ablaufen: Deine Sachen, die bleiben erstmal hier. Bruno hier wird dich abtasten. Nach dem Scan lotse ich dich direkt zu Andrea. Meine Augen kleben an deinem Hinterkopf, und wenn ich irgendetwas, auch nur irgendetwas, Faules rieche, dann verlässt dein Arsch dieses Gebäude nur noch als Düngermittel. Haben wir uns verstanden?«
Michelle nickte.
»Dann komm.«
Die schweren Tore schlossen sich elektronisch hinter ihnen, und dort war ein reges Treiben in den Korridoren des Hauses. Die Wände waren kahl, hier und da waren krude Zeichnungen zu finden, aber kein Graffiti, keine Initialen, keine Geschlechtsteile. Die Leute gingen durch die Korridore, lächelten, grüßten einander, auch die Wache, die einige Schritte hinter Michelle ging und die Richtung ansagte. Hier waren waschechte Apartments, an manchen hingen selbstgemachte Tonschilder mit Namen, an anderen waren Bilder und Symbole. Sie hörte sogar Gesang durch die Gänge hallen, eine schaurige Melodie, und das aus mehreren Hälsen.
Eine Tür stand offen. Dort lag nur jemand in einem Bett. »Augen nach vorn«, zischte es von hinten. »Da vorn rechts.«
Nach dem Rechtsabbieger sahen sie eine neue Geräuschquelle: Unverständliches, manisches Gebrabbel. Ein dürrer Kerl mit geschorenen Haaren saß am Boden neben einem leeren Rollstuhl an die Wand gelehnt, mit den Händen an den Wänden, und gab Tiraden von sich. Sie zögerte etwas und blieb stehen. »Das ist nur Mike«, sagte die Wache. »Der tut dir nichts.«
Sie gingen an ihm vorbei, und ja, er tat ihnen nichts, beachtete sie nicht einmal.
Einen Treppenaufgang und eine Kurve später hielten sie vor einer Tür an. Eine Tulpe war mit Ölfarben an die Tür gemalt, als wäre das Holz eine Leinwand. Eine Biene landete zufrieden darauf, die Sonne schien. Die Wache drängte sich unsanft an Michelle vorbei und klopfte an die Tür. Einige Sekunden vergingen, dann kamen gedämpfte Geräusche, und kurze Zeit später öffnete niemand anderes als Andrea die Tür. Sie sah aus wie eh und je, trug einen schlichten Rock und ein eng anliegendes, dunkles Top, ihre blonden Haare in einem Dutt, ihr Gesicht zutiefst erschrocken beim Anblick ihrer Schwester. »Michelle? Was …«
»Hey«, antwortete sie.
Andrea starrte mit offenem Mund zur Wache. »Falls irgendwas ist, sind Bruno und ich unten«, sagte diese. Sie packte Michelle unsanft an den Haaren. »Und wenn du Ärger machst, sehen wir uns wieder«, und schon stieß sie sie ein wenig nach vorn. »Ihr meldet das heute noch Brian«, befahl sie, während sie den Gang herunterging und hinter der Kurve verschwand.
Die beiden Schwestern schauten sich an. Hinter Andreas Kopf erschien ein muskulöser Mann mit tiefen Augenringen und einem Vollbart, der verwirrt dreinschaute.
»Andrea, wer ist das?«, fragte er.
»Meine Schwester«, sagte sie.
Andrea hatte ihr einen Teller mit kalten Nudeln und Tomatensauce vorgesetzt. Michelle verspürte den Drang, das Essen in hohem Tempo zu verschlingen, doch dafür war sie zu schwach. Es war keine hohe Küche, aber hundertmal besser, als die Rationen, die sie seit Monaten fast jeden Tag herunterwürgte.
Ihre Schwester und ihr Mann unterhielten sich währenddessen in einem anderen Raum. Andrea war verheiratet, wie sie festgestellt hatte, und ihr Mann, Henry, nahm die Situation überraschend gelassen. Michelle war platt vor Erschöpfung, ihr Schädel dröhnte, und sie fühlte sich, als ob das Essen allein sie von der Bewusstlosigkeit abhielt. Sie sprachen über sie, und kurz darauf, oder länger - Zeit war relativer denn je - verschwand Henry durch die Tür.
Andrea nahm behutsam gegenüber ihrer Schwester Platz. »Hey«, sagte sie.
»Hey.« Sie schob sich noch einen Löffel Nudeln in den Mund und kaute mühsam.
»Du siehst nicht gerade gesund aus«, sagte Andrea. »Geht's dir gut?«
Sie kaute und schluckte herunter. »Entzug«, sagte sie. Sie wusste nicht, ob sie Drogen, Schlaf oder beides sagen sollte, falls ihre Schwester mehr Details forderte.
»Wo lebst du denn gerade? Wohnst du immer noch mit diesem Typen zusammen? Diesem … wie hieß er? Raven?«
Raven war vor drei Monaten an einer Überdosis gestorben. Der Vermieter hatte gekündigt, und sie hatte in einem von Junkies besetzten Gebäude ein Zimmer ohne Türschloss mit einer Matratze gefunden. »Bin offiziell obdachlos«, murmelte sie.
Ihre Schwester legte ihren Kopf schief und setzte ihre besorgte Mine auf. »Ich wusste, dass es nicht gerade gut um dich steht, aber … verdammt nochmal, Michelle. Warum bist du hier? Brauchst du Geld?«
Geld hatten die beiden offenbar nicht viel. Die Wohnung war schlicht eingerichtet, nur das Nötigste, wenn auch hier und da manches bunt bemalt war. Dennoch waren diese zwei Zimmer für sie purer Luxus. »Die Imperialen haben mich geschnappt. Ich brauche einen Job.« Sie schob noch einige Nudeln hinterher.
»Ich verstehe«, sagte sie. Das war es immer gewesen. Andrea verstand stets, auch, wenn sie nicht verstand, und wenn auch nur, um die Stille zu füllen. In dieser Hinsicht hatte sie sich nicht verändert. »Aber du willst etwas ändern! Du willst offenbar von den Drogen weg, willst arbeiten! Michelle, das ist toll!«
Sie zuckte mit den Schultern. »Du hast 'nen Nachweis, oder?«
Andrea schaute kurz an die Decke. Sie seufzte. »Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber … das ist nicht meine Entscheidung, weißt du? Henry fragt gerade unseren …« Ihr fehlte entweder ein Wort, oder sie scheute sich, es zu sagen. »Er fragt unseren Anführer. Wenn es nach mir ginge, dürftest du gern ein, zwei Nächte bleiben.«
Sie log. Ihr fehlte jede Form von Aufrichtigkeit. Michelle glaubte nicht, dass sie sie nicht mehr mochte, dass sie nicht mehr ihre kleine Schwester war, sondern dass sie sich gerade zwischen ihrem friedlichen Leben mit ihrem Mann und dem Pflegertum eines heruntergekommenen Skeletts von einer kleinen Schwester entscheiden musste. Sie war wie ein Unwetter, ein saurer Regen, der gerade auf ihr friedliches Leben prasste und es gefährdete.
Sie konnte diese Lüge verstehen, und das tat am meisten weh.
»Ich lasse dich sonst einfach erstmal in Frieden essen, alles klar? Komm zu Kräften. Du scheinst eine Menge hinter dir zu haben.« Andrea lächelte, und diesmal wirkte es ernst gemeint, und dann verschwand sie im Nebenzimmer.
Der Teller mit den Nudeln war noch zur Hälfte gefüllt. Sie hätte zwar noch essen können, aber ihr Hunger war vergangen.
Henry kehrte eine gute halbe Stunde später zurück. Er hatte ihren Mantel und den Beutel dabei und legte diese behutsam neben der Eingangstür ab. Michelle saß noch immer am mit Häkeldeckchen verzierten Tisch und starrte gedankenlos auf den Teller vor sich. Er kam zu ihr und hob lächelnd seinen Arm zum Gruß. »Andrea?«
Sie kam rasch dazu. »Und?«
»Also … er bittet uns, Michelle über die Nacht bei uns aufzunehmen. Morgen Abend möchte er sie persönlich kennenlernen.« Er lächelte sie an. »Das bedeutet viel Gutes für dich. Glaube mir.«
Andrea umarmte ihn. »Danke dir.« Langsam kam sie auf ihre Schwester zu. »Ich … morgen wird sich viel entscheiden, weißt du?«
»Ich kann es mir denken.«
Sie packte sanft ihre Hand. Michelle wich erst zurück, doch ließ es dann zu. »Du magst einige Vorurteile über diesen Ort haben.«
»Die habe ich.«
Sie seufzte. »Michelle, du denkst vielleicht, das hier ist ein Kult, oder eine Sekte oder so etwas, und dass morgen-«
»Ja, das ist es doch auch!« Sie wurde lauter, deutlicher. Sie schrie nicht, aber die Kraft dafür hätte ihr auch gefehlt. »Sub... sub was? Sub-Interkommune?«
»Sub-Interkonnektivität«, korrigierte Henry, der das Schauspiel aus der Ecke mit vor der Brust verschränkten Armen beobachtete. Dieser Kerl war nicht nur muskulös, sondern gebaut wie ein Türsteher. Michelle würde nicht gern im Wege seiner Fäuste stehen.
»Und ihr habt einen Anführer? Der will mich inspizieren, oder was? Seid ehrlich, nicht, weil ich euch verurteile, sondern damit ich mich drauf vorbereiten kann: Muss ich mich nackt ausziehen? Muss ich ihn vögeln?«
Die Ohrfeige kam, und ihre Wange glühte vor plötzlichem Schmerz auf. Michelles Hände wanderten dorthin. »Du hast keine Ahnung, was er alles für diesen Ort getan hat, was er geopfert hat«, sagte ihre Schwester mit Vorboten von Tränen in den Augen. »Du kommst hierher, platzt nach ewiger Funkstille einfach in mein Leben, und wir bieten dir auf dem Silbertablett eine Mahlzeit an, einen Platz zum Schlafen, eine Chance. Oh, du weißt nicht einmal was für eine Chance du gerade bekommen hast. Und so dankst du ihm, dankst du uns?«
Ihre Wange pochte, und alles klang gerade dumpf in ihren Ohren. Sie konnte nur mit offenem Mund dort sitzen und akzeptieren, was geschah.
»Ich werde mich jetzt schlafen legen. Das Sofa gehört dir. Eine Decke haben wir nicht, aber irgendwas sagt mir, dass dich das nicht stören wird.« Andrea stand auf und verschwand in ihrem Zimmer. Die Tür hinter ihr knallte zu.
Henry stand noch immer da. Er blieb eine Sekunde still, sah ihr dabei zu wie sie geistesabwesend ihre Wange rieb. »Das hier wird verfliegen, weißt du? Es wird alles besser. Ich … ich kümmere mich um deine Schwester. Bis morgen.« Und Henry verschwand auch hinter der Tür.
Michelle zog ihre zerschlissenen Schuhe aus. Sie schnappte sich ihr Hab und Gut, schaltete das Licht im Zimmer aus und legte sich auf das Sofa. Das Nachtlicht befestigte sie hastig an einem Tisch und schaltete es an. Das schwache Licht war eine wahre Wohltat.
Hinter der Tür unterhielten sich die beiden im Flüsterton, doch Andreas Worte waren zischend und wütend. Henry beruhigte sie. Es dauerte nicht lange, bis beide still wurden. Und dann geschah es.
Die beiden sangen. Es war eine kurze Melodie, eingängig und gespenstisch. Die Töne wurden pyramidenhaft erst höher und höher, dann sanken sie ab. Die Melodie wiederholte sich, und sie wurde lauter und lauter, höher und höher, und der unmenschliche Charakter des Gesangs sorgte sofort für eine Gänsehaut. Michelle begann zu zittern, den Verstand zu verlieren.
Sie erkannte Fetzen dieser Melodie. Als sie mit der Wache durch die Korridore gegangen war wurde sie bereits gesungen. Dieser Kult, was auch immer er war, hatte gespenstische Gesangsrituale, und sie prägte sich das Lied so gut sie konnte ein.
Sie konnte sich gut vorstellen, es bald selbst singen zu müssen.
3. KAPITEL
Es war ihr unmöglich, die Uhrzeit einzuschätzen. Sie lag schon seit gefühlten Jahrtausenden auf dieser Couch und kämpfte mit dem Schlaf. Ihr Körper war schon mit jeder Ritze, mit jeder Sprungfeder vertraut, und jedes Drehen, jedes Hochkämpfen aus dem Sekundenschlaf, war aufs Neue ein grausamer Akt.
Sie war so müde, so unsagbar müde. Normalerweise war es schon schlimm, doch das hier sprengte alle Grenzen. Jedes Glied ihres Körpers hatte sich mit dem Schmerz angefreundet, und jede Zelle schrie nach Erholung, nach der gütigen Umarmung des Schlafes.
Das Licht war schwach, und hier war keine Werbetafel, kein Fenster, keine frische Brise Luft, die sie ablenken und in der Realität verankern konnte. Ihre kleine Leselampe wurde schwächer und schwächer, wie sie dort über ihr hing, auf ihr Gesicht schien, ihr blaues Licht ausstrahlte. Und während sie dort lag, in diesem blauen Lichtkegel, wurde ihr bewusst, wie sich ihre Schritte verlangsamten. Dort, auf der anderen Straßenseite, war jemand, mit hochgezogenem Mantel. Der Lichtkegel der Straßenlaterne erleuchtete ihn, und er wirkte, als hätte er etwas dabei. Kaum war er hinter der Häuserecke verschwunden, trat sie aus ihrem Versteck hinter der Mülltonne hervor, hinaus in den kühlen Sprühregen. Sie eilte ihm hinterher, hatte das Messer gezückt, lugte um die Ecke, und da war er, langsam, volltrunken wankend. Ihr Mund war trocken, ihr Kopf tat noch immer weh, und wie sie sich wieder danach sehnte, wie sie danach lechzte, es zu spüren, brachte sie nahezu um den Verstand. Sie kam hervor, möglichst leisen Schrittes, pirschte ihm hinterher, nutzte die Dunkelheit, und sie kam näher, näher, und schon kurz bevor sie da war, nahm sie das Me-
Sie wurde wieder wach, und diesmal schrie sie. Sie kreischte, in kurzen, heftigen Atemzügen, und das Licht war beinahe erloschen. Ihre Brust hob sich und sank wieder, und der Rhythmus verlangsamte sich augenblicklich.
Der Schlaf kam immer näher, von Nacht zu Nacht, nutzte jede Schwäche aus. Und das konnte sie nicht zulassen.
Sie lauschte der Dunkelheit. Sie war laut gewesen, sehr laut, doch im Nebenzimmer regte sich nichts. Hatte sie sich den Schrei nur eingebildet, oder war ihre Schwester so wütend, dass sie selbst so etwas ignorierte?
Das war egal. Michelle erhob sich, schlüpfte in ihre Schuhe und ging zur Tür. Vorsichtig öffnete sie sie, ohne ein Quietschen oder Knarzen, und sie ging hinaus in die Wohnquartiere des Kollektivs.
Es war unmöglich zu sagen, wie spät es war, doch das hier wirkte nicht normal. Es war ein reges und rücksichtsloses Treiben im Kollektiv. Sie hörte Unterhaltungen, sah am Ende des Ganges hier und da jemanden entlanglaufen. Behandelte man so seine Mitmenschen, die sich etwas Ruhe gönnen wollten?
Ein Mief hing in der Luft, ein verräterischer Duft, ein Schlafzimmerduft. Es roch noch-so-vage nach altem Schweiß und nach Sterilium, ein erfolgloser Versuch, all das zu überdecken. Hier gab es kein Tageslicht, nur blasse Leuchtröhren. Fenster am Ende irgendeines Ganges waren nirgendwo zu sehen. Ab und zu fehlte Putz an den Wänden, was, gepaart mit den kleinen (aber harmlosen) Kritzeleien und Verschönerungsversuchen eher einem Flickenteppich anmutete. Die anderen Sammlungen von Fanatikern waren immerhin auf optischen Zusammenhalt hinaus, auf Reinheit durch Weiß und helle Töne, auf Einigkeit durch Uniformen und gemeinsame Merkmale, aber das hier? Eine Kommune, in der man Uniformität feierte, war das hier keinesfalls.
Andererseits konnte sie sich beim Anblick vor der Tür nicht beschweren. Sie war anderes gewöhnt.
Eine weitere Gestalt, diesmal mit Koffer und Blaumann, ging am Ende eines Ganges vorbei. Sie hatte es nicht eilig, also folgte sie. Ihre Füße waren noch immer zwei Gewichte voller dumpfer Schmerzen, doch Neugier überwog, wie immer.
Noch bevor sie um die Ecke schaute, hörte sie bereits das Klackern von Werkzeug. Sie ging herum, und sie sah den Mann, groß, Bierbauch, haarig an jeder entblößten Körperstelle, vor einer geöffneten Konsole an der Wand sitzen. Der Werkzeugkoffer lag geöffnet neben ihm.
Sie kam langsam etwas näher.
Er schien sie zu bemerken und drehte seinen Kopf zu ihr. Der Handwerker trug eine Nickelbrille, die seine Augen schon fast komisch vergrößerten. Diese setzte er kurz ab. »Heyo«, sagte er vergnügt. »Du bist definitiv neu.«
»Woher weißt du das?«
Er schnaubte kurz. »Wenn du das fragen musst, dann stimmt es auf jeden Fall. Du bist Blumes Schwester, hm?«
Sie nickte verdutzt.
»Oh, Tratsch und Klatsch reisen überall schnell, aber hier tun sie es besonders rasant.« Er stellte sich ächzend auf, nahm seine zerfledderten Arbeitshandschuhe ab und streckte ihr die Hand entgegen. Sie wusste nicht, wie weit ihr letzter Handschlag zurücklag, also erwiderte sie ihn nicht zögerlich, aber vorsichtig. Er drückte erst fest zu, korrigierte sich dann aber schnell.
»Mohammed«, sagte er. »Mo.«
»Michelle.«
»Brian will dich morgen kennenlernen, oder?«
Sie nickte. »Wird es … schlimm?«
Er lachte, laut und gellend, und wischte sich die Hände vor dem Bauch ab. »Ich glaub' du hast ein falsches Bild von diesem Ort hier. Das wird morgen eher einem Kaffeekränzchen ähneln, so wie ich Brian kenne. Mit mir hatte er sich zwei Minuten unterhalten, und dann hatte ich schon einen Platz zum Schlafen und einen Arbeitsnachweis. Glaub mir.«
»Dann erklär's mir. Bitte. Was macht ihr hier?«
»Es ist quasi, wie du's dir vorstellst. Wir leben zusammen, jeder hat einen Job, wie fließige Bienchen. Ich repariere Sachen, meist, wenn alle anderen schlafen. Jeder kennt jeden, grüßt sich. Es ist friedlich. Gute, ehrliche Arbeit.«
»Ja aber … als Religion? Sub-Interkon... nekt?«
Er grinste. Ein, zwei Zähne fehlten. »Brian wird entscheiden, was genau man dir wann erzählt. Bis dahin muss ich seine Entscheidungen respektieren. Und, glaub mir, das werden die anderen hier auch tun.«
»Alles klar, alles klar.« Mo war ein grundoffener, freundlicher Geselle, daran bestand kein Zweifel. Er zwinkerte ihr kurz entgegen, kniete sich wieder hin und schnappte sich irgendein Werkzeug, das Michelle nicht kannte.
»Du wunderst dich bestimmt, warum alle deine Schwester Blume nennen«, sagte er.
Sie nickte. Er achtete nicht auf sie, aber die Stille verriet wohl alles.
»Viele haben hier Spitznamen. Nicht alle. Bei manchen passt es besser. Du könntest auch einen bekommen, vertrau mir. Was deine Schwester angeht: Wir nennen sie garantiert nicht wegen ihrer exotischen Schönheit oder wegen ihres zarten Gemüts so. Ich vermute, du wirst das schnell genug herausfinden.«
»Hast du einen Spitznamen? Ich meine, außer Mo?«
»Wasserfall. Manche nennen mich Wasserfall.«
Jetzt fehlten ihr wirklich die Worte.
»Ja, genau. Mo ist besser. Finde ich auch.«
»Warum Wasserfall?«
»Weil ich einer bin!« Er schaute nun wieder zu ihr, mit dieser Brille mit den Vergrößerungsgläsern, und zwinkerte ihr zu. Er schnalzte mit der Zunge, werkelte an etwas in der Wand, zischte und fluchte einmal kurz. »Sag mir: Warum bist du wach? Es ist Nacht. Da schlafen die meisten. Kann ja sein, dass du das nicht wusstest. Wer weiß das schon, bei den Zuständen da draußen?«
»Ich … um ehrlich zu sein hatte ich in den letzten Tagen … naja, Wochen Probleme zu schlafen.«
Mo ließ sein Werkzeug fallen. Er nahm die Brille ab. Er schaffte es kaum von den Knien hoch, ehe er laut wie ein Berserker zu lachen begann und sich auf dem Boden krümmte.
Michelle zuckte ein wenig zusammen. Der Lärm, der nun von den Wänden hallte, tat sogar ein wenig weh. Ihr Schädel pochte noch immer.
Er hatte sich einige Sekunden später beruhigt. »Oh, glaub mir, du wirst es hier lieben.« Er wischte sich noch eine Träne weg, gefolgt von einigen weiteren zuckenden Lachern. Dann wendete er sich wieder seiner Aufgabe zu.
»Hast du denn keine Angst, jemanden zu wecken?«, fragte sie, während sie sich noch immer den Kopf rieb.
»Die schlafen alle wie Steine. Die würden nicht einmal aufwachen, wenn ein Wasserfall auf sie prescht! Oh ja, oh ja!« Er kicherte noch immer ein wenig.
»Also … ich sollte wieder besser zurückgehen. Du hast zu tun. Vielleicht wacht meine Schwester bald auf.«
»Wann sind sie denn schlafen gegangen?«, fragte er, noch immer mit den Augen auf die Arbeit.
»Ich weiß es nicht. Ich war wach. Keine Ahnung, wie spät es ist. Die letzten Tage waren … etwas durcheinander.«
»Das sieht man dir an, Kiddo. Warte mal kurz.« Er stand wieder auf, stampfte auf sie zu. Er griff an sein Handgelenk und entblößte eine Armbanduhr, die er ihr nun entgegenhielt. Es war ein uraltes Ding aus Plastik mit Digitalanzeige. »Hab ich mal von 'nem Scrapper bekommen. Hat den Krieg überlebt, und bis jetzt auch weitergemacht. Japanisches Teil, unplattbar. Siehst du die Balken hier, über dem Display? Solar. Einmal am Tag für 'ne Stunde auf die Fensterbank legen, dann läuft die wahrscheinlich noch, wenn wir beide nicht mehr sind! Oh ja!«
»Für mich?«
»Du siehst aus, als könntest du sie dringender gebrauchen, und ich hab' noch 'ne andere. Nimm schon, ich will das hier nicht zu 'ner peinlichen Nummer machen!«
Michelle nahm ihm die Uhr ab. Sie war federleicht. Das Armband war durch einen Lederriemen ersetzt worden, und das Plastikgehäuse in der Mitte war an einigen Stellen stark zerkratzt und zerschrammt. Sie funktionierte aber wie gehabt. Das Display zeigte 4:07 AM an.
»Ganz schön früh, oder?«, kommentierte Mo. »Kleiner Tipp, unter uns: Kann noch dauern, bis die beiden aufwachen, glaub mir.«
Nun kamen ihr echte Tränen.
»Du hast lange kein Geschenk mehr gekriegt, hm?«, sagte Mo lächelnd. »Wir sind hier eine große Familie. Das wird nicht dein letztes Geschenk sein.« Er klopfte ihr sanft auf den Rücken. »Ich lass dich mal in Frieden. Bevor deine Schwester aufwacht, kannst du ja noch ein bisschen damit rumspielen. Fünfmal am Tag piept die Uhr, als Erinnerung, für meine Gebete. Das Ding kann dir auch Mekka anzeigen lassen. Die Satelliten dafür sind noch da oben und funktionieren, oh ja! Das musst du umprogrammieren. Einfach mit den Knöpfen an der Seite spielen und den Befehlen auf dem Display folgen.«
Michelle schluchzte nun ein wenig. »Danke.«
»Durchhalten, Michelle! Wir sitzen alle im selben Boot!«
Sie ließ sich auf das Sofa fallen. Es war sanft und angenehm. Ihre Leselampe schaltete sie wieder ein, aber mittlerweile war bestenfalls ein kleiner Trostschein im Unterschied zur Dunkelheit erkennbar.
Auf dem Rücken liegend nahm sie sich die Uhr hervor. Sie hatte sie schon auf dem Weg hierher voller Bewunderung beäugt, aber jetzt, in der Dunkelheit, testete sie sie aus. Sie wusste noch, wo der LIGHT-Knopf war, groß unter dem Display, und siehe da: Hellblaues Licht strömte aus der Armbanduhr.
Vielleicht würde Mo Recht behalten, und sie würde es hier wirklich lieben. Vielleicht war dieser Kult auch nur ein Vorwand für Hirnwäsche. Von außen wirken alle Sekten wie große Familien. Der Gesang, das Geschwafel von Zusammenhalt. Wer wusste das schon genau?
Mo hatte von den programmierten Alarmzeiten gesprochen. Die würde sie nun ändern. Was hatte sie denn sonst zu tun? Einige Zeit später hatte sie alles gefunden, das Display war immerhin verständlich. Fünf Alarme, wie prophezeit, morgens, mittags, nachmittags, abends, nachts. Sogar der Pfeil nach Mekka wurde angegeben. Michelle stellte alle Alarme aus und entfernte den Pfeil. Dann folgten einige Spinnereien darüber, ob sie sich eigene Alarme stellen sollte, um sich an Pflichten zu erinnern, die sie noch gar nicht hatte.
Das hier war ihr kostbarster Besitz, und er wurde ihr von einem Fremden geschenkt, der sie für wertvoll genug hielt, selbst nach einem kurzen Gespräch. Vielleicht war das Wärme, die sich nun in ihrem Herz ausbreitete.
Vielleicht würde sie sich einen Alarm stellen, um sich an diese Begegnung um vier Uhr nachts zu erinnern.
Plötzlich fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Eben war sie noch in ihrem schläfrigen Dauerzustand gewesen, doch eine Erkenntnis durchflutete ihre Venen nahezu elektrisch.
Mo, Mohammed, er betete fünfmal täglich nach Mekka. Er war gläubiger Anhänger des Islam. Andrea, Henry, die Wachen, nein, das Gebäude selbst wirkte nicht gerade so, als würden sie Teil einer muslimischen Gemeinschaft sein.
Dies war eine eingetragene religiöse Kommune. Diese Menschen hier waren Sub-Interkonnektivisten, wenn sie sich richtig an das Wort erinnerte.
Warum betete man dann hier zu Allah?
4. KAPITEL
Ihr Kopf hatte sich schon längst in den Leerlauf gesetzt. Sie badete im blauen Licht der Uhr, das auch langsam schwächer wurde, aber das war ihr jetzt egal. Alle Funktionen hatte sie erforscht, die Garantiebedingungen auf dem Display durchgelesen, doch jetzt war endlich ein neuer Tag angebrochen, heute um 10:29 AM, wie ihre Uhr verriet.
Man schlief hier lange, sehr sehr lange, so viel wusste sie.
Die Tür öffnete sich und das Licht im Zimmer wurde eingeschaltet. Michelle schüttelte sich etwas wacher und richtete sich auf. Dort stand Henry, sportlich, in einem alten, löchrigen Shirt und in einer Jogginghose. »Morgen, Michelle«, sagte er. »Hunger?«
Essen war zu dieser Zeit ein Roulette-Spiel, aber sie konnte es nicht verneinen. Sie nickte.
»Deine Schwester dürfte bald wach werden. Dann gehen wir in den Speisesaal. Geht auf uns.« Er zwinkerte ihr zu.
»Weck' sie doch. Ihr habt lange genug geschlafen.«
Henry kratzte sich seufzend den Hinterkopf. »Gib ihr eine Sekunde. Der Abend war für sie auch nicht gerade einfach. Ansonsten kann ich dir ein Handtuch geben und die Duschen zeigen, wenn du nicht warten willst.«
Bei dem Wort Dusche wäre ihr beinahe das Herz aus der Brust gesprungen.
Es waren Gemeinschaftsduschen, und sie war zwar nicht allein, dort klebten immerhin die Blicke von zwei, drei anderen Fremden auf ihr, aber das war egal. Henry hatte sie vor dem Eingang der Damenduschen abgeliefert, und als der Wasserstrahl nun auf sie fiel, so warm und gütig, wäre sie vor Glückseligkeit beinahe explodiert. Einen kurzen Blick in den Spiegel hatte sie riskiert, doch sie hatte sich erschrocken. Früher war sie fast übergewichtig gewesen, gut genährt, wie Mum gesagt hatte, ehe ihr Hirn löchrig geworden war. Jetzt war sie Knochen mit einem Fetzen Haut darüber.
Sie erkannte anhand der Brühe, die sich unter ihr bildete und im Abfluss verschwand, wie dreckig sie gewesen sein musste. Dort waren waschechte Duschgelspender an den Wänden, und sie bediente sich eifrig.
Als sie zwanzig Minuten später in der Wohnung der beiden erschien, strahlte sie noch immer. Sie wirkte wach, sie wirkte gekräftigt, sie fühlte sich, als könnte sie einen Riesen im Boxkampf bezwingen.
Ihre Schwester und Henry saßen am Tisch bei einer Tasse Tee. Andrea sah nicht gerade glücklich aus, aber sie hatte den Anstand, ihre Schwester anzusehen, wie sie dort stand, in ein Handtuch gehüllt, ihre langen Haare mit dem schon beinahe verwaschenen Blauton, unter dem das Blond schon stellenweise komplett zurückgekehrt war. »Hunger?«, fragte Michelle.
Der Hunger war groß. Die beiden hatten offenbar schon sehnsüchtig auf sie gewartet. Nachdem sie sich wahllos Teile ihrer Wechselklamotten übergeworfen hatte, machten sie sich gesammelt auf den Weg in den Speisesaal. In den Korridoren begegneten sie anderen, die dasselbe Ziel ansteuerten. Sie gingen die Treppen hoch, bis in den fünften Stock, und jeder grüßte eifrig jeden, tauschte ehrliche Blicke aus, schüttelte ausgiebig Hände. Michelle musste sich sehr oft anhören, dass sie neu war, die Schwester der weltberühmten Blume.
Kurz vor der Ankunft im fünften Stock hörten sie schon das Raunen des Alltags. Michelle hörte Gesprächsfetzen, die keinen Sinn ergaben, mit Namen, die keine sein sollten, Namen, die Begriffe waren. Blume, Wasserfall, Echo, Hirn, Sub, Nase. Ein Brei von Nonsens mischte sich aus den Unterhaltungen zusammen, und sie gab es bald auf, zu lauschen.
Der Speisesaal, in den sie eintraten, war kleiner als erwartet, aber noch groß genug, um imposant zu sein. Er erinnerte eher an eine Kantine. Die Wände waren mit bunten Mosaiksteinchen überzogen, die keinerlei Muster ergaben. Alles wirkte wie aus einem fernen Jahrhundert, nicht nur modisch veraltet, sondern unmodisch, unwillkommen, in möglichst wenig Arbeit erledigt und für akzeptabel empfunden.
Die Essensversorgung funktionierte: Es gab Tabletts, Teller, Schüsseln und Besteck, jeder, der etwas essen wollte, reihte sich ein. Andrea und Henry taten es, also folgte sie ihnen. Der herzhaft-salzige Geruch von Rührei, von Speck, von Fleisch mit Bratensauce hing in der Luft. Am Ende der zwei Dutzend Mann langen Schlange war eine kleine Glasfront, an der bedient wurde. Jeder bekam üppige Mengen an Essen. Es war nicht nur üppig, sondern beinahe unverschämt. Jeder bekam Massen, so viel, dass die Teller überquollen.
Andrea begrüßte die, die das Essen ausgaben, sehr herzlich und bekam ebenso viel Liebe zurück. Die Menge an Essen, die sie und Henry nun bekamen, war ebenso stark wie die der vor ihnen. Michelles Hände zitterten schon bei dem Gedanken, so viel Essen tragen zu müssen. Sie goss sich eine Tasse Kaffee ein und versuchte möglichst nichts zu verschütten.
Sie war dran. »Nicht so viel, bitte«, rief sie über das Raunen hinweg. Man sah sie jedoch nur verwirrt an. »Ich bin neu«, sagte sie. »Blumes Schwester.«
»Aaaaah!« Ein Laut der Erkenntnis kam von der dicken Kantinenfrau. Sie zeigte auf Blume, die ein Zwinkern und einen Daumen nach oben verteilte. Ihr Kommentar von eben wurde ignoriert, und Michelles Tablett unter Rührei und Speck begraben. Nur mit Mühe schleppte sie das Tablett zum Tisch, an dem die beiden schon Platz genommen hatten.
Die beiden hatten nicht einmal auf sie gewartet. Michelle hatte gesehen, dass jeder von ihnen, nicht nur die beiden, sondern auch andere im Saal, ihre Mahlzeit regelrecht verschlangen, und das schon auf dem Weg zum Sitzplatz. Henry brauchte keine zehn Sekunden um drei der kleinen Bratwürste zu verschlingen, die auf seinem Teller war. Andrea verputzte ihr Rührei ohne zu atmen.
Sie zuckte mit den Schultern und nahm einen ersten Bissen. Vielleicht war das Essen großartig. Und das war es, ohne Frage. Frisch, reichhaltig, herzhaft, voller Geschmack, so, wie sie es in den letzten Monaten bei den Rationen nur sehr selten geschmeckt hatte. Sie spürte, wie sie schon nach wenigen Bissen nach dem Essen lechzte. Sie aß nicht annähernd im Tempo der anderen, aber sie ließ es sich gut gehen. Sie merkte schon jetzt, dass ihr Teller nicht leer werden würde, aber sie würde deutlich mehr verspeisen als sonst.
Henry war jetzt schon fertig, und er lehnte sich schon beinahe komatös zurück über die klapperige Stuhllehne des schlichten Metallstuhls. Er atmete schwer. Andrea tat es ihm kaum fünf Minuten später gleich. Michelle aß noch immer, und langsam kam sie an ihre Grenzen. Irgendwann legte sie ihre Gabel hin und widmete sich ihrem Kaffee, der eine trinkbare Temperatur erreicht hatte.
»Isst du das noch?«, sagten die beiden gleichzeitig, gefolgt von munteren Blicken zueinander. Es war nicht schwer zu verstehen, warum die beiden ein Paar waren.
Wortlos schob sie ihr Tablett nach vorn. Sie hörte nur, wie die beiden sich auf ihre Reste stürzten. Mittlerweile verschwendete sie keine Gedanken darauf. Dieser Ort war es, der sie interessierte, die Menschen, die hier waren, miteinander saßen und aßen, nein, fraßen. Ihre Augen tasteten den Saal ab, und jeder stürzte sich entweder gerade auf sein Essen oder lehnte sich entspannt zurück, um kurz komatös zu ruhen. Sie erkannte einige Gestalten wieder, teils vom Vorbeigehen, teils aus unangenehmen Situationen. In der Ecke saßen die beiden Türwächter, die sie gestern Abend kennenlernen durfte. Der große, Bruno, wenn sie sich recht erinnerte, diesmal nicht in Lederjacke, sondern in einem selbst für ihn viel zu großen Shirt, verputzte offenbar gerade seinen vierten Teller. Die Frau neben ihm hatte bereits gegessen, und sie beäugte Michelle, mit einem Blick, der zwar nicht töten, aber verstümmeln konnte. Nach einigen verhängnisvollen Sekunden des Augenkontakts, die definitiv beiderseitige Wahrnehmung bedeuteten, wechselte sie vor Angst in eine beliebige Blickrichtung. Dort saß wieder ein bekanntes Gesicht. Im Schneidersitz saß da eine hagere Gestalt mit den geistlosen Augen eines Tieres auf dem Stuhl, sein schlecht geknöpftes Hemd mit Flecken überdeckt, und jemand fütterte ihn trotz gelegentlicher Versuche der Gegenwehr mit der Geduld eines Heiligen. Gestern hatte er noch wild lachend an einer Wand gesessen. Der tut nichts, das hatte die Wache ihr gesagt. Wie war noch sein Name gewesen?
»So«, kam es von neben ihr. Sie erwachte aus ihrer Trance. Andrea erhob sich, und Henry blieb noch kurz sitzen. »Ich fange dann mal an. Michelle, Henry kümmert sich erst einmal um dich. Wir sehen uns heute Abend bei Brian.« Sie bückte sich und küsste ihren Mann keck auf die Lippen, gefolgt von beiderseitigem Lächeln und geschlossenen Augen. Andrea ging herüber zur Essenstheke, erntete dabei einige Rückenklopfer, ging durch eine Klapptür und verschwand in der Küche.
»Sie ist Köchin hier?«, fragte Michelle.
»Aber sowas von. Sie ist die beste. Jeder isst hier gern, das erklärt ihre Beliebtheit.« Henry zwinkerte ihr zu. »Wollen wir?«
»Was wollen wir denn?«
Er zuckte mit den Schultern. »Keine Ahnung, ich muss erst in zwei Stunden anfangen. Wonach ist dir?«
Ein Schulterzucken traf es gut.
Henry kam in einer Strickjacke aus dem Schlafzimmer. Eine der Schnüre, die von seiner Kapuze hingen, war über seine Schulter geworfen. Michelles Blick war darauf fixiert. »Jeder hat hier seine Aufgabe«, sagte er, während er sich auf den Stuhl gegenüber von ihr setzte. »Deine Schwester kocht, ich arbeite in der Wäscherei. Selbstversorgung ist aber kein Job, den das Imperium mit einem Arbeitsnachweis duldet. Unten im Keller ist eine große Fabrik für Maschinenteile, und da arbeiten die meisten von uns. Wir bauen Teile nach Bestellung, für die Koloschiffwerft. Das hier ist die größte non-imperiale Fabrik dieser Art im Umkreis von vierhundert Meilen, ob du's glaubst oder nicht. Das Imperium hat zwar automatisierte Fabriken, aber oft genug brauchen sie Teile, die echtes Handwerk benötigen. Wir sind unentbehrlich, und daher lässt das Imperium das alles zu.«
»Also das hier ist eine Kommune, eine Religion und eine Fabrik?«
»Quasi. Der religiöse Aspekt ist nur die Kirsche obendrauf.«
»Und heute Abend bekomme ich wahrscheinlich einen Job, oder wie?«
»Davon gehen wir aus. Das Kollektiv wächst, und zwar ziemlich schnell, deshalb gibt es immer was zu tun.«
»Irgendeinen Haken wird das doch haben.«
Er stockte kurz, lachte in sich hinein, schaute dabei auf den Boden. »Einen Haken würde ich es nicht nennen. Ich denke, du erfährst es noch früh genug. Ich verderbe dir den Spaß jedenfalls nicht. Das ist der Grund, warum Geschenke eingepackt sind. Rätsel und Vorfreude sind alles.« Er stand auf. »Ich werde mich bald verabschieden, und du gehst am besten raus. Treib dich in der Stadt 'rum. Irgendwas sagt mir, dass du darin Erfahrung hast. Dreh durch, mach einen drauf. Du wirst die Welt bald anders sehen, und das sage ich aus Erfahrung.«
»Soll mir das jetzt Mut machen?«
»Wie gesagt: Rätsel und Vorfreude, Michelle.« Er stand auf und öffnete die Tür. »Zieh sie hinter dir zu, wenn du gehst. Kein Grund, sie abzuschließen. Hier klaut niemand. Und vergiss bei all dem Nachdenken nicht, dass du wieder zurückkommen solltest. Deine Schwester war gestern Abend etwas … unangenehm, aber sie freut sich wirklich, dass du wieder da bist.«
Er verschwand, die Tür blieb offen, und eine andächtige Ruhe legte sich über sie.
Das hier war ein Test, wenn man es denn so nennen wollte, und sie glaubte nicht, dass sie Lust hatte mitzumachen. In dieser Wohnung sitzen zu bleiben, ehe die neugierigen Maden in ihrem Kopf sie komplett zerfraßen, war aber auch keine Alternative, also ging sie hinaus in die Welt.
Ihre Füße taten noch immer weh, als sie wiederkehrte. Dort draußen war nichts passiert, mit Ausnahme der höhnischen Blicke, der vereinzelten Pfiffe, der Kontrolle durch Imperiale, die sie nicht gerade freundlich daran erinnert hatten, dass sie selbst mit einem Ausweis Abschaum wäre. Einer der beiden hatte sie Methanie genannt und vor ihr auf dem Boden gespuckt, ehe die beiden lachend verschwunden waren.
All das war nur nebensächlich gewesen. Ihre Gedanken drehten sich durch das Kollektiv. Mehr noch: Als sie das Gebäude verlassen hatte, hatte sie über dem Ausgang ein Schild gesehen, exakt auf der Rückseite des Schildes, das über dem Eingang hing. Es war jedoch ein anderes:
Dieses Bild und seine Bedeutung hatten sie stundenlang beschäftigt. Ihre Armbanduhr hatte ihr geholfen, um einzuschätzen, wann es Zeit für die Rückkehr war. Sie fühlte langsam, wie nach den vehementen Tagen des Entzugs ihre Stärke lethargisch in ihren Körper zurückkroch, und das gute Essen, die Offenheit der Menschen des Kollektivs und vor allem die Dusche waren zentral daran beteiligt gewesen. Sie kehrte zwar gestärkt zurück, jedoch ohne Antworten.
Was war das nur für ein Ort?
Sie öffnete die Wohnungstür, und die Fragen krochen noch immer durch ihre grauen Zellen, doch Andrea und Henry saßen bereits dort am Tisch.
»Komm«, sagte Andrea, stand auf und führte sie zu Brian.
Das Treppenhaus schien sie zu verspotten. Es nahm kein Ende. Das Hirn dieser Operation war an oberster Stelle des Gebäudes, und offenbar hatten die Bewohner dank des Mangels an Aufzügen eines mit herkömmlichen Religionen gemein: Sie genossen Selbstgeißelung.
Michelle spürte ihre Oberschenkel nach dem elften Stockwerk kaum noch, und sie nahm die Stufen als einen kleinen Krieg wahr. Mittlerweile musste sie nach jedem Treppenlauf eine kurze Pause einlegen und durchatmen. Andrea verdrehte dabei jedes Mal die Augen, Henry ermahnte sie jedoch zu Geduld, und so nahmen sie es alle hin.
Sie schnaubte, sie prustete, und sie nahm die magischen Worte „Wir sind da“ nur aus gewisser Distanz ihrer Sinne wahr. Doch es schien so weit: Im obersten Stockwerk des Gebäudes, welcher es auch immer sein musste - sie hatte das Zählen aufgegeben - war nur eine schlichte Holztür, an der jemand ein Tonschild mit dem Wort „BRIAN“ gehängt hatte. Henry klopfte an, und ein geistesabwesendes „Herein“ folgte bald.
Das Pärchen ging hinein, Michelle lehnte sich jedoch gegen den Türrahmen, um ihren Kreislauf zu finden. Sie konnte jedoch schnell erkennen, dass das hier kein heiliges Innerstes, kein Tempelhof, kein Altar, keine Kirche, sondern ein stinknormales Büro war: Fünfzehn Quadratmeter Mittelmäßigkeit, fusseliger Teppich, Holzimitatregale voller alphabetisch sortierter Ordner, ein Schreibtisch, auf dem ein anatomisches Modell eines Hirns stand, drei Stühle, einer davon besetzt. Brian war keine zehn Jahre älter als Michelle, hatte so tiefe Geheimratsecken, dass man kaum noch von einer Frisur sprechen konnte, und er schien seinen nicht sonderlich gut geschneiderten Anzug nur der Form halber zu tragen. Das hier war kein Sektenführer, sondern der Chef eines mittelständigen Unternehmens.
»Aaaah, Biene und Blume«, sagte er und klatschte in die Hände. Äußerlich war er alles, nur nicht überzeugend, aber seine Stimme und seine Art zu sprechen waren Honig. »Und das da muss deine Schwester sein. Wie war dein Name noch gleich?«
»Mi...« Sie rang nach Luft.
»Michelle! Genau!« Er zeigte mit einer Fingerpistole auf sie. »Kommen wir zum Punkt: Michelle D'Arby! Du suchst einen Arbeitsnachweis. Ich habe ihn, und du sollst ihn bekommen!«
Sie nickte nur.
»Setz dich, setz dich.«
Sie tat es.
»Also, folgendes: Du bist verwirrt, wie wir alle, weil du auf einem Gesteinsball in einem Affentempo durch das Nichts rast. Niemand hat dich gefragt, doch man hat dich trotzdem gewaltvoll auf diesen Planeten geworfen, hat dir einen Namen aufgedrückt und erwartet jetzt von dir, dass du selbst mit deinem Tod klarkommst. Presto.« Er sprach in einer Geschwindigkeit, die seine Worte noch surrealer wirken ließ, als sie es waren.
»Tagein, tagaus kämpfen wir, wir waten durch knietiefe Scheiße, und wir vermuten hinter jeder hüfthohen Mauer jemanden mit einem Messer von der Länge eines Unterschenkels. Dann sind da noch Genozid, atomarer Fallout, der Holocaust, Kreuzzüge, andere Planeten, Götter, ebenso göttliche Gebote, Sonderangebote, Rationen, Rationalität und der ganze Einheitsbrei. Was uns allen fehlt, und du siehst mir auch so aus, ist eine Richtung, ein kleiner Fingerzeig, wie Schwerkraft, doch nicht ewiglich nach unten, sondern pfeilschnell zu etwas, das dem ganzen Bullshit hier Sinn gibt. Oder irre ich mich? Hm? Michelle D'Arby, was hat dir bisher Sinn gegeben?«
Er stellte seine Ellenbogen nun auf den Tisch, kam näher, wartete einige Sekunden. Ihre Gedanken kamen jedoch nicht mit. Ihre Augen waren aufgerissen, ihre Brust hob sich.
»Ich kann's förmlich riechen. Was war's, hm? Betty? Gack? Sovereign? Arc? Waren es Pillen, oder hast du's über die Augen aufgenommen, und wie lange musst du schon ohne auskommen?«
Etwas Unsichtbares fiel von ihren Schultern. Ob es eine Last war, wusste sie nicht, aber sie wusste instinktiv, dass dieser Mann sie nicht verurteilte, dass dieser Mann ihr nichts Böses wollte, sondern dass er genuin gute Absichten hatte, dass er sie an etwas führen wollte, was er tatsächlich als positiv, als lebenswert bezeichnete. »Gack«, flüsterte sie, ungläubig, gläubig. Devot.
»Es kreischt noch danach, hm? Schau her …« Er stand auf, legte seine Manschettenknöpfe - natürlich ein Gehirn - auf den Tisch, und zog sein Jackett aus. Nach dem Hochkrempeln des Ärmels erkannte sie sofort die verdunkelten Adern an seiner linken Ellenbeuge. »Moist Martha«, sagte er und kleidete sich wieder an. »Jahrelang. Hat mir meinen halben Schädel weggefressen. Doch dann kam etwas, dann kam verdammt nochmal etwas, oh, dann traf es mich wie ein Homerun an der Schläfe, meine Liebe. Es hat mir die Erkenntnis nicht nur geschenkt, es hat sie mir von innen in den Schädel gebrannt, mit Feuer, mit Hass, mit Verzweiflung, mit blinder, verdammter und grenzenloser Angst. Wir fürchten, was wir nicht verstehen, und was du heute erleben wirst - da werde ich dich nicht im Dunkeln sitzen lassen, Michelle - was wir dir heute zeigen, das verstehen wir nicht. Wir nutzen nur, was es kann und es wird dir helfen. Du schläfst nicht, oder?«
Sie schüttelte den Kopf.