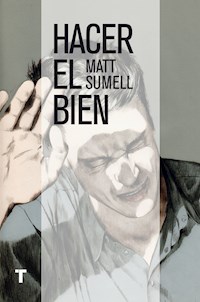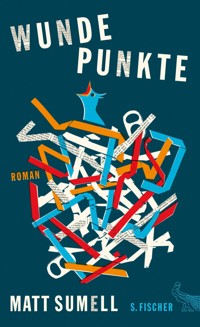
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der erste Roman des Amerikaners Matt Sumell - ein emotionaler Faustschlag. Eigentlich ist Alby ein guter Kerl. Aber dennoch schlägt er seine Schwester, besäuft sich sinnlos und fängt mit jedem Streit an, der ihm in die Quere kommt. Kein Wunder, dass seine Mutter selbst auf dem Sterbebett kein gutes Wort für ihn übrig hat. Dabei liebt Alby sehnsuchtsvoll und unbeholfen: einen verletzten Vogel, seine Großmutter, jeden Schwachen und Wehrlosen unter uns. In seinem ungestümen Wesen offenbart sich ein verletzlicher, melancholischer und liebessüchtiger Held, der uns wider Willen zum Lachen bringt. Ein erstaunliches Debüt voll derbem Humor und verblüffender Intensität.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Matt Sumell
Wunde Punkte
Roman
Über dieses Buch
Eigentlich ist Alby ein guter Kerl. Aber dennoch schlägt er seine Schwester, besäuft sich sinnlos und fängt mit jedem Streit an, der ihm in die Quere kommt. Kein Wunder, dass seine Mutter selbst auf dem Sterbebett kein gutes Wort für ihn übrig hat. Dabei liebt Alby sehnsuchtsvoll und unbeholfen: einen verletzten Vogel, seine Großmutter, jeden Schwachen und Wehrlosen unter uns. In seinem ungestümen Wesen offenbart sich ein verletzlicher, melancholischer und liebessüchtiger Held, der uns wider Willen zum Lachen bringt. Ein erstaunliches Debüt voll derbem Humor und verblüffender Intensität.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Eigentlich wollte Matt Sumell gar nicht Schriftsteller werden, sondern nur seiner Literaturdozentin imponieren. Das Imponieren hat nicht geklappt, dafür aber das Schreiben. Nun erscheint sein erster Roman. ›Wunde Punkte‹ ist der Beweis eines ungeheuren Talents. Matt Sumell hat an der University of California Creative Writing studiert. Seine Erzählungen erschienen in verschiedenen Zeitschriften und wurden mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sumell lebt zurzeit in Los Angeles.
Weitere Informationen, auch zu E-Book-Ausgaben, finden Sie bei www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die Originalausgabe erschien
unter dem Titel ›Making Nice‹
bei Henry Holt and Company, LLC, New York 2015
© 2015 by Matt Sumell
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2016 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hissmann, heilmann, hamburg / Sybille Dörfler unter Verwendung einer Idee von Gray318
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403175-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
Widmung
Jackie schlagen
Die kleinen Dinge
Wenn P, dann Q
Vergewaltigung im Tierreich
Alles ist eine große Sache
Iss die Milch
Zweimal um den Block
American Ninja 2
Austausch von Freundlichkeiten
Supermärkte
Ihre festgelegten Runden
Rastplatz
Geprüft
I
II
III
KEIN PRÜFUNGSSTOFF AUF DIESER SEITE
IV
V
VI
Toast
Immer seitwärts
Ich bin euer Mann
Erbe
Der kalte Weg nach Hause
Okay
Käfer
Danksagung
Dieses Buch ist meinem Vater Albert gewidmet,
der mir das Segeln beibrachte.
Jackie schlagen
Es war so, dass sie dachte, Töpfe und Pfannen gehörten nicht in die Spülmaschine, also wies ich sie darauf hin, dass die Maschine ein Programm für Töpfe und Pfannen hatte, guck mal, hier ist es doch, mach die verdammten Augen auf. Na ja, das fand sie nicht so gut und fing damit an, dass ich ein planloser Loser wäre und so, was mich normalerweise nicht aufbringen würde, nur dass es vielleicht stimmt, außerdem kam es von jemandem, der sich angeblich was aus mir macht und aus dem ich mir was mache und bla bla bla, ich meine, ich habe so ziemlich mein ganzes Leben zu ihr aufgeblickt – sie ist wie ein großer Bruder für mich, nur eine Frau.
Wie auch immer, sie meinte es nicht so, glaube ich, vielleicht ein bisschen, aber eigentlich testete sie nur, was mir am meisten weh tun würde, und wenn ich behaupten würde, dass ich so was in früheren Streits nicht auch schon gemacht hätte, wäre das gelogen. Gerade neulich Abend erst mit diesem Mädel in einer Bar, das nicht nett zu meinem netten Freund James war, weshalb ich sagte: »Wow, das ist ja übel.« Als sie fragte: »Was denn?«, sagte ich: »Dein Gesicht. Und jetzt hau ab.« Es stimmte nicht, aber ich war mir ziemlich sicher, dass es ihre Gefühle verletzen würde, und wie sich herausstellte, hatte ich recht. Ich wusste, dass ich recht hatte, weil sie anfing zu weinen und mich einen verdammten Wichser nannte, nur dass es bei ihr mehr wie »Wächser« klang, verdammter Wächser! – und dann zeigte sie mir den Mittelfinger und stakste wackelig auf ihren hohen Absätzen Richtung Damenklo.
Außerdem, und das ist vielleicht ganz ähnlich gelagert, gilt für jeden rassistischen Spruch, der aus meinem Mund kommt, dass er, wenn er nicht humorvoll gemeint ist, einfach nur verletzen soll. Einmal zum Beispiel ging so ein asiatischer Typ extra langsam mit einer Orange in der Hand über den Zebrastreifen, also habe ich das Fenster heruntergekurbelt und gesagt: »Geht’s vielleicht ein bisschen schneller, Ninjarsch? Ich hab noch was vor.« Ich habe das nicht so gemeint, das mit dem Ninjarsch, es war nur so, dass er mich echt genervt hat, also wollte ich ihn auch nerven. Ich weiß, dass es da rassische Empfindlichkeiten gibt, die ohne das Attribut genau wie alle anderen Empfindlichkeiten sind: leicht auszunutzen. Es liegt keine Aufrichtigkeit darin, nur Bosheit, und genau das vermute ich, wenn meine Schwester mich einen Loser nennt, nur dass sie es vielleicht auch ein bisschen so meint. Ich bin mir nicht sicher.
Wie auch immer, es hat mich echt aufgebracht und ich habe die Kühlschranktür so zugeknallt, dass die Milch explodiert ist, dann habe ich mich umgedreht und ihr gesagt, dass sie die Klappe halten soll, oder ich würde ihr den Schnurrbart aus dem Gesicht fegen und zusehen, wie er wie ein haariger Käfer durch die Küche fliegt. Dann habe ich mit den Armen gewedelt, als würde ich fliegen, wie ein Käfer, wie ihr Schnurrbart. Tja, ich weiß, dass ich da eine Grenze überschritten habe, aber ich hoffe, dass ein paar Leute wenigstens zu schätzen wissen, was es mich gekostet hat, mich nicht einfach umzudrehen und ihr eine zu scheuern. Wohlwissend, dass einige Leute dies nur schwer zu schätzen wissen werden, will ich diesen phantastischen Vergleich anbringen: Meine Wut ist wie eine Monsterwelle aus Waffen, und mein Ego ist der Deich, der die Monsterwelle aus Waffen davon abhält, über die Stadtbewohner/-bewohnerin, in diesem Fall meine Schwester, hereinzubrechen. Manchmal ist die Welle aus Waffen aber zu groß oder zu mächtig oder was auch immer und einige Waffen werden durch einen Riss gepresst oder schwappen obendrüber oder so was. Das ist unglücklich, klar, aber verdiene ich nicht wenigstens ein bisschen Anerkennung dafür, dass ich 99 Prozent der gesamten Waffen-Welle zurückhalte, wo ich sie doch genauso gut über sie hereinbrechen lassen könnte, wenn ich als Person/Ego/Deich nichts taugen würde? Wichtiger noch, sie hatte sich ja über das Ego/den Deich lustig gemacht und provozierte geradezu den Bruch oder was auch immer. In gewisser Weise sabotierte sie mich, wie eine verdammte Saboteurin. Wie eine verdammt dreckige, nichtsnutzige, keinen-Topf-spülende, Schuppen-habende Saboteurin. Worauf ich also hinauswill, ist: Hatte sie nicht in gewisser Weise als Erste eine Grenze überschritten? Ich glaube ja, und das ist die Nummer eins auf meiner Liste von sieben Entschuldigungen, warum es okay war, dass ich meine Schwester in die Titten geboxt habe.
Sie hat angefangen. Ich weiß, das klingt kindisch, aber ...
Wenn erwachsene Geschwister in das Haus zurückkehren, in dem sie groß wurden, regredieren sie häufig und benehmen sich wieder wie Kinder.
Geschwisterstatus schlägt Frauenstatus. Geschwister zählen nicht als Frauen.
Die Testosteron-Ausschüttung steht in direktem Zusammenhang mit Aggressionen und schwankt in Reaktion auf Wettbewerbssituationen wie z.B. ein Tennismatch oder Streits über Spülmaschinen oder Veränderungen im empfundenen eigenen Status in einer sozialen Hierarchie, zum Beispiel einer Geschwister-Hierarchie oder einer Spülmaschinen-Entscheidungs-Hierarchie oder einer Haararchie von Schnurrbärten (in diesem Fall gewinnt sie mit links). Wenn ich nicht respektiert werde, kommt es zu einer Reaktion in meinen Eiern, und sie machen mehr Zeug, das mehr Aggressionen macht. Was ich auch tue, ich kann’s nicht kontrollieren. Das ist vielleicht ein schwaches Argument, aber die Logik ist auch nicht anders, als wenn man sich wie ein Arschloch benimmt und es dann auf PMS schiebt.
In Gewalt liegt eine gewisse Klarheit. An ihr ist nichts rhetorisch oder vage – sie bedeutet nur, was sie bedeutet, was sich grob übersetzt ungefähr so anhören würde: »Ich mag dich gerade nicht, und zwar doll.« Eine weniger grobe Übersetzung hängt von den Einzelheiten ab, und die einzelnen Einzelheiten dieses Falls in Betracht ziehend, würde meine Übersetzung in etwa lauten: »Die Tatsache, dass du mich beleidigst, obwohl du sowieso schon intelligenter, eloquenter, ruhiger und erfolgreicher bist und zudem noch all deine Haare und eine Wohnung und einen Job hast, der dir tatsächlich etwas bedeutet, frustriert mich so ungemein, dass ich dich physisch dominieren werde, weil das der einzige Lebensbereich ist, in dem ich die Oberhand zu haben scheine.« Aber wie auch immer man Gewalt übersetzt, sie ist nicht gar so grausam oder folgenschwer. Meiner Erfahrung nach ist körperliches Leid vergänglicher als emotionales. Worte hingegen können bleibende Schäden verursachen. Man kann sie nicht zurücknehmen. Nicht wirklich.
Einmal habe ich ihren damaligen Freund mehrfach ins Gesicht geboxt, weil sie mir erzählt hatte, er habe sie geschlagen. Jahre später gestand sie mir, dass sie sich das ausgedacht hatte, weil sie sauer auf ihn war. Er starb bei einem Autounfall, bevor ich mich entschuldigen konnte. Ein anderes Mal hat sich ein Vollidiot in einer Bar ihr gegenüber wie ein Vollidiot benommen, woraufhin ich ihm sagte, er solle aufhören. Das tat er, mehr oder weniger, und als ich zurück zum Tisch ging, kam sie zu mir gerannt und sagte: »XY glaubt, dass du nicht die Eier hast, ihm eine runterzuhauen.« Ich war jünger (dümmer) und betrunken (noch dümmer) und hatte ein hündisches Verständnis von Loyalität, was sie alles wusste, weshalb ich mir sicher bin, dass sie vermutet hatte, dass meine Reaktion im Sinne von Ach ja? ausfallen würde – was sie auch tat. Ich drehte mich um, ging wieder zu dem Typen, tippte ihm auf die Schulter und schlug ihm aufs Ohr usw. Das sind nur zwei von geschätzt vierzig Fällen von Gewalt in meinem Leben, die sie in gewisser Weise angezettelt hat, was, wenn ich richtig rechne, Pi mal Daumen so um die fünf Prozent sein müssten. Meine Frage lautet deshalb: Wie kann jemand, der mehr als einmal etwas in Anspruch genommen hat, das ich als brüderliches Wohlwollen bezeichnen will, sofort Foul rufen, wenn sich diese Art von Aufmerksamkeit gegen ihn wendet? Das ist in vielerlei Hinsicht falsch.
Sie hat es wirklich herausgefordert. Nachdem ich ihr gedroht hatte, hat sie mir ins Gesicht geschrien: »Glaubst du, das macht dich zu nem starken Mann? Hm? Willst du mich schlagen, starker Mann? Na, dann mach doch, schlag mich. Schlag mich. Schlag mich, du verdammtes Stück Scheiße.«
»Das will ich ja«, sagte ich. »Dringend.«
»Na, dann los, du verdammtes Arschloch. Du bist dreißig und ein verdammter scheiß Loser und weißt du noch was, du verdammter dreißigjähriger scheiß Loser? Mom hatte recht, du bist ein scheiß gewalttätiges Stück Scheiße.«
Der Hintergrund dieser Bemerkung ist, dass unsere Mutter, als sie im Sterben lag, jeden von uns einzeln in ihr Krankenhauszimmer rief, für ein letztes Gespräch unter vier Augen – die Gelegenheit, alles zu sagen, was wir je würden sagen können. Meine Schwester wurde als Erste hereingerufen, während mein Bruder und ich im Flur warteten und uns leise über Jennifer unterhielten, eine der Krankenschwestern. Ich sagte, sie sei so hübsch, dass ich sie nackt sehen und dann Sex mit ihr haben wolle. Er sagte ziemlich unmissverständlich, dass er dasselbe wolle, woraufhin ich sagte, er solle mal halblang machen, was er nicht tat, und wir fingen an zu streiten. Nach ungefähr zehn Minuten kam meine Schwester heraus und sah ziemlich aufgelöst aus, also gingen wir zu ihr und gaben unser Bestes – was nicht gut war –, um sie zu trösten, dann fragten wir, wie es so war. Sie erklärte, dass das Gesagte privat sei, aber dass es insgesamt nichts Besonderes gewesen sei, hauptsächlich eine Menge Ich hab dich liebs und Tut mir leids und im Grunde ein emotionales Abschiednehmen. »Klingt hart«, sagte ich. »Ich muss wahrscheinlich ungeschützten Verkehr mit Jennifer haben, um mit alldem klarzukommen.« Als ich mich nach der Tür streckte, warf ich einen Blick zurück auf meinen Bruder und fügte hinzu: »Muss wahrscheinlich an ihren Melonen lutschen –«
»Mom will als Nächstes mit AJ reden«, sagte meine Schwester.
»– und lecken. Was?«
»Mom will als Nächstes mit AJ reden«, wiederholte sie.
»Das ist okay«, log ich. Und nachdem AJ und ich uns ein paarmal übertrieben dramatisch zugenickt hatten, ging er ins Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Natürlich hat mich das ein bisschen gestört, weil ich angenommen hatte – ich glaube, das hatten wir alle, nachdem Jackie als Erste hereingerufen worden war –, dass die Sache in der Reihenfolge der Geburt ablaufen würde, was bedeutet hätte, dass ich als Nächstes dran gewesen wäre, jedenfalls in Anbetracht der Tatsache, dass ich als Nächstes aus unserer Mutter herausgekommen war, und zwar richtig herum. Kopf zuerst. Als sie mich übersprang, versetzte mir das deshalb einen Stich. Aber, nun ja, ich bin erwachsen – ich trinke Kaffee und so –, sogar ich kann dann und wann ein wenig Großmut zeigen. Und das tat ich auch. Ich habe still mit meiner Schwester im Flur gewartet, dann still beim Getränkeautomaten mit einem Latino in roter Rangers-Jogginghose und Schläuchen in der Nase, dann nicht so still auf der Herrentoilette und dann wieder still bei meiner Schwester. Und als AJ endlich herauskam, war ich der Erste, der ihm die Schulter gedrückt und den Kopf geschüttelt und Sachen gesagt hat wie: »Schlimm, oder?« und »Das ist echt schwer« und »Wie auch immer ...«
»Sie will im Moment nicht mit dir sprechen«, sagte mein Bruder.
»Ja«, sagte ich. »Gut.«
»Ernsthaft. Sie sagt, sie ist zu müde.«
»Also wann will sie denn mit mir reden?«
»Ich habe keine Ahnung, Mann – vielleicht so was wie morgen?«
Ich dachte, er macht vielleicht Witze, aber nach einigem aggressiven Hin und Her fand ich mich mit der Tatsache ab.
Meine Mutter blieb die nächsten paar Tage zu müde, um mit mir zu sprechen, und ich finde, ich bin die meiste Zeit verständnisvoll, geduldig und reif damit umgegangen, von dem Zwischenfall bei The Wharf einmal abgesehen, wo ich so einem Typen den Hamburger aus den Händen gehauen habe.
Am dritten Tag fühlte sich meine Mutter bereit, mit mir zu reden.
»Bitte weine nicht oder wir kommen nicht durch«, sagte sie. »Bitte. Sagen wir einfach, was wir einander zu sagen haben. Okay?«
»Okay«, sagte ich weinend.
»Okay«, sagte sie.
»Soll ich anfangen?«
Sie schloss die Augen und nickte.
»Okay«, sagte ich. »Was genau sollen wir denn hier sagen?«
»Was immer dir ein Bedürfnis ist.«
»Okay«, sagte ich. »Na ja, ich meine, es ist keine große Sache oder so, aber es ergibt nicht wirklich Sinn, dass du AJ ausgewählt hast, vor mir hierherzukommen. Ich meine, ich war das mittlere Kind und er war das letzte und ein Kaiserschnitt, also ... und dann musste ich so lange warten und bin nervös geworden, ich dachte, wir würden vielleicht nie zum Reden kommen, und dann habe ich die Faust in einen Papiertuch-Halter gerammt und in einen Typen im Diner und – Bist du noch wach?«
»Ja«, sagte sie. Aber ihre Augen blieben geschlossen.
»Nun?«
»Ich weiß nicht, warum«, sagte sie. »Gibt es noch etwas, was du mir sagen möchtest?«
»Ich hab dich lieb.«
»War’s das?«, fragte sie.
»Ja«, sagte ich. »Das war’s.«
Sie kniff mit Daumen und Zeigefinger ins Laken, dann ließ sie los. »Du hast also keine Beschwerden über mich als Mutter oder so was?«
»Nein«, sagte ich. »Du warst eine großartige Mutter. Mehr könnte ich nicht verlangen. Ich hatte eine großartige Kindheit.«
Sie nickte und drückte meine Hand. »Also gut«, sagte sie. »Nun, es gibt etwas, was ich dir sagen möchte.«
»In Ordnung«, sagte ich. »Was denn?«
»Du hast einmal ein Buch nach mir geworfen. Du warst vom College zurück und wegen irgendetwas wirklich wütend auf mich und du hast mir ein Buch an den Kopf geworfen.«
Ich hatte keinerlei Erinnerung daran. Ich fragte mich, ob das wieder die Schmerzmittel waren, die aus ihr sprachen.
»Wurdest du getroffen?«, fragte ich.
»Nein. Ich habe mich geduckt, und das Buch prallte an die Wand.«
»Wow«, sagte ich. »Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern.« Wir blinzelten einander an. »Ehrlich«, sagte ich kopfschüttelnd. »Ich erinnere mich nicht.«
»Tja, ich schon«, sagte sie. »Und ich erzähle dir das, weil ich nicht möchte, dass du einer Frau gegenüber jemals, jemals wieder gewalttätig wirst. Du darfst Frauen nicht misshandeln, Alby. Das musst du mir versprechen.«
»Okay«, sagte ich. »Versprochen.«
»Du versprichst was?«
»Ich verspreche, dass ich keine Damen misshandeln werde.«
»Niemals.«
»Niemals«, sagte ich. »Ich werde niemals Damen misshandeln.«
»Okay«, sagte sie, streichelte meine Hand ein bisschen, tätschelte und drückte sie. Dann sagte sie, sie sei müde, und bat mich zu gehen. Ich stand auf, küsste sie auf die Stirn und ging zur Tür.
»Ich kann mich wirklich nicht erinnern.«
»Das glaube ich dir«, sagte sie. »Jetzt mach bitte das Licht aus.«
»Okay«, sagte ich und drückte den Schalter.
Nachdem ich die Tür geschlossen hatte, eilte ich sofort zu meinem Bruder und meiner Schwester und erzählte ihnen alles; dann fragte ich sie, ob sie sich erinnern konnten, davon gehört zu haben. Meine Schwester sagte nein, aber dass es nach etwas klinge, was ich tun würde, und ich sagte ihr, sie solle verdammt nochmal die Klappe halten.
Mein Bruder sagte, er würde sich tatsächlich irgendwie an so was erinnern, ihm sei so, als erinnere er sich möglicherweise daran, wie sie ihm eines Tages am Telefon davon erzählt habe. Ich forderte mehr Details, damals und bei zig anderen Gelegenheiten seitdem, aber das Einzige, was er noch darüber gesagt hat – Jahre später bei ein paar Bieren und einer Flasche Bourbon, nachdem ich ihn wirklich bedrängt hatte –, war, dass es schon passen würde, weil ich zu der Zeit auf dem Gipfel meiner Arschlochphase gewesen sei. Dann hielt er inne, blickte in die Ferne und fügte hinzu: »Dem ersten Gipfel.«
Sie starb nicht lange danach, und nachdem ich mir jahrelang das Hirn darüber zermarterte, fand ich schließlich zu einer vagen Erinnerung an den Vorfall. Nichts Konkretes, nur wie ich am Küchentisch sitze, mit einem Buch vor mir, und sie steht da, und wir schreien beide. Das ist alles. Natürlich konnte diese Erinnerung von zahllosen Malen rühren, als wir uns in der Küche anschrien, oder vielleicht war sie auch reine Einbildung, etwas, was ich mir in Reaktion auf all das ausgemalt habe. Aber wie auch immer, ich glaube daran. Ich glaube, dass ich das Buch geworfen habe. So muss es gewesen sein.
Und jetzt war da meine Schwester und verwendete es gegen mich, weil sie – zu Recht – glaubte, dass es weh tun würde. Das Beste, was mir im Gegenzug einfiel, war: »Lern erst mal was über Geschirrspüler, Schwachkopf.« Sie feixte und schüttelte den Kopf. »Und«, fügte ich hinzu, »hör auf, die kaputten Spitzen von deiner Lesben-Frise im Waschbecken liegen zu lassen, das ist echt widerlich, genau wie deine Schuppen. Du solltest es mal mit T/Gel probieren, denn Apfelessig bringt’s echt nicht, du verdammtes Hippie-Arschloch. Und hör auf, blutiges Klopapier von deinen ekligen rasierten Beinen in den Mülleimer im Bad zu werfen, weil scheiß Sparkles das verdammt nochmal riecht und dann den scheiß Eimer umwirft und das Zeug verdammt nochmal frisst. Okay? Keiner will ins Bad kommen und scheiß blutiges Klopapier im scheiß Eimer sehen. Also fick dich.«
Sie beschimpfte mich noch ein bisschen mehr, deshalb verhöhnte ich sie mit meiner Verhöhn-Stimme: »Das bist du: Ich bin viel zu beschäftigt, wichtige Kunst zu schaffen, als dass ich Rücksicht auf andere nehmen und hinter mir aufräumen könnte, also verteile ich meinen Scheiß auf sämtlichen freien Flächen, damit auch ja keiner am Tisch essen kann, ohne erst mal meinen Scheiß wegzuschaffen. Außerdem bin ich eine dumme Fotze. Das bist du, du dumme Fotze.«
Da begann sie, mich durch die Tür zu schubsen und zu brüllen: »Hau ab! Hau ab! Hau verdammt nochmal ab!« Und es ist kein Witz, wenn ich sage, dass sie superstark ist und mich fast schon draußen hatte, ich habe mich auch kaum gewehrt, ging fast schon freiwillig, aber dann habe ich nur gedacht: Nein, du hau ab. Als sie mich wieder schubste, habe ich ihr Hemd gepackt, und dann war das wirklich so ein Fall, bei dem ich stärker war, als ich dachte, weil sie irgendwie durch die Luft flog und mit dem Rücken auf dem Boden landete. Wir waren beide schockiert, ich wahrscheinlich noch mehr. Sie sprang aber schnell auf und stürmte auf mich zu, verteilte links und rechts Faustschläge (das gehört noch auf die Liste: Nr. 8 – sie hat mich zuerst geschlagen), was nicht viel bewirkte, außer mich wieder ein paar Schritte in die Küche zu treiben. Schließlich hörte sie auf, um den Schaden zu begutachten, und ich grinste sie an. Sie griff wieder an, schlug wild auf mich ein, und ich wehrte ab, was ich konnte, und schubste sie dann weg. Als sie ein drittes Mal losschlug, zielte ich mit einem mittelstarken Faustschlag mitten auf ihre Brust, wobei ich die rechte Titte irgendwie streifte und voll auf der linken landete, was sie rückwärts über die Klappe des Geschirrspülers warf, der immer noch offen stand, mit reichlich Platz für Töpfe und Pfannen. Es war allerdings schon etwas Besteck in dem Besteck-Dings, darunter auch ein Messer mit, ich glaube, Frischkäse, das sie sich beim Aufrappeln schnappte. Ich drehte mich um und rannte los. Ich hatte es gerade nach draußen geschafft, als ich hörte, wie das Messer innen an die Hintertür knallte.
Den Rest des Abends und fast den ganzen nächsten Tag gingen wir einander aus dem Weg, bis unser Vater von der Arbeit nach Hause kam, vollgepumpt mit Ritalin, und sich wie ein Arsch aufführte; warum genau weiß ich nicht mehr und es spielt auch keine Rolle. Was eine Rolle spielt, ist, dass geteiltes Leid zu einem Gefühl von Solidarität führen kann – fälschlicherweise vielleicht und ganz sicher nicht von Dauer –, so dass wir uns gegen ihn verbündeten, bis er sich nach oben in sein Zimmer flüchtete, um Sudoku oder irgendeinen Scheiß auf dem Computer zu spielen. Meine Schwester und ich verbrachten die folgenden paar Stunden am Küchentisch und schluckten, was immer an Alkohol noch im Haus war, schworen uns Treue, versprachen, dass es nicht wieder vorkommen würde, und sagten, es tue uns leid, es tue uns leid. Es tut uns so leid.
Die kleinen Dinge
Ich verschränkte die Arme. Sie fühlten sich kräftig an, zu allem in der Lage. Hochheben, tragen, graben, Kühe mit PCP füttern, so dass sie sich mit unerwarteter und enormer Heftigkeit aufbäumen – irgendwas. Geschenke in Seidenpapier einwickeln und Zähne aus christlichen Schädeln schlagen, Sachen pink anmalen und Unkraut pflanzen, weil es unfair behandelt wird. Fahrradreifen aufpumpen, Benzin abzapfen, Gewichte stemmen, Einkäufe einpacken und Felsbrocken über den Long Island Sound bis nach Connecticut hüpfen lassen. Eier mit einer Hand zerdrücken und Wäsche zusammenlegen. Das liegengebliebene Auto meines mexikanischen Nachbarn donnerstagmorgens über die Straße schieben, damit er am Tag der Straßenreinigung keinen Strafzettel bekommt, und mein Handy einem Freund zuwerfen, der unbedingt seine Mom anrufen muss. Jeder Dame jedes Glas aufmachen. Helfen. Mir war nach helfen. Ich fühlte mich, als könnte ich helfen.
Das Erste, was ich tat, war die Mikrowelle zu putzen. Da fing ich an. Manchmal war ich erfolgreich, manchmal lief es anders. Ich habe gesehen, wie Leute kaputtgehen, weinen, zusammenbrechen, sich töten, getötet werden oder alt werden. Ich habe gesehen, wie Leute ihre Haare verlieren, ihren Verstand, ihren Führerschein. Mein Vater hat seine Gallenblase wegen einer Diät mit Nutrisystem verloren. Was konnte ich schon tun? Ich wischte den Küchenboden, ging spazieren, sah ein totes Baby-Kaninchen mit einer Fahrradreifenspur mitten durch. Das erinnerte mich an einen Freund namens Nicky, der behaarte Beine hatte und Feuerwerk mochte. Eines Sommers erwischte er seine Freundin beim Fremdgehen, sprintete von ihrer Tür zum Vanderbilt Boulevard und warf sich vor einen Kombi mit ein paar Kindern auf dem Rücksitz.
Beim 7-Eleven sah ich eine alte Dame im Nachthemd, die rote Fäustlinge an ihren Füßen hatte und blaue Venen an den Knöcheln. Ich kaufte Kartoffelchips. Leute heirateten. Sie kauften Häuser, und sie kauften Möbel, und sie vertrauten der Regierung, und sie wurden dick. Da war ein Obdachloser mit langem Haar, einer schwarzen Lederjacke, grünen abgeschnittenen Shorts und einem mentalen Problem, das er durch Gehen abzuschütteln versuchte wie eine Baseballverletzung als Kind. Gehen, gehen, immer gehen. Er war sehr braun. Die Leute aus der Gegend nannten ihn den »Mann mit einer Million Meilen an den Füßen«. Die Polizei schoss ihm in den Rücken, als er nicht stehen blieb, um ihre Fragen zu beantworten.
Ich weiß noch, wie ich nach einem Abendessen bei Roy Rogers einmal auf dem Beifahrersitz im Diesel meines Vaters saß. Mein Bruder saß hinten. Ein Auto ein paar Wagen weiter vorn scherte nach links aus, dann das nächste Auto, dann das nächste, bis das Auto direkt vor uns nicht nach links ausscherte. Im Scheinwerferlicht sahen wir drei Welpen darunter hervorrollen, beugten uns zu ihnen vor, während mein Vater bremste, um sie herum und an ihnen vorbei steuerte und auf dem Seitenstreifen hielt. Von dort sahen zwei von ihnen eigentlich gut aus, nur waren sie tot. Der dritte blutete – es war schwer zu sagen, wo genau, denn da war eine Menge Blut –, aber er atmete noch ein paar Minuten weiter, bis er aufhörte und im blitzenden Orange des Warnblinkers meines Vaters starb.
Menschen essen Kalbfleisch. Ich bin mal mit einem pummeligen katholischen Mädchen ausgegangen, das mir erzählte, dass ihre Eltern sie nie berührten, dass sie als Kind so unglaublich dringend berührt werden wollte, dass sie sich schon auf die Läuse- und Skoliose-Untersuchungen in der Schule freute. In der Junior Highschool kannte ich mal einen Jungen, der allen erzählte, er besitze einen Baby-Elefanten; Jahre später brachte er seine Stiefmutter um, indem er ihr den Schädel mit einer Chicken-&-Stars-Suppendose einschlug. Ich habe Katzen, Hunde, Opossums, Waschbären und Eichhörnchen, einen Fuchs, ein Känguru, einen Bären, Rehe, Kaninchen und Vögel, Kröten, Ratten und Mäuse und Schlangen gesehen, mit herausgeplatzten Gedärmen, die Eingeweide ausgeweidet, die Schädel zertrümmert, tot in der Sonne am Straßenrand. Meine Mutter hatte Krebs.
Ich kam nach Hause, hielt ihre Hand, drückte auf den Schmerz-Knopf, machte ihr die Nägel und schüttelte die Kissen auf, putzte ihr die Zähne und leerte ihren Pissebeutel. Ich brachte ihr Plüschtiere mit und Lakritz und lange Strohhalme, damit sie ihren Saft im Bett trinken konnte. Meistens schlief sie nur und übergab sich. Ihr Krankenhauszimmer war laut. Viel Stöhnen, knarrende Betten, piepende PCA-Pumpen, Schwestern, die kamen und gingen und lachten und fragten: Wie geht es Ihnen auf einer Skala von null bis zehn, wobei null für keinen Schmerz steht und zehn für den schlimmsten Schmerz, den Sie je gefühlt haben? Zwölf.
Nach drei Monaten saßen mein Bruder und ich da, sahen dem Dilaudid-Tropf zu und hörten, wie sie im Schlaf »au au au« murmelte, als sich mit einem Mal ihre Augen weit öffneten, dann noch weiter und dann in einem superlangsamen drogenberauschten Blinzeln wieder schlossen. Dann warf sie ihr Betttuch zu Boden und zog sich das Krankenhausnachthemd über den Kopf. »Kein scheiß Wasser mehr.«
Ich fragte: »Soll ich für dich zum Cola-Automaten gehen?«
»Warum versucht ihr, mich umzubringen?«
»Das tun wir nicht.«
»Ist euch klar, dass ich hier splitternackt rumliege?«
»Ja.«
»Macht es euch glücklich, eure Mutter splitternackt zu sehen?«
»Nicht wirklich.«
»Dann verschwindet.«
Wir blieben sitzen und wussten nicht, was wir tun oder sagen, wo wir hinsehen sollten. Sie schrie, da sei Salz auf ihren Beinen, dann irgendetwas über elektrische Leiter und die Prozedur und fass meine antike Gabel nicht an. Sie riss sich die Venenkatheter aus den Armen, den Hickman-Katheter von der Brust. Blut spritzte hoch. Ich packte sie, während mein Bruder schreiend den Flur zum Dienstzimmer hinunterrannte. Ich drückte sie an den Handgelenken nieder – was nicht schwer war, sie hatte das Essen verweigert und wog zu diesem Zeitpunkt vielleicht knapp vierzig Kilo. Als sie genug gekämpft hatte, fiel sie einfach in sich zusammen und weinte. Ich sagte: »Mom«, als wäre es eine Frage.
Später, nachdem sie sie ans Bett geschnallt, verbunden und mit starkem Was-auch-immer vollgepumpt hatten, so dass sie das Bewusstsein verlor, nachdem sie die Venenkatheter in ihre Füße verlegt hatten, damit sie nicht herankam, nachdem wir unseren Vater angerufen und ihn belogen hatten, dass alles prima sei und er den Abend freinehmen solle, nachdem wir unsere Schwester angerufen, ihr alles erzählt und es dann bereut hatten, rauchten wir draußen vor dem Krankenhaus ein paar Zigaretten mit einem Kurier, der sich die Hand mit Zimtschneckenglasur verbrannt hatte, und beschlossen, die Nacht über zu bleiben. Zurück im Zimmer, nachdem wir wieder dem Dilaudid-Tropf zugesehen, eine halbe Stunde nicht gesprochen und nur dem »au au au«-Gemurmel unserer schlafenden Mutter gelauscht hatten, wandte ich mich an meinen Bruder und sagte: »Yo, ihre Vagina ist viel besser in Form, als ich gedacht hätte.«
Er überlegte einen Moment und nickte dann zustimmend.
Zum Sterben kam sie nach Hause. Das Hospiz lieferte ein Bett, Geräte, Schachteln mit Medikamenten und eine Ärztin, die uns sagte, ein bis drei Tage. Wir brachten sie ins Fernsehzimmer, unter den Deckenventilator, an den meine Schwester mit Schnüren kleine Glaslibellen gebunden hatte. Meiner Mutter schien es zu gefallen, ihnen dabei zuzusehen, wie sie ihren Runden drehten, aber mir nicht. Ich wurde gut im Wände verputzen, staunte darüber, wie sich Kaugummi dem Verfall widersetzte, futterte ihr Ativan wie Aspirin. Ich sagte ihr, dass ich sie vermissen würde, dass ich ihren Körper dafür hasste, krank geworden zu sein, dass ich Gott oder das Schicksal oder das Universum am liebsten an der Kehle packen und zwingen würde, von ihr abzulassen. Sie lachte mich aus. Aus ihren Druckgeschwüren leckte eine übelriechende Flüssigkeit. Mein Bruder, meine Schwester und ich wechselten reihum ihre Verbände und Betttücher, tranken ihr flüssiges Valium und spielten UNO. Wir sahen unserem Vater zu, wie er ihr beim Sterben zusah, lernten vom Schmerz, der auf seinem Gesicht lag, wenn er in das Zimmer ging. Er hielt es nie länger als zehn Minuten aus. Ein Priester kam, um die Sterbesakramente zu vollziehen, und ich bedachte ihn mit meinem gemeinsten Blick. Er fragte mich, ob ich die Kommunion empfangen wolle, und ich schenkte ihm einen anderen gemeinen Blick und verließ den Raum. Eine Woche später kehrte die Ärztin zurück, sagte wieder, ein bis drei Tage. Mein Bruder und ich schrieben uns Kopf-hoch-Nachrichten auf braune Papierservietten.
Hast du Angst, dass Mom aus dem Himmel deine schwulen Gedanken sieht?
Nein. Hast du Angst, dass sie per Röntgenblick die innen liegenden Hoden im Unterleib deiner Freundin entdeckt?
Diese Freundin, Tara, kam an jenem Tag noch vorbei und hing mit uns rum, als gehörte sie zur Familie, dann bereitete sie zum Abendessen ein Huhn zu. Gerade als wir uns zum Essen hinsetzten, sagte mein Bruder, dass ich abwaschen solle. Ich sagte: »Nicht im Ernst?« Er sagte, doch. Ich erklärte, dass ich keinen verdammten Abwasch machen würde, solange er nicht die Granatsplitter seiner Reizdarmsyndrom-Scheiße von der verdammten Toilette putzte. Sein Gesicht lief rot an. Ich sagte: »Sieht so aus, als wolltest du mich schlagen. Wenn du das tust, steche ich dir mit meiner Gabel in den Kopf.« Dann nahm ich einen Bissen Huhn – es war ziemlich gut –, und er schlug ihn mir mit der Faust aus dem Mund. Krachte mitten in meinen Kiefer. Ich war so schockiert, dass ich zwei volle Sekunden lang gar nichts tat, wie alle anderen auch. Dann stürzte ich mich auf ihn, würgte ihn, knallte seinen Kopf auf den Küchentresen. Er fing irgendwo im Haar zu bluten an, seine Freundin fing an, an meinem zu ziehen, und meine Schwester zwängte sich zwischen uns. Ich glaube, sie bekam den einen oder anderen verunglückten Schlag ab, bevor wir alle in die leeren Bierflaschen auf der Heizung stürzten. Mein Vater kam schwankend wie ein Gorilla hereingerannt und schrie etwas, was ich nicht richtig verstehen konnte, weil Tara sich an meine Ohren krallte.
Draußen in der Einfahrt kam ich langsam wieder zu Atem, rauchte eine Zigarette, stampfte auf einer Scheibe aus Eis herum, die im umgedrehten Deckel einer Mülltonne festgefroren war, zitterte. Ein paar Minuten später kam meine Schwester mit meiner Jacke heraus und fragte mich, ob alles in Ordnung sei. Ich sagte ja und fragte, ob bei meinem Bruder alles in Ordnung sei. Sie sagte, er habe eine ordentliche Platzwunde am Kopf, aber es scheine ihm gutzugehen. Zum ersten Mal seit langer Zeit verspürte ich Erleichterung, als hätte ich gerade gevögelt oder geweint oder einen Job hingeschmissen. Es fühlt sich gut an, ins Gesicht geschlagen zu werden, jemand anderem ins Gesicht zu schlagen. Ich ging rüber zum Anleger und starrte eine Weile auf die Boote, dann ging ich zu dem mexikanischen Restaurant um die Ecke und trank Budweiser. Zwanzig Minuten später tauchte mein Vater auf, sagte, er sei meinen Fußspuren im Schnee gefolgt. Ich fragte ihn, ob er einen Kurzen wolle, irgendeinen. Er sagte: »Wenn ich jetzt anfange zu trinken, höre ich nicht mehr auf.« Genau in diesem Moment rief mein Bruder auf meinem Handy an.
Er sagte: »Hey Mann.«
Ich sagte: »Hey Mann.«
»Hast du wirklich auf mich eingestochen?«
»Nein.«
»Machst du jetzt den Abwasch?«
»Ja, ich mach den Abwasch.«
»Cool.«
»Lebt Mom noch?«
»Ja.«
»Cool.«
Sie starb eine Woche später. Ich bekam einen Job, bei dem ich Häuser entkernte.
Ich arbeitete mit einem interessanten Typen zusammen, der Sachen von Alufolie rauchte; er hatte eine üble Kindheit gehabt, und Erwachsensein ist für alle übel. Wir rissen gerade Vinylfliesen aus einer Küche, als er mir von einem achtundzwanzigjährigen Mädel erzählte, das er kannte und das gerade bei Lord & Taylor arbeitete, als ihr Herz explodierte. Er erzählte mir das einfach so, nüchtern, überhaupt nicht wütend. Ich erzählte ihm, dass eine Fünfzehnjährige aus Bayport vor einen LIRR-Zug getreten war und sich von ihm hatte überfahren lassen.
»Davon habe ich gehört«, sagte er. »Hat ihren Körper eine Meile mitgeschleift.«
Außerdem waren zwei Fahrradfahrer von einem Auto auf dem Sunrise Highway getötet worden, und eine Zwanzigjährige war nur einen Block von unserem Haus entfernt an einer Überdosis gestorben. Ihre Tochter war drei. Jedes Jahr sterben mindestens zwei Menschen im Ronkonkoma-See, und Tausende von Kröten sterben in Swimmingpools. Der kleine Bruder von einem guten Freund wurde im Irak getötet, ein wirklich hübsches Mädchen, das ich in San Francisco kennengelernt hatte, ging eines Abends schlafen und wachte nicht mehr auf, und ein Typ, den ich kannte, hatte keine Krankenversicherung, als bei ihm Multiple Sklerose diagnostiziert wurde. Das Restaurant, in dem er arbeitete, war so nett, eine Benefizveranstaltung für ihn zu veranstalten, bei der achttausend Dollar zusammenkamen. Man gab ihm sechshundert.
Ein paar Wochen später traf ich meine Familie zum Mittagessen, fragte meine Schwester, wie es ihr gehe seit Mom. Sie sah mich nur an und ließ ihre Augen sich mit Tränen füllen. Ich fragte meinen Dad dasselbe. Er zeigte nur auf meine Schwester, wie um zu sagen, ich fühle mich genauso. Mein Bruder zuckte mit den Achseln. Ich sagte ihnen, mir gehe es gut, was vielleicht stimmte, und dass ich ihnen helfen würde, wenn ich nur wüsste, wie. Die Kellnerin kam herüber, ganz in Schwarz, einschließlich der Schürze, und sagte zu mir: »Ma’am, Sir ... Ma’am.« Ich fragte: »Sehe ich wie eine Dame aus?« Sie stammelte eine Entschuldigung, sagte, dass sie nicht genau genug hingesehen habe, was seltsam war, weil sie es vermied, mich beim Sprechen anzusehen. Ich aß nicht viel, pickte nur in meinen Pommes herum und trank Eiswasser, während sie aßen und stritten, über das Testament, über das Geld. Ich wusste nicht, was ich über das Geld dachte, nur, dass ich nicht darüber streiten wollte. Wir sind keine Nachtisch-Familie, aber wir mögen schwarzen Kaffee. Ich hatte meine Tasse fast ausgetrunken, als meine Schwester sagte, sie sei zum Friedhof gegangen und habe etwas Gras vom Grab unserer Mutter gegessen. Mein Vater griff nach seinem Portemonnaie.
Als wir nach Hause kamen, war da ein Baby-Vogel in der Einfahrt, lag einfach da, ohne Federn. Er war winzig. Seine Haut war fast durchsichtig. Wir standen alle nur um ihn herum und guckten. Ich sagte: »Ich hole mal was, wo man ihn reintun kann«, und machte mich auf den Weg zum Haus. Mein Vater sagte, vielleicht wäre es das Beste, einfach rückwärts mit dem Auto drüberzufahren.
Wenn P, dann Q
Als er gerade voll dabei war, an der Tafel eine Gleichung zu lösen, ließ mein Mathelehrer in der elften Klasse die Kreide fallen, welche auf dem Boden in zwei Stücke zerbrach. Er sah ein paar Sekunden auf die Stücke hinunter, wandte sich dann zur Klasse und sagte: »Als Kind habe ich immer mit einem Schmetterlingsnetz Hummeln gefangen. Wenn ich eine gefangen hatte, gab ich sie in ein umgedrehtes Glas und schob dann ein in Alkohol getränktes Papiertuch unter den Rand, was die Hummel ohnmächtig werden ließ. Dann band ich ganz vorsichtig eine Schnur um den Hals der Hummel, und nach ein paar Minuten wachte die Hummel auf, und ich hatte sie an der Leine.« Dann ging er rüber zum Fenster und starrte nach draußen, über den Parkplatz voller Autos, die alle gleich aussahen.