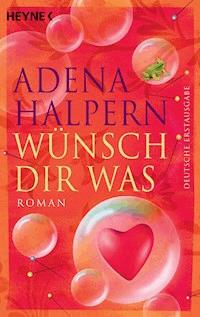
7,99 €
7,99 €
oder
-100%
Sammeln Sie Punkte in unserem Gutscheinprogramm und kaufen Sie E-Books und Hörbücher mit bis zu 100% Rabatt.
Mehr erfahren.
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Heyne
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
29 Jahre alt zu werden, das ist doch das Schönste auf der ganzen Welt, denkt sich Ellie. Das beste Alter, um sich mal wieder ein paar neue Outfits zu gönnen, mit der Freundin die Straßen von Manhattan unsicher zu machen und in der angesagtesten Bar einen überraschend netten und ausnahmsweise vielversprechenden Typen kennenzulernen. Was passiert jedoch, wenn man für alle diese Dinge nur einen Tag Zeit hat?
• Sex and the City meets PS. Ich liebe dich
• Adena Halpern trifft einen Nerv: flapsig, gefühlvoll, ironisch, einfühlsam
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 377
Veröffentlichungsjahr: 2009
4,9 (16 Bewertungen)
Bewertungen werden von Nutzern von Legimi sowie anderen Partner-Webseiten vergeben.
Legimi prüft nicht, ob Rezensionen von Nutzern stammen, die den betreffenden Titel tatsächlich gekauft oder gelesen/gehört haben. Wir entfernen aber gefälschte Rezensionen.
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Das Buch
Die Autorin
Fünfundsiebzig
Heiliger Strohsack!! Ich bin ein Männertraum!!!
Copyright
Das Buch
Lucy und Ellie lieben beide stylishe Kleider, attraktive Männer und Kuchen aus ihrer Lieblingsbäckerei. Sie sind wie beste Freundinnen - mit einem kleinen Altersunterschied. Ellie ist Lucys Großmutter, aber sie wünscht sich nichts sehnlicher, als noch einmal 29 zu sein. Natürlich rechnet sie nicht damit, dass Wünsche über Nacht in Erfüllung gehen, als sie an ihrem 75. Geburtstag die Kerzen auf ihrer Torte ausbläst. Die Traumfrau, die ihr am nächsten Morgen aus dem Spiegel entgegenblickt, ist daher erst mal ein Schock. Bis Ellie klar wird, dass sie diese Chance nutzen muss. Das Dumme ist allerdings: 29 ist sie nur für 24 Stunden.
»Humor- und gefühlvoll.«
Joy zu »Die zehn besten Tage meines Lebens«
»Göttlich!« InTouch
Die Autorin
Adena Halpern, geboren in Philade lphia, studierte Dramatic Writing an der New York City University und Screenwriting am American Film Institute. Sie arbeitet als Journalistin und Kolumnistin und schrieb unter anderem für Marie Claire und die New York Times. Adena Halpern lebt mit ihrem Ehemann in Los Angeles, wo sie an ihrem nächsten Roman arbeitet.
Fünfundsiebzig
Ich beneidete meine Enkelin.
Natürlich hätte ich das niemals zugegeben.
Angeblich wird man ja mit zunehmendem Alter immer weiser, aber ich fühlte mich kein bisschen weise.
Es heißt auch, es sei ein großer Segen, fünfundsiebzig Jahre alt werden zu dürfen. Das behauptete ich gegenüber anderen zwar selbst immer, aber eigentlich nur, damit ich mich besser fühlte. Ich erzählte den Leuten, das Schönste am Älterwerden sei die Weisheit, die sich damit einstelle. Dabei war das dummes Geschwätz. Allerdings konnte ich das wohl kaum offen zugeben, ohne meine Mitmenschen vollends zu frustrieren. Sie würden schon von selbst dahinterkommen, wenn sie erst mein Alter erreicht hatten. Wenn mir jemand prophezeit hätte, wie deprimierend ich es finden würde, fünfundsiebzig zu sein, ich hätte schon vor Jahren einen Abgang gemacht. Selbstmord? Nein, Gott bewahre. Ich hätte mich auf eine einsame Insel zurückgezogen und meinen Lebensabend ohne die schmerzliche Gegenwart eines Spiegels verbracht.
Ich fragte mich, wieso ich noch kein Heilmittel gegen Krebs erfunden hatte, wenn man mit fünfundsiebzig angeblich so unglaublich weise ist. Wenn ich so verdammt schlau war, warum traute man mir dann nicht zu, dass ich die Erde vor der endgültigen Zerstörung rettete? Warum wurden meine fünfundsiebzigjährigen Freundinnen und ich nicht zu UNO-Sitzungen eingeladen und gefragt, wie man die Welt zum Besseren verändern könnte? Wenn wir schon so klug waren, sollten wir doch die Gelegenheit bekommen, unsere Ansichten kundzutun. Trotzdem wurden wir nie nach unserer Meinung gefragt - und wissen Sie, weshalb? Weil die Sache mit der Weisheit nämlich kein Mensch glaubte. Wenn es jemand getan hätte, dann hätte man uns vielleicht gelegentlich Gehör geschenkt.
Ich fand es grauenhaft, fünfundsiebzig zu sein. Ganz im Ernst. Ich wollte auch diese Geburtstagsparty an jenem Abend nicht, aber meine Tochter Barbara hatte darauf bestanden, eine für mich zu organisieren. Barbara konnte zuweilen eine richtige Nervensäge sein.
Nach allem, was Sie bisher gelesen haben, halten Sie mich vermutlich für eine dieser verbitterten, zerknitterten alten Schachteln, die in Selbstbedienungsrestaurants Süßstoff mitgehen lassen, sich ständig über fiktive Zugluft beschweren oder Obst in den Supermarkt zurückbringen, wenn es angeschlagen ist. So war ich ganz und gar nicht. Ich mochte gar keinen Süßstoff. Meine Enkelin Lucy sagte immer: »Meine Großmutter ist cool.« Ich hielt mich selbst auch für cool. Ich bemühte mich, auf dem Laufenden zu bleiben. Ich verfolgte die Nachrichten, sah mir diese neumodischen Fernsehserien an, obwohl ich sie nicht ausstehen konnte, und versuchte stets, mich modebewusst zu kleiden.
Fünfundsiebzig.
Ich war schon so verdammt alt.
Übrigens fluche ich normalerweise höchst selten, aber im Moment ist das die beste Art und Weise, meine Gefühle auszudrücken.
Meine Freundinnen und ich versicherten einander immer wieder, dass das Alter nur eine Zahl sei.
»Ich fühle mich nicht wie fünfundsiebzig«, sagte Frida, die schon mein Leben lang meine beste Freundin war.
»Ich auch nicht«, log ich, wohl wissend, dass auch sie log. Frida sah eher wie fünfundachtzig aus, und sie benahm sich auch so, aber ich hütete mich, je irgendeine Bemerkung in diese Richtung zu machen.
»Meine Mutter ist eine jung gebliebene Fünfundsiebzigjährige«, erzählte meine Tochter anderen Leuten - in meinem Beisein, wohlgemerkt. Ich hasste es, wenn sie das sagte. Warum tat sie das?
»Weil du so gut aussiehst für dein Alter und ich mit dir angeben will«, meinte sie. Ich fand, mein Alter gehe niemanden etwas an. Wenn ich es jemandem verraten wollte, war das meine Sache, aber meine Tochter hatte nicht das Recht dazu.
»Meine Tochter ist fünfundfünfzig«, sagte ich in solchen Fällen lächelnd.
»Was sollte das denn?«, fragte mich Barbara dann, sobald sich die Leute, die ungefragt mit all diesen Informationen überschüttet worden waren, außer Hörweite befanden.
»Was hast du denn?«, verteidigte ich mich und stellte mich dumm: »Du siehst doch auch gut aus für dein Alter!« Meine Tochter hätte mir niemals vorgeworfen, dass ich das aus Rache tat. So viel Grips traute sie mir gar nicht zu.
Aber was mich ehrlich gesagt so richtig wurmte, war die Tatsache, dass mir noch gut und gern fünfzehn, zwanzig Jahre blieben, um darüber nachzudenken, was ich in meinem Leben alles hätte tun und lassen sollen. Das machte mich traurig. Traurig und wütend.
Ich bereute zum Beispiel, dass ich mich jahrelang in die Sonne gelegt hatte. Uns hatte damals nämlich niemand vor den Gefahren gewarnt. Tja, das gehört wohl zu den Dingen, die man mit zunehmendem Alter lernt. Vielen Dank auch.
Wenn ich daran dachte, wie oft ich unter einer dicken Ölschicht am Pool gesessen hatte, ohne jeglichen UVA- oder UVB-Schutz! So etwas hatte es damals überhaupt nicht gegeben. Ungeschützt in der Sonne zu sitzen galt sogar als gesund. Wir hatten unsere Kinder der prallen Sonne ausgesetzt, weil es hieß, das täte ihnen gut, und wenn sie hinterher einen Sonnenbrand hatten, dann legten wir ihnen einen kalten Waschlappen auf. Von Hautkrebs war damals keine Rede gewesen. Wir hatten nie davon gehört. Inzwischen war Hautkrebs bei meinen Freundinnen und mir eines der wichtigsten Gesprächsthemen. Sobald eine von uns einen klitzekleinen dunklen Fleck an ihrem Arm entdeckte, entspann sich daraus eine mehrstündige Episode von Dr. House, bis der Arzt Entwarnung gab. Im Falle der armen Harriet Langarten hatte es leider keine Entwarnung gegeben. Deshalb hatten wir alle solche Angst. Seitdem gehörte ich zu den alten Damen, die ihren Regenschirm aufspannen, sobald auch nur ein Sonnenstrahl zu sehen ist. Im Laufe der Jahre hatte ich sämtliche Cremes auf dem Markt durchprobiert, um Sonnenflecken und Falten loszuwerden. Ich hatte chemische Peelings über mich ergehen und mir von Dermatologen die oberste Hautschicht vom Gesicht kratzen lassen, um die Schäden zu beheben, die ich mir beim Sonnenbaden in den Siebzigern zugezogen hatte, weil ich für irgendeine Cocktailparty knackig braun und sexy aussehen wollte.
Ich bereute außerdem, dass ich nicht mehr Sport getrieben hatte. Als ich jung gewesen war, hatten Normalsterbliche nicht »trainiert«. Wir hatten gelegentlich Tennis oder Golf gespielt, aber die meiste Zeit trafen wir uns im Country Club zum Bridge, während unsere Ehemänner Golf spielten. Und da die meisten unserer Männer mittlerweile bereits gestorben waren, konnte man davon ausgehen, dass Golf allein als Sport wohl auch nicht ausreicht. Vor ein paar Jahren hatte ich mich mit Frida in einem Fitnessstudio angemeldet, aber alle anderen Mitglieder waren mindestens dreißig Jahre jünger als wir. Wir waren genau ein Mal dort. Stattdessen kaufte ich mir ein Laufband, auf dem ich unzählige Kilometer zurücklegte. Insgesamt war ich darauf inzwischen garantiert bis China und wieder retour marschiert. Ich behauptete immer, ich würde mich wohler fühlen, wenn ich Sport trieb, aber das war gelogen. Mir tat regelmäßig alles weh, die Füße, die Gelenke, der Busen. Es heißt ja immer, Schönheit muss leiden, aber ich kam irgendwann zu dem Schluss, dass ich genug gelitten hatte. Seitdem benutzte ich dieses Folterinstrument kaum mehr.
Ich hatte es auch mit Schönheitsoperationen versucht, um jünger auszusehen - mit Botox und Restylane, mit Collageninjektionen und Elektrolyse. Ich hatte mir das Gesicht liften lassen (SCHMERZ lass nach!) und die Stirn (noch schmerzhafter, und wirkungslos obendrein; die reine Geldverschwendung). Ich sah zwar nicht aus wie einer dieser Hunde, die vor Falten kaum die Augen offen halten können, aber ich ging definitiv nicht als Fünfzigjährige durch, wie der Arzt es mir versprochen hatte. Quacksalber.
Aber von den Äußerlichkeiten einmal abgesehen, gab es auch sonst so einiges, das ich anders gemacht hätte, wenn ich die Zeit hätte zurückdrehen können.
Erstens: Ich hätte eine bessere Ausbildung absolviert.
Es mag verrückt klingen, aber zu meiner Zeit, in den 1950er Jahren, um genau zu sein, war Bildung für Frauen absolut entbehrlich gewesen. Zumindest vertraten unsere Eltern (meine und die meiner Freundinnen jedenfalls) diese Ansicht. Als ich verkündete, ich wolle an der University of Pennsylvania englische Literatur studieren, sagte meine Mutter zu mir: »Du brauchst einen tüchtigen Ehemann«. Sie bestand darauf, dass ich auf die Sekretärinnenschule ging. Also lernte ich Tippen und dachte mir, gut, die Klassiker kann ich ja auch lesen, wenn ich mal allein zu Hause sitze, als müsste ich es heimlich tun; als wäre die Lektüre von James Joyce oder Dylan Thomas unrecht oder unschicklich. Leider hatte ich dann nie die Zeit zum Lesen. Wer hat das schon?
Stattdessen lernte ich meinen Mann kennen.
Das ist auch etwas, das ich anders gemacht hätte, wenn ich gekonnt hätte. Ich hätte meinen Mann nicht geheiratet.
Auch das dürfen Sie auf keinen Fall weitererzählen.
Nicht, dass ich meinen Mann nicht geliebt hätte. Ich habe ihn geliebt, sehr sogar. Er war ein anständiger Kerl. Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, war er nicht der Richtige für mich.
Howard Jerome war ein sehr prominenter Anwalt aus Philadelphia. Als wir uns zum ersten Mal über den Weg liefen, war er Bezirksstaatsanwalt und noch sehr jung, und ich arbeitete als Sekretärin in derselben Kanzlei wie er. Er war nicht der attraktivste Anwalt der Firma, aber er war derjenige, der mich wollte. Howard war klein, kahl und dick, schon damals. Ich hatte mich in einen seiner Kollegen verguckt, Burt Elliot, doch der hatte nur Augen für eine andere Sekretärin, die er dann auch heiratete.
»Du heiratest Howard«, beschloss meine Mutter nach unserem zweiten Date. »Damit gehst du auf Nummer sicher.«
Also heiratete ich Howard.
»Gott sei Dank«, sagte meine Mutter. »Ich hatte ernsthaft befürchtet, du könntest als alte Jungfer enden.«
Da war ich neunzehn. Neunzehn!
Howard war zehn Jahre älter als ich. Im September lernten wir uns kennen, im Juni heirateten wir. So lief das damals. Wenn es Zeit war zu heiraten, dann wurde geheiratet. Ich zog bei meinen Eltern aus und bei Howard ein, ohne je allein gelebt zu haben. Bevor Barbara zur Welt kam, war Howard einmal, ein einziges Mal, zwei Tage geschäftlich unterwegs, und das war bis zu seinem Tod meine erste und letzte Erfahrung mit dem Alleinleben. In diesen zwei Tagen rauchte ich eine halbe Schachtel Zigaretten, und danach hörte ich übrigens ganz damit auf (Rauchen ist nämlich ungesund, und ich verlor im Lauf der Zeit viele Bekannte, weil sie rauchten, also lassen Sie bloß die Finger davon!), und außerdem war ich allein im Kino. Das war das Verrückteste, das ich je unternommen hatte. Wenn ich doch nur ein Mal in meinem Leben etwas richtig Verrücktes tun könnte!
Wie dem auch sei, ein Jahr nach der Hochzeit kam Barbara zur Welt, und vier Jahre darauf mein Sohn Daniel. Danny, wie wir ihn nannten, zog später nach London und nannte sich Daniel. Er war Investment Banker, und er blieb unverheiratet, aber er schien mit seinem Leben zufrieden zu sein. Manchmal wünschte ich mir, er würde nicht ganz so weit weg wohnen, aber solange er glücklich war, war ich es auch. Zugegeben, er hätte ein bisschen öfter anrufen können, aber damit will ich jetzt gar nicht erst anfangen. Barbara hingegen traf dieselben Entscheidungen wie ich. Sie heiratete früh - einen Zahnarzt namens Larry Sustamorn - und brachte eine Tochter zur Welt. Ich hatte ihr geraten, damit zu warten, sich erst einen Job zu suchen, aber sie wollte nicht auf mich hören. Ich hätte darauf bestehen sollen, dass sie arbeiten geht, mit derselben Vehemenz, mit der meine Mutter darauf bestanden hatte, dass ich es nicht tue. Ich bedauerte, dass ich Barbara nicht vermitteln konnte, wie wichtig es ist zu arbeiten, nicht nur des Geldes wegen, sondern um der Tätigkeit selbst willen. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich fand es wunderbar, Barbara und Danny großzuziehen, ich hätte nur vorher gern noch etwas anderes gemacht. Aber ich hatte mit fünfundzwanzig bereits zwei Kinder und ein Haus in einem noblen Vorort von Philadelphia.
Vor zwei Jahren fiel Howard dann im Nate’n’ Al’s Deli in Los Angeles aus heiterem Himmel tot um, als er gerade ein Corned-Beef-Sandwich verspeiste. Das war das Schlimmste, das ich je erlebt habe.
Kein Mensch hatte damit gerechnet. Zugegeben, Howard hatte seit längerem an einer Herzinsuffizienz gelitten; ein Bypass hier, ein Bypass da, aber in unserem Alter waren Herzoperationen etwas derart Alltägliches, dass man sich darüber nicht mehr groß den Kopf zerbrach.
Wenn ich mich mit Bekannten zum Dinner verabredete, bekam ich schon mal zu hören: »Diesen Samstag lieber nicht; Alan hat am Freitag eine Bypass-Operation. Wie wäre es nächste Woche?«
Bei den Prostata-Eingriffen verhielt es sich ähnlich.
Wie dem auch sei, wir waren in Los Angeles gewesen, weil die Tochter meiner Freundin Thelma Punchick zum zweiten Mal heiratete, einen Architekten. Wir saßen beim Essen und unterhielten uns darüber, ob wir lieber ins Getty Museum oder ins Los Angeles County Museum of Art gehen sollten, und da kippte Howard ohne Vorwarnung vornüber in seinen Krautsalat. Ich sagte: »Howard?«
Er reagierte nicht, also wiederholte ich, etwas lauter: »Howard?«
Wieder keine Reaktion.
Ich wusste, dass er tot war, als er da so zusammengesunken auf dem Tisch lag, aber ich war so geschockt von dem Anblick, dass ich eine Sekunde lang dachte: Vielleicht schmeckt ihm ja der Krautsalat so gut … Keine Ahnung, wie ich darauf kam, obwohl der Krautsalat in der Tat sehr lecker war. Dann sprang ich auf und schrie aus voller Kehle:
»HOWARD!«
Sämtliche Anwesenden verstummten. Am Nebentisch saßen zwei sympathisch aussehende Männer um die dreißig in T-Shirts und beigefarbenen Hosen, die zum Glück blitzschnell reagierten. Sie waren mir schon vorher aufgefallen, weil sie beide recht attraktiv waren, so dass ich mich unwillkürlich gefragt hatte, ob sie wohl Filmschauspieler waren. Nun richtete der eine Howard auf und bettete ihn auf die Sitzbank (zum Glück hatte Howard darauf bestanden, in einer der Boxen zu sitzen, sonst hätte man ihn bestimmt auf den schmutzigen Boden gelegt). Der andere junge Mann rief derweil den Notarzt, während ich mich an die Kellnerin klammerte und das Gesicht an ihrer Brust vergrub, obwohl ich sie überhaupt nicht kannte. Ich hätte ihr eine Dankeskarte schicken oder ihr zumindest ein ordentliches Trinkgeld dalassen sollen. Jedenfalls war der arme Howard, als der Notarzt eintraf, bereits dahingeschieden, und ich musste mir überlegen, wie er zurück nach Philadelphia transportiert werden sollte. Sie können sich nicht vorstellen, wie kompliziert es ist, eine Leiche zu überführen, vor allem, wenn man ohnehin völlig von der Rolle ist. Auf dem Rückflug stand der Sarg im Bauch der Maschine, und ich saß oben und hatte meine Handtasche auf den Platz gestellt, auf dem Howard hätte sitzen sollen. Ich fragte mich, ob das womöglich pietätlos war; ob ich den Platz zum Gedenken an Howard lieber hätte leer lassen sollen, aber ich brauchte meine Handtasche, damit ich die Taschentücher griffbereit hatte, weil ich nicht aufhören konnte zu weinen.
Ich weinte nicht nur, weil gerade mein Ehemann gestorben war, den ich geliebt hatte, obwohl er gar nicht der Richtige für mich gewesen war, sondern auch, weil sich Howard immer um alles gekümmert hatte. Ich hatte ihn sämtliche organisatorische Angelegenheiten regeln lassen, wie ich es von meiner Mutter gelernt hatte. Ich hatte mich entspannt zurückgelehnt, während er hinter der Bühne dafür gesorgt hatte, dass alles seinen geregelten Lauf nahm. Wie sollte ich ohne ihn klarkommen? In diesem Augenblick bereute ich mein Leben zum ersten Mal so richtig, und bei dem Gedanken an meine Hilflosigkeit flossen die Tränen jedes Mal erneut in Strömen. Zum Glück hatte ich Barbara und Danny. Barbara war so geistesgegenwärtig, ein Bestattungsunternehmen anzurufen, das sich um Howards Rückführung kümmerte. Ich war heilfroh, dass Barbara für mich da war, wenn ich sie brauchte, was ich ihr gegenüber jedoch nie und nimmer zugegeben hätte. Barbara gehörte nämlich zu den Menschen, die in der Lage waren, solche Komplimente später als Waffe einzusetzen.
Howard fehlte mir wirklich sehr. Mehr als ich gedacht hatte (aber bitte nicht weitersagen, ja?). Wir waren über fünfzig Jahre verheiratet gewesen. Dabei hatten wir nicht das Geringste gemeinsam, als wir heirateten, aber damals ging es einfach darum, einen Menschen zu finden, mit dem man eine Existenz gründen konnte. Und das taten wir. Unser Leben war nicht perfekt, aber was ist schon perfekt? Wenn mich allerdings jemand gefragt hätte, ob Howard meine große Liebe war, dann hätte ich ehrlicherweise antworten müssen: nein. Wer war meine große Liebe? Es war leider zu spät, das herauszufinden. Barbara fand, ich sollte mich wieder mit Männern verabreden. Mit wem denn, bitte schön? Hershel Neal machte mir schöne Augen, seit ich hier eingezogen war. Er lud mich ständig zu sich ein, damit wir uns gemeinsam seine Chopin-Platten anhörten, aber ich gab ihm immer einen Korb. Was sollte ich mit noch einem gesundheitlich angeschlagenen Mann, der jederzeit tot umfallen könnte? Nein, danke, einmal reichte mir.
Howard hatte hart gearbeitet, aber er erlaubte sich dafür auch einiges. Er hatte so manche Affäre in all den Jahren. Er muss mich für ziemlich dumm gehalten haben, wenn er wirklich dachte, es würde mir nicht auffallen, dass seine Hemden nach Parfüm rochen. Nahm er etwa ernsthaft an, ich würde ihm glauben, wenn er behauptete, er müsste am Freitagabend länger arbeiten?
Als Danny und Barbara noch klein waren, wollte ich ihn deswegen verlassen. Ich hätte am liebsten meine Sachen gepackt und wäre mit den Kindern irgendwohin gezogen, wo uns keiner kannte. Wie oft stellte ich mir das vor, wenn ich bei unseren Kindern zu Hause saß, während Howard fremdging. Aber damals tat eine Frau so etwas nicht - man verließ seinen Mann nicht einfach.
Wissen Sie, was man als Frau damals tat? Man hielt den Mund.
Schließlich führte ich ja ein äußerst komfortables Leben. Ich musste mich finanziell nie einschränken. Ich hatte reichlich Haushaltsgeld zur Verfügung, und ich konnte es nach Herzenslust ausgeben. Meine Kinder waren bestens versorgt. Wir unternahmen Reisen, herrliche Reisen in die ganze Welt. Ich habe alles gesehen, vom Eiffelturm bis zur Chinesischen Mauer, und mit dem Schmuck, den mir Howard im Laufe unserer Ehe schenkte, hätte ich mich von Kopf bis Fuß mit Diamanten bedecken können. Barbara und Danny fehlte es nie an etwas. Sie besuchten die besten Schulen, sie verbrachten die Sommer im Ferienlager und später an der Küste von Jersey. Was das anging, war Howard ein großartiger Ehemann und Vater. So gesehen, wäre es eine sträfliche Dummheit gewesen, ihn zu verlassen, und wie gesagt, es kam damals so gut wie nie vor. Heute ist das anders; heutzutage können Frauen einen ordentlichen Batzen Geld verdienen und allein leben. Damals jedoch bekam eine Frau nur eine Kreditkarte, wenn ihr Ehemann ein Konto für sie eröffnete, wussten Sie das? Im Ernst! Deshalb hielt ich den Mund. Selbst jetzt, zwei Jahre nach Howards Tod, hatte ich keinerlei Geldsorgen. Ich hatte alles, was ich brauchte. Howard hatte dafür gesorgt, dass ich immer gut bei Kasse war, und dafür würde ich ihm ewig dankbar sein. Trotzdem wäre es schön gewesen, wenn er mich wie eine gleichberechtigte Partnerin behandelt hätte.
Natürlich konnte ich das nicht einzig und allein Howard zum Vorwurf machen. Es war vielmehr ein Problem meiner Generation. Ehefrauen waren eben gut angezogene, gepflegte Bürger zweiter Klasse. Ich hatte getan, was auch meine Freundinnen taten, um nicht auf der Straße zu stehen: Ich hielt den Mund.
Und zwar unter anderem deshalb, weil … Ich verrate Ihnen jetzt mein allergrößtes, allerdunkelstes Geheimnis, das ich noch nie zuvor jemandem verraten habe. Es kommt mir gerade so vor, als hätte mir jemand ein Wahrheitsserum gespritzt. Also, wollen Sie den wahren Grund dafür wissen, weshalb ich mich nicht beschwerte und mich nicht von Howard scheiden ließ?
Ich beneidete ihn um seine Affären.
Es ist kaum zu glauben, aber damals wurde es quasi gebilligt, wenn ein Mann Affären hatte. Bei Frauen war das natürlich undenkbar. Ich erinnere mich noch genau, wie ich zu meiner Mutter sagte: »Er hat eine andere.«
Worauf sie lediglich die Achseln zuckte und sagte: »Er arbeitet hart, und er sorgt für dich. Thema erledigt.« Und das war’s. Zu dieser Zeit hat man als Frau noch auf die eigene Mutter gehört und ihre Meinung respektiert. Mittlerweile nicht mehr. Ganz recht, du bist gemeint, Barbara!
Was hätte ich damals nicht alles gegeben für eine kleine Romanze.
Wenn mir mit meinen fünfundsiebzig Jahren etwas klar wurde, dann das. Traurig, aber wahr.
Der Sex mit Howard war ganz in Ordnung gewesen; glaubte ich jedenfalls. Es mangelte mir ehrlich gesagt an Vergleichsmöglichkeiten. In meinem ganzen Leben hatte ich mit keinem anderen Mann geschlafen als mit Howard. Wir machten auch nie etwas sonderlich Ungewöhnliches. Die gute alte Missionarsstellung, gelegentlich war auch ich oben, dreimal die Woche, manchmal viermal, wenn Howard danach war. Ich hatte ohnehin nie viel für Sex übrig. Ich fragte mich, ob ich mehr Spaß daran gehabt hätte, wenn ich je mit einem anderen Mann ins Bett gegangen wäre. Ich war ein hübsches junges Ding mit einer tollen Figur; ich hätte jede Menge Männer haben können, wenn ich gewollt hätte. Ich wünschte, ich hätte einen Mann kennengelernt, der mir Liebesbriefe schrieb. Howard hatte mir nie auch nur eine einzige Zeile geschrieben. Sogar auf den Geburtstagskarten hatte seine Sekretärin seine Unterschrift gefälscht. Wie wunderbar und aufregend wäre es gewesen, wenigstens einmal zu spüren, dass mich ein anderer Mann attraktiv fand!
Einmal wäre es tatsächlich beinahe so weit gekommen. Nicht, dass ich mich wirklich auf eine Affäre eingelassen hätte, als mich Russell Minden bei einer Benefizgala für das Philadelphia Museum of Art beiseitenahm und mir sagte, ich sei eine der schönsten Frauen, die er je gesehen habe. Er wollte mich zum Lunch einladen. Das war 1962, und ich war wie gelähmt vor Angst. Ich war überzeugt, jeder auf der Gala könne meine Unterhaltung mit Russell mit anhören, also lachte ich zurückhaltend und lehnte ab. Ich bereute es den Rest meines Lebens. Russell starb vor ein paar Jahren (das böse Wort mit K, an der Bauchspeicheldrüse). Ich schickte gleich eine Spende an das Philadelphia Museum of Art, als ich die Todesanzeige im Philadelphia Inquirer sah, quasi zum Andenken an ihn, und um ihm auf meine Weise zu danken. Ich hatte Russell seit gut zwanzig Jahren nicht gesehen, aber ich werde nie vergessen, wie schön ich mich seinetwegen an diesem Abend fühlte.
Das war noch etwas, was mich wurmte - dass ich keine Ahnung hatte, wie attraktiv ich war. Wenn ich mir später Fotos von damals ansah … Gott, was war ich hübsch. Natürlich hatte man es mir von allen Seiten versichert, aber ich glaubte es nie. Ich wünschte, ich hätte mir mein Aussehen mehr zunutze gemacht. Damals hatte ich für Howard gut ausgesehen. Wenn ich zum Friseur ging und auf mein Gewicht achtete, dann nur für meinen dicken, kahlköpfigen Ehemann, der sich hinter meinem Rücken mit anderen Frauen vergnügte. Wenn ich ein neues Kleid kaufte oder ein neues Parfüm, dann nicht zu meinem eigenen Vergnügen, sondern um von Howard ein Kompliment einzuheimsen. Ich hätte es für mich tun sollen, um mich gut zu fühlen.
Kurz gesagt, all diese Umstände - meine dürftige Ausbildung, mein monogames Liebesleben, meine Ahnungslosigkeit in Bezug auf die Schädlichkeit der Sonnenstrahlung und dazu die Tatsache, dass mir damals nicht bewusst gewesen war, wie schön ich war -, all das zusammengenommen war der Grund dafür, weshalb ich meine Enkelin Lucy beneidete. Sie hatte ihr ganzes Leben noch vor sich, und sie lebte in einer großartigen Zeit. Immer wieder kam ich zu diesem Schluss, während rund um mich mein fünfundsiebzigster Geburtstag gefeiert wurde: dass ich zum falschen Zeitpunkt zur Welt gekommen war. Ich wünschte mir nichts sehnlicher, als Lucy sein zu können.
Sie hätten sie sehen sollen, meine Lucy, auf meiner Party. Sie besaß eines dieser winzigen Telefone, mit denen man Nachrichten empfangen und verschicken kann, und damit beriet sie sich den ganzen Abend mit ihren Freundinnen, wohin sie nach meiner Geburtstagsparty noch ausgehen sollten.
»Immer dieses Handy«, nörgelte Barbara in einem fort, was so viel hieß wie: »Lucy, wir feiern hier den Geburtstag deiner Großmutter. Könntest du dieses Ding mal zwei Minuten weglegen und mit deiner Großmutter anstoßen?«
Mir machte es nicht das Geringste aus, im Gegenteil. Mich hätte bloß interessiert, mit wem sich Lucy wohl verabredete und wohin sie gehen würde.
Ich blinzelte ihr verschwörerisch zu.
Und wie sie angezogen war! Sie trug ein Minikleid und dazu hohe Schuhe mit Plateausohlen und eine Jeansjacke. »Wie eine Nutte«, meckerte Barbara den ganzen Abend. Ich fand, Lucy sah aus wie ein Filmstar. Was hätte ich darum gegeben, mich so anziehen zu können! Lucy hatte eine erstklassige Figur, und sie war tipptopp in Form - ganz anders als ihre Mutter, die mit ihren breiten Hüften und dem üppigen Busen äußerlich eher nach ihrem Vater und dessen Familie kam. Barbara war ständig auf Diät. Allerdings hatte ich den Verdacht, dass sie die meiste Zeit schummelte. Lucy und ich dagegen, wir konnten essen, was wir wollten. Natürlich achtete auch ich auf meine Figur, aber mein Stoffwechsel wurde damit fertig, wenn ich gelegentlich über die Stränge schlug, und bei Lucy war es nicht anders. Manchmal aßen wir zum Abendbrot einfach bloß Eis. Erst vorige Woche hatten wir uns einen großen Becher von Ben & Jerry’s besorgt (die Sorte mit Plätzchenteig und Schokostückchen) und waren darüber hergefallen wie zwei ausgehungerte Hyänen. Lucy sah aus wie ich, als ich in ihrem Alter war. Ich hatte immer schlanke Beine und einen knackigen Po gehabt, genau wie sie jetzt. Alle hatten das gesagt. Doch irgendwann … Ich wusste auch nicht, wie das geschehen konnte, aber mein Körper war … erschlafft. Mittlerweile sah ich aus wie … wie dieses berühmte Bild mit den Uhren von Dalí. An allen Ecken und Enden baumelte, pendelte und hing etwas. Ich war schlank, aber schlaff. Ach, was hatte ich damals für einen hübschen, knackigen Po! Er fehlte mir sehr, mein knackiger Po. Er kam mir irgendwann zwischen dem vierzigsten und dem sechzigsten Lebensjahr abhanden, und ich trauerte ihm immer noch nach. (Ach ja, an dieser Stelle ein Tipp für die jüngeren Semester: Feuchtigkeitscreme! Feuchtigkeitscreme ist wirklich das A und O der optischen Altersvorsorge. Ich schwöre jedenfalls darauf. Sie werden mit fünfundsiebzig zwar trotzdem aussehen wie das Gemälde von Dalí, aber immer noch besser als Ihre gleichaltrigen Freundinnen. Zu dumm, dass ich Ihnen Frida nicht zeigen kann.)
Wie dem auch sei, wir standen uns sehr nahe, meine Enkelin und ich. Sie wohnte wie ich im Zentrum von Philadelphia, nur etwa vier Straßen weiter, und darüber war ich heilfroh. Nachdem Howard gestorben war, gab es nichts mehr, das mich in unserem viel zu großen Haus in der Vorstadt hielt. Ein paar Monate nach seinem Tod fiel mir auf, dass der Boiler draußen hinter dem Haus tropfte. Ich hatte keine Ahnung, dass ein Boiler nicht tropfen sollte. Der Boiler war Howards Baustelle gewesen, und ich hatte ihn in den dreißig Jahren, die wir dieses Haus bewohnt hatten, keines Blickes gewürdigt. Als ich eine Woche später ein Bad nehmen wollte, stellte ich fest, dass es kein heißes Wasser gab, und kurz darauf entdeckte ich im Garten hinter dem Haus eine riesige Pfütze. Ich rief Barbara an, die stante pede vorbeikam und mich rügte, weil ich nicht rechtzeitig einen Klempner geholt hatte. (Gut, rügen ist vielleicht etwas übertrieben, aber sie behandelte mich wie ein kleines Kind. Woher sollte ich denn wissen, dass ein Boiler nicht tropfen darf?) Jedenfalls gab dieser Vorfall endgültig den Ausschlag für meinen Umzug. Ich ließ einen neuen Boiler einbauen und inserierte das Haus noch am selben Tag in der Zeitung, und mein Auto ebenfalls (Bemerkung am Rande: Die Kontrollleuchten am Armaturenbrett dienen nicht nur der Dekoration!). Ich legte mir eine hübsche Wohnung am Rittenhouse Square zu, im selben Haus, in dem auch Frida wohnte, und seither fühlte ich mich bedeutend wohler. Ich verbrachte meine Tage mit Bridge spielen oder besuchte gelegentlich ein Konzert im Kimmel Center, und abends ging ich mit Frida oder anderen Freundinnen, deren Männer bereits gestorben waren, zum Dinner aus. Frida und ich besuchten uns gegenseitig immerzu. Wir hatten eine Menge Spaß, und außerdem konnten wir so ein Auge aufeinander haben. Von meiner Wohnung aus sah man auf den Rittenhouse Square Park hinunter, und wenn die Sonne schien, saß ich oft dort unten auf einer Bank unter einem Baum, um die Zeitung zu lesen.
Barbara war dagegen gewesen, dass ich in die Stadt zog. »Das ist viel zu weit weg von mir«, hatte sie gesagt. »Warum bleibst du nicht hier in der Vorstadt?« Ehrlich gesagt, war es mir ganz recht, dass Barbara in der Vorstadt wohnte. Ich verstand mich zwar ganz gut mit ihr, aber nicht so gut wie mit Lucy. Lucy und ich waren auf einer Wellenlänge, wie es so schön heißt; das würde bei Barbara und mir nie der Fall sein. Ja, ich weiß, ich bin ihre Mutter, aber mal ganz im Vertrauen, es lag nicht ausschließlich an mir, dass Barbara und ich uns nicht so nahestanden.
Bei uns klang jedes Gespräch wie eine Auseinandersetzung. Mit Lucy dagegen konnte ich mich völlig normal unterhalten. Barbara saß mir ständig im Nacken, genau wie ich es bei ihr damals getan hatte, als sie ein Teenager war. »Himmel noch mal, Barbara, ich bin erwachsen und kann sehr gut auf mich selbst aufpassen!«, beschwerte ich mich mit schöner Regelmäßigkeit, aber das ging bei Barbara zum einen Ohr rein und zum anderen wieder raus.
»Wer soll sich denn um dich kümmern, wenn nicht ich?«, fragte sie immer.
»Du musst dich nicht um mich kümmern«, beharrte ich dann, obwohl ich mir da gar nicht so sicher war. Aber ich musste achtgeben, dass sie mich nicht zu sehr bevormundete. Barbara war in vielerlei Hinsicht die weibliche Ausgabe von Howard. Sie traute mir überhaupt nichts zu.
Lucy dagegen hielt mich für eine Frau von Welt. Ich genoss es, von meiner Enkelin so verehrt zu werden. Man stelle sich vor, sie hatte nach dem Uniabschluss sogar den Familiennamen ihres Vaters abgelegt und meinen Nachnamen angenommen! Es war wirklich ein Segen, dass sie nur ein paar Straßen weiter wohnte.
Lucy kam ungefähr zweimal die Woche vorbei, manchmal auch öfter. Sie hatte keine eigene Waschmaschine, deshalb wusch sie bei mir und sah sich derweil ihre diversen Lieblingsserien an. Wenn sie kam, briet ich uns meistens ein Brustfilet, und das verdrückten wir dann vor dem Fernseher. Manchmal ließen wir auch die Wäsche Wäsche sein und gingen in eines der gemütlichen kleinen Lokale hier in der Gegend, in denen es üblich war, dass die Gäste den Alkohol selbst mitbrachten. Dann erzählte mir Lucy von ihrem Liebesleben und ihrem Job als Kleiderdesignerin, und ich hörte mir ihre Klagen über den aktuellen Verehrer an, von dem sie glaubte, sie würde ihn lieben. Sie war fünfundzwanzig und hatte noch keinen festen Freund, und ich fand das völlig richtig. In letzter Zeit erwähnte sie des Öfteren einen gewissen Johnny, aber ich glaubte kaum, dass das etwas Ernstes war. Wie sollte man einen Mann ernst nehmen, der sich Johnny nannte statt Jon oder Jonathan oder John? Barbara bekniete Lucy in einem fort, sich einen Mann zu angeln und endlich sesshaft zu werden, aber ich versicherte Lucy immer wieder, dass sie dafür auch später noch genügend Zeit hatte. Ich lauschte ihren Geschichten über ihre Arbeit und ihre neuen Bekanntschaften, wer ihr welche Kreationen abgekauft hatte und wie viel Stück davon. Sie fragte mich auch oft nach meiner Meinung zu ihren Entwürfen, und ich gab ihr nur zu gern Auskunft. Ich hatte immer in der Modebranche arbeiten wollen, so wie Lucy. Früher hatte ich den Warenbestand von Saks an der City Line Avenue besser gekannt als so manche Verkäuferin. Hester Abramowitz, die beste Freundin meiner Mutter, arbeitete dort jahrelang, praktisch bis zu ihrem Tod. Hester überlebte meine Mutter und ihre Freundinnen um fünfundzwanzig Jahre, und sie behauptete stets, das läge nur an ihrer Arbeit. Ich mochte Hester sehr, und ich dachte immer noch oft an sie. Hesters Tochter Diane, die viel jünger war als ich, bat mich, bei der Beerdigung ihrer Mutter eine kurze Rede zu halten, also sprach ich über Hesters Zeit bei Saks, denn meistens hatte ich sie dort getroffen. Ich erwähnte, wie gewissenhaft sich Hester um ihre Kundinnen, von denen die meisten auch auf der Beerdigung waren, gekümmert hatte. Hesters Stilgefühl war unschlagbar gewesen. Dasselbe sagte man auch von meinem Stilgefühl (ganz meine Meinung übrigens), und das verdankte ich einzig und allein Hester. Ich hatte selbst gelegentlich mit dem Gedanken gespielt, mir eine Stelle zu suchen, aber ich musste mich um Howard und die Kinder kümmern, und obwohl mir dabei eine Vollzeit-Haushaltshilfe zur Hand ging (unsere treue Gladys, die letztes Jahr starb), hatte ich meine Rolle als Hausfrau und Mutter zu spielen. Außerdem galt es damals als eine Schande, wenn eine Frau arbeiten gehen »musste«. Ich hatte das Thema im Laufe der Jahre ein paarmal angeschnitten, aber Howard tat meine Pläne stets lachend ab.
»Wozu brauchst du einen Job? Sind wir etwa arm?«, höhnte er meist.
Nach ihren Besuchen bei mir ging Lucy häufig noch aus. Sie traf sich dann mit ihren Freunden in einer Bar in der Nachbarschaft, und ich hätte alles dafür gegeben, sie begleiten zu können. Manchmal drohte ich ihr im Scherz, ich würde mitkommen, und dann drängte sie: »Du wärst die coolste Lady in der ganzen Bar! Los, los, zieh dich an!« Einmal, ein einziges Mal nur wäre ich gern mit ihr gegangen, um zu erleben, was sie so trieb, wenn sie ausging.
Lucy hatte auch viel mehr Grips, als ihre Mutter es ihr je zugetraut hätte. Barbara wollte unbedingt, dass Lucy Jura studierte, wie Howard, doch ich wusste, das war nichts für meine Lucy. Lucy hatte an der Parsons School of Design in New York City studiert und sogar zwei Jahre für Donna Karan höchstpersönlich gearbeitet, als Assistentin oder so, ehe sie voriges Jahr nach Philadelphia zurückgekehrt war, um sich als Designerin selbständig zu machen. Erwähnte ich schon, dass sie nach dem Studium meinen Nachnamen angenommen hatte? Ich kann mich nicht erinnern. Das kommt öfter vor in meinem Alter. Nun, ich muss sagen, Lucy Jerome machte sich als Modemarke bedeutend besser als Lucy Sustamorn. Ist das nicht ein grässlicher Familienname? Als Barbara ihren Zukünftigen damals das erste Mal mit nach Hause brachte und er sich uns als Larry Sustamorn vorstellte, dachte ich: Sustamorn? Gütiger Himmel, das klingt ja fast wie Zystenmann, wenn man es hastig ausspricht. Aus Lucy Sustamorn wurde also Lucy Jerome, und obwohl Barbara erst etwas gekränkt war, fand sie sich am Ende damit ab. Schließlich gab es Lucys Kreationen in einigen der teuersten Läden von Philadelphia zu kaufen, darunter Plage Tahiti und Knit Wit und Joan Shepp. Und der Einkäufer der neuen Barneys-Filiale am Rittenhouse Square hatte ebenfalls bereits Interesse signalisiert. Barneys!
Hach, was war ich stolz auf meine Enkelin.
Lucy ließ sich gern von meinen alten Kleidern zu ihren Kreationen inspirieren. Meine Schränke zu inspizieren gehörte zu ihren Lieblingsbeschäftigungen. Meine Sammlung konnte sich aber auch wirklich sehen lassen. Als ich aus unserem Haus am Stadtrand ausgezogen war, war dort jeder einzelne Schrank bis oben hin mit meinen Sachen vollgestopft. Der Schrank in Dannys ehemaligem Zimmer mit meinen tollen Ballkleidern, der in Barbaras Zimmer mit den Chanel-Kostümen und den Halston-Hosenanzügen aus den sechziger und siebziger Jahren. Meine Pelze (aus der Zeit, als das Tragen von Pelzmänteln noch nicht verpönt gewesen war und man keine Angst vor Farbattacken haben musste) und die anderen Wintermäntel hingen im Garderobenschrank, und in meinem eigenen Schrank waren die Kleider und Schuhe untergebracht, die ich jetzt trug.
»Das könntest du alles versteigern!«, hatte Barbara bemerkt, als ich anfing, meine Sachen für den Umzug zu packen.
Aber das hätte ich nicht übers Herz gebracht. Meine Kleider erinnerten mich an all die schönen Zeiten. Ich besaß keine verstaubten alten Fotoalben; diese Schränke enthielten mein gesamtes Leben: mein Ballkleid von Oscar de la Renta; mein James Galanos, asymmetrisch und mit Pailletten bestickt, ein Traum in Weiß, den ich mir in den achtziger Jahren für eine Gala in New York gekauft hatte. Howard hatte damals gemeint, ich hätte nie schöner ausgesehen. Ich hätte mich niemals davon getrennt, von keinem von ihnen. Nur über meine Leiche.
Also hatte ich mir eine Dreizimmerwohnung gekauft und eines der Zimmer zum begehbaren Kleiderschrank umbauen lassen. Es dauerte über drei Monate, bis alles so aussah, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber als die Schreiner endlich fertig waren, hätte ich am liebsten rund um die Uhr dort drin gesessen. Barbara verstand das nicht. Lucy schon.
Mit Lucy hätte ich den ganzen Tag in meinem begehbaren Schrank verbringen können. Sie fertigte Skizzen von manchen meiner Kleider an. Eines kopierte sie sogar, ein rosafarbenes Etuikleid von Lilly Pulitzer, das ich mal auf einer Reise nach Palm Beach, Florida gekauft hatte. Das war in den sechziger Jahren, noch bevor sich Lilly Pulitzer in der Modewelt einen Namen gemacht hatte.
Lucy nannte es das »Ellie Jerome«-Kleid.
Sie benannte es nach ihrer Großmutter.
Wenn ich an meine Enkelin dachte, fing ich an zu strahlen.
Und genau deshalb beneidete ich sie.
Da saß ich nun also im Prime Rib, um meinen fünfundsiebzigsten Geburtstag zu feiern, und dachte in einem fort, wie gern ich die Zeit zurückdrehen und mein Leben noch einmal leben würde, in der heutigen Zeit. Und sei es nur für einen Tag. Wenn ich doch nur noch einmal einen Tag lang meinen knackigen Po und meine glatte, gebräunte Haut wiederhaben könnte … einmal jemanden lieben, wild und leidenschaftlich; jemanden, der nur darauf bedacht ist, mich zu verwöhnen … Es ging mir nicht um ein ganzes Leben; so gierig war ich dann auch wieder nicht. Ich wünschte mir bloß einen Tag Urlaub von meinem trostlosen Dasein als alte Schachtel, um all das nachzuholen, das ich verpasst hatte, und um die Dinge, die ich als selbstverständlich hingenommen hatte, etwas mehr schätzen zu lernen. Ich war jetzt exakt 27 375 Tage alt. Das hatte ich am Morgen mit dem Taschenrechner ausgerechnet. War es denn zu viel verlangt, wenn ich einmal alles hinter mir lassen, einen Tag blaumachen und so richtig auf die Pauke hauen wollte? War das nicht ein toller Wunsch? Und so kreativ. Ich hätte gern jemandem davon erzählt, aber leider muss man seine Wünsche ja für sich behalten, sonst gehen sie nicht in Erfüllung. Ha!
Während ich so über meinen Wunsch nachsann, kamen Barbara und Lucy mit einem riesigen Geburtstagskuchen auf mich zu.
»Es haben beim besten Willen nicht mehr als neunundzwanzig Kerzen draufgepasst«, scherzte Barbara unüberhörbar. Manchmal raubte sie mir wirklich den letzten Nerv.
Also blies ich meine neunundzwanzig Geburtstagskerzen aus.
Und ich wünschte mir dabei, noch einmal neunundzwanzig sein zu können, nur einen Tag lang.
Wenn ich diesen einen Tag bekäme, würde ich alles ganz anders angehen.
Diesmal würde ich alles richtig machen.
Ich würde nie wieder etwas bereuen.
Heiliger Strohsack!! Ich bin ein Männertraum!!!
Der erste Hinweis heute Morgen war mein Busen.
Ich schlief stets auf dem Bauch, und ich hatte mich längst daran gewöhnt, dass meine Brüste über Nacht in meine Achselhöhlen rutschten und ich sie erst einmal zurechtschieben musste, wenn ich aufwachte.
Als mich an diesem Morgen Barbaras Anruf aus dem Tiefschlaf riss, griff ich daher instinktiv nach meiner linken Brust, und bei dieser Gelegenheit stellte ich fest, dass sie sich nicht wie üblich irgendwo im Abseits befand, sondern dort, wo eine Brust normalerweise hingehört.
Das hätte mich stutzig machen müssen, aber noch dachte ich mir nichts dabei. Es war quasi der erste Hinweis darauf, dass sich über Nacht etwas geändert hatte, doch das wurde mir erst später klar.
Allerdings fiel mir sehr wohl auf, dass ich scharf sehen konnte.
Nachdem ich die Augen aufgeschlagen und nach meiner Brust getastet hatte, warf ich nämlich einen Blick auf den Digitalwecker auf meinem Nachttisch und sah, dass es halb neun war. Das kam mir dann doch etwas seltsam vor. Schließlich bin ich seit meinem fünfzigsten Lebensjahr praktisch blind wie ein Maulwurf. Mein erster Gedanke war: Du bist wieder mit der Brille auf der Nase eingeschlafen. Das passierte mir oft, nur verrutschte sie sonst immer, weil ich ja auf dem Bauch schlief. Meine Brille war von Versace; Schildpatt und ziemlich groß. Ich spähte noch einmal zum Wecker und tappte mir dann auf die Nase. Nichts. Ich fand meine Brille in der Nachttischschublade. Vielleicht hatte ich mir ja bloß eingebildet, dass ich den Wecker gesehen hatte. Ich war wohl noch ziemlich verschlafen.
Also richtete ich mich im Bett auf und schob mir die Brille auf die Nase, worauf alles um mich herum plötzlich verschwamm.
Ich nahm sie wieder ab.
Und sah meine Umgebung wieder klar.
Ich setzte die Brille erneut auf.
Verschwommen.
Mir fiel Bernice Zankhower, eine Bekannte meiner Freundin Lois Gordon ein, die eines schönen Morgens feststellen musste, dass ihre Füße über Nacht um eine halbe Schuhgröße geschrumpft waren. Wer weiß, vielleicht war das hier ja ein ähnliches Phänomen.
Das Telefon hatte die ganze Zeit über unablässig geklingelt. Jetzt nahm ich den Hörer ab. Es war Barbara, wer sonst.
»Na, war das gestern ein Geburtstag nach deinem Geschmack?«, fragte sie.
»Oh ja, Liebes«, antwortete ich. An diesem Morgen hatte ich noch keinen Ton von mir gegeben, und doch klang meine Stimme ungewöhnlich hell und jugendlich. Spätestens jetzt hätte ich Verdacht schöpfen müssen, aber ich dachte mir wiederum nichts dabei. Wie auch - wer kommt denn schon auf die Idee, dass so etwas tatsächlich geschehen könnte? Selbst Barbara war die Veränderung nicht entgangen.
»Heute klingst du jedenfalls um einiges entspannter«, bemerkte sie.
»Ich fühl mich auch entspannter«, sagte ich.
Mit diesen Worten schlüpfte ich in meine Pantoffeln. Dabei hätte mir, wenn ich nicht so schwer von Begriff gewesen wäre, auffallen müssen, dass meine Zehen nicht mehr verformt waren vom jahrelangen Tragen zu enger Stöckelschuhe und die Krampfadern, die ich nach der Geburt der Kinder bekommen hatte, verschwunden waren. Doch ich registrierte lediglich, dass meine Pediküre noch erstaunlich gut aussah nach einer Woche, ein Rekord. Und auch darüber zerbrach ich mir nicht weiter den Kopf. Ich war abgelenkt von Barbaras Geschwafel.
»Sah Lucy nicht fürchterlich aus gestern?«, klagte sie. »Wie sie sich manchmal anzieht! Ich weiß, du findest die Sachen, die sie trägt, oft ganz hübsch, aber sei doch mal ganz ehrlich, Mutter …«
Es gab schon so viele Hinweise, die mir hätten zu denken geben müssen, ehe ich vor den Badezimmerspiegel trat, aber wer nimmt schon gleich morgens nach dem Aufstehen seinen Körper kritisch ins Visier? Trotzdem hätte ich ohne Barbaras Gejammer vielleicht bemerkt, dass sich die Altersflecken auf meinen Händen verflüchtigt hatten, genau wie die hässlichen Spuren der Sonne auf meinem Dekolletee. Meine Oberarme waren muskulös; verschwunden die »Fledermausärmel«, die sonst im Wind flattern, sobald ich die Arme hebe.
»Und mein Steak war nicht richtig durch«, fuhr Barbara fort, während ich das Bad betrat.
»Nun hör schon auf, Barbara. Es war alles in bester Ordnung.«
»Trotzdem finde ich, dass wir länger als nötig auf das Essen gewartet haben. Deine Freundinnen sahen aus, als würden sie vor Hunger gleich vom Stuhl kippen.«
Ich gebe zu, Frida hatte tatsächlich deutlich hörbar der Magen geknurrt, aber sie sollte ohnehin etwas abspecken. Vor den Wechseljahren hatte sie stets Größe achtunddreißig getragen, bis sie dann vor gut fünfundzwanzig Jahren von einem Tag auf den anderen aufgegangen war wie ein Hefeteig, und so sieht sie heute noch aus.
»Na egal. Ich rufe an, weil du, glaube ich, noch meine Sonnenbrille hast«, fuhr Barbara fort. »Du hast sie für mich eingesteckt, weil in meiner Handtasche kein Platz mehr war. Kannst du mal nachsehen?«
»Moment«, murmelte ich, ohne mein Spiegelbild eines Blickes zu würdigen.
Meine Handtasche stand wie immer auf dem Tischchen im Vorraum, unter dem Spiegel, den Howard und ich vor einer Ewigkeit auf einem Flohmarkt in Paris erstanden hatten. Ich liebe diesen Spiegel. Er zierte schon früher, in unserem Haus in der Vorstadt, die Eingangshalle, und auch jetzt hängt er wieder neben der Wohnungstür.
»Hast du sie? Dann komme ich kurz vorbei«, sagte Barbara. »Bei der Gelegenheit könnten wir gleich einen Happen essen gehen.«
»Warum nicht«, erwiderte ich. »Was hältst du davon, wenn wir ins …« Während ich überlegte, wo wir uns zum Lunch treffen sollten, warf ich einen Blick in den Spiegel.
Und da sah ich mich zum ersten Mal.
»HEILIGER STROHSACK!!!« Ich kann mich nicht entsinnen, jemals so laut geschrien zu haben.
»WAS IST PASSIERT?«, stieß Barbara am anderen Ende der Leitung hervor.
Mein erster Gedanke war: Da steht jemand hinter dir. Also fuhr ich wie der Blitz herum. Nichts. Da war niemand.
»MUTTER! IST ALLES OKAY BEI DIR?«
»Gütiger HIMMEL!«
»WAS IST DENN LOS, MUTTER? SOLL ICH DIE POLIZEI RUFEN?«
Ich stand da und brachte keinen Ton heraus, während Barbaras panische Stimme aus dem Hörer drang. Ich starrte die Frau im Spiegel an. Wer war sie? Was war geschehen? Träumte ich?
Die Originalausgabe 29erscheint bei Simon & Schuster, New York.
Vollständige deutsche Erstausgabe 10/2009
Copyright © 2009 by Adena Halpern Copyright © 2009 der deutschen Ausgabe
by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlagillustration und Umschlaggestaltung: © Eisele Grafik-Design, München
eISBN : 978-3-641-03512-5
www.heyne.de
Leseprobe
www.randomhouse.de





























