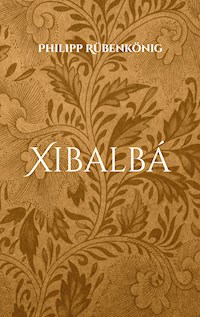
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Suizid als Dienstleistung, ist das möglich? Diese und einige andere existenzielle Fragen stellt sich David, der nicht weiß, was er mit seinem Leben anfangen soll. Also macht er sich in seiner Verantwortungslosigkeit auf, seine Unendlichkeit zu verschwenden...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 285
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Paradies des Wilden Mannes
von
Dr. Stefan Lindl
Dicht behaart, ansonsten nackt, mit einer Keule in der Hand, das ist der Wilde Mann, der in allen Kulturen weltweit existiert. Im Himalaya lebt der Yeti, in Europa sind es die Wilden Männer. Rübezahl ist einer von ihnen, viele andere halten Wappenschilde von Königen und Herzögen. Urmenschen, Waldgeister ungeschliffen, ungehobelt, kulturlos fern der Zivilisation und doch beneidenswert unbeschränkt, einfach paradiesisch zeigen sich in den Märchen und Geschichten. Allein und einsam leben sie glücklich oder unglücklich mit sich, vermeiden soziale Kontakte. Enttäuscht werden können sie mit ihrer Lebensweise nicht. Vielleicht sind sie in ihrer Einsamkeit glücklicher als die Anderen. Eremiten sind ihnen in vielem nicht unähnlich. Wilde Männer symbolisieren Kraft, Wildheit. Der ‚Émile‘ Jean-Jacques Rousseaus hat etwas von diesen Wilden Männern. Die beiden prominenten Brüder Romulus und Remus sind sowieso Wilde, wilde Kinder von einer Wölfin erzogen. Kaspar Hauser ist auch einer von ihnen. Wilde Männer, Frauen, Kinder finden sich in Geschichten. Oft verstecken sie sich, sind nicht sofort erkennbar, wie in Xibalbá.
Xibalbá zeigt einen Wilden Mann im unbestimmten urbanen Raum. David, der Alleinige, David, der Einsame, David, der Existierende, David, dessen Sinn des Lebens nicht einmal das Leben ist, David, der Herr über Leben und Tod. Eine unbeugsame Figur stellt uns Xibalbá vor. Doppelgesichtigkeit ist die Eigenschaft dieses Wilden. Er moralisiert, zeigt sich als unbarmherziger Richter und erweist sich selbst als ein verwerfliches schwaches Wesen, das voller Verachtung und Misanthropie auf die Welt blickt. Ohne moralischen Kompass, ohne Ziel vegetiert er vagabundierend in einer rechtsstaatlichen Gesellschaft, ohne sich als dessen Teil zu erkennen, ohne Identität zu entwickeln. Wie jedes Kind war auch David hoffnungsvoll ins Leben hineingeworfen worden. Es hätte etwas aus ihm werden können, aber dann hat er sich dem Erfolg rechtzeitig verweigert. Er ist ein Individuum geworden, das nicht mit, sondern in der Gesellschaft lebt, abgeschottet ohne Kultur, Kultiviertheit und zivilisatorischer Errungenschaften. Der Wald der Wilden Männer verhält sich zu Xibalbá so, wie die Stadt zu David. So steht die Hauptfigur von Xibalbá in langen erzählerischen Traditionslinien. Vielleicht passt auf David eine Spielart der Wilden Männer: Er scheint ein tötender Werwolf zu sein. Wenn er nicht trinkt, vernichtet er Leben. Er hilft suizidwilligen Menschen. Über ein schlechtes Gewissen verfügt er nicht. Das liegt an seiner Einsamkeit. Weil er selbst allein ist, hatte er übersehen, dass andere Menschen, sich durch soziale Bindungen definieren und durch Liebe gekettet sind. Liebe kennt David nicht. Da er nicht liebt, umgeben ihn keine geliebten Menschen. Geliebte Menschen fühlen Schmerz und trauern über den Tod. Er nimmt Geld für seine Dienstleistung. Er nimmt es gerne, leistet sich ein angenehmeres Leben, als er es zuvor hat führen können. Doch die Folgen seiner Dienstleistung begreift er spät: der Schmerz der anderen. Ob der wilde Stadtmann David wild bleibt oder sich der Gesellschaft und ihren Gesetzen unterwirft, verrät allein ein Blick in die groteske Geschichte des David in Xibalbá.
Wichtige Vorbemerkung des Autors:
Bevor Sie, geneigter Leser, beginnen, dieses Buch zu lesen, möchte ich Ihnen eines noch mit auf den Weg geben. Dieser Roman soll niemanden verleiten, niemanden motivieren und vor allem will der Roman nicht als Legitimation verstanden werden, sich in irgendeiner Art und Weise etwas anzutun. Befindest Du Dich, lieber Leser, in einer scheinbar ausweglosen Situation - hole Dir Hilfe, denn diese gibt es. Halte Dir ferner immerzu vor Augen - jemand liebt Dich und Du bist nicht alleine!
Inhaltsverzeichnis
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Kapitel
Letztes Kapitel
1.
Stumpfer Regen drückte flache Pfützen in den rauchgrauen Asphalt, über den ich übermüdet rannte. Natürlich trat ich in eine der zahlreichen Pfützen. Zeit, um mich darüber aufzuregen, hatte ich nicht, denn ich hatte wieder einmal verschlafen und es blieben mir noch genau vier Minuten bis zum Beginn meiner Schicht in einem gutbürgerlichen Restaurant.
Warum ich diesen Job überhaupt machte, konnte ich gar nicht sagen. Persönliche Erfüllung oder Hingabe waren jedenfalls nicht der Grund. Vielmehr war es die Angst vor dem Verhungern, die Angst vor dem Scheitern, dem erneuten Versagen, die mich täglich zur Arbeit trieb.
Als ich damals auf das Gymnasium kam, prophezeiten mir meine Eltern eine rosige Zukunft, vollgestopft mit Perspektiven und Freiheiten. Diese gab es allerdings erst nach dem Abitur.
Dann, eben nach dem bestandenen Abitur, wollte ich mich gerade daranmachen, das verheißungsvolle Tor aufzustoßen, hinter dem sich all die angepriesenen Dinge verbargen, da wurde ich von meinen Eltern wieder auf einen späteren Zeitpunkt vertröstet.
„Jetzt musst du dich nur noch ein paar Jährchen reinknien. Sobald du deinen Master oder besser deinen Doktortitel hast, dann ist deine Zeit gekommen.“
Was ich studieren sollte, war selbstverständlich auch schon geklärt.
Etwas mit Zukunft. Zwar unternahm ich den zaghaften Versuch, meine Eltern davon zu überzeugen, dass ich etwas studieren sollte, was ich auch wirklich wollte, doch dieser wurde mit einem gekonnten wie ignoranten „Wir werden wohl wissen, was gut für dich ist“ abgewehrt.
Dementsprechend quälte ich mich einige Jahre durch das verhasste BWL-Studium.
Dessen größter Erfolg war der Abbruch nach vier oder fünf Semestern. Dort begriff ich eines zum ersten Mal in meinem Leben: In diesen Momenten, in diesen Augenblicken der völligen Verantwortungslosigkeit, da war ich frei und konnte mich vertrauensvoll in das sanfte, weiche Nichts fallen lassen.
Endlich musste ich mich um nichts mehr kümmern, um irgendetwas sorgen. Ich konnte einfach sein, konnte mich einfach auf den Wellen der Existenz treiben lassen. Ontologisches Treibholz sein, wenn man es so sagen will. Wie man sich nur höchst unschwer vorstellen kann, strandete ich sehr schnell auf den Sandbänken der Realität.
Da ich mich nicht mehr um mein Studium kümmern musste und daher viel Zeit hatte, fassten meine Eltern recht zügig den Entschluss, mir sämtliche Unterstützung zu verwehren, die sie mir bis dahin zur Verfügung gestellt hatten.
Nun sah ich mich also gezwungen, mir irgendeine Arbeit zu suchen. Das Diffizile hieran war nicht, eine Arbeit zu finden, denn das war relativ schnell bewerkstelligt; vielmehr war das Behalten der Arbeit mein Problem. Ich hangelte mich von einem Gelegenheitsjob zum nächsten. Gerade war ich Spüler in einem nichtssagenden gutbürgerlichen Restaurant.
Jetzt stand ich hier lustlos, durchnässt und obendrein verspätet zwischen hektisch klapperndem Geschirr und gereizt köchelnden Töpfen.
Dichter Dunst hing in der Luft und vernebelte mir meine ohnehin schon eingeschränkte Sicht.
„Da bist du ja endlich!“, schnauzte mich der dicke Koch mit einer überaus feuchten Aussprache an. „Dachte schon, du bist dir zu fein für diese Arbeit.“
Meine Antwort bestand lediglich aus einem abwesenden Kopfschütteln. Jeder Mensch kennt doch diese alltägliche Tragödie, an einem Ort zu sein, ohne dort sein zu wollen. Man ist in seinem eigenen Alltag eingekerkert und fristet sein Leben zwischen Pflichten und Terminen. Da man sich selbst dort reingebracht hat, gibt es auch keine Wachen, die man bestechen könnte, um seine Haftbedingungen zu verbessern. Im Grunde ist jeder Mensch in seiner Existenz gefangen. Einzelhaft, versteht sich.
„Hey, David! Beweg dich!“, fuhr der Koch mich an, eine fettige Haarsträhne im nachlässig rasierten Gesicht hängend.
Mechanisch griff ich nach den dreckigen Töpfen und dem schmutzigen Geschirr und stopfte alles in den Spüler. Zwei Minuten Zeit, in denen ich meinen Gedanken restlos ausgesetzt war. Wenn ich mir die Vielzahl von Spülvorgängen ins Bewusstsein rief, die ich im Beisein der Maschine verbracht hatte, dann drängte sich mir die Frage auf, ob die Redewendung „Vom Tellerwäscher zum Millionär“ nicht schon längst obsolet war. Niemand von uns ist in der letzten Instanz unersetzlich, denn will oder kann man eine Arbeit nicht tadellos verrichten, dann wird sich mit Sicherheit eine Maschine finden, die es kann.
„David! Warum bist du überhaupt gekommen, wenn du nur die Kacheln zählst, anstatt zu arbeiten?“
„Wieso schreist du rum, anstatt zu kochen?“, knurrte ich kaum hörbar mit gesenktem Kopf.
„Was hast du gerade gesagt?“
„Nichts.“
Der Koch rümpfte missbilligend seine knollenförmige Nase. „Das will ich dir auch geraten haben.“
Lust- und energielos verrichtete ich meine Arbeit, ohne großartig darauf zu achten, was um mich herum passierte oder ob ich meine Aufgaben richtig erledigte.
Gemeinhin bezeichnet man diesen Zustand, denke ich, als Funktionieren.
2.
Ein elementarer Teil meiner Arbeit bestand, neben dem Spülen und Verräumen von Geschirr, im Schälen und Schnippeln von Gemüse. Egal, ob es Kartoffeln, Karotten oder Zwiebeln waren - alles hatte ich zu bearbeiten, zu zerteilen und herzurichten.
Dazu wurde ich hinunter in den „Kerker“ geschickt, einen geräumigen Kellerraum, der wie eine weitere Küche eingerichtet war. Der trennende Unterschied war allerdings ein massiver Edelstahltisch in der Mitte des Raumes. An diesem Tisch schnitten, schälten und hakten ständig irgendwelche Küchenhilfen und Spüler.
Manchmal stand auch der dürre Beikoch an dem Tisch und zerteilte, filetierte oder tranchierte etwas. Meistens war es ein totes Tier. Das Bearbeiten von Fleisch war für uns Küchenhilfen ein absolutes Tabu. Wenn der Koch einen von uns Spülern auch nur in der Nähe des Fleisches sah, bekam er einen standesgemäßen Schreikrampf. Auch im generellen Umgang mit Mitarbeitern war der Koch nicht weniger garstig. Ganz besonders hatten esihm die ausländischen Mitarbeiter angetan. Jeder, der kein Muttersprachler war, wurde in unregelmäßigen Abständen grundlos niedergemacht. So war auch die erste Frage, die er mir stellte: „Ey?!
Bist du ‘n Deutscher? Noch mehr Kanaken kann ich hier nicht gebrauchen!“ Bei Frauen, beispielsweise bei der vietnamesischen Spülerin, blieb es nur bei hässlichen Worten. Männern mit ausländischem Aussehen oder Akzent trat der Koch nicht so gnädig gegenüber. Von Gewalt zu sprechen, wäre zu weit gegriffen, aber es flogen gerne mal Töpfe und anscheinend gab es vor meiner Einstellung einen Vorfall mit einem Spüler und einem Kochlöffel. Nähere Details habe ich nie erfahren. Besonders aber Sven, der hagere Beikoch, stand im Fokus seiner Attacken. Es fing schon damit an, dass Sven gar nicht sein richtiger Name war. Zwar hatte ich ihn in einem unbeobachteten Moment nach seinem richtigen Namen gefragt, aber zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich mir den ellenlangen Namen beim besten Willen nicht merken konnte. Also blieb es notgedrungen bei Sven. Ein weiteres Rätsel blieb seine Herkunft. Niemand wusste so richtig, wo Sven ursprünglich herkam. Er selbst nährte diesen Mythos, da er sich diesbezüglich in tiefes, vieldeutiges Schweigen hüllte.
Mir gegenüber war Sven stets höflich, fast schon devot.
Vielleicht lag das daran, dass ich ihn im Gegensatz zum Koch nicht wie einen räudigen Hund behandelte.
In einer unserer sehr wenigen Pausen, die wir hatten, hockten wir gemeinsam auf der Treppe des Hinterausgangs.
Gekonnt zückte Sven eine Zigarette und zündete sie an, dann zog er eine weitere aus der Schachtel und hielt sie mir auffordernd hin: „Nimm!“
„Nein danke, ich rauche nicht.“
Fast schon enttäuscht nickte er und steckte die Zigarette wieder weg.
„Sag mal, Sven …“, ich knirschte mit den Zähnen. „Wieso hast du dich nicht schon längst gegen den Koch gewehrt?“
Sven zog kräftig an seiner Zigarette.
„Ich scheiß' auf den. Ich lerne, was er kann, bis ich es selber kann. Denn weissch‘ …“, er unterbrach sich mit einem weiteren Zug. „Eines Tages ich werde ein eigenes Restaur…“ Er stolperte über dieses Wort, machte wirbelnde Handbewegungen. „Eigenes Lokal werd' ich haben.“ Ich nickte langsam.
Sven zeigte mit dem glimmenden Ende seiner Kippe auf mich. „Willsch' du auch mal ein … Lokal?“
Mit unbeabsichtigter Arroganz stieß ich Luft aus. „Ne. Sicher nicht.“ Er runzelte seine Stirn. „Wieso arbeitsch' dann hier?“
Ich zuckte mit den Schultern.
„Irgendwoher muss das Geld doch kommen, oder?“ Nachdem Sven an seiner Zigarette gezogen und den Rauch langsam ausgestoßen hatte, sah er den Hinterhof entlang und fragte vorsichtig: „Hasch keine Träume?
Willsch's zu nix bringe?“
„Zu etwas bringen …“, wiederholte ich halblaut, um etwas Zeit zu gewinnen, denn ich wusste schlichtweg keine Antwort auf diese Frage. „Ich weiß es nicht.“
„Träume muss ma' doch haben. Ohne Träume isch ma' doch kein Mensch, oder?“
Die fette Silhouette des Kochs erschien im Hinterausgang: „Genug gefaulenzt!
Zurück an die Arbeit! Vor allem du, Sven!
Scheiß Zigeuner!“, schrie er in einer völlig unangebrachten Lautstärke.
Der Angesprochene schnippte gekonnt seinen Zigarettenstummel in den Hinterhof, klopfte mir im Aufstehen beiläufig auf die Schulter und quetschte sich dümmlich grinsend am Koch vorbei hinein in die Küche.
Der Koch tippte mir mit seinen verdreckten Schuhen gegen die Nieren.
„Und du? Brauchst du eine Extraeinladung?“
Ohne zu antworten, erhob ich mich und folgte Sven in die Küche.
Die folgenden Wochen verbrachte ich in dem Zustand, in dem man sich über sein eigenes, sein wahres Ich erhebt und nur noch in blindem Aktionismus aufgeht. So ist das - Aktionismus verwässert die eigene Existenz. Eine Antwort auf Svens Frage fand ich in all dieser Zeit aber nicht.
Hin und wieder, meistens während der Arbeit, dachte ich intensiv über seine Frage nach. Hatte ich Träume? Ja, ich hatte Träume, bevor sie erbärmlich an der Krankheit „Realität“ krepierten. Ich versuchte, mich an meinen letzten Traum, den ich gehabt hatte, zu erinnern.
Minutenlang durchforstete ich mein Gedächtnis, grub in meinen Erinnerungen, jedoch ohne Erfolg. Als Kind wollte ich professioneller Fußballspieler werden, aber das ließ ich nicht gelten. Immerhin ist es das Vorrecht der Kindheit, träumen zu dürfen, Träume zu haben und diese auch zu pflegen. Danach kam nicht mehr viel an Träumereien. An Hirngespinsten sicherlich, aber an wirklichen, echten Träumen nicht mehr. Es war ein Donnerstag, kurz vor Ende meiner Schicht, als der Betreiber des Restaurants mich beiseitenahm.
„Auf ein Wort, David, wir müssen etwas besprechen.“
„Okay“, gab ich lustlos zurück. „Worum geht es?“
Mein Chef sah mich mit väterlicher Strenge an und atmete einmal tief durch.
„Ich mache es kurz, David, ich muss dich entlassen.“
Obwohl ich mit so einer Nachricht schon seit einiger Zeit gerechnet hatte, erschrak sie mich doch.
„Was? Wieso das denn? Ich war fast immer pünktlich.“ Mehr fiel mir zur Stärkung meiner Position nicht ein.
„Es gab in letzter Zeit immer häufiger Beschwerden wegen deiner Sorgfalt und vor allem wegen deiner Schnelligkeit. Wir sind hier in einer Küche und du bist einfach zu langsam. Die Mitarbeiter haben sehr oft das Gefühl, dass du gar nicht bei der Sache bist.“
Wut stieg in mir auf. „Von wem? Wer hat sich beschwert?“
„Das ist doch nicht wichtig, David.“
„Das finden Sie vielleicht.“
„Ja. Und glücklicherweise bin ich der Boss.“
„Sie können mich nicht feuern.“
Langeweile machte sich auf dem Gesicht meines Vorgesetzten breit. „Und wieso nicht?“
„Weil, weil …“, stammelte ich. „Was soll ich denn sonst machen?“
„Auf Wiedersehen, David. Alles Gute für deine Zukunft.“
Wie verwunderlich die Schärfe des Schmerzes doch ist, wenn man eine Sache verliert, selbst wenn diese einem widerwärtig ist. Überhastet lief ich zu meinem Spind, raffte meine wenigen Habseligkeiten darin zusammen und stopfte sie in meinen Rucksack.
„Hat der Chef endlich durchgegriffen?“, fragte der Koch hämisch an die Spinde gelehnt. Ein schmieriges Grinsen überzog sein Gesicht und brachte seine zimtfarbenen Zähne zum Vorschein. Doch jetzt, endlich, musste ich mich nicht mehr zügeln. Jetzt war der Zeitpunkt gekommen, an dem ich meine Gefühle nicht mehr verstecken, nicht mehr verleugnen musste. „Halt einfach deine Fresse!“, fuhr ich den Koch an. Er baute sich vor mir auf und streckte mir seine Fettschürze entgegen. „Machst du mich etwa dumm an?“
Durch seinen Körperbau wirkte dieser Einschüchterungsversuch weniger bedrohlich als vielmehr lächerlich. Als würde man versuchen, einem Kartoffelsack Haltung beizubringen. Ich wandte mich ab.
„Wo willst du hin? Du hast noch zwei Stunden Arbeit vor dir!“
„Ich bin hier fertig.“
Der Kopf des Kochs bekam die Farbe von Himbeeren. „Das hast du nicht zu entscheiden!“
„Stimmt. Du aber auch nicht.“
Im Vorbeistürmen sah Sven mir nach. „Was isch'n los?“
„Sie haben mich gefeuert“, erklärte ich, ohne stehen zu bleiben.
„Oh, vielleicht treffe …“ Mehr hörte ich nicht, denn ich schmiss die Tür hinter mir zu.
Mit mahlenden Zähnen stand ich auf der Straße, den Rucksack auf dem Rücken und den Frust im Nacken. Tränen der Wut brennen immer etwas auf der Haut, zumindest kommt es mir so vor. Sie fließen nicht einfach die Wangen hinab, sie fräsen sich ihren Weg durch die Haut. Ich war nicht wütend über den Verlust des Jobs, der war mir fast egal. Was mich wurmte, war meine Unfähigkeit, dazuzugehören. Ich wollte doch nur ein kleines geöltes Zahnrad in der laufenden Maschinerie der Gesellschaft sein. Aber das war ich nicht. Meine Rolle war die des Sandes im Getriebe.
Irgendetwas machte ich gehörig falsch.
Irgendwo in meinem System hatte sich ein gewaltiger Fehler eingenistet und es gelang mir einfach nicht, ihn ausfindig zu machen. Lag es möglicherweise daran, dass ich der Fehler war?
„VERDAMMMTE SCHEISSE!“, brach es aus mir heraus und ich trat gegen eine Mülltonne, die mit einem blechernen Knall zu Boden fiel.
Von Selbstzweifeln zerfressen irrte ich ziellos durch die Stadt. Ich hatte Angst, nach Hause zu gehen, um dort meinen finsteren Grübeleien ausgesetzt zu sein.
Irgendwann fand ich mich an einem Tresen wieder, ohne genau zu wissen, wie ich dorthin gelangt war. Wenn ich schon mal hier war, dann konnte ich mich auch volllaufen lassen. Was sollte ich auch sonst anderes machen?
Mein Blick sprang umher wie ein ungezogenes Kind. Ganz gleich, wie sehr ich mich konzentrierte, ich fand keinen Gedanken, an dem ich mich festhalten konnte. Meine glühende Wut war zu einem flauen Gefühl der Resignation geworden.
Aus Ermangelung an Alternativen begann ich, mein bisheriges Leben Revue passieren zu lassen. Möglicherweise hatte ich ein ordentliches Kindheitstrauma übersehen, das mich zu dem entarten ließ, der sich jetzt hier an diesem Tresen festhielt wie an einer alten Überzeugung.
Doch völlig egal, wie tief ich in meiner Psyche grub, ich stieß auf nichts. Gar nichts.
Meine Eltern waren stinknormale Menschen mit Arbeit und ohne Suchtproblem. Mein Vater war Beamter in irgendeinem Amt und meine Mutter arbeitete halbtags als Zahntechnikerin. An ihren freien Tag erledigte sie den Haushalt und nörgelte hinter meiner Schwester und mir her. In ihrer gemeinsamen Freizeit sorgten sie sich beide um die Zukunft ihrer Kinder.
Meine Schwester machte ihnen dabei kaum Probleme. Sie studierte erfolgreich Jura.
Zumindest war das mein Informationsstand.
Wir hatten noch nie ein besonders inniges Verhältnis zueinander. Ob es mir passte oder nicht – ich war normal. Nie musste ich mich für irgendetwas richtig ins Zeug legen. Alles war da, immer und zu jederzeit verfügbar. In meiner Kindheit und Jugend gab es keinen Mangel, keine Not. In der Schule kam ich problemlos durch. Das lag nicht etwa an meiner überragenden Intelligenz oder meinem bemerkenswerten Fleiß. Ich war ganz simpel und einfach der Durchschnitt.
Wohlbehütet und leidenschaftslos. Zur Passivität erzogen, zum Befehlsempfänger ausgebildet.
Eine strohblonde Bedienung riss mich mit der Frage „Was darf es bei dir noch sein?“ aus meinen Gedanken.
„Weiß nicht“, gab ich schroff zurück.
„Wie wäre es mit einem hausgebrauten Bier?“, schlug sie vor.
Meine Antwort bestand aus einem phlegmatischen Schulterzucken.
„Meinetwegen.“
„Kommt sofort“, sagte sie, klopfte auf die Theke und ließ mich wieder mit meinen dämmrigen Gedanken alleine. Finster starrte ich vor mich hin und hing trübsinnigen Gedanken nach.
So verliefen die nächsten Wochen. Ich erwachte mittags aus einem traumlosen, strapaziösen Schlaf, zog mir irgendetwas an und schlurfte missmutig zur Kneipe. Einzig die Hoffnung, die Bardame, deren Namen ich unbedingt noch herausfinden musste, wieder zu sehen, erhellte mein Gemüt ein wenig. Ich versuchte in Erfahrung zu bringen, ob sie regelmäßig arbeitete. Dem schien aber nicht so zu sein. Sie stand hinter der Bar, wenn ich sie brauchte.
An guten Tagen, also wenn sie arbeitete, hockte ich am Tresen und mein Blick verfolgte sie wie ein aufdringlicher Schatten. Ob sie es merkte, wusste ich nicht, jedenfalls sprach sie mich nie darauf an.
In meinem benebelten Kopf entspannen sich etliche Szenarien, die ich mir in den leuchtendsten Farben und nuanciertesten Schattierungen ausmalte.
Mein liebstes Szenario war dieses, in dem wir in einem kleinen, malerischen Küstenort in Italien, irgendwo in der Nähe von Neapel oder Rom, nach einer Nacht voller Leidenschaft durch die vornehm aufgehende Sonne geweckt wurden.
Es wäre kein abruptes Herausgerissenwerden aus dem Schlaf, vielmehr wäre es eine freundliche Bitte an unser Bewusstsein, sich aus dem Nebel des Schlafes zu erheben. Die güldenen Sonnenstrahlen würden, wie meine Finger in der vorigen Nacht, über ihren Körper gleiten. Wir würden uns gegenseitig mit liebevollen, zarten Küssen aus dem Halbschlaf helfen. Ob wir uns der Leidenschaft daraufhin erneut hingeben würden, ließ ich bewusst offen.
Schließlich braucht auch ein Traum seine dunklen Winkel.
Nach einer Dusche voller Albernheiten, die nur frisch Verliebte kennen, würden wir Hand in Hand zum Strand schlendern.
Wo wir … „Kann ich dir noch etwas bringen?“, riss mich die Bardame aus meiner Träumerei.
„Äh, ehm …“ Ich schaute erschrocken auf mein noch halbvolles Bierglas. „Nein.
Eigentlich nicht.“
Sie wandte sich ab.
„Aber deinen Namen könntest du mir anvertrauen“, rief ich ihr hinterher.
„Ich bin Klara“, antwortete sie lakonisch, fast schon desinteressiert.
Mit dieser Information zog ich mich wieder zurück in die Ungewissheit meiner Tagträume.
Nach unserem Urlaub würde es nicht lange dauern, bis wir zusammenziehen würden. Es wäre kein bewusster Entschluss, den man in mehreren Gesprächen erarbeiten würde.
Viel eher wäre es eine natürliche, in unserer Wahrnehmung fast schon überfällige Entwicklung.
In einer kleinen Dachwohnung würden wir leben, auf vielleicht 60 Quadratmetern.
Sie würde all ihre Bücher mitbringen, die ich dann lesen könnte. Was für Bücher das wohl wären? Eine Mischung aus großer Literatur und Fantasy, denn bei aller Ernsthaftigkeit und Reife hatte sie nie das Träumen verlernt. Jeden Tag würde ich sie von der Arbeit abholen und sie würde mir von ihrem anstrengenden Tag berichten. Was ich wohl den ganzen Tag machen würde? Vielleicht würde ich die Rolle des Hausmanns annehmen und gänzlich darin aufgehen … „Wenn du nichts mehr willst, wie wäre es denn dann, wenn du mal deine Schulden bezahlst?“ Mit dieser Frage holte mich Klara unsanft in die Realität zurück.
„Ja, ehm …“ Ich klopfte ungelenk meinen Pullover ab, der gar keine Taschen besaß.
„Hab' meinen Geldbeutel vergessen.“
Ich lächelte windschief.
Klara klopfte fest auf den Tresen zwischen uns. „Beim nächsten Mal hast du ihn besser dabei, sonst muss ich's Marco sagen.“
„Okay …“, murmelte ich. Wer war Marco?
Doch wohl nicht ihr Freund? Noch bevor Tränen aus meinen Augen rinnen konnten, erhob ich mich vom Barhocker und floh aus der Kneipe.
Knapp eine Woche später, ich bezog gerade wieder Position am Tresen, bediente mich ein hochgewachsener, lockiger Mann. Wie alt er war, konnte ich selbst mit zusammengekniffenen Augen nicht abschätzen. Anfang 30? Ende 40?
„Ist Klara heute nicht da?“, erkundigte ich mich verunsichert.
Der Tag war für mich gelaufen.
„Nein. Die hat heute frei“, antwortete der Lockenkopf mit einer eigenartig näselnden Stimme.
„Hmm. Achso.“
„Was darf es bei dir sein?“
„Klara empfiehlt mir immer etwas.“
„Aber wie du siehst, ist Klara nicht da.“
Diese Benennung einer Offensichtlichkeit trieb mich an den Rand der Verzweiflung.
Wenn Klara nicht da war, was wollte ich dann überhaupt hier? Es gab zwar schon Tage, an denen sie nicht da war, aber es traf mich nicht im Mindesten so hart wie jetzt. Auf eine undefinierbare Weise kam ich mir verraten, betrogen vor.
Wo war Klara? Vielleicht bei ihrem Freund?
Diese Vorstellung, dass ihr jemand anderes durch ihr samtenes Haar strich und ihren Duft inhalierte, löste in mir ein Gefühl aus, das ich so gar nicht kannte. Ich wollte zu Klara, ich wollte sie an ihren zarten Schultern packen und ihr meine Gefühle ins Gesicht schreien.
Sie durfte keinen Freund haben. Sie durfte niemand anderen lieben.
Schließlich liebte ich sie doch. Ich fuhr hoch, da war das Wort. Liebe. Das mächtigste Wort der Welt.
In meinem amourösen Duell gegen mich selbst merkte ich erst gar nicht, dass mich der Lockenkopf eingehend musterte.
„Bist du der Kerl, der seinen Deckel seit einem Monat offen hat?“
Oh Klara, wieso hast du mich verraten?
Ist dir unsere Verbindung gar nichts wert?
„Nein“, versuchte ich es mit einer Lüge.
„Also ja“, schlussfolgerte der Lockenkopf, der der angedrohte Marco sein musste, messerscharf und hielt eine Art Kassenzettel vor sich. Er rückte seine Brille zurecht, bevor er vorlas: „287,50 Euro.“
„Was?“, fragte ich scheinheilig nach, während sich der schwere Schatten der Befürchtung über mich legte.
„Du schuldest mir 287,50 Euro. Ohne Trinkgeld.“
„Das kann gar nicht sein!“, stritt ich fadenscheinig ab. Es konnte sehr wohl sein. Marco knallte den Fresszettel so fest zwischen uns auf den Tresen, dass zwei Besucher am anderen Ende der Bar vor Schreck fast vom Hocker kippten. Er zückte einen angeknabberten Kugelschreiber und fing an, es mir vorzurechnen. „Du trinkst immer unser hausgebrautes Bier, das sind pro Glas 3,80 Euro. Davon trinkst du vier Stück am Tag, das sind 15,20 Euro. Und das zwanzig Mal diesen Monat. Das sind …“ Er kritzelte auf seinem Stück Papier herum.
„Das sind 304 Euro.“
Marco hielt kurz inne. „Hm! Klara hat sich sogar verrechnet. Na immerhin ist sie hübsch.“
Er schob mir seine Rechnung hin. „Ich will nicht so sein, sagen wir 300 Euro.“
Jegliche Farbe wich mir aus dem Gesicht, woher sollte ich so viel Geld nehmen?
„Ich …“, setzte ich krächzend an. „So viel hab‘ ich nicht.“
„Wie viel hast du denn?“, fragte Marco trocken nach.
Ich vergrub meine Hände so zaghaft in meinen Hosentaschen, als lauerte in ihnen ein Tier, das mir sofort in die Finger biss, sobald es meine Hände zu Gesicht bekäme. Nach einer künstlich in die Länge gezogenen Suche barg ich 14,73 Euro aus den Tiefen meiner Hosentaschen.
Marcos Blick oszillierte zwischen verdecktem Mitleid und naserümpfender Missbilligung. „Das ist nicht viel.“
Beschämt sah ich auf das kümmerliche Häufchen Zahlungskraft. Marco strich das Geld vom Tresen. „Für den Rest lasse ich mir was einfallen“, erklärte er knapp, ging ein paar Schritte und wandte sich noch einmal zu mir um. „ So lange bleibst du hier. Ich hab' keinen Bock, die Polizei rufen zu müssen.“
Ich nickte übereifrig. Das konnte ich auch nicht gebrauchen.
Es dauerte eine Weile, bis Marco wieder auf mich zukam. Er strich sich stöhnend ein paar Locken von der Stirn. „Hast du schon mal in der Gastronomie gearbeitet?“
Hoffnung witternd sah ich auf. „Ja. Hab' ich.“
Die Überraschung schien Marco förmlich ins Gesicht gemeißelt. „Wirklich?“
„Ja. Eine Zeit lang habe ich als Spüler in einer Küche gearbeitet.“
Marco überlegte eine Weile, wahrscheinlich wog er ab, ob er mir glauben konnte oder nicht.
„Scheiß‘ drauf“, raunte er schließlich.
„Pass auf, vor ein paar Tagen hat mein Hilfskoch hingeschmissen.“
„Okay …“ „Es ist eine …“, er holte Luft.
„Innovative Lösung, aber was hältst du davon, deine Schulden abzuarbeiten?“
Ich rieb mir das Kinn, um Nachdenklichkeit zu simulieren. Natürlich würde ich dieses Angebot annehmen. So hätte ich zumindest wieder so etwas wie einen Job. Eine Frage wollte ich aber noch beantwortet wissen. „Und wenn ich meine Schulden abgearbeitet habe?“
„Dann schauen wir, wie es läuft.
Sollte Edith mit dir zufrieden sein, dann setzen wir uns wieder zusammen.“
„Wer ist Edith?“
„Die Köchin. Du lernst sie gleich kennen“, sagte er und führte mich zu einer Schwingtür im hinteren Bereich des Wirtsraums. Noch völlig überrumpelt von der Situation folgte ich ihm um den Tresen herum. Mir war gar nicht bewusst, dass Möglichkeiten so eng verwandt mit Unglück sein konnten. Eben noch hatte ich Schulden und wusste nichts mit mir anzufangen. Jetzt hatte ich eine Anstellung als Hilfskoch. Ich zuckte unmerklich mit den Schultern, immerhin besser als Spüler. Diesmal musste ich mich aber zusammenreißen. Diesmal musste es endlich klappen. Unendlich viele Chancen würde es auch für mich nicht geben. Marco öffnete eine weitere Schwingtür, die üblich war für einen solchen Raum, und wir standen in einer engen und etwas schmuddeligen Küche. In der Mitte des Raumes stand ein angelaufenes Edelstahlgestell, das überladen war mit Pfannen, Töpfen und anderen Küchenutensilien wie Löffeln und Zangen. Marco, im Türrahmen stehend, rief über das geschäftige Schüsselgeklapper hinweg: „Edith, kommst du mal? Ich habe hier jemanden für dich!“
Es dauerte nicht lange und eine kleine, gedrungene Frau schnellte hinter dem eisernen Regal hervor. „Ja?“
„Das hier ist Daniel.“
„David“, verbesserte ich halblaut.
„Dann eben David. Er ist dein neuer Hilfskoch.“
Ihre verklebten, wunden Augen musterten mich eingehend.
„Und was verschafft mir die Ehre?“
Marco räusperte sich erklärend. „David und ich haben ein Abkommen.“
„Und welches wäre das?“
„Er hat Schulden.“
„Und deswegen stellst du ihn ein?“, fragte Edith spitz.
„Irgendwie muss ich an mein Geld kommen, oder?“
„Musst du wissen. Du bist der Chef“, zischte sie.
„Richtig“, antwortete Marco trocken und verließ ohne ein weiteres Wort die Küche.
Es herrschte ein Moment Stille. Nur der rasselnde Atem der Köchin war zu hören.
„Du hast schon mal in einer Küche gearbeitet?“, fragte sie mit einer Stimme wie ein Holzhobel. Ich nickte etwas abgeschreckt.
„Gut. Komm morgen um 13.00 Uhr vorbei und wir arbeiten dich ein. Aber ich sag's dir gleich, hier ist kein Platz für Schlappschwänze.“
Ich schluckte verunsichert.
Edith spürte mein Unbehagen und stellte mit einem maliziösen Lächeln fest: „Ängstliche Menschen arbeiten besser, war schon immer so.“
Oder sie arbeiten gar nicht, schoss es mir durch den Kopf.
„Hat Marco dich vorgestellt oder habe ich deinen Namen vergessen?“
„Ich weiß es nicht“, gab ich zu.
„Wie heißt du denn jetzt?“, polterte Edith los.
„David“, antwortete ich ein wenig zu leise. Sie nickte knapp und machte eine undefinierbare Handbewegung. „Komm morgen wieder. Ich kann dich hier jetzt nicht gebrauchen. Du würdest nur im Weg stehen!“
Wie ein geschlagener Hund trollte ich mich wieder zurück in den Wirtsraum. Dort stand ich allerdings auch verloren herum.
„Bis morgen dann“, holte mich Marco aus dieser Apathie.
„Ja, bis morgen“, stammelte ich und verließ die Kneipe.
3.
Um kurz vor 13.00 Uhr am darauffolgenden Mittag stand ich in der fleckigen Küche, in welche mich Marco am Vortag geführt hatte. Edith war noch nicht da, also stand ich wieder verloren herum.
Vielleicht hatte ich Glück und würde Klara heute sehen, bevor Edith käme.
Behutsam schlich ich mich aus der Küche und sah mich im Wirtsraum um und tatsächlich erspähte ich ihren goldblonden Haarschopf.
„Hey, Kollegin“, begrüßte ich sie mit unangebrachter Großspurigkeit.
Klara fuhr erschrocken herum. „Was? Ach, hey.“ Sie presste sich ein müdes Lächeln ab.
„Ich arbeite jetzt hinten bei Edith in der Küche.“
„Ja? Lässt Marco so deine Schulden abarbeiten?“
„Quatsch. Marco hat mich gefragt, ob ich hier anfangen könnte, weil ihm der Hilfskoch abgesprungen ist.“ Ich fühlte mich zwar ertappt, aber so klang es besser.
„Dann viel Spaß mit Edith.“ Klara sah über meine Schulter in Richtung Küche und schob noch eine Erklärung hinterher.
„Die letzten Beiköche haben alle noch im ersten Monat gekündigt und haben ihre Schulden entweder anderweitig beglichen oder sie sind in der Versenkung verschwunden“, erläuterte sie mir wie einem Schuljungen.
„Und es gab bisher keine Ausnahme?“
„Doch, doch.“ Klara wuchtete einen Karton mit Altglas auf den Tresen. „ Javier, Özgür und …“ Sie sah konzentriert auf die leeren Flaschen. „Ne, das war's.
Vielleicht bist du ja der Dritte.“
„Wäre schön, oder?“
Klara zuckte mit den Achseln. „Keine Ahnung, ist mir auch egal. Hauptsache ich muss nicht nach hinten in die Küche zu dieser Kröte.“
Diese lapidare Aussage versetzte mir einen Stich, war ich ihr wirklich egal?
„Mach dich mal nützlich und hilf mir mal!“ Klara wies auf den Altglaskarton.
Diensteifrig trug ich den Altglaskarton in den Hinterhof, wo Klara mir zeigte, wo die leeren Flaschen abzustellen seien.
Gerade stellte ich den zum Brechen vollen Karton ab, da trat stampfenden Schrittes Edith auf uns zu. Im Schlepptau hatte sie einen Mann mittleren Alters.
„Du bist nicht hier, um die Weiber anzumachen! Du sollst deine Schulden abarbeiten!“, brüllte sie mich an.
„Entspann dich, Edith! Er hat mir nur geholfen“, sprang Klara mir bei.
„Ja, ja. So fängt es an“, grunzte Edith.
„Und am Ende bist du schwanger.“
„Edith, Liebling, willst du wirklich so deine Schicht beginnen?“ Der Mann strich liebevoll über ihre Schulter. Diese Zärtlichkeit wirkte befremdlich, als würde man in aller Öffentlichkeit einen Stein liebkosen. Edith holte tief Luft, hustete und steckte sich eine Zigarette an. „Ab mit dir in die Küche“, wies sie mich an.
In der Küche stellte sie eine abgegriffene Plastiktasche in eine Ecke. „Das“, sie zeigte beiläufig auf den Mann neben ihr, „ist mein Mann Ralf und gleichzeitig mein Beikoch.“
Wir reichten uns die Hände. Mehr war in Sachen Begrüßung nicht drin „Und scheinbar ist er stumm?“, witzelte ich.
„Was redest du da?“, polterte Edith. „Was soll er sonst sprechen?“
„Ich meine …“, zaghaft zeigte ich aus der Küche hinaus. „Die eine Bedienung meinte, der Beikoch spricht kein Deutsch.“
Mit einem schneidenden Blick folgte Edith meinem Fingerzeig. „Sie meinte sicher Javier!“ Kehlig hüstelnd wandte sie sich ab. „Den lernst du aber erstmal nicht kennen. Der hat … Urlaub.“
„Ich helfe dir die ersten Tage, zeige dir alles und bringe dir die Handgriffe und Rezepte bei, die du kennen musst“, mischte Ralf sich freundlich ein.
„Klar.“
„Lass uns gleich mal anfangen“, sagte Ralf und drückte mir zwei Plastikeimer in die Hand. „Weißt du, wo unser Lager ist?
Ach, nein? Dann lass uns mal Zwiebeln holen.“
Das Lager war ein fensterloses, komplett gekacheltes Kabuff im hinteren Teil des Restaurants. Ralf drückte routiniert den Lichtschalter, woraufhin eine Neonröhre zitternd ansprang. Durch die ehemals weißen Kacheln wurde die klirrende Kälte, die einen beim Eintritt sofort umschloss, nur noch verstärkt, aber so war das in Lagern nun einmal. Ich rieb mir fröstelnd die Arme, denn ich trug nur eine ausgewaschene Jeans, Sneakers und ein weißes T-Shirt.
„Weißt du, Edith ist etwas kratzbürstig.
Lass dich davon aber nicht abschrecken, denn eigentlich ist sie eine ganz Liebe.“
„Was genau meinen Sie damit?“, erkundigte ich mich vorsichtig. Ralf verzog sein pockennarbiges Gesicht, als hätte ihm die Anrede wehgetan: „Siez michnicht. Da komme ich mir ja noch älter vor, als ich bin!“
„Dir wird doch schon jemand gesteckt haben, dass Edith einen …“ Ralf zögerte.
„Recht hohen Verschleiß an Beiköchen hat.“
„Nein“, log ich. „Ist das denn so?“
Ralf sah mich wissend mit einer hochgezogenen, überaus buschigen Augenbraue an. „Ja, das ist so.“
Er nahm Zwiebeln aus einem kleinkindgroßen Plastikeimer und legte sie in einen der von uns mitgebrachten Plastikeimer.
„Was ich dir sagen will, nimm dir ihre Worte nicht zu Herzen. Dich schüchtert es nur unnötig ein und sie meint es im Grunde nicht so. Vor allem wenn sie laut wird. Hör einfach weg.“





























