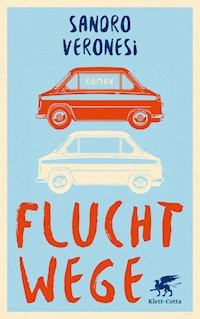17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Im verschneiten Wald nahe des Bergdorfs San Giuda werden die Leichen von elf Touristen gefunden. Die Autopsie der Leichen offenbart etwas Unfassbares: elf Leichen, elf Todesursachen. Mord und Selbstmord, Krebs und Herzinfarkt. Ein Opfer scheint dem Biss eines Haifisches erlegen zu sein. Nichts passt zusammen. Während die Behörden die unerklärlichen Details der Tragödie vertuschen, versuchen der Priester Don Ermete und die Psychologin Giovanna, das Rätsel zu lösen. Ihre Ermittlungen führen den Leser auf eine philosophische Reise in die Grenzgebiete unseres Verstandes.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 509
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
SANDRO VERONESI XY
Roman
Aus dem Italienischen
von
Michael von Killisch-Horn
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Speicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Erfahren Sie mehr über die Einwohner von Borgo San Guida und folgen Sie den Indizien des Rätsels von XY auf www.xy-roman.de
Weitere Bücher aus dem Verlag Klett-Cotta finden Sie unter: www.klett-cotta.de
Klett-Cotta Die Originalausgabe erschien unter dem Titel "XY" © 2010 by Fandango Libiri s.r.l., Roma Für die deutsche Ausgabe © 2011 by J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart Alle deutschsprachigen Rechte vorbehalten Cover: Studio Jellici/Federico Mauro Digitale Illustration: Papirus Datenkonvertierung: Kösel, Krugzell
Für Nina, in dieser Welt
Ein Geschehen kann schon allein deshalb nicht wie eine Rechnung aufgehen, weil wir nie alle notwendigen Faktoren kennen, sondern nur einige wenige, meistens recht nebensächliche. Auch spielt das Zufällige, Unberechenbare, Inkommensurable eine zu große Rolle.
Das Schicksal ist nicht unsichtbar
Borgo San Giuda war nicht einmal mehr ein Dorf, es war ein Weiler. Vierundsiebzig Häuser, davon mehr als die Hälfte verlassen, eine Bar, ein Lebensmittelgeschäft und die Kirche mit ihrem Pfarrhaus – unverhältnismäßig groß im Vergleich zum Rest. Ende. Kein Zeitungskiosk, kein Friseur, keine Ambulanz, keine Grundschule; dafür und für alle anderen Errungenschaften der Zivilisation musste man nach Serpentina durch den Wald fahren oder nach Doloroso, nach Massanera, nach Gobba Barzagli, nach Fondo, nach Dogana Nuova oder geradewegs hinunter nach Cles. Doch es gab einen Schmied, Wilfred, der Riesenkräfte hatte und wie Mangiafuoco, der Puppenspieler aus Pinocchio, aussah, und einen Friedhof mit mehr als dreihundert Gräbern. Dort zu leben ergab keinen Sinn, doch wir lebten dort, wir waren dreiundvierzig, eigentlich zweiundvierzig, seit der alte Rezè gestorben war. Es war ein Ort, der so gut wie nicht existierte, und niemand wird jemals begreifen, warum das, was geschehen ist, gerade dort geschehen ist, wo nie etwas geschah.
Das Einzige, was im Winter in San Giuda geschah, war die Ankunft des Schlittens von Beppe Formento. Die Formentos waren eine der vier Familien von San Giuda – die mächtigste, könnte man sagen, wenn es nicht so lächerlich klänge. Sein Bruder und seine Schwester besaßen die Bar und das Lebensmittelgeschäft, und ihre Kinder waren die einzigen jungen Leute, die dort lebten. Die eine, Perla, Tochter von Rina, hatte der Biathlon-Nationalmannschaft angehört und auch eine Medaille im Staffellauf gewonnen; der andere, Zeno, Sohn von Sauro, war ein vielversprechendes Talent im Skispringen gewesen, doch dann hatte er damit aufgehört. Beppe Formento liebte Pferde und besaß ein Reitzentrum in der Nähe von Serpentina; im Sommer kamen Urlauber, um Pferde für Ausritte zu mieten, und im Winter gelang es Beppe im Rahmen der weißen Wochen, ein Dutzend Touristen pro Tag für eine Fahrt mit dem Pferdeschlitten zu begeistern: Alte, Mütter und kleine Kinder, die den Prospekt in den Hotels der Region fanden und beschlossen, sich einen Ausflug wie im 19. Jahrhundert zu gönnen. Die Strecke war immer die gleiche: vom Reitzentrum hinauf zur stillgelegten Skischanze, von dort durch den Wald bis zu dem vereisten Baum (er vereiste ihn selbst jedes Jahr mit der Schneekanone, um seine Kunden in die richtige Stimmung zu versetzen) und dann direkt nach San Giuda und zurück. Jeden Vormittag, pünktlich um zehn, brachte Beppe Formento den Schlitten auf dem Dorfplatz zum Halten, stieg aus, kündigte einen Aufenthalt von zwanzig Minuten an, und die frierenden Touristen flüchteten sich in die Bar seines Bruders, um einen Espresso oder Cappuccino zu trinken. Mit einem Gepäckkarren auf Kufen, der an den Schlitten angekoppelt war, brachte er jeden Morgen frisches Gemüse und Fleisch, Mineralwasser, Milch, Kaffee, Nudeln, Käse, Wein und Getränke zum Laden seiner Geschwister. Während die Touristen sich stärkten, lud er die Waren ab und empfahl allen, vor der Abfahrt noch die Kirche zu besichtigen; die Touristen hörten jedes Mal brav auf ihn, und jetzt kam ich ins Spiel: Ich nahm sie am Portal in Empfang und zeigte ihnen das hölzerne Kruzifix aus dem 15. Jahrhundert, die spätgotische Kanzel mit ihren Basreliefs, die Statue der Madonna delle Selve und die unseres Heiligen, über den ich ihnen erzählte, was es zu erzählen gab: der heilige Judas Thaddäus (alle glauben immer, es handele sich um Judas Ischariot, den Verräter), Apostel, Bruder von Jacobus dem Jüngeren und Cousin von Christus, gestorben als Märtyrer im Orient, Beschützer der Enterbten und aller, die ohne Hoffnung sind. Manchmal waren meine Worte inspirierter, oder unter den Touristen gab es tatsächlich ein paar Verzweifelte, und dann verloren wir etwas Zeit, weil jemand vor der Statue niederkniete und das Gnadengebet sprach. Ein wunderschönes Gebet übrigens. Dann stiegen alle wieder auf den Schlitten, Beppe Formento ließ die Peitsche knallen, und die beiden Pferde, Zorro und Malinda, setzten sich unter Glockengeläut wieder in Bewegung in dem leichten und anmutigen Trab, den Beppe Formento ihnen beigebracht hatte. Buck, der deutsche Stallbursche, blieb noch etwas in der wohlig warmen Bar, bevor er losgaloppierte, um den Schlitten vor der Biegung zum Wald zu erreichen, und das wiederholte sich, von Dezember bis April, jeden Vormittag, einschließlich sonntags. Nachmittags kehrte Beppe Formento nie ins Dorf zurück; er hatte immer eine Menge im Reitzentrum zu tun, und seit ihm jemand vor Jahren eines Nachts alle Sättel und das gesamte Zaumzeug aus dem Stall gestohlen hatte, schlief er dort in einer Kammer hinter dem Büro.
Das sollte genügen, um eine Ahnung davon zu vermitteln, wie entsetzt wir an jenem Morgen waren, als der Schlitten um zehn auf den Platz kam, pünktlich wie immer, aber leer. Kein Beppe Formento, keine Malinda, keine Touristen, kein Anhänger mit den Lebensmitteln und kein Buck als Nachzügler. Nur der Schlitten, gezogen im Galopp von Zorro, mit schauerlichem Glockengeklirre, das uns alle, die wir es hörten, sofort misstrauisch machte. Es heißt, das Schicksal sei unsichtbar, doch zumindest dieses eine Mal hätte es für uns nicht auffälliger sein können. Dieser Augenblick veränderte unser aller Leben, jeder erkannte es, und keiner von uns wird es jemals vergessen können; immer werden wir uns daran erinnern, was wir gerade taten (ich zum Beispiel kochte Orangenmarmelade) und wie schnell wir hinausliefen, obwohl es heftig schneite. Und keiner von uns, die wir auf den Platz liefen, wird je die Augen dieses armen Pferdes vergessen, seinen völlig verängstigten Blick und die – glauben Sie mir – menschlichen Zuckungen seines verstörten Mauls. Wenn je ein Tier kurz davor war zu sprechen, dann Zorro an diesem Morgen; doch selbst wenn er fähig gewesen wäre zu sprechen, hätte er wohl nicht die Worte gefunden, denn für das, was er hätte sagen müssen, gibt es keine Worte.
Blut. Auf den Laken, auf dem Kissen, überall. Bin ich ermordet worden? Sind sie eingedrungen, während ich schlief, um mir die Kehle durchzuschneiden? Mein Herz schlägt wie wild, ich habe Angst; ich habe Angst zu entdecken, dass ich ermordet worden bin. Und doch muss ich hinschauen, mich vergewissern. Dabei geht es mir gut, ich fühle mich wohl; möglicherweise ist es gar nicht mein Blut. Aber von wem dann? Das macht mir noch mehr Angst. Ich stehe auf, es ist kalt. Wie spät ist es? 10 Uhr 45 – das heißt, in Wirklichkeit 9 Uhr 45, denn ich habe den Radiowecker nicht auf die Winterzeit umgestellt, ich habe so gut wie nicht geschlafen – und das Blut da auf dem Bett, auf dem Kissen ist mein Blut. Aber ich lebe, ich stehe aufrecht da, ich habe keine Schmerzen. Das Blut ist an der Hand, der linken, an den Fingern – und es ist frisches Blut. Ich muss mich hinsetzen, ich bin kurz davor, ohnmächtig zu werden. So war es schon immer. Auch an der Universität wurde ich beim Anblick von Blut ohnmächtig. Im Sitzen ist es besser. Ich sollte einen Blick in den Spiegel werfen, aber ich habe Angst, dass ich auch im Gesicht Blut habe. Entstellt könnte ich nicht leben. Aber entstellt von wem? Alberto? Er hat immer noch den Schlüssel; er ist wahnsinnig geworden, er ist gekommen, während ich schlief, und hat mich – so ein Unsinn! Der arme Alberto, wie komme ich bloß auf so was? Aber irgendetwas ist geschehen, da ist Blut auf den Laken, auf dem Kissen, an der Hand – rot, frisch. Es tropft immer noch von der Hand, auf dem Fußboden sind Blutstropfen. Ich muss unbedingt hinschauen, muss mich vergewissern, ich darf nicht ohnmächtig werden. Bin ich Ärztin oder nicht? Nur Mut: die Hand, die linke Hand. Ja. Die Finger. Der Zeigefinger vor allem, auf dem Fingerglied – o Gott, nein. O nein! Die Narbe. Wie ist das möglich? Wie zum Teufel ist das möglich? Und doch ist es so, die Narbe ist wieder aufgebrochen. Aber es ist nicht möglich, dass sie wieder aufgebrochen ist – seit wann? Es war das letzte Jahr der Wettkämpfe, ich war sechzehn – nach fünfzehn Jahren. Aber es ist die Narbe, diese Narbe. Ja, sie ist es. Sie ist tatsächlich wieder aufgebrochen, sieh nur hin. Man kann den Knochen sehen, o Gott, wie damals, als ich mich geschnitten hatte, vor fünfzehn Jahren – ich fühle mich schlecht, ich werde ohnmächtig. Man kann den Knochen sehen, das Blut fließt in Strömen, ich fühle mich schlecht, aber ich muss es stoppen, ich muss etwas tun, ein Taschentuch nehmen, ja, genau, es fest um den Finger wickeln, es zusammenschnüren, klar – aber womit? Das Haargummi, nein, das hält nicht; die Pflaster im Bad wären nicht schlecht, aber im Bad hängt der Spiegel, und ich habe Angst, in den Spiegel zu blicken: Wenn ich entstellt bin? Doch ich muss es tun, und zwar schnell, sonst verblute ich noch. So, jetzt bin ich im Bad. Jetzt blicke ich in den Spiegel. Nichts, das Gesicht ist in Ordnung, abgesehen von den Augenringen und der Leichenblässe – kein Wunder, ich bin kurz vorm Verbluten. Doch nein, ich halte durch, ich atme und halte durch, nehme das Pflaster aus dem Schränkchen, nein, besser das Heftpflaster, ja, so ist es gut fixiert, das Taschentuch ist schon ganz blutgetränkt. Und was mache ich jetzt? Ich atme, kehre ins Schlafzimmer zurück und setze mich aufs Bett. Ich atme. Yoga. Ein. Aus. Ein. Aus. Wie geht das Mantra noch? Soham, glaube ich. Ja, richtig. Soham. Sieh dir das an, was für ein Blutbad, es sieht wirklich aus, als hätten sie mir die Kehle durchgeschnitten. Was soll ich tun? Ich werde in die Notaufnahme gehen, Crocetti hat Dienst, er ist gekommen, als ich ging, wir sind uns in der Eingangshalle begegnet; er wird sich darum kümmern. Aber dafür muss ich mich anziehen und werde alles blutig machen, ich muss den Jogginganzug anziehen, das Sweatshirt, etwas, das leicht zu waschen ist – aber wieso mache ich mir darüber überhaupt Gedanken? Ich muss aufpassen, dass ich nicht verblute. Ich muss mich beeilen, gleich werde ich ohnmächtig, aber ich darf nicht ohnmächtig werden, ich muss rausgehen, aber vorher muss ich die Schlüssel nehmen, ja, und das Handy, und atmen, tief durchatmen – Soham – und mich auf den Weg machen, mit Anorak und Mütze. Es schneit immer noch, ich kann nicht zu Fuß gehen. Ich muss es mit dem Wagen riskieren. Ich muss so schnell wie möglich zu Crocetti, er wird mich nähen. Mist, der Clio ist zugeschneit, wie viel wird in anderthalb Stunden gefallen sein? Mindestens zehn Zentimeter. Komm schon, Giovanna, rein in den Wagen. Los, starte den Motor. Schalte den Scheibenwischer ein. Ja, gut so. Und atmen, nicht den Finger anschauen, und erst recht nicht das blutgetränkte Taschentuch; stell lieber die Klimaanlage an, die Scheiben beschlagen. Okay. Und jetzt fahr vom Parkplatz, vorsichtig, ganz langsam, den Fuß nur leicht aufs Gaspedal. Wenigstens ist die Straße geräumt, die Schneeräumer sind unterwegs, und los, langsam, vorsichtig, in den Spuren der anderen Fahrzeuge. Ja, genau so, ja nicht ruckartig fahren, ja nicht bremsen – zum Glück sind nicht viele Leute unterwegs. Die Narbe ist wieder aufgebrochen. Wie ist das möglich? Ich muss mit dem Finger im Schlaf gegen irgendwas gestoßen sein, irgendwas Scharfes, keine Ahnung, auf dem Nachttisch, schau auf die Straße, nicht ruckartig in die Kurve, ganz weich, ja, genau so, oder am Kopfende des Bettes, ein Schlag beim Umdrehen im Schlaf, ja, gegen irgendetwas Scharfes. Vorsicht, der Bus. Nicht überholen, dahinter bleiben. Lass die Leute aussteigen, warte, bis er losgefahren ist. Nein. Nach fünfzehn Jahren kann eine Narbe nicht wieder aufbrechen, so tief und präzise wie – mein Gott, beim Gedanken daran werde ich ohnmächtig. Atmen, atmen und warum diese Angst? Warum habe ich solche Angst? Wovor? Soham. Ich bin nicht im Schlaf abgestochen worden, ich bin nicht entstellt, ich bin nicht ohnmächtig geworden, und jetzt verblute ich auch nicht mehr, da ist das Krankenhaus, da ist die Schranke der Notaufnahme. Der Wächter hat gewechselt, der Glatzkopf hat jetzt Schicht, dessen Schwester Leukämie hat, die Arme. Er erkennt mich, öffnet die Schranke, grüßt mich, nach fünfzehn Jahren kann eine Narbe doch nicht von allein wieder aufbrechen, das kann einfach nicht sein, wahrscheinlich habe ich nicht richtig hingeguckt, ich habe mich daneben verletzt, ganz bestimmt, am selben Finger, ich habe nicht richtig hingeguckt, kein Wunder vor lauter Angst, und ich habe immer noch Angst. Ah, da ist ja ein freier Platz – aber vorsichtig, nicht, dass du in den Schneehaufen fährst. Besser etwas rangieren. Ja, perfekt. Geschafft. Und jetzt aussteigen und aufpassen, dass du nicht hinfällst auf diesem Schneematsch, der – verdammt, nicht zu glauben, ich habe keine Schuhe angezogen. Ich habe die Pantoffeln angelassen, ich bin in Pantoffeln gefahren – diese grauenvollen Pantoffeln, die Alberto mir geschenkt hat, die mit den Mickymaus-Ohren. Ich komme mit Mickymaus-Pantoffeln in die Notaufnahme. Nun ja, nicht mehr zu ändern, ich bin schon drin. Ciao, Luciano, ciao, Ignazio. Die Krankenpfleger schauen mich merkwürdig an, aber ich gehe einfach weiter, ich spüre, dass ich nur einmal versuchen kann, diese unerklärliche Sache zu erklären, und zwar Crocetti, während er mich näht. Da ist er schon, vor der Tür der Notaufnahme, er steht einfach da, kein Notfall, plaudert mit der hübschen Krankenschwester, wie heißt sie gleich, Sofia …
»Giovanna«, sagt er, als er mich sieht.
»Mario«, erwidere ich. »Du musst mich nähen.«
Sofia wirft einen Blick von der Seite auf das blutgetränkte Taschentuch und verzieht sich. Wir betreten die Notaufnahme, Essensgeruch liegt in der Luft, Pasta al forno, und das so früh am Morgen. Crocetti macht ein besorgtes Gesicht, vielleicht wegen meines Aussehens, des blutgetränkten Taschentuchs, der Pantoffeln.
»Lass sehen«, sagt er und beginnt den vom Blut durchtränkten Verband abzuwickeln. »Was hast du da gemacht?«
Und ich, ich schäme mich. Ja. Jetzt, da ein anderer die Wunde untersucht, jetzt, da die Verantwortung nicht mehr bei mir liegt, kann ich den Finger mit der Aufmerksamkeit betrachten, die ich vorher nicht aufzubringen vermochte – und es ist tatsächlich diese Narbe, die wieder aufgebrochen ist. Kein Zweifel, es ist genau dieser Schnitt, sauber, tief – zweiter Finger, dorsal, mittlerer Bereich, genau auf dem Knöchel. Nur dass ich mich jetzt plötzlich schäme; ja, plötzlich schäme ich mich, ihm zu sagen, dass eine fünfzehn Jahre alte Narbe wieder aufgebrochen ist, plötzlich habe ich nicht mehr diese einzige Möglichkeit, es zu erklären – aber was zu erklären? Nach fünfzehn Jahren kann eine Narbe nicht wieder aufbrechen.
»Ich habe mich beim Brotschneiden geschnitten«, sage ich. Das Gleiche sagte ich vor fünfzehn Jahren Mama am Telefon, nachdem ich genäht worden war. Nur damals stimmte es.
»Schau dir das an«, sagt Crocetti und bewegt vorsichtig den Finger. »Man kann den Knochen sehen. Wie hast du das nur gemacht?«
Wenigstens die Angst ist weg. Sehen wir es positiv: Ich bin nicht mehr der Ohnmacht nahe, ich werde nicht verbluten. Crocetti hat letztlich eine beruhigende Wirkung auf mich, mit seiner Glatze, seinen runden Brillengläsern, seinem gelangweilten Blick, wer weiß, vielleicht macht er diese Arbeit ja sogar schon seit fünfzehn Jahren.
Wie ich das gemacht habe?
»Ich habe das falsche Messer benutzt«, erkläre ich, »das für den Schinken. Das Brot war hart, die Klinge ist auf der Kruste ausgerutscht und zack …« Wie ich es Mama vor fünfzehn Jahren erklärte. Nur, damals stimmte es, und ich war sechzehn, und jetzt bin ich einunddreißig, und ich habe absolut nichts gemacht – aber das vermag ich ihm nicht zu sagen, denn sie kann nicht im Schlaf von allein aufgebrochen sein.
Crocetti schüttelt den Kopf.
»Giovanna, Giovanna«, sagt er. Was er damit wohl sagen will? Dass ich ungeschickt bin? Dass ich unreif bin? Leichtsinnig? Gewiss, ihm müssen alle leichtsinnig vorkommen, schlapp, wie er ist. Aber gerade deswegen wirkt er ja so beruhigend, weil er schlapp ist. Derjenige, der mich vor fünfzehn Jahren genäht hat, sah dagegen wie der Schauspieler Lando Buzzanca aus. Ich erinnere mich sehr gut.
»Ich nähe dich, wenn du willst«, sagt er, »aber es ist möglich, dass du die Sehne verletzt hast, und in dem Fall …«
Nein. Lando Buzzanca hatte die gleiche Befürchtung vor fünfzehn Jahren, in der winzigen Krankenstation von – wo war es, Val Senales? Es war das Finale der regionalen Meisterschaften, ja, es war Val Senales. Doch dann stellte sich heraus, dass die Sehne nicht verletzt war.
»… eine kleine Wiederherstellungsoperation. Wenn du nicht riskieren willst, dass der Finger steif bleibt.«
Nein. Dieses Risiko bin ich bereits vor fünfzehn Jahren eingegangen, und es ist gutgegangen.
»Nein«, sage ich, »nähe mich. Die Sehne ist in Ordnung.«
Schön, es kann nicht geschehen, doch wenn es geschieht wie anscheinend in meinem Fall, wenn eine Narbe nach fünfzehn Jahren wieder aufbricht, im Schlaf, einfach so, mir nichts, dir nichts, absurderweise, dann kann keine Sehne verletzt sein, die zum Zeitpunkt des Unfalls nicht verletzt worden war. Oder doch?
»Wie du willst.«
Verdammt. Wir können die Logik nicht einfach im Klo runterspülen. Wenn das die Narbe ist, dann ist das auch die Verletzung; und diese Verletzung hat die Sehne nicht verletzt. Punktum.
Mehr oder weniger habe ich das neulich auch zu Alberto gesagt, als ich Schluss mit ihm machte – mit einem Descartes-Zitat: die Irrationalität, schön und gut, das Unbekannte, schön und gut, alles schön und gut, aber der Efeu kann nicht höher klettern als der Baum, der ihn trägt.
Wir fuhren zu dritt: Beppes Bruder Sauro Formento, sein Sohn Zeno und ich. Wir nahmen die Motorschlitten. Der Schneefall war dichter geworden, dicke, schwere, dauerhafte Flocken, die auf der Haut nicht schmolzen. Ich lenkte den einen Motorschlitten, Zeno den anderen; Sauro, der Stammvater, der Vater, der ältere Bruder, der Patriarch und der Befehlshaber über alles in San Giuda, konnte es nicht wegen seines in Mitleidenschaft gezogenen Arms. Zwei Herzinfarkte hatte er gehabt und einen Schlaganfall, der seinen linken Arm gelähmt hatte. Er konnte den Motorschlitten nicht fahren, und ehrlich gesagt war es nicht gut, dass er überhaupt irgendetwas allein machte, auch wenn er noch die Kraft dazu hatte; deswegen wich ihm sein Sohn Zeno nicht von der Seite, finster und schweigsam – und sonderbar, wie alle sagten, seit er mit achtzehn die Nationalmannschaft der Skispringer verlassen und sich nach San Giuda zurückgezogen hatte. Wir fuhren die Straße in Richtung Wald, durch blendendes Weiß, das Gesicht vom Schnee gepeitscht. Er fiel so dicht, dass er die Spuren des Schlittens bereits ausgelöscht hatte; daher fuhren wir langsam, und Zeno hielt sogar immer wieder an, um zu überprüfen, ob wir noch auf der Straße waren und nicht etwa auf dem Feld der Zwillinge Antonaz – denn bei diesem Wetter konnte man sich durchaus verirren, selbst zu Hause, selbst auf der einzigen Straße, die es gibt. Andererseits, wohin fuhren wir überhaupt? Wir hatten nichts besprochen, wir waren einfach losgefahren. Keiner von uns dreien hatte über die Angst gesprochen, die alle beim Anblick des leeren Schlittens und dieses panischen Pferdes empfunden hatten, und unsere Expedition hatte daher etwas Unredliches, als würde man etwas verschweigen, verdrängen; die Vernunft, mit der Zeno sie anführte, ließ vermuten, wir wüssten, was wir taten, wir führen zielstrebig in die richtige Richtung; kurz, unser Handeln hatte einen Anschein von Konkretheit, der heute lächerlich wirkt, angesichts der Situation aber ganz natürlich war. Im Übrigen fällt es mir heute sehr schwer, mich zu erinnern, was ich in jenen Augenblicken empfand; das, was im unmittelbaren Anschluss geschah, wirbelt in meinem Gedächtnis herum und hat Rückwirkungen auf das Davor. Mit Sicherheit war ich besorgt, aber ich kann mich nicht erinnern, wie real dieses Gefühl war, und ich habe Mühe zu glauben, dass sich in diese Besorgnis – und es war bestimmt so – auch ein wenig Hoffnung mischte – zumindest die naive Überzeugung, dass wir, was immer auch passiert war, damit schon fertig werden würden. Tatsache ist, dass die Zeit nur in eine Richtung fließt, doch man erfasst diese nur, wenn man sie noch einmal in der entgegengesetzten Richtung durchläuft; daher sehe ich uns drei heute in der Erinnerung geradewegs auf dem Weg in die Hölle, doch in Wirklichkeit war es nicht so, wir wussten nicht, wohin wir fuhren, wir hatten nicht die geringste Ahnung, was uns erwartete.
Geschafft. Der Finger ist genäht – vier Stiche, klar, wie damals; die Laken sind in der Waschmaschine, alles ist wieder sauber, nirgends mehr Spuren von Blut. Keine große Sache, alles in allem. Damals dagegen, als ich mich in Val Senales geschnitten hatte, war das Zimmer in der Residenz tagelang blutverschmiert; wegen der Verletzung verbot mir der Trainer – Amerigo hieß er –, an den Wettkämpfen teilzunehmen, und ich schmiss alles hin und fuhr verzweifelt nach Hause zurück; meine Zimmergenossinnen, zwei zickige Slalomläuferinnen namens Irene Norsa und Maria Adele Passarelli, sagten, es sei nicht ihre Sache, mein Blut zu beseitigen, und ließen sich ein anderes Zimmer geben; die von der Wohnanlage machten einen Riesenaufstand und behaupteten, das Blut zu entfernen sei gefährlich, das Mädchen könnte ja Aids haben, und weigerten sich. Drei Tage nach meiner Heimfahrt rief der Präsident des Skiklubs bei uns an und verlangte, ich solle zurückkommen, um das Zimmer zu reinigen – in Val Senales, dreieinhalb Stunden Busfahrt –, da im ganzen Tal niemand dazu bereit sei und die Leitung der Residenz mit Klage drohe. Mein Vater schickte ihn zum Teufel, dass ich nicht bereit sei, die Putzfrau zu spielen, während die anderen an meinem Wettkampf – dem Super-G – teilnähmen, sei ja wohl klar. Schließlich löste Mama das Problem auf ihre Weise; klammheimlich nahm sie ihren R5, fuhr zu dieser Residenz und machte innerhalb weniger Stunden alles sauber. Allerdings kam sie ziemlich erschüttert zurück – nicht so sehr wegen der Anstrengung als vielmehr wegen des Zustandes, in dem sie das Zimmer vorgefunden hatte; es sah aus, sagte sie, als sei ich abgestochen worden. Der Grund war, dass ich, als ich mich geschnitten hatte, allein gewesen war. An dem Vormittag fand der Slalom statt, die beiden Zicken waren in aller Frühe aufgebrochen, um sich mit der Strecke vertraut zu machen, und ich hatte mir ein amerikanisches Frühstück eingebildet. Wir hatten gleich nach der Ankunft in dem kleinen Supermarkt eingekauft, da der Skiklub uns nur eine Mahlzeit am Tag bezahlte, und an dem Morgen war ich hungrig aufgewacht. Ich hatte Lust auf Eier mit Speck. Ich war in Hochform, fühlte mich stark wie ein Raubtier, in den Trainingsläufen der vorangegangenen Tage hatte ich anderthalb Sekunden Vorsprung vor den anderen gehabt; ich war wirklich überzeugt, den Super-G zu gewinnen, was bedeutet hätte, dass ich am Finale der Nationalmeisterschaften Ende des Monats mit einer ganz anderen Einstellung teilgenommen hätte, es wäre nicht mehr nur um eine Plazierung gegangen, sondern darum, endlich um den Titel zu kämpfen, gegen die üblichen drei oder vier, die mir immer zusetzten – die Tramor, die Menzio, die Caponegro – und denen ich gerade erst in dem magischen Wettkampf in Campiglio den Kopf zurechtgerückt hatte, als Karen Putzer mir die Hand geschüttelt hatte. Ja, ich war in hervorragender Form, wenigstens glaubte ich das, und auch der Bärenhunger an dem Morgen war ein Zeichen dafür. Die Favoritin Nummer Eins, die ihrem durchtrainierten Körper Kraftstoff zuführen muss. Ich mache einen schön starken Kaffee. Ich lasse Milch aufkochen und etwas abkühlen. Ich schenke mir ein Glas Orangensaft ein und trinke es zur Hälfte. Ich brate den Speck und die Eier in der Pfanne, und bei all diesen Handlungen fühle ich mich groß, frei, glücklich – die tüchtige und durch nichts zu erschütternde Frau, die ich werden will, die den ganzen Tag arbeitet und am Abend müde nach Hause kommt, aber nicht jammert, weil ihr Mann ihr nicht in der Küche hilft, und ihm schnell ein einfaches und gutes Abendessen zubereitet und den Kühlschrank mit dem Hintern schließt, während sie die Mayonnaise selbst macht und ihm dabei eine merkwürdige Sache erzählt, die sie während des Tages erlebt hat. Erst als die Eier fast fertig sind, bemerke ich, dass ich das Brot nicht geschnitten habe. Es ist ein zwei Tage alter halber Laib, Schwarzbrot mit Kruste. Ich suche das Messer mit Säge, ich suche es wirklich – denn es muss da sein, schließlich haben wir es gestern Abend noch benutzt –, aber ich finde es nicht, weder in der Schublade noch in der Spüle und auf dem Tisch auch nicht. Verschwunden. Eier und Speck sind jetzt fertig, und in der Eile nehme ich das Aufschnittmesser, das ganz lange und superdünne. Ich packe den Brotlaib mit der linken Hand und will ihn mit diesem falschen Messer, das ich fest in der rechten Hand halte, schneiden – und sofort, im Bruchteil einer Sekunde, beim ersten Kontakt der Klinge mit der Kruste merke ich, dass es so nicht geht, dass die Frau, die ich bis dahin gewesen bin, es anders gemacht hätte; ich erinnere mich gut daran, weil ich mich auch an meinen sofortigen Entschluss erinnere, nicht aufzuhören, nicht das Feuer unter der Pfanne auszuschalten und nicht in aller Ruhe das richtige Messer zu suchen und das Brot nicht zu schneiden, bevor ich es gefunden habe, schlimmstenfalls die Eier kalt werden zu lassen oder, besser noch, sie wegzuwerfen und noch mal neu zu braten, wenn das Brot geschnitten wäre … Ich erinnere mich sehr gut, dass mir all diese Gedanken durch den Kopf schossen, so blitzartig, dass mir keine Zeit blieb, die richtige Entscheidung zu treffen, hinweggefegt von einem ebenso blitzschnellen wie unwiderruflichen »Ach, zum Teufel«. Heute weiß ich, wie man diese Handlungsweise nennt, heute weiß ich alles über autoaggressives Verhalten und Fehlleistungen, doch damals war ich einfach nur eine sechzehnjährige Idiotin, die das Falsche tut. Also setze ich das Messer an, und anstatt in die Kruste einzudringen, rutscht die dünne und biegsame Klinge seitlich ab und schneidet in den Zeigefinger meiner linken Hand, genau auf dem Knöchel – ich sehe, wie sie ins Fleisch eindringt. Ich spüre keinen Schmerz, es ist eher Entsetzen: Ich sehe, wie das rosa Fleisch sich rot färbt, erkenne auf dem Grund des Schnitts etwas Weißes – den Knochen – und spüre, wie ich ohnmächtig werde. Ich habe noch die Geistesgegenwart, das Feuer unter den Eiern auszuschalten und mich heftig blutend mit zitternden Beinen zur Eingangstür zu schleppen, wo eine Sprechanlage ist, die mit der Pförtnerloge verbunden ist. Doch ich bin schon halb bewusstlos, und als die Frau in der Pförtnerloge mir antwortet, kann ich gerade noch »Hilfe!« flüstern und sinke entkräftet zu Boden, wobei ich mit den blutverschmierten Fingern Streifen auf der Wand hinterlasse.
Es ist unglaublich, wie lebendig diese Erinnerung jetzt ist. Das üblicherweise metaphorisch gebrauchte Wiederaufbrechen von Wunden, das Wiederaufleben eines verdrängten Schmerzes ist mir tatsächlich passiert, so dass ich spontan versucht bin, selbst an die Version zu glauben, die ich Crocetti erzählt habe. Ich muss mich geradezu zwingen, wieder zur Wahrheit zurückzufinden: der Unfall beim Brotschneiden vor fünfzehn Jahren und die Narbe, die von allein wieder aufgebrochen ist, während ich schlief, was, soweit ich weiß, nicht möglich ist. Ich habe hier nicht viele Bücher, ich habe sie fast alle bei Alberto gelassen – und ich habe nicht die Absicht, ihn jetzt anzurufen. Ich habe nur eins, Bricot, Die globale Reprogrammierung des Haltungssystems, das jedoch die Haltungsstörungen und die psychischen Traumata der Narbenträger behandelt und mich nicht weiterbringt.
Das Internet. Ich habe keine Wahl.
Ich habe es den Carabinieri gesagt, ich habe es dem Staatsanwalt gesagt, ich habe es allen gesagt, die mich gefragt haben: »Was habt ihr gesehen?« Den Baum haben wir gesehen, den vereisten Baum. Das war das Erste, was wir sahen, als wir den Wald erreichten – und auch danach, als wir alles Übrige sahen, blieb er das einzig Unversehrte. Der Baum. Er stand da, an seinem Platz, dort, wo der Wald beginnt, wie kristallisiert in seinem Eismantel, dessen Durchsichtigkeit durch den frisch gefallenen Schnee getrübt wurde – doch er war rot. Ja, er war rot, als hätte Beppe Formento beim Vereisen Kirschsirup in die Kanone geschüttet. In diesem schicksalhaften Weiß war er das Einzige, was noch eine Form besaß, und er schien – ich übertreibe nicht – zu glühen, in diesem pulsierenden inneren rötlichen Licht, von dem ich heute noch träume. Ich träume von dieser roten Durchsichtigkeit, ja, heute noch, und ich träume es jetzt ohne den Baum, ja, ohne die Gestalt des Baums, ich träume diese Farbe, sonst nichts. Ein Sonnenuntergang, gefangen in einem gallertartigen Himmel, ein Vorhang aus rotem Quarz, der sich auf meinen Traum senkt und die Welt verdeckt; ich habe nicht aufgehört, von dieser roten Transparenz zu träumen, und träume immer noch davon, weil es das ist, was wir gesehen haben, als wir den Wald erreichten. Was habt ihr gesehen? Wir haben den vereisten Baum gesehen, durchtränkt von Blut.
Ich schäme mich, es zu sagen, aber als ich ihn in der milchigen Wolke, die ihn umhüllte, erkannte, bewunderte ich einen Moment lang seine Schönheit; und mit dem letzten unverdorbenen Gedanken meines Lebens, mit dem letzten unbedeutenden und kindischen und oberflächlichen und reinen und unschuldigen Gedanken meines Lebens bildete ich mir für einen Moment ein, diese Schönheit sei das Einzige, was geschehen sei. Ich bildete mir ein, Beppe Formento habe an dem Morgen, um die Eintönigkeit unserer Tage zu durchbrechen, den vereisten Baum rot gefärbt und den leeren Schlitten nach San Giuda geschickt, um uns dorthin zu locken, und er habe sich mit seinen Fahrgästen zwischen den Bäumen versteckt, um sich zusammen mit ihnen an unserem Staunen zu erfreuen. Ich bildete mir ein, sie alle würden, während wir überrascht von den Motorschlitten steigen und auf den Totempfahl zugehen, fröhlich aus ihrem Versteck gerannt kommen, aus vollem Halse schreiend, um uns Angst zu machen. Ich schäme mich, es zu sagen, doch in dem Augenblick, in dem ich die überirdische Schönheit des Baums bewunderte und das Ganze für einen grandiosen Scherz von Beppe Formento hielt, bedauerte ich, dass die anderen nicht mitgekommen waren; ich dachte an Rina, die im Lebensmittelladen geblieben war, ich dachte an Perla und ihren Sohn, ich dachte an Ignazio, an Wilfred, an Florian in seinem Rollstuhl, an Enrico und Manrico Antonaz, an die Frau von Rezè, Urania, seit kurzem Witwe, an Argenia, an Adua, an Regina, an Heidi, an Genise, an die Lechner-Zwillinge, an Polverone, an Terenzio, an Nives, an Fernanda, an Maria, Armin und Lorenzetto; ich konnte gerade noch denken, wie blöd ich gewesen war, dass ich, als Zorro auf den Platz galoppiert gekommen war, nicht sofort begriffen hatte, dass es sich um eine Einladung von Beppe Formento handelte, alle gemeinsam zum Wald zu gehen, das ganze Dorf, zu Fuß, im Schneegestöber, um alle gemeinsam den vereisten Baum zu bestaunen, den er rot gefärbt hatte. Es war, ich wiederhole es, der letzte unbeschwerte Gedanke in meinem ganzen Leben, und obwohl er mir blitzschnell durch den Kopf schoss, werde ich mich immer daran erinnern.
Nachdem die Motoren der Schlitten ausgeschaltet worden waren, herrschte Totenstille. Der Schnee fiel immer noch in dicken Flocken, die sich einzeln gegen den dunklen Wald abhoben, doch als wir uns umwandten, in Richtung San Giuda, schien es, als seien wir blind geworden. Doch leider hatten wir unsere Sehkraft noch, alle drei. Im Laufe der Zeit ist in mir die Überzeugung gereift, dass Zeno die Körper als Erster gesehen haben musste, obwohl der Schrei – herzzerreißend, grauenhaft – von seinem Vater kam. Ich war jedenfalls der Letzte, der sie sah. Und von noch etwas bin ich inzwischen überzeugt: Wäre ich allein gewesen, hätte ich sie nicht gesehen, ich hätte mich geweigert. Und das Wort »Körper« trifft es auch nicht, denn es handelte sich zum größten Teil um Reste, verstreute Teile bedauernswerter Körper; und außerdem hatte der Schnee bereits alles zugedeckt, so dass sie sich unseren Blicken allenfalls noch als Ausbuchtungen, als unförmige Falten des weißen Teppichs darboten. Der Gedanke drängt sich auf, dass dieser außergewöhnliche Schneefall tatsächlich ein Geschenk der Madonna delle Selve war, zu der wir in unserer Kirche so inbrünstig beteten, auf dass sie sich für uns einsetzen, unseren Kummer lindern und uns Trost spenden möge – und offensichtlich erhörte sie uns damals, da sie über das Grauen dieses Morgens diesen weißen Schleier gebreitet hatte, um uns zu retten. Ja, man kann sagen, dass diese Schneedecke uns das Leben gerettet hat – meins, das von Sauro Formento und seinem Sohn Zeno – oder zumindest den Verstand, denn ich glaube, der Anblick dessen, was sich darunter verbarg – und was in der Folge zum Vorschein kam –, hätte uns darum gebracht.
Der vereiste Baum war immer noch rot, er glühte nach wie vor phosphoreszierend. Sauro stieß noch immer verzweifelte Schreie aus. Zu seinen Füßen ein dickes Schnee-Ei: der Kopf seines Bruders.
Mein Problem ist allerdings immer das gleiche: Ich kann kein Englisch. Ich beherrsche es nicht gut genug. In den Sätzen, die mich interessieren, gibt es immer etwas, das ich nicht verstehe und das mich fatalerweise daran hindert, den ganzen Satz zu verstehen. Ich weiß nicht einmal, wie man »Narbe« auf Englisch sagt. Ich muss auf Italienisch suchen, und das bedeutet schon mal eine ziemliche Einschränkung. Suche: cicatrici riapertura (Narben Wiederaufbrechen). Enter. 5580 Ergebnisse. Erstes Ergebnis: Die Narben Estetica on line: … eingesunkene Narbe: ist tiefer im Vergleich zur umgebenden Haut. Entsteht durch das Wiederaufbrechen der Wunde infolge einer Infektion oder weil sie … Nein, das ist nicht das Richtige. Zweites Ergebnis: Aknenarben lasern: … in manchen Fällen kommt es zum Wiederaufbrechen von scheinbar vernarbten Wunden … Nein, das ist es auch nicht. Und das dritte, vierte, fünfte Ergebnis ebenfalls nicht. Das sechste, das siebte – nichts, lauter Websites für Schönheitschirurgie. Und das, was ist das? Mountain Bike Community. Ich will nicht ohne Narben sterben. FIKO CRASTO … oder von einem Transporter überfahren? Lohnt es sich, von Bergamo aus aufzubrechen, oder sollte man besser auf die Wiedereröffnung des Mottarone warten? … O.k., der Begriff riapertura (Wiederaufbrechen, Wiedereröffnung) ist nicht der richtige. Ich muss einen technischeren wählen – zum Beispiel deiscenza, Dehiszenz. Ja, deiscenza – aber mit i oder ohne? Versuchen wir es mit i. Suche: cicatrici deiscienza. Klick. Meinten Sie deiscenza? Richtig. Ohne also. Aufbrechen der Kaiserschnittnarbe als Ursache der Blutung nach Abtreibung im zweiten Schwangerschaftsdrittel …, nein, nein, um Himmels willen. Weiter. Uterusruptur, es wird immer schlimmer …
Das Handy. Alberto. O nein, nein, nein, ich geh nicht ran. Ich habe es ihm gesagt, ruf mich nicht an, akzeptiere es, quäl mich nicht, es hat keinen Sinn mehr, immer nur zu reden, zu reden und noch mal zu reden, du musst es endlich akzeptieren, aber nein, er ruft doch an – und wie hartnäckig er ist. Aber ich geh nicht ran, es ist alles gesagt, ich geh nicht ran. Endlich gibt er auf. Jetzt wird er mir eine SMS schicken, bitte ruf mich an, ich halte es nicht aus – seine Erpressungsversuche. Auch darauf werde ich nicht antworten. Außerdem bin ich beschäftigt. Wo waren wir stehengeblieben? Dehiszenz. Drittes Ergebnis: Wikipedia, na ja, schauen wir mal: Geschichte: Die Wunde ist die sofortige und offensichtliche Folge einer Verletzung …, vielen Dank, und jetzt der ganze Sermon, die Naht, das Penicillin, wen interessiert das, wo ist die Dehiszenz? Ah, im Abschnitt Wundkomplikationen: Dehiszenz: Komplikation, die im spontanen teilweisen oder vollständigen Wiederaufklaffen der Wunde besteht. Sie kann verschiedene Ursachen haben wie die Infektion des Operationsgebietes, Platzen der Naht, Zerreißen der Gewebe infolge übermäßiger Spannung (Husten, übermäßige Anstrengung, falsche Bewegungen), operationstechnische Fehler (nicht korrekte Vereinigung der Wundränder). Na ja. Das sagt überhaupt nichts über die Dehiszenz meiner Narbe. Überlegen wir noch mal, hat Crocetti meine Geschichte widerspruchslos geschluckt? Hat er wirklich geglaubt, dass ich mir die Verletzung gerade erst beigebracht habe? Dass zwischen einer frischen Wunde und einer, die nach fünfzehn Jahren wieder aufbricht, kein Unterschied zu erkennen ist? Was ist das denn? »… Posttraumatische oder iatrogene alte Narben (> 2 Jahre) können sehr selten von einer sekundären spontanen Dehiszenz betroffen sein … Verdammt, das ist es. Also: Atti del 54° Congresso della Società Italiana di Chirurgia Plastica. Messina, März 2007 – Die Rolle der kollagenen und elastischen Fasern im Bindegewebe der Narbe – Referent Prof. Ennio Roncone. Öffnen wir es mal. … Die Definition der spontanen Dehiszenz ist alles andere als exakt oder kann in die Irre führen, denn wenn kein äußerer Faktor vorliegt, müssen wir davon ausgehen, dass Narben, sobald sie geschlossen sind, nie wieder aufbrechen sollten. Die Ursachen für ein derartiges Vorkommnis können eingeteilt werden in Verletzungen, mechanische Einflüsse und Stoffwechselstörungen. Die Verletzung im Bereich einer Narbe hat eine schädigende Wirkung vor allem in dem Maße, wie sie gesunde Haut schädigt. Von stoffwechselbedingten Ursachen spricht man bei krankhaften Veränderungen des Bindegewebes und/oder des Stoffwechsels, die nach der Phase der Narbenbildung auftreten und die Narbenoberfläche für eine sekundäre Dehiszenz anfällig machen, auch wenn sie minimalen Verletzungen ausgesetzt ist. Mechanische Einflüsse betreffen das oberflächliche und das tiefe Bindegewebe der Haut, die für die Stabilität der entstandenen Narbe verantwortlich sind. Wenn es nicht möglich war, ein Bindegewebe und eine ausreichende Dicke aller weichen Gewebe im Narbenbereich wiederherzustellen, bleibt die Haut die einzige Barriere für äußere Einflüsse, und sie ist verletzlicher, weil sie zu wenig von unten gestützt wird, so dass auch in diesem Fall eine kleine Verletzung die Dehiszenz auslösen kann. Nichtsdestoweniger …
Das Handy, schon wieder. Hat er beschlossen, mich zu drangsalieren, bis ich rangehe? Doch diesmal ist es nicht er: unbekannte Nummer. Oder besser, er kann es schon sein, wenn er die Raute-Taste gedrückt hat, um zu verhindern, dass die Nummer auf dem Display erscheint; doch eigentlich ist er nicht der Typ, der zu solchen Tricks greift, er ist zu stolz, das passt nicht zu ihm – aber man weiß ja nie, besser, ich geh nicht ran. Außerdem könnte es auch ein Patient sein, einer der Bergbewohner, die vom öffentlichen Fernsprecher aus anrufen – eigentlich können sie meine Privatnummer gar nicht haben, manchmal kriegen sie sie aber doch raus, weiß der Teufel wie, und rufen mich an. Wie auch immer, wenn die Nummer unbekannt ist, sollte man nicht rangehen – aber ich muss rangehen, ich habe keine Wahl. Es könnte ja auch Mama sein, wenn sie vom schnurlosen Telefon anruft, wird die Nummer nicht angezeigt, keine Ahnung, warum – und sie ruft fast immer vom schnurlosen Telefon an.
Die Wahrheit ist, ich habe es noch nie geschafft, bei einem Anruf mit unbekannter Nummer nicht ranzugehen; nie, nicht ein einziges Mal.
»Hallo?«
»Schaust du gerade fern?«
Der Mistkerl. Er hat doch die Raute-Taste gedrückt.
»Nein. Warum?«
»Schalte den Fernseher ein.«
»Warum?«
»Schalte ihn ein.«
»Was ist passiert?«
»Schaltest du ihn endlich ein!«
»Welchen Kanal?«
»Ganz egal.
Die Zeit fließt nur in eine Richtung
»Hallo?«
»Ciao, Nì.«
»Ciao, Mama. Wie geht es dir?«
»Mir gut. Aber du…«
»Aber ich was?«
»Wie geht es dir?«
»Gut, warum?«
»Wo bist du?«
»Zu Hause.«
»Du bist nicht zu Hause. Ich habe gerade angerufen, und du bist nicht rangegangen.«
»Ich bin in meiner Wohnung, Mama.«
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!