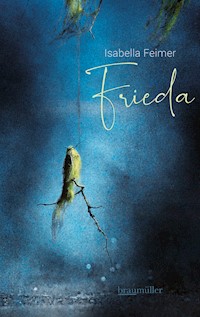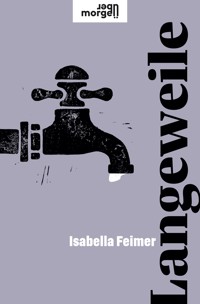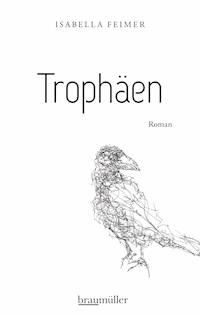10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Septime Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau und ihre Zeitalter - drei Momentaufnahmen, drei Stationen, drei Umbrüche. Die Einblicke in Marias Leben führen die Unausweichlichkeit der eigenen Geschichte vor, unspektakulär im Alltag, gnadenlos in ihrer Konsequenz. Maria, zeitlebens demütig im Hinnehmen, duldsam im Ertragen, sorgsam in der Erfüllung ihrer Pflichten, träumerisch im Wünschen aber kompromisslos, wenn das eigene Ich in der Unbedeutsamkeit zu verschwinden droht. Das Trauma einer Generation - man spricht nicht über die Dinge, nicht über eigene Gefühle, schon gar nicht über Vergangenes, Krieg, Verluste, Leid und Schuld. Ihre innersten Ängste und Wünsche adressiert Maria an den Kosmonauten Juri Gagarin, mit dem sie - so ihre Vorstellung - den Traum von der Schwerelosigkeit in Zeit und Raum teilt. »Schwerelosigkeit ist, wenn der eigene Körper kein Gewicht, das einem in das Leben und den vom Leben gewählten Alltag hineindrückt« Maria nimmt ihr eigenes Leben in Abschnitten wahr. Vermeintlich fremdgesteuert, in selbst gewählten Abhängigkeiten, lebt sie ihren Alltag mit geradezu fatalistischer Hingabe und wird sich nur in wenigen Augenblicken ihrer selbst bewusst - in Form eines Seufzers, als stumme Klage. Zwar träumt sie Zeit ihres Lebens von Möglichkeiten, erhebt jedoch die Pflichterfüllung zum obersten Prinzip. Eigene Bedürfnisse werden hintangestellt, Verdrängung wird großgeschrieben. Scham und Schuld sind ständige Begleiter. In Panikschüben tauchen persönliche Erinnerungen auf - an den Krieg, die russische Besatzungszeit, die Folgejahre, die von Konflikten, Demütigungen und Übergriffen innerhalb der Familie geprägt waren, unerfüllte Sehnsüchte. Eingekapselt in diesen Erinnerungen, in Gedankenfetzen, stummen Emotionen - die Toten als ständige Begleiter, die Frage nach dem Sinn und der Relation von Zeit und Erleben so offensichtlich, aber niemals ausgesprochen. In Rückblicken, Träumen und Briefen werden die Erlebnisse Marias durch Assoziationsketten aneinandergeheftet.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 238
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Cover
Impressum
Titelseite
Autorin und Klappentext
Buchanfang
Leseproben
Jürgen Bauer - Das Fenster zur Welt
Gudrun Büchler - Unter dem Apfelbaum
Christoph Flarer - Am achten Tag
Corinna Antelmann - VIER
Isabella Feimer, Zeit etwas Sonderbares
E-Book
ISBN: 978-3-903061-00-2
© 2014, Septime Verlag, Wien
Alle Rechte vorbehalten
Die Zitate vor den Kapiteln stammen aus: Juri Gagarin, Der Weg in den Kosmos, Elbe-Dnjepr-Verlag, Klitzschen 2001 (Reprint der Originalausgabe: Verlag für fremdsprachige Literatur, Moskau 1961), S. 152, S. 145 und S. 152.
Lektorat: Nadine Kube
Umschlag: Jürgen Schütz
Umschlagbild: © Claudia Hantschel
Printversion: Hardcover Schutzumschlag, Lesebändchen
ISBN: 978-3-902711-24-3
www.septime-verlag.at
www.facebook.com/septimeverlag | www.twitter.com/septimeverlag
Isabella Feimer
Zeit etwas Sonderbares
Roman | Septime Verlag
Die Autorin erhielt für die Arbeit an diesem Roman ein bm:ukk Arbeitsstipendium
sowie ein Aufenthaltsstipendium Writers in Residence
des Prager Literaturhauses und des Literaturhauses Niederösterreich.
Isabella Feimer
Jahrgang 1976, lebt als freie Schriftstellerin und Theater-Regisseurin in Wien.
2013 erschien ihr Demütroman Der afghanische Koch, ausgezeichnet mit dem 2.Platz der Akademie Graz und dem Anerkennungspreis für Literatur des Landes Niederösterreich.
Klappentext
Eine Frau und ihre Zeitalter – drei Momentaufnahmen, drei Stationen drei Umbrüche. Die Einblicke in Marias Leben führe die Unausweichlichkeit der eigenen Geschichte vor, unspektakulär im Alltag, gnadenlos in ihrer Konsequenz.
Maria, zeitlebens demütig im Hinnehmen, duldsam im Ertragen, sorgsam in der Erfüllung ihrer Pflichten, träumerisch im Wünschen und kompromisslos, wenn das eigene Ich in der Unbedeutsamkeit zu verschwinden droht.
Das Trauma einer Generation – man spricht nicht über die Dinge, nicht über eigene Gefühle, schon gar nicht über Vergangenes, Krieg, Verluste, Leid und Schuld.
Ihre innersten Ängste und Wünsche adressiert Maria an den Kosmonauten Juri Gagarin, mit dem sie – so ihre Vorstellung, den Traum von der Schwerelosigkeit in Zeit und Raum teilt.
„Schwerelosigkeit ist, wenn der eigene Körper kein Gewicht, das einem in das Leben und den vom Leben gewählten Alltag hineindrückt“
Für Mitzi, die mir Vergissmeinnicht zeigte.
Erde bin ich, Luft und schwerelos,
Sternenstaub,
toter Stein, funkelt, diamantengleich,
und man glaubt,
im eigenen Innern eine Sternschnuppe zu sehen.
Der tiefschwarze Himmel ähnelte einem gepflügten Feld, das mit Sternen besät ist.
Sie leuchten hell und klar. Die Sonne sendet einen unerträglichen Glanz aus, man kann selbst mit zusammengekniffenen Augen nicht auf sie blicken.
Juri Gagarin
Die Nacht heftet sich mit Metallklammern an den Abend, endlich die Füße strecken auf dem Holzschemel, den man den ganzen Tag hoch- und niedergestiegen, hat man den Staubteppich von Regalen und Kästen gewischt, von der Herrgottsfrüh an den Schmutz von den Bierkrügen, den geliebten Sammlerstücken vom Alten, Jahrzehnte schon, die er sich an ihnen festhält, an ihnen und an den damit verbundenen Zeiten, die besser waren, sagt er, einmal heute auch die Staubkruste auf den Holzrahmen mit den vergilbten Verwandten weggekratzt, die ihre Namen verschluckte.
Im Nebenzimmer schläft der Alte, die Tür offen, man muss hören können, ob’s noch atmet, das Herz, noch schlägt, das Gehirn im Schädel, die Kuckucksuhr tickt laut, ihr Innerstes nach außen, wenn die volle Stunde naht, der Rücken schmerzt, warum hat man nur?, dann ist der Gedanke weg, der Hund bellt, will in den Garten, und man lässt ihn schnell hinaus, bevor er noch den Alten weckt, der endlich eingeschlafen, will Auslauf, der Hund, will das, was man selbst nicht mehr, sich hat nehmen lassen, was, bittschön, hätte man denn tun sollen?, den Alten in ein Heim?, so ohne Geld, und man selbst dann ohne Aufgabe im Leben, dessen Mitte überschritten.
Herz und Seel’, das sind sie nicht, nur stiefväterlich verwandt, und das auch nur, weil Mutter, die auch Maria hieß, so wie man selbst nach ihr, da erstgeboren, in der Eile keinen Besseren gefunden, mit dem sie die anderen Töchter hat kriegen können, und der Bruder endlich einen Vater und eine strenge Hand, warum sich keine der anderen um den Alten kümmert, warum?, weil die Älteste immer alles und nie auf sich hat schauen, konnte man sich nicht aussuchen, nicht auf dem Land, wo jeder gleich redet, gleich viel zu allem zu sagen und zu schweigen hat, ach, tät’s denen nur wirklich das Maul zerreißen und dem Alten gleich dazu.
Würde man dem, was Heimat ist, sich nicht so verpflichtet fühlen, hätte man sich schon längst aus der Heimat gehen lassen, wäre mit der Schwester gegangen, die eine halbe Erde entfernt, die ein Haus und einen Mann, auch zwei Kinder, auch einen Hund, aber einen kleinen, hat’s gut, die Schwester, dort, wo ewig Sommer ist, man selbst weniger gut, hat es aber einmal gut gehabt, einmal im Krieg und einmal danach, im Krieg musste man nicht zu Hause bleiben, durfte nach Berlin, dann nach Brüssel, Nachrichtendienst, Telefonvermittlung, hat verbunden und getrennt, sich’s gut gehen lassen neben all den Toten, aber Krieg, das war einmal, und jetzt ist er kalt und hat seine Mauern.
Man holt sich eine Weste über die Kleiderschürze und ein Kopftuch übers Haar, macht leise und bedacht, will nicht wecken, die Eingangstür zu, setzt sich auf den Gartenstuhl, der an der bröckelnden Mauer, legt den Kopf in den Nacken, die Nacht bringt einen Sternenhimmel wie schon lange nicht, und einen wolkenlosen Mond, ist einfach da, der Mond, und weit weg, und zwischen dir und ihm unentdeckte Ewigkeit, und die Ewigkeit erinnert dich, Maria, der Mann im Mond schläft untertags, hat Mutter erzählt, früher am Bettrand, und nachts wacht er über all die schönen Seelen, braver Mann, der Mann im Mond, der Alte nicht, der hat einem immer etwas anzuschaffen, und man selbst das Gefühl, nie zu ruhen, nie zu schlafen, nur Schmerzen hat man, einen schönen Garten zwar und einen Schäferhund, doch bald fünfzig, ein paar Jahre bleiben noch, die besten schon gewesen, hundert wird man nicht, hofft inständig, der Alte wird’s auch nicht, krepiert bald, damit man wieder Ruhe und Auslauf und ein Leben, nicht bloß zwischen den Gemüsebeeten.
Die ersten Leberflecke zittern am Handrücken, haben sich hartnäckig zwischen die Knöchel gesetzt wie Zecken, die weißen Haare zwischen dem Semmelblond früher, kamen mit den schlimmen Nachrichten, der ist tot, und der auch, ja, und auch der andere, so glaubten viele, der, der jetzt im Nachbardorf, auch der Bruder, über den man nicht mehr spricht, der Josef, aber der ist doch nur vermisst, sagten alle, irgendwo in der Ukraine, vielleicht kommt er noch, so fünfzehn, zwanzig Jahre nach dem Krieg, kommt, noch, wieder, zurück, und manchmal denkt man auch, der hat irgendwo ein Leben, ein fesches, eine Frau, die lieb zu ihm, und Kinder, die ausschauen wie er, einen Bauernhof, und er fährt Traktor, das wollt er immer vor dem Krieg, als alle noch wollen durften, aber manchmal denkt man auch, und das öfter, dass er wirklich tot, nie und nimmer kommt, nicht, mehr, weil nur noch loses Gebein, namenlose Erde, dass halt auch alle tot, die ihn sterben sahen, und irgendwo steht ein Kreuz und sein Helm daraufgesetzt, hier ruht der Josef, er war ein guter, treuer Kamerad, und der Alte froh, dass der angeheiratete Sohn nicht wiedergekommen, keine Konkurrenz im Haus, kein Widerstand von einem jungen Wilden, der mehr will, als sich vom alten falschen Vater schlagen und schimpfen lassen.
Der Hund, der Teddy, schleckt einem sanft über die Finger, die sich über die Plastiklehne krallen, gestreichelt wird er trotzdem nicht, nicht, wenn man einmal kurz für sich, sich nicht kümmern muss, nicht mit einem Staubtuch über die verblasste Familie, nicht mit dem Schwamm über den verderbenden Körper, hat der Alte gehustet?, man schreckt zusammen, hustet er, spuckt es ihm das Schwarz aus der Seele, spuckt aufs Bettzeug, das man überziehen, und den Fußboden, den man wischen muss, hoffentlich krepiert er bald, Maria!, aus dem Haus die kratzige Stimme, laut, obwohl der Körper schwach, Maria!, aber man rührt sich nicht, keinen Millimeter, denkt nicht mal dran und gibt vor, sich und dem Alten, mit dem Hund spazieren zu sein.
Kann nicht immer verfügbar sein, schon gar nicht, wenn mit den Gedanken woanders, nein, nicht auf dem Feld, wo es seit Wochen nach Herbst riecht, seit Juli riecht das Feld angestrengt nach September, man denkt sich aus dem Garten, hinaus aus dem Herbst, denkt sich verschämt ins Nachbardorf, Maria!, noch einmal schreit er, man ist still, einen Tee wird der Alte haben wollen oder Wasser oder eine Hand, die dann seine hält und tätschelt, und eine Stimme, die sagen muss, dass sie da ist, sanft sagen muss, an seiner Seite bis zum End, nein, lieber schaut man sich die Sternschnuppe an, die zu schnell über den Himmel zischt, als dass man sich etwas wünschen könnt, man schließt die Augen, trotzdem, man weiß ja nicht, vielleicht kommt ein Wunsch da oben langsamer voran, ist dick und dicht da zwischen Sternen und Unendlichkeit, dann dankt man Gott, dass er auch dort oben, dankt, dass man an ihn glauben kann und dass er in der Kirche jeden Sonntag wartet, und rasch wünscht man sich den nächsten Morgen und den Kaffee in der Blümchentasse, die einen Sprung hat, ein Stück Porzellan herausgebrochen wie ein Stück Zahn dem Alten, ersehnt sich den Morgen, denn am Morgen ist Ruhe, ist Zeit, während der Alte schläft, tief und lautlos, seinen wunden Rücken der Küche zugewandt.
Sich gegen die Sterne strecken, von denen man weiß, die greift man nicht, recken, ins Schwarz greifen, ins Leere, ins Universum, an dessen Unendlichkeit man glaubt, später in der Dunkelheit des Hauses in den Nachttopf, den man entleeren muss, und dem Jammern trotzen, das der Alte einem entgegenschleudert, holt man den Nachttopf, und fängt das Jammern an, würde man ihm gerne ein Kissen aufs Maul drücken, aber nicht jetzt, erst später, später, und steht man auf, um dem Jammern gut zuzusprechen, verstummt es, pünktlich wie die Kuckucksuhr, und für Eigenes bleibt keine Zeit, bleibt nur die kurze Stille, die bald den Herbst bringt, ja, man hört die Blätter in den Herbst fallen und denkt wehmütig an den Winter, denn im Winter ist es am Schlimmsten und der Alte die Gemeinheit in Person.
Man weiß, man muss wieder in den Schlund des Hauses, das eine Küche mit alten Kredenzen, an denen der Lack splittert, das ein Schlafzimmer, in dem der Alte, der Geruch nach Vergänglichkeit, der bleibt, egal, wie viel und oft man scheuert, einen Vorraum mit Gartenwerkzeug und dem Waffenrad im Winter, in der Küche das Feldbett, und ein Säckchen getrockneter Lavendel unter dem Kopfkissen, auch den gönnt man sich, Lavendel hat man gern, erinnert an Orte, an denen man noch nicht gewesen, Hand in Hand durch ein Lavendelfeld, betört vom Duft und einer Liebe, ach, an Liebe hat man immer, glaubt man sein Leben lang, und ein Seufzer wär angebracht, einer von der traurigen Sorte, und traurig winselt auch der Hund, schleckt übers Knie, bleibt mit der Zunge an dem Wollstoff hängen, will er wirklich noch aufs Feld?, aber man will nicht mehr, will sitzenbleiben, kalt ist’s, Maria!, schreit er, und man schreckt zusammen, aber soll er doch, man muss Sternderln schauen und wünschen, bevor die nächste Schnuppe kommt, Maria!, aber nein, du alter Trottel, denkt man, nicht jetzt, bin nicht da, bin anderswo, und denkt, dass man den Mann im Mond gern kennenlernen würde, wie der ausschaut?, fragt man sich, hat sicher ein blasses Gesicht bei so wenig Sonne, schmunzelt man, aber der Mond strahlt nur wegen der Sonne, auch das weiß man, obwohl in der Schule damals, da haben sie einem wenig beigebracht, lesen, schreiben, und das schön, und rechnen, gut, das bringt etwas fürs spätere Leben, man führt ein Haushaltsbuch, eine Liste übers Haushaltsgeld, das aus der Rente kommt, der Kriegsrente vom Alten und ein bisschen eigener Witwenrente dazu.
Man denkt vor, in allem und schon immer, den Wünschen, derer viele sind, und dem Haushalt, brav, wie man es gelernt, ja, man geht, man muss, für mehrere Tage einkaufen, damit man sich den Rest der Zeit, die keine Stunden kennt, ergiebig kümmern kann, schwingt sich aufs Waffenrad und treibt mit dem Fahrtwind, der eine kleine Freiheit näher bringt, zum Greißler, dort nimmt man den Korb vom Träger und packt ihn randvoll bis obenhin, fast eine Wochenration, mit Brot und Käse und Milch, Gemüse braucht man nicht, das gibt der Garten her, noch, bald nicht mehr, wenn der Winter kommt, dann muss das Gemüse auch in den Korb, wenn Platz vorhanden, und für Wurst und Fleisch, das hat der Alte gern, fährt man zu einer anderen Adresse.
Gell, der Fleischhauer lächelt einen immer so an mit so einem verschmitzten Lächeln und lässt einen kosten von der frischen Extrawurst, und während man kaut, erzählt er von der Welt und wie er sie so sieht, von der Sowjetunion, die einmal, ist lange her, Russland hieß, der Kommunismus, abgeschottet hinter Mauern, die größte Gefahr, und das schon immer, gut, sagt er, dass es eine Mauer gibt, könnt höher sein und dicker, und man lächelt zurück, macht aber keinen Knicks wie noch als junges Mädchen, wie beim Fleischhauervater, bevor der im Krieg gefallen, war’s in Frankreich?, nein, Russland war’s auch nicht, da sind die anderen, nein, nicht verliebt, ist man nicht mit bald fünfzig, aber zurücklächeln darf man, adrett, das sagen alle, Maria, eine feine Frau, lächeln für ein bisschen Gratiswurst.
Jetzt schreit der Alte nicht mehr, gibt auf das Schreien, und es braucht nur Geduld, bis sein Körper und seine Stimme endlich kraftlos, die gab’s am Anfang nicht, ist man immer gleich gelaufen, wenn der Alte sich im Bett auch nur gedreht, gehüstelt, gespuckt, gekratzt, und man selber hat weitergekratzt an den Stellen, an denen es ihn gejuckt, ihn dann gewaschen, und die wunden Stellen gesundversorgt, Jod und ein Pflaster und Zureden, aber mit bald fünfzig, wenn man die meisten Jahre davor vergessen, wenn ein Jahr zu einem Tag geworden, wird man gelassener, will sich ein Neinsagen gönnen, auch ein Leben, aber das wartet andernorts, und bald schon pustet man auf dem Geburtstagskuchen die fünfzig Kerzen aus, jede Kerze ein Wunsch, der in Zukunft sich erfüllen sollte, doch hat man noch so lang im Leben für all die fünfzig Wünsche?, Wunsch eins, der Alte muss krepieren.
Ein Seufzer noch, dann aufgestanden und die Tür geöff-net, die Kälte aus dem Körper auf den Fußabtreter geschüttelt, der Hund zwischen den Beinen durch in die Küche, und man reibt sich die Hände, macht kein Licht, auch alte Augen sehen durch die Finsternis, lauscht ins Zimmer zum Alten, sein Atem ohne Gleichmäßigkeit, sieht seinen Schatten, der sich mal hebt, mal senkt, der Alte schläft, Gott sei’s gedankt, zu wach ist man, um gleich ins Bett, ein Gläschen Wein eingeschenkt, ein erster Schluck, dann ins Mariazimmer, klein und fein, ein Sofa und die ganzen Bücher, die man einmal lesen wird, Landkarten und Stadtpläne, die man bereisen, ein Schreibtisch, und in den Laden Briefe von den Schwestern, die jetzt alle nicht mehr da, eine in dem Dorf gleich nebenan, eine in der großen Stadt, die ist verrückt geworden, eine über dem Ozean, dort wo es immer Sommer ist, dort gibt es Eukalyptus und roten Sand, dort hat die Schwester einen Kakadu, weiß ist der, und der Kamm ist gelb, und man muss lachen, wenn man an den Vogel denkt, und die Schwester schrieb, er redet, krächzt, good morning und good bye, und jeder Brief der Schwester eine Einladung in ihre Welt,
kannst zu uns kommen, Maria, Platz ist genug,
hab jetzt, da die Kinder größer, ein ganzes Stockwerk nur für Dich,
ich weiß, Deine Pflichten hindern Dich,
doch überlege, so eines Tages …
Die Türe zu, der Schlüssel sperrt von innen, beim Schreibtisch macht man Licht, öffnet die Lade, nimmt Stift, nimmt Papier und schreibt doch nicht, noch ein Schluck Wein, einmal will man die anderen sehen, nein, jetzt nicht traurig sein, der Tag ist beinah geschafft, die Schmerzen im Rücken und in den Füßen für heute überstanden, selbst Schuld, Maria, wärst mitgegangen.
Mit der Nacht kommt der Mond ins Fenster und all das Sentimentale auf den Tisch, kommen die vergilbten Briefe auf die Schreibfläche, kommt der Verlobte, spätere Ehemann, Konrad, der ein Deutscher war, dem ein Granatsplitter das Herz zerfetzt, deins, Maria, er hat ohnehin nichts mehr gespürt, wenigstens schnell dahinverstorben, nicht in einem Lazarett vervegetiert, schneller tot als jemals lebendig, musst nicht leiden, der Konrad, nicht viel vom Krieg erleben, die Feldpost zwischen den klammen Fingern, die zittern, wenn sie von Zeile zu Zeile springen, junges Mädchen in den Fingerspitzen, der letzte Brief, den er schickte, der größte Schatz.
Augenstern,
ich sitze fest, im Graben mit den anderen, die fühlen so wie ich, denken an ihre Liebsten und reichen Fotografien herum, Dein Bild gehört mir, will ich mit den Kameraden nicht teilen, alles andere teilen wir, das Essen, auch eine Zigarette, Geschichten von zu Hause, Mutter, Vater, Geschwister, alle hier mit uns, am schwachen Feuer sitzend, und wir lachen über Vergangenes,
und der Kommandant hat mich gelobt, ich sei ein guter Soldat, ich denke mit, bin für die Kameraden da und schieße gut, treffe den Feind, bevor er uns,
Maria, Liebste, Du kannst stolz auf mich sein, der Krieg kein sinnloser,
und ich denke oft, was ich zu Hause machen werde, bin ich entlassen aus der Pflicht, denke, wir könnten ein Geschäft, ein kleines, denke, ich könnte Beamter werden, und Du meine Beamtenfrau, wir haben Möglichkeiten, und ich bin stark und habe einen Willen,
im Moment, da will ich Dich,
lieben, schätzen, ehren, und das mein Leben lang.
Wie oft hat man ihn gelesen, sagt ihn auf wie den Rosenkranz, seit Jahren schon, seit damals, als er von einem ging, nein, die Erinnerung an die Stimme verfliegt nicht, ist kein Vogel, der in den Süden zieht, ist wie die Blätter der Rhabarberstaude, hat sich ins Herz gefressen, Herbst war’s, als Konrad ging, als er gehen musste und alle Träume mit sich nahm, die gemeinsam ersponnen, einmal den Mond erobern, reisen vom gemeinsam Ersparten, einmal die Welt von oben sehen, und sich anders fühlen, so gar nicht als Teil von ihr, Gott gibt, Gott nimmt, sagt der Pfarrer, und dem gütigen Gott ist alles zu verzeihen, da steckt ein Plan dahinter, wie nach jeder Nacht ein neuer Tag, wie der Mond gehen muss, wenn die Sonne nach dem Sternenhimmel greift und Licht bringt und Wärme auf all die Gottespflanzen.
Und mit den Zeilen kommt die lebendige Erinnerung, mit Konrad durch Berlin, kennengelernt unter einem Lindenbaum, noch ohne Mauer, noch ohne Trümmer, und das erste Mal geküsst in einem Keller bei einem Fliegeralarm, das sanfte Blau in seinen Augen, wie so ein Himmel, bevor er Abend wird, und du gleich hin und weg und tief in süßen Zukunftsträumen, fesch, der Konrad, nicht bloß wegen seiner Uniform, fesch, weil gebildet, weil aus einer großen Stadt, und die deutsche Familie, Maria, die du bald kennengelernt und die dich in ihr Familienherz geschlossen, gebildet, nicht so stumm wie die eigene, nicht so auf dem Land und mit dem Land verwurzelt, dass man vor lauter Wurzeln die Erde nicht mehr fassen, luftig auch Konrads Gemüt, hatte immer ein Lächeln, eine Berührung, einen flüchtigen Kuss, ein Wissen, das er mit einem teilte, über Welt, Geschichte, und man hatte Träumereien, träumte sich in eine gemeinsame Zukunft, mit Kindern, die draußen im Hof, mit Vater, Mutter, und gerne dachte man sich in eine zukünftige Familie, immer lächelnd und immer fröhlich, hübsche Kinder, hübsche Eltern, hübsches Paar, und hübsch das Leben, das man führen würde, beschauliches Glück, doch so vergänglich.
Nacht ohne Sterne, und in einer Stille, wie sie im Krieg nur selten war,
und Konrad an deiner Seite, hielt dich im Arm, nahm die Bibel und las daraus, las über Erlösung,
und du hörtest sein Herz, klopfte gleich wie deins in Liebe, in Erwartung, schnell,
er liebkoste dich mit Worten, seinen Blicken,
nur diese eine Nacht, die uns vereinte, hielt bis zum Morgengrauen.
Morgen, denkt man, wird man im Garten sein, sich dem Unkraut widmen und dem Gemüse, morgen wird man länger mit dem Teddy, morgen ist der Alte vielleicht schon tot, und endlich Ruhe, und man schämt sich, denn so was sagt man nicht, tut Gutes als so ein Gotteskind, wer weiß, den Glauben an die Hoffnung, an die Zukunft verliert man nicht.
*
Der Kuckuck übt sich schon in Ungeduld, kalte Sonne, grelles Licht, doch man will nicht aufstehen, sich nicht aus der Lavendeldecke schälen, will nicht, dass sich die konservierte Körperwärme verflüchtigt in der klammen Küchenluft, das Nachthemd eine zweite Haut, und die Lavendeldecke ein Kokon, man schwitzt, doch will man noch nicht schlüpfen, Schmetterling, das war einmal, jetzt ein Kuckuck, der pünktlich auf die Stunde, das Uhrwerk tickt, solange es noch aufgezogen, hätte man eine Ehe und Kinder, man müsste sich nicht um den Alten, dessen erstes Röcheln im Traum schon bekümmert werden will, man müsste anderes, aber beschenkt durch Kinderlächeln, der Alte, der lächelt nie, verzieht nur seinen Mund, legt sein Gesicht in noch mehr Falten, dass einem schlecht wird, und das gleich in der Früh, dass man die Haare raufen, ihm seine ausreißen möchte, jedes einzeln, und ihm die Augen, wie sie so in ihren Schlitzen sitzen, und ihn, bis er, endlich,
vorsichtig streckt man eine Hand ins erste Tageslicht, Staubpartikel schwirren, greift nach den kleinen Planeten im Küchensonnensystem, hat man geträumt, ja?, den halben Schritt zum Mann im Mond?, da oben im Sternenstaub, vorbeigeträumte Schwerelosigkeit, und ganz klar die Risse, die die Mondoberfläche zeichnen, und man versucht sie mit den Fingerspitzen nachzuziehen, greift ins Licht.
Noch hat der Alte keine Stimme, kann nicht schreien, die Stimme kommt erst nach dem Röcheln in den Hals, nachdem der Hals sich freigeschleimt, aber aufs Klo wird er müssen, und man weiß, jetzt muss man endgültig raus, aus dem Feldbett und zu ihm hin und ihm den Nachttopf halten, dann die Windel auf, schauen, ob er geschissen, den Urin bringt er noch selber in die Schüssel, sagt täglich, wenn ich das nicht mehr, will ich erschossen werden, bittschön, denkt man, würd selber wollen, dass einer ein Erbarmen, man setzt sich auf, das Feldbett quietscht, der Hund, der Teddy, kommt dahergelaufen, und man streichelt ihn pflichtbewusst in den neuen Tag, das Fell so weich, man möcht es küssen, und so steht man auf, die Füße finden ihren Weg, der erste in den Garten mit dem Hund, dort soll er springen, dann geht man ins Mariazimmer, in die Strümpfe, in das Hauskleid, in die Kleiderschürze, für die Katzenwäsche in die Küche, Maria!, schreit der Alte schon, und man muss zu ihm, schaut in die Windel und in den Nachttopf unterm Bett, und jetzt rotzt der Alte, der Rotz an der Nase, zieht sich bis aufs Kinn, und man will ihn in seinem Körperdreck verrecken lassen.
Wieder schmerzt der Rücken, und seit Kurzem ist da so ein Ziehen im rechten Bein, von der Hüfte bis zum großen Zeh, glaubt, man versinkt, zieht einen hinab, quer durch den Erdboden, und man denkt, vielleicht ist der Schmerz ein Seil, das an den Fuß gebunden, und auf der anderen Seite der Erde festgezurrt, und die Schwester steht und zieht in ihrem Garten, und auf ihrer Schulter sitzt der Kakadu, sagt, hello, zieht dich, Maria, durch die Erde durch.
Schleich dich, faucht der Alte, und die Stimme ist zurück, schleich dich, Trampel, elender, und man schleicht sich, den vollen Nachttopf lässt man dort, lässt sich nicht lumpen, hat Mittel, eigene Wege, um es dem Alten heimzuzahlen, und man schlägt die Tür zur Küche zu, Trampel, schreit er nochmal, ich weiß, willst mich verrecken lassen, gemeines Mensch, das warst du immer schon, jetzt der Kaffee verdient, was meinst, Maria?, und mit dem Kaffee in der Blümchentasse riecht man an der Milch, tut man immer seit dem einen Mal, als der Alte die gute gegen eine schlechte, hat er mit Absicht, damit man nicht aus dem Haus, sondern im Bett mit Magenschmerzen, hat gemerkt, dass man sich einmal mit einem anderen Mann, nur auf eine Stunde, dass man mit dem Fleischhauer auf einen Tee, was einen verraten?, der Alte hat gerochen, wenn etwas faul, jetzt kaum Geruchssinn mehr, nur seinen Urin, den wird er riechen, der beißt, stinkt nach der Fäulnis, die im alten Körper wächst und gedeiht, und heute lässt man auch seine Windel stinken, ist doch egal, ob er wund, muss auch erdulden, wenn man seine Scheiße riecht, vom Hintern schabt, macht einem nichts, wenn man ihn füttert, muss auch hinnehmen, dass er einem ins Gesicht, mit Leidenschaft aus seinem Rachen die Medizin, die bitter schmeckt und scheußlich riecht, dass er danach versucht, einen zu schlagen, doch meist ist man schneller, ist wendig und kennt den Alten, nur zu gut.
Der andere, was er jetzt tun mag?, noch schlafen oder doch an einen denken, wär gern mit diesem anderen zusammen weggegangen in ein anderes Land, über Flüsse, die beide gerne mochten, Flüsse, sagte der andere, ziehen dich in die Welt hinaus, doch das Heimatdorf hat keinen Fluss, nur ein Bächlein, an dem sich Ottern tummeln, aber das war vor dem Krieg, und der andere liegt jetzt an einer anderen Seite, einem Fluss, der größer ist und breiter als das Bächlein, liegt nicht so fern von der großen Stadt, doch unerreichbar, einmal nur, ein Zaun, ein Windhauch, ein Sonnenuntergang, haben sich die Finger durchs Gitter berührt, die Lippen noch nicht, das war erst, bevor er und die andere Schwester in das Nachbardorf, um eine Tochter und ein trautes Eigenheim, wie es sich die Schwester wünschte, doch seine Sehnsucht blieb zurück, nein, nicht auf der Strecke, er sehnt sich noch, das schreibt er, und Sehnsucht setzt den Fluss in Gang.
Geküsst hat man den anderen auch am Ende des Zaunes, einmal am Ende einer Sehnsucht, die jäh gestört und unterbrochen von der Schwester, der der andere gehörte, versprochen war, schon vor dem Krieg, hat beobachtet, die Schwester, aber nichts gesagt, ist dann nur schnell zum Altar und noch schneller aus dem Dorf in ein nächstes, und der andere, der musste mit, weil er in der Schwester Schuld, weil sie ihn durchgefüttert, nachdem er aus der Gefangenschaft, mit seinen Wunden zum Verheilen, aber man hätte auf sein Liebesrecht bestehen sollen, nicht auf die Mutter hören mit ihren Gutenachtgeschichten von Glaube, Treue, Loyalität, der eigenen Schwester nimmt man doch den Mann nicht weg, und verheiratet war man ja schon, einmal, auch wenn nur kurz, auch wenn keine Flitterwochen, nur in München ein kurzer Fronturlaub und diese eine, einzige Nacht.
Soll man ins Nachbardorf?, mitsamt dem Hund, das Haus und all die Erinnerungen verkaufen, ein neues Leben sich aus dem Verkauften bauen, aber der Garten, der ist so schön, und liebevoll gepflegt, geackert, vom Unkraut ausgezupft, nein, zuerst wird man das Begräbnis richten und eine Zeit lang trauern, Hände schütteln an dem Grab, und das dem ganzen Dorf, sagen, da ging ein Großer, ein Guter, man vermisst ihn, und man wird der Gemeinde im Wirtshaus Fleisch und Kraut spendieren müssen vom Rest vom Haushaltsgeld, danach täglich in die Kirche, traurig und gebückt, man glaubt an Gott mehr als an die Hoffnung, Gott, immer da, auch in den kleinsten Dingen, dem Sprung in der Blümchentasse, Gott auch im Weihrauch, den man gerne riecht, wird einem nicht schlecht davon wie all den anderen, denen, die nicht in die Kirche gehen, müssen sich daran erbrechen, weil sie niemals Buße tun, und man redet gern mit dem Herrn Pfarrer und das lang, der hört zu, und wenn man beichtet, klagt man ihm sein Leid, sagt nicht, dass man den Alten mit dem Kissen, mit dem Nachttopf, mit der Gartenschaufel, ersticken, ertränken, erschlagen will, sagt nur, dass alles schmerzt von so viel Arbeit, all den Mühen, und der Pfarrer sagt, damit es besser wird, drei Vaterunser und einen Rosenkranz, auf Knien beten, auf den Knien.