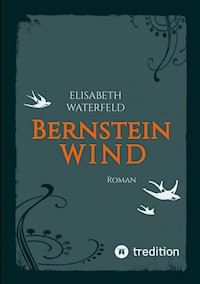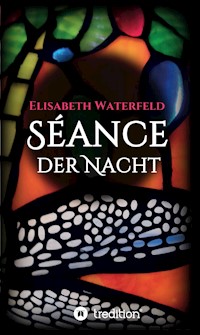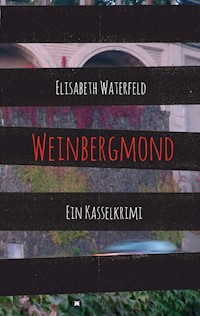5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wilhelm hat, was ein Mann braucht. Er ist jung, gut aussehend und mit einflussreichen Beziehungen ausgestattet. In einer Zeit des politischen Umbruchs begleitet er die junge Marie auf eine Reise, in der Traum und Realität verschwimmen. Kann sich Geschichte wiederholen? Dieser Frage geht Elisabeth Waterfeld in ihrem zweiten Roman nach: Die Schauplätze Berlin, Paris und Kassel bieten die Kulisse für eine Zeitreise der besonderen Art.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 249
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Kann sich Geschichte wiederholen? Dieser Frage geht Elisabeth Waterfeld in diesem Roman nach: Die Schauplätze Berlin, Paris und Kassel bieten die Kulisse für eine Zeitreise der besonderen Art, bei der der Protagonist Wilhelm Sokol an seine Grenzen stößt.
Eine leidenschaftliche Liebe trifft auf einen Verrat vor dem Hintergrund politischer Umbrüche.
Die Autorin
Elisabeth Waterfeld schrieb die Romane "WEINBERGMOND - Ein Kasselkrimi" und "KIRMESBLUT - Musik für Gardner", die sie der Stadt Kassel und ihrer Heimat Nordhessen widmete. "WEINBERGMOND" schaffte den Einstieg in die Tredition-Bestsellerliste.
Elisabeth Waterfeld
ZEITENBRAND
Roman
© 2016 Elisabeth Waterfeld
Autor: Elisabeth Waterfeld
Umschlaggestaltung, Illustration:
Elisabeth Waterfeld
Verlag: tredition GmbH, Hamburg
ISBN: 978-3-7345-6577-9 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
„Wenn Du so weit bist,
dann geh zum Merkurpunkt.
Ich warte so lange.“
Teil I
HITZE
Berlin – Paris
Eins
D er Ausblick ist gigantisch. Ich kann nicht sagen, welche Wüste es ist, aber es muss wohl eine sein, die nach allen Seiten kein Ende hat. Am Horizont sehe ich das Licht, wie es auf den hellen Sand sowie auf seine kleinen und großen Hügel trifft.
Nur wenn ich ganz genau hinschaue, erkenne ich noch etwas von dem Blau, das der Himmel offensichtlich hat. In weiter Ferne unterscheidet sich der Sand nicht mehr vom Himmel. Ich blinzele und fühle, wie meine Augen schmerzen. Heiße Tränen rinnen an meinen Wangen hinab.
Wüsten kenne ich aus dem Atlas. Dort sind die Flächen im direkten Vergleich zu den anderen Gegenden relativ große, aber überschaubare Flecken in beige. Ich drehe mich um und sehe nichts außer dieses Licht.
Was ist der nächste Schritt? Welche Richtung muss ich einschlagen? Meine Füße stecken im Sand. Auch wenn die Sonne brennt, sind meine Zehen angenehm kühl. Ich stehe im Sand, nicht direkt darauf. Er fühlt sich klebrig an und ich spüre, wie sich in der Bewegung meiner Zehen die Körner an meinen Füßen festsetzen.
Jetzt, als ich einen Schritt nach vorn wage, begehe ich einen folgenschweren Fehler. Meine rechte Fußsohle durchfährt ein stechender Schmerz. Zuerst eiskalt aufblitzend, fühle ich, wie die Hitze in meine Haut schneidet. So beschließe ich, meinen Fuß wieder an seinen ursprünglichen Ort zu stellen.
Wie komme ich weiter? Ich sehe an mir herunter und erkenne, dass ich helles Leinen trage, gerade richtig für eine solche Expedition. Ich warte ab in der Hoffnung, dass mir jemand zur Hilfe kommt. Ein Nomadenvolk vielleicht oder zumindest ein einsamer Reiter auf einem Kamel.
Kann ich hoffen auf menschliches Leben und auf Unterstützung in dieser Ödnis? In meinen Hosentaschen befindet sich nichts, das mir helfen könnte. Zwar trage ich einen kleinen Kompass immer bei mir, aber was helfen nun die Himmelsrichtungen?
Erfahrungsgemäß ist es im Süden wärmer. Ich drehe mich um und beiße die Zähne zusammen. Die ersten Schritte gen Norden schmerzen so, wie ich mir die Glut der Hölle vorstelle. Nach einigen Metern meines Weges werden die Stiche erträglicher. Dafür habe ich nun ein neues Problem.
Wer von Wüsten schon gehört hat, ahnt, wie ich mich fühle. Da ich keine Kopfbedeckung trage, spüre ich ein stetiges Pochen in meinem Kopf, das sich mit nahezu jedem Schritt verstärkt. Als wäre mein Kopf eingezwängt in einer Schraubzwinge, zieht sich das Gewinde stärker zu. Mit meinen Händen versuche ich, die Sonne abzuhalten, was mir nicht gelingt. Ich erwarte zudem unsäglichen Durst, auch wenn er mich jetzt noch nicht plagt. So gehe ich mit den Händen über dem Kopf durch den heißen Sand, überquere mühevoll einige kleinere Berge in der Hoffnung, den rechten Weg eingeschlagen zu haben.
Das Gehen im Sand ist schrecklich. Ich habe das Gefühl, überhaupt nicht vorwärts zu kommen, weil meine Füße immer wieder verrutschen.
Nach weiteren etwa hundert Metern bleibe ich wieder stehen. Warum bin ich so töricht, zu glauben, dass sich am Horizont ein Ort, eine Stadt oder Menschen ausmachen ließen? Dieselbe Kulisse wie noch vor einigen Minuten. Das Licht ebenso grell und ermüdend. Und doch ist da etwas.
Ich reibe meine Augen und vermute eine Sinnestäuschung. Vielleicht ist mein Bewusstsein schon völlig ausgeschaltet oder meine Schmerzen sind einfach zu stark.
In einigen Metern Entfernung steht ein Tisch. Mitten in der Wüste. Sein Fuß ist gusseisern verziert. In Paris hatte ich solche in kleinen Bistros gesehen. Damals, als ich mich mit Marie dort getroffen hatte. Auch der Tisch damals hatte eine weiße Decke aus Damast. Ich weiß noch, wie wir uns daran gegenüber saßen und wie die Hors d´ Oevres uns auf der Zunge zergingen.
Ich gehe näher zu dem Tisch und berühre das gestärkte Tischtuch. Ich spüre unter meinen Fingerspitzen, wie die Fäden sorgfältig zu einem Stoff verwoben wurden. Darunter fühle ich noch etwas.
Er ist kühl. Eigentlich hätte der Tisch die Temperatur der Umgebung haben müssen. Ich glaube deshalb, dass man ihn erst vor kurzem hierher gestellt hat. Also nutze ich die Gelegenheit, mich auf seine Oberfläche zu setzen und atme tief ein. Meine Füße lasse ich locker baumeln und spüre, wie der Schmerz unter meinen Sohlen nachlässt.
Noch immer kann ich nicht sagen, wie ich hierher gekommen bin. Noch mehr interessiert mich aber die Frage, ob ich denselben Weg nehmen könnte, den der Tisch hierher geführt hat und ich sehe mich um. Der Horizont sieht aus wie vorhin. Die Sonne scheint und kein Baum zeichnet sich in der Ferne ab.
Ich lehne mich zur Seite, um den Kompass aus meiner Hosentasche zu ziehen und schüttele ihn leicht. Ich muss tatsächlich einige hundert Meter gen Norden gelaufen sein. Die Nadel schlägt noch immer aus.
Während ich auf meinen Kompass sehe, bin ich froh über den günstigen Schatten, sodass ich lesen kann.
Schatten?
„Entschuldigen Sie, dass ich mich verspäte. Hier ist Ihr Stuhl. Was darf ich Ihnen bringen? Kaffee? Tee? Eine heiße Schokolade mit Sahne?“
Vor mir steht ein Kellner mit einem Stuhl. Er ist gut gekleidet, trägt ein weiß gestärktes Hemd zu schwarzer Weste. Ich möchte mich gerade über sein Angebot wundern, als ich sehe, wie seine Gesichtszüge verschwinden. Vorher sehe ich noch, wie sich sein freundliches Kellnerlächeln zu einem tiefen, hämischen Grollen verändert.
Mein Bein verlängert sich gen Norden.
Zwei
Ich bin schuldig im Sinne der Anklage.“ Starkes Husten durchfuhr den Körper des jungen Mannes, das sich zu einem gefährlichen Anfall steigerte. Seine Krankheit hatte ihn sichtlich geschwächt. Das weiße Bettlaken tat sein Übriges, um die Blässe und Kraftlosigkeit seines Körpers zu unterstreichen.
Wilhelm wusste nicht, wie er diesem armen Menschen helfen sollte.
„Matthias, es tut mir unendlich leid, aber in dieser Angelegenheit kann ich Dir keine bessere Nachricht mitteilen. Das deutsche Recht ist sehr streng bei allem, was als so genannte Unzucht bezeichnet werden kann.“
Vorsichtig nickte der Kranke und lächelte dazu verschmitzt. Ihm und seinem Anwalt war die Nutzlosigkeit ihres Gespräches längst klar geworden - ob er nun Recht bekam oder ob man ihn einsperren würde.
Die Frage, ob der junge Goldberg es noch bis zu seiner Verhaftung schaffte, drängte sich beiden unter vielen anderen am stärksten auf. Wilhelm wusste, dass die Familie Goldberg alles daran setzte, die Schande ihres Sprosses zu verbergen. Er war gebildet und kultiviert. Ein einmaliger Fehltritt sollte nun für seinen gesellschaftliches und körperliches Sterben sorgen.
Schon lange hasste Wilhelm die Gesellschaft dafür. Schon oft hatte er mit seinem Vater Streit darüber gehabt. Er war ein Anwalt, der die Kanzlei treu im Sinne seiner Vorfahren weiterführte. Trotzig und Ehrfurcht gebietend blickten sie noch von den Wänden auf das, was Vater und Sohn besprachen.
Wilhelms Vater wusste stets, was sich gehörte. Ein Klient wie dieser junge Goldberg vertrug sich nicht mit dem Renommee der Kanzlei. Wilhelm war sich darüber bewusst, aber warum sollte er sich nicht für jemanden einsetzen, der wegen schwerer Krankheit in ein Gefängnis musste? Sein Husten und seine fiebrig glänzende Haut verhießen nichts Gutes.
Es war klar, dass Matthias sterben würde. Warum durfte er dies dann nicht in Würde tun? In der letzten Woche hatte Wilhelm lange mit seinem Vater über diesen Fall gestritten und sein Vater hatte sich eindeutig dagegen positioniert.
Früher, als Wilhelm noch dem Wunsch seines Vaters, die Kanzlei zu übernehmen, entsprechen wollte, hatte er vorgehabt, den Menschen zu helfen, denen ihr Recht zustand. Jetzt war davon nicht mehr viel übrig.
„Danke, Matthias, ich finde allein heraus.“
Der junge Mann nickte leicht und ließ seinen Anwalt gehen. Er hoffte, der Zuchtanstalt entkommen zu können, schätzte seine Situation aber realistisch ein.
Wilhelm ging zurück durch das fallende Laub. Die Sonne stand jetzt im Herbst sehr tief und schien noch stärker als im regnerischen Sommer. Er betrachtete die vielen leuchtenden Farben der Blätter, die ihn an seine eigenen Tiegel erinnerten und die schon länger unberührt an ihrem Platz standen.
Eher heimlich hatte Wilhelm in letzter Zeit seine ersten Gehversuche in der Malerei gemacht. Zuerst hatte er noch ungelenk mit seinem Kohlstift die Zeichnungen seiner Kindheit und Jugend heraufbeschworen und seine Ansichten waren ihm leidlich gelungen.
Mit etwas Übung, so dachte er, würde er eine ansehnliche Beschäftigung verfolgen können. Sein Steckenpferd war die Natur. Die getreue Darstellung verschiedener Pflanzenarten und einiger Tiere, die sich unter seinem Fensterbrett zeigten, hatte er sehr realitätsnah abbilden können. Ihm gefiel diese Arbeit und was sich nicht mit Talent bestreiten ließ, musste er mit einem soliden Handwerk ausgleichen.
Wilhelms bestem Freund Simon Schmidt waren die kleinen Zeichnungen bereits aufgefallen und so machte er schnell Bekanntschaft mit Personen, die laut Schmidt seine Entwicklung als Maler und seinen intellektuellen Horizont erweitern sollten.
„Du schaffst mehr als diese kleinen Vögelchen, bist doch kein Botaniker.“ Schmidt glaubte an sein Talent und schmückte sich dazu gern mit Personen, die seine eigenen Fähigkeiten in ein besseres Licht rückten.
Drei
Ä h, vielleicht ein Wasser mit Eis und Zitrone?“ - „Gern.“ Der junge Kellner notiert die Bestellung auf einem kleinen Block, wahrscheinlich, damit er sie nicht vergisst. Mich wundert das, denn es sind keine weiteren Gäste in der Nähe, deren Wünsche seine Erinnerung trüben könnten. Der Stuhl ist angenehm kühl und die Sitzfläche fühlt sich weich an. Die Tischplatte ist aus Marmor. Mit dem Finger zeichne ich die vielen kleinen Adern nach, die der kühle Stein aufweist.
Jetzt, wo ich sitze und die Aussicht auf ein kühles Getränk habe, fühlt sich die Sonne nicht mehr so brennend an. Ich blicke vorsichtig nach vorn in der Hoffnung, dass der Horizont mir eine neue Offerte macht. Aber die Aussicht bleibt karg. Dünen reihen sich in jetzt sanftem Licht aneinander. Einige sind größer als andere und wirken wie hohe Alpen mit tiefen Tälern.
Wo bleibt mein Kellner? Ob er doch nur Einbildung war und ich einfach halluziniere? Die Adern meines Tisches und die Tatsache, dass ich auf dem Stuhl sitze, spüre ich jedoch wie eine tiefe Bestätigung.
Mein langes Bein kribbelt und vorsichtig kratze ich mich. Vielleicht wird das Laufen noch gehen. Morgen sollte ich mich dazu beraten lassen. Was wohl die anderen denken werden? Schmidt hat immer Interesse an Außergewöhnlichkeiten. Unpraktisch ist es allemal.
Ich sehe wieder nach vorn. Langsam scheint die Sonne zu sinken und fällt in hellem Saum zu Boden. Es ist ein schöner Anblick und ich freue mich über das Feuer, das die Giraffe mit sich führt. Ihr langer Hals wiegt sich sanft auf ihrem mächtigen Körper. Ihre Beine müssen noch einen langen Weg zurücklegen, ehe ich sie genau betrachten kann.
„So, einmal Wasser mit Eis, der Herr.“
„Vielen Dank.“
Die Flecken in ihrem Fell leuchten wie ein orientalisches Mosaik in vielen Farben, bleiben aber harmonisch. Ihr Kopf weist in meine Richtung und ich hoffe, dass sie zu mir hersieht. Sachte hebe ich mein Glas, um sie anzulocken. Die Flammen in ihrer Mähne bilden einen Kranz um ihren Körper und sie scheinen sich mit dem Saum der Dünen zu verbinden. Sie beugt sich langsam zu Boden und sucht nach Futter. Ihre Vorderbeine hat sie nun leicht zur Seite gestellt.
Wie wird es mir ergehen, wenn ich mich nach unten beugen möchte? Wird sich mein Bein bewegen lassen? Lässt es sich noch beugen? Wie wird es aussehen?
Die Giraffe streckt sich und kommt in meine Richtung. Vielleicht sieht sie das Wasserglas? Ob sie überhaupt Durst hat? Das Feuer auf ihrem Rücken scheint sie nicht zu stören. Vermutlich hat sie keine Schmerzen, obwohl die Flammen in alle Richtungen züngeln.
Das Tier ist wirklich erstaunlich. Noch immer bückt es sich und schnobert nach Futter. Leider ist in der Nähe weder Strauch noch Baum, sodass sie nichts finden kann. Sie schwingt ihren Kopf wieder nach oben und blickt erneut in meine Richtung.
Mein Wasser ist kühl. Ich trinke in kleinen Schlucken und fühle, wie es mir die Kehle hinabrinnt. Zuhause trinke ich mein Wasser immer ohne Eis. Vielleicht muss ich mir angewöhnen, Eis dazu zu geben. Aber was wird Marie über diese Verschwendung sagen? Zuhause ist es ja ohnehin gerade kalt. Wie komme ich nur auf solche Ideen?
In langsamen Schritten kommt die Giraffe vorsichtig auf mich zu. Ich habe etwas Respekt. Angst habe ich eigentlich nicht, obwohl ich in Strausberg einmal von einem riesigen Hannoveraner gebissen wurde. Er hatte mich abgeworfen und irgendwie hatten wir auch später keine Sympathien füreinander. Aber Giraffen sind Pferden natürlich überlegen. Sie werden sich doch nicht die Mühe machen, einen Menschen zu beißen?
Ach, was spinne ich! Auf mich kommt schließlich eine riesige Giraffe zu, die im Dunkeln leuchtet und aus deren Mähne Flammen schlagen. Was davon ist wohl gefährlicher? Ein Biss wird wohl das kleinere Übel sein. Wahnsinn!
Wo bin ich hier gelandet? Selbst wenn ich unbeschadet an diesem Biest vorüberkomme, werde ich trotzdem verdursten. Ich finde keinen Ausweg!
Die Giraffe kommt näher und ich kann sehen, dass das Tier größer sein muss als die Prachtbauten in Wilmersdorf. Im Zoo habe ich noch nie Giraffen gesehen, aber sicher lässt sich behaupten, dass dieses Tier eine ungeheuerliche Größe hat, auch wenn Giraffen grundsätzlich schon sehr groß sind. Aus einiger Entfernung sehe ich die Bewegung ihrer Nüstern und erkenne, dass sie in meine Richtung schnobert. Trotz ihrer kolossalen Größe ist sie doch wohl eine Pflanzenfresserin? Insgesamt ist der Körper des Tieres nicht so groß, vielmehr sind es ihre abnormen Extremitäten, die sie so groß erscheinen lassen.
Es scheint ihr vielleicht wie mir selbst zu gehen. Mein Bein hat mehrere Kniegelenke und genau weiß ich nichts damit anzufangen. Ihr Hals bildet jetzt einen weiten Bogen, der bis zu meinem kleinen Tisch reicht, an dessen Ende der kleine Kopf nach etwas Essbarem sucht. Mir wird sehr warm, aber ich kann nicht begründen, ob dies an meiner Angst oder an der Hitze liegt, die durch die nun intensiv züngelnden Flammen in ihrer Mähne entstanden sind.
Mein Respekt wandelt sich in Angst. Ihr Kopf kommt näher, ihre Augen sehen nun direkt in meine. Es ist aber nicht der bissige Hannoveraner, sondern die Güte eines Wesens, das stärker ist als ich. Diese Güte strahlt mir entgegen. Zaghaft schiebe ich mein Glas zu ihr, damit sie nicht erschrickt. Die Öffnung des Glases ist schmal, ihr Maul ist groß und ich habe schon viel getrunken.
Sie riecht an dem Glas und taucht ihre Zunge hinein. Während sie den für sie kleinen Schluck trinkt, schließt sie ihre Augen. Sie scheint froh über das kühle Wasser zu sein.
Der Kellner ist mittlerweile fort. Auch als ich mehrfach nach ihm rufe, erscheint er nicht. Dankbar und gütig sieht mich das Tier jetzt an und ich streiche über seine samtige Wange. Leicht wirft es seinen Kopf zur Seite und es ist, als wolle sie nun ihren massigen Körper hinlegen. Das Mosaik auf ihrem Leib wirkt jetzt angestrengt und die Farben schillern mannigfach.
Sie beugt ihre Knie und kippt ihren Körper nach vorn. Es ist mir für einen Moment, als fiele sie vor Erschöpfung um. Die Flammen wirbeln jetzt noch
heißer um ihren Kopf. Ich sehe an ihr hinauf und muss wegen der enormen Hitze wieder blinzeln. Als ich zu meinem Tisch zurück sehe, fällt mir auf, dass der Kopf der Giraffe beständig auf ihren Rücken weist. Jetzt stupst sie mich vorsichtig an und bewegt ihren Kopf wieder zur Seite. Ich deute dies als Zeichen, auf ihren Rücken zu klettern. In einiger Entfernung zu ihrer feurigen Mähne bemühe ich mich, ihren massigen Körper zu erklimmen.
Schon sitzend ist das Tier so groß wie ein Haus. Als ich mich einigermaßen bequem hinsetze, wartet die nächste Herausforderung: Sie steht auf.
Ich muss um hunderte von Metern gestiegen sein, denn dort, wo ich jetzt bin, kann ich kleine Wolkenschleier ausmachen und überblicke die karge Landschaft.
Das Tier geht langsam. Trotzdem kommen wir schnell voran, denn mit ihren langen Beinen kann sie viele Meter auf einmal nehmen. Noch immer habe ich Angst vor dem Feuer in ihrer Mähne, aber ich schöpfe wieder Hoffnung.
Vier
S chon lange war Wilhelm nicht mehr so aufgewacht. Seine Glieder fühlten sich an, als hätte ein Zug ihn überrollt. Er räkelte sich noch für einige Momente im Bett, als er näher darüber nachdachte, wie der Traum entstanden sein könnte. Und wer war eigentlich Marie?
„Ach, Quatsch!“ ließ er es nach ein paar Minuten dabei bewenden. In letzter Zeit hatte er sich ohnehin zu stark in die Gespinste verrannt, die er als seine Träume bezeichnen musste. Heute stand allerdings noch viel Arbeit an, die sich nicht von selbst erledigen würde. Er wusste, dass ihm sein Vater viele Klienten überlassen wollte und Wilhelm ahnte, dass er ihm ein Mindestmaß an Kompetenz beweisen musste. Trotz des großen Vertrauens, das sein Vater in ihn hatte, wollte und durfte Wilhelm ihn nicht enttäuschen.
Für´s Erste galt es demnach, sich den Fällen zu widmen, die für Vater und Sohn unbestritten waren. Matthias Goldberg gehörte eindeutig nicht dazu. Trotzdem ließ ihn dieser Fall nicht los. Wilhelm hatte den jungen Künstler erst vor kurzem kennen gelernt und war sich sicher, dass es dieser junge Mann mit seinem Kopf und seinem Talent noch weit bringen konnte.
Wilhelm unterlag in dieser Hinsicht höchster Diskretion. Näheres über die Umstände von Goldbergs Erkrankung wusste er nicht. Die Syphilis war aus seiner Sicht eine derjenigen Erkrankungen, die man sich nicht in ersten Häusern, sondern in verschlagenen Hinterhöfen zuzog. Aus diesem Grund sprach man in Wilhelms Kreisen nur hinter hervorgehaltener Hand über solche Themen.
Ein Blick in den Spiegel brachte Wilhelm auf seine eigene Person. Sein Gesamteindruck gefiel ihm noch immer. Jetzt, im Alter von fünfunddreißig Jahren war er nicht mehr zu jung, sondern ein Mann, der für Frauen attraktiv wurde, hatte er doch bereits erste Lebenserfahrungen gesammelt und war zeitgleich noch nicht zu bodenständig.
So konnte ihm in diesem Zusammenhang auch von Mal zu Mal ein jugendlicher Leichtsinn zugestanden werden, ohne dass dieser negative Folgen gehabt hätte. Die ersten Fältchen um seine Augen deutete Wilhelm demnach als Zeichen von Reife. Das Alter kam später.
Wenn es nach ihm selbst gegangen wäre, so hätte es ewig so weitergehen mögen, wären da nicht die Wünsche nach einer festen Bindung und nach einer guten Heirat, die sein Vater regelmäßig äußerte. Wilhelm hatte einen Schneid bei den Frauen. So viel stand fest. Schließlich konnte er die vielen Eroberungen der letzten Jahre kaum zählen.
Gerade in seinem jetzigen Jahrgang fühlte er sich besonders beliebt. Seine wechselnden Beziehungen waren aber bei seinem Vater ebenso wenig angesehen wie seine persönlichen Interessen. Wilhelm Sokol hatte sich einfach anders entwickelt, als es erwünscht gewesen war.
Während er noch im Bad mit der Verortung seiner Person in die gesellschaftlichen Positionen beschäftigt war, begann unten bereits ein reger Tumult.
Margaret schien heftig mit Schmidt zu diskutieren, der zu Wilhelm durchgelassen werden wollte.
„Meine Liebste, Zuckersüßeste! Wegen mir müssen Sie doch nicht wie ein Schießhund aufpassen!“
„Herr Schmidt! Es kann hier nicht jeder einfach so hereinplatzen, wie es ihm passt! Der junge Herr ist noch nicht zugegen.“
Kaum eine Minute später steckte Schmidt auch schon seinen Kopf durch die Tür.
„Na, alter Knabe? Was macht die Kunst?“
„Hast Du unsere Margaret verärgert? Hast Du
keine Arbeit?“
„Ach, ich war grad in der Gegend bei feinen Leuten und dachte, ich sehe mal nach, was Ihr so treibt.“
„Ich muss gleich los.“ Wilhelm blickte noch immer in den Spiegel, sich vorsichtig rasierend.
„Oh, der junge Herr Sokol von Sokol und Sohn kommt zur Raison.“
Wilhelm grinste mit Schaum im Bart.
„Naja, so weit es notwendig ist, hast schon Recht.“
„Dann wart´ ich so lange, bin mit Rad.“
Nach etwa einer halben Stunde war Wilhelm das, was man unter einem geschätzten Anwalt verstehen konnte.
Schmidt hatte diese Wandlung schon mehrfach erlebt, staunte aber immer wieder über seinen besten Freund, aus dem binnen Minuten ein seriös dreinblickender Rechtsvertreter oder ein Hallodri werden konnte.
Fünf
Schmidt und Wilhelm galten gemeinhin als ungleiche Freunde. Das lag daran, dass Schmidt zwar aus einer angesehenen Familie stammte, aber als Handwerker längst nicht zur bürgerlichen Mitte der Sokols gehörte. Was für Wilhelm selbstverständlich war, war für Schmidt stets harte Arbeit gewesen, auch wenn er es nicht zeigte. Die Leichtfüßigkeit seines Freundes ergänzte Wilhelms bisweilen schwerfällige Art. Schmidt war ein Hansdampf. Seine Kunden gewann er mit einem Gefühl von Wärme und Leidenschaft, das er in jeder Gesellschaft versprühte.
Das Geld der Sokols hatte nie zwischen ihnen gestanden. Im Gegenteil – Schmidt hatte mit seiner lockeren Art ein eigenes ansehnliches Vermögen erwirtschaftet, das dem der Sokols im direkten Vergleich hätte standhalten können.
Bei ihrer gemeinsamen Fahrt in das morgendliche Berlin hatten sie kaum gesprochen. Die Luft war jetzt am Morgen kühl, doch fühlte Wilhelm, dass es gegen Mittag noch einmal warm werden würde. Sein Jackett flatterte leicht im Fahrtwind und zwischen den Bäumen der langen Allee konnte er die noch nicht ganz aufgegangene Sonne beobachten.
Wilhelm liebte den beginnenden Tag, aber heute fiel es ihm schwer, sich auf die Dinge zu konzentrieren.
„Ist das nicht herrlich? Man müsste wieder öfter Rad fahren.“ Schmidt hatte sein Gesicht direkt in den Wind gehalten und lächelte.
„Ja, das macht man viel zu selten.“
Als sie in Mitte ankamen, wurde der neue Tag bereits geschäftig vorbereitet. Reinigungskräfte und Gesinde auf Kutschböcken machten sich fleißig daran, die Reste vom Vortag gründlich zu beseitigen. Wilhelm hielt kurz an einem Kiosk, um sich eine Zeitung zu kaufen.
„Guck mal an, mein Lieber. Hat tatsächlich noch einer Geld für Zeitungspapier.“
„Naja, ist bei unseren Anschlüssen ja auch kein Wunder, dass das System lahmt.“ Wilhelm steckte die Zeitung rasch ein und wechselte das Thema.
„Sag´ mal, wollen wir heute abend weg?“
„Oh klar, in Friedrichshain hat ´ne neue Kneipe aufgemacht. Das soll´s wohl ordentlich zur Sache gehen. Die haben sogar Tango.“
Die Aussicht auf eine neue durchwachte Nacht sorgte bei Wilhelm zwar nicht für Beruhigung, verschaffte ihm aber eine Abwechslung vom Alltag, die er momentan dringend nötig hatte.
„Klar, gute Idee. Ich bieg´ hier ab, sagen wir so um zehn bei mir.“
„Bis dann.“ Schmidt blieb auf seiner Strecke und Wilhelm genoss die Gelegenheit, allein noch ein paar Meter zu fahren, ehe er sein Rad pflichtbewusst im Eingangsbereich der Kanzlei Sokol & Sohn abstellen würde. Die goldenen Lettern blitzten schon von weitem fordernd auf und schienen Wilhelm seine verspätete Ankunft entgegen zu schreien.
Er wusste, auf seinem Tisch lag die Akte „Goldberg“. Er würde sich für den jungen Mann einsetzen, koste es, was es wolle, doch für heute waren die kleineren Delikte an der Reihe.
Sechs
U nzucht war eine Straftat, die in der Geschichte immer wieder als solche gehandelt wurde. Seit der Aufklärung hatte sich das Gesetz in dieser Hinsicht zwar gelockert. Wilhelm wusste aber, dass es viele andere Aspekte waren, die den Betroffenen zu einer Gefahr für sich und andere machten.
Begrenzte Rohstoffe und finanzielle Mittel sorgten unter anderem für diese Ächtung. Wilhelm hatte schon von anderen Zeiten gehört, aber grundsätzlich war er bereit, sich mit seinem Leben und den Gegebenheiten seiner Zeit zu arrangieren.
Nach einer ausgiebigen Begrüßung der Vorzimmerdamen stellte Wilhelm erleichtert fest, dass sein Vater außer Haus war. Leider ging es für ihn nicht nur darum, gesellschaftliche Probleme grundlegend zu verändern, auch kleinere Ladendiebstähle bis hin zu Nachbarschaftsstreitigkeiten gehörten zu den festen Aufgaben von Sokol & Sohn.
Er ging zu dem Stapel, der schon seit längerem nahezu unberührt auf seinem Tisch lag. Diese Akten interessierten Wilhelm wenig, aber jetzt, nachdem bereits einige Zeit vergangen war, hatte er Einiges nachzuholen. Bis Mittag hatte Wilhelm einige Daten sortiert und ein paar Briefe aufgesetzt.
Hannah hatte in ihrem Rock umwerfend ausgesehen. Diese Strumpfhosen mit schwarzer Naht in der Rückansicht waren wirklich ein Segen. Wilhelm wusste aber, dass seine Verabredungen vor allem außerhalb der Kanzlei stattfinden mussten und so genoss er heimlich den Anblick der Damen.
Gegen vierzehn Uhr stieg er auf sein Fahrrad in Richtung Kiosk und erwarb dort eine der Bockwürste, die es wert waren, dass man sie am Spreeufer genoss.
„Na, Herr Sokol, hamse frei? Bei Jelejenheit hätt ick ´nen Auftrag für Se.“
„Um was geht es denn?“ Wilhelm biss geräuschvoll ab.
„Naja, ick hab´ da so eene Sache am Laufen. Nüscht Ernstet, aber ick will meene Bude erweitern und da bräucht ick eenen schlauen Kopf, der mal über meene Papiere kiekt.“
„Na klar, morgen um diese Zeit, aber meine Wurst geht auf´s Haus.“
„Ehrensache, Chef!“
Wilhelm wickelte den Rest seiner Mahlzeit ein und steckte ihn in seine Manteltasche.
Heute an diesem Herbsttag schien der Sommer noch einmal geweckt zu werden. Viele Mütter mit ihren Kindern flanierten an der großzügigen Promenade und Wilhelm setzte sich auf eine kleine Mauer.
Während er den Rest seines Mittagessens verspeiste, sah er auf den Fluss, der im Sonnenlicht glitzerte und auf dem noch immer Boote fuhren. Er zückte seine Zeitung, um sie kurze Zeit später wieder einzupacken. Die schlechten Berichte hatte er ziemlich satt und hoffte im Stillen, dass die Ruhe der letzten Jahre noch einige Zeit währte.
Deutschland hatte sich seit der letzten Katastrophe gut erholt, aber noch immer klafften die Wunden, als wollten sie mit ihren schrecklichen Zeiten warnen.
Sieben
W ilhelm blickte von den Spaziergängern der Promenade zurück auf das Wasser. Es war kein Wunder, dass er nachts von Wüsten träumte. Schließlich war Deutschland vor nicht allzu langer Zeit auch eine Wüste gewesen. Die Nachrichten beschworen die Ängste der Bevölkerung derart herauf, dass man glaubte, Not und Hunger seien gestern gewesen und schlössen an morgen an.
Trotzdem war es eine komische Vorstellung, auf einer riesigen Giraffe durch die Wüste zu streifen. Seine Höhenangst im realen Leben wie auch im Traum verbesserte die Lage nicht.
Um nicht zu sehr in Gedanken zu geraten, gab Wilhelm sich nach einigen Minuten einen Ruck und saß kurze Zeit später erfrischt wieder am Schreibtisch.
„Herr Sokol, Herr Goldberg schreibt Ihnen. Hier ist das Dokument.“
„Danke, Hannah. Legen Sie es dorthin.“
Wilhelm zwang sich, das Schreiben bis zum heutigen Feierabend nicht zu lesen und deutete pünklich nach der Bearbeitung einiger Fälle gegen Abend die fein notierten Buchstaben, die sicher aus Matthias Goldbergs eigener Hand stammen mussten.
Sehr geehrter Herr Sokol – mein lieber Freund,
in der heutigen Nacht wurde in das Haus meiner Familie eingebrochen. Mir selbst ist nichts passiert.
Da ich mich in meinem Domizil nicht mehr sicher fühle, ist es mir wichtig, dass Sie von meinem baldigen Umzug nach Wien erfahren.
Hochachtungsvoll Dein ergebener
Matthias Goldberg
Die Nachricht kam für Wilhelm völlig überraschend. Wer könnte Matthias Goldberg beraubt haben? Sicher hätten viele Personen Interesse an den herrschaftlichen Dingen, die das Haus des jungen Künstlers enthielten. Gerade jetzt stand er aber wegen seiner Anklage bereits im Kreuzverhör und war in dieser Hinsicht unfreiwillig in der Öffentlichkeit. Der Brief klang für Wilhelm endgültig. Sein Umzug nach Wien schien nichts mehr zu verhindern und er überlegte, ob er noch bei Matthias vorbei fahren sollte. Es dämmerte schon und Wilhelm nutzte die Gelegenheit, eine vorbeifahrende Droschke anzuhalten.
„N`abend, det Rad lassense aber hier!“
„Guten Abend, ich kann es zusammenklappen, dann müsste es passen.“
Leicht mürrisch schnaubte der Kutscher, während er beobachtete, wie Wilhelm sein Gefährt um etwa zwei Drittel verkleinerte.
Wilhelm mochte die abendlichen Fahrten mit den kleinen Kutschen. Man fühlte sich sehr behaglich in dem kleinen Raum, der zwar dunkel, aber doch mit vielen angenehmen Stoffen ausgekleidet war, sodass er wie eine Höhle wirkte. In der Droschke fanden etwa vier Personen Platz. Am liebsten saß Wilhelm jedoch allein und hing seinen Gedanken nach.
Oft stiegen andere Menschen hinzu, fragten interessiert nach seinem Ziel oder erzählten ungefragt aus ihrem Leben. Heute hatte er den Waggon für sich. Sein Fahrrad belegte ohnehin einen Großteil der Sitze, sodass er beruhigt sein konnte, für sich zu sein.
Am Stadtrand angekommen, lag die Häuserzeile in völligem Dunkel. Nur in den Fenstern brannten kleine Kerzen und Öllampen. Zwei große Kandelaber zeigten an, dass zumindest Goldbergs Mitarbeiter zu Hause sein mussten.
„Guten Abend, Herr Sokol. Kommen Sie herein.“ Die freundliche Haushälterin hatte ihn schon mehrfach gesehen und führte ihn jetzt durch den großen Flur in ihre Küche.
„Bitte, nehmen Sie Platz. Herr Goldberg ist heute morgen abgereist. Er sagte mir, dass er an Sie einen Brief gerichtet habe, in dem er Ihnen von seiner Reise nach Wien erzählte.“
„Ja. Was ist vorgefallen?“
„Naja, seit dem Zeitungsartikel fühlen wir uns hier alle nicht mehr ganz wohl. Viele Briefe erreichten den jungen Herrn. Einige davon zeigte er mir und bedauerlicherweise waren ihre Inhalte furchtbar. Es waren Drohbriefe.“ Sie stand auf, ging zu einer Schublade und zog einen Stapel heraus, der aufgeklebte Zeitungsschnipsel enthielt.
„Die soll ich Ihnen überlassen. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Ich selbst könnte jetzt einen gebrauchen.“ - „Ja, gern.“ Etwa zehn Blätter wiesen kurze Botschaften auf, bestückt mit Ausdrücken wie PERVERSER, JUDENSAU, SODOMIST.
„Das tut mir sehr leid.“
„Der junge Herr ist ein sehr guter Mensch mit einem sanften Gemüt. Alle paar Tage hatten wir solche Briefe im Kasten. Manche habe ich selbst abgefangen und habe sie ihm zum Schluss vorenthalten, weil es nichts half, wenn er sich noch größere Sorgen machte.“
„Aber warum hat er mir die Drohungen nicht mitgeteilt? Wir hätten doch recherchieren können?“
„Anzeige gegen Unbekannt ist ja nie besonders erfolgreich und er wollte nicht zu viel Aufhebens darum machen. Als vorgestern dann nachts eingebrochen wurde, hat er beschlossen, zu seinen Verwandten zu fahren. Vielleicht tut ihm die Luftveränderung gut.“
„Und wie geht es ihm?“