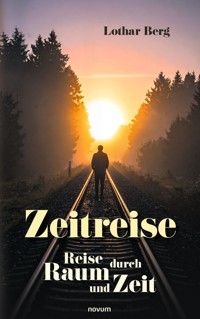
18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: novum Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als 1950 Geborener wurde Lothar Bergs Leben früh von den Nachwirkungen des Zweiten Weltkriegs bis in die Familie hinein geprägt. Der Selbstmord seines Vaters wirft für ihn Fragen auf, die sich erst im Laufe eines langen und wechselvollen Lebens beantworten lassen. Frühe Reiseerfahrungen in Indien und auf dem asiatischen Kontinent inspirieren ihn dazu, neue Welten auch in Südamerika zu entdecken und anhand eigener Visionen großangelegte Bauprojekte in Angriff zu nehmen. Eine bereichernde, wechselvolle Biografie, die neben den geheimen Verstrickungen des Lebens auch die anspruchsvollen politischen und gesellschaftlichen Bedingungen in Ländern Südamerikas wie Bolivien, Peru, Venezuela und Kolumbien vor Augen führt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 348
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Impressum
Persönlichkeitsbeschreibung
Zeitreise
Gedanken Bahia Lodge 2008
Sechzigerjahre – Jahre der Veränderung
Ladakh
Usbekistan
Indien oder Südamerika
Es ist in deiner Hand
Rückkehr 2007 – Juni
Siggi – mein Freund
Wasserkraft
Das Ende einer Reise
Seitenliste
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
Navigationspunkte
Cover
Impressum
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://www.d-nb.de abrufbar.
Alle Rechte der Verbreitung, auch durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger, elektronische Datenträger und auszugsweisen Nachdruck, sind vorbehalten.
© 2025 novum publishing gmbh
Rathausgasse 73, A-7311 Neckenmarkt
ISBN Printausgabe: 978-3-99130-896-6
ISBN e-book: 978-3-99130-897-3
Lektorat: Falk-M. Elbers
Umschlaggestaltung, Layout & Satz: novum publishing gmbh
www.novumverlag.com
Persönlichkeitsbeschreibung
Geburtshoroskop Maya Zodiac:
Destino: Weltenumspanner – Energie des Todes
Energia Oculta: Adler – Vision
Analogenergie: Der auf den Wolken wandert
Ocultärenergie: Krieger
Leitenergie: Zeitloser Magier
Ich bin der „Enthüller der heiligen Geheimnisse“
Zeitreise
Es war einer der typischen Novembertage.
Es hatte fast den ganzen Tag genieselt, und die Kälte schien sich durch die Kleidung bis zu den Knochen durchzuziehen.
Es fehlten nur noch ein Monat und vier Tage bis zum Heiligen Abend.
Der Zeiger der Uhr hatte schon seine elfte Nachtumdrehung durchlaufen.
Ich wollte nicht mehr warten.
In Bingen, in dieser Nacht, bestieg ich den Zug meines Lebens.
Zu meiner Freude war da neben meiner Mutter, einer sehr liebevollen und besorgten Frau, die Ende des Jahres ihren sechsundzwanzigsten Geburtstag feiern würde, auch mein Vater, ein großer, stattlicher Bär mit großen Tatzen, die mich sicherlich jederzeit leicht verteidigen könnten.
Der große Bär hatte im Frühjahr schon seinen fünfunddreißigsten Geburtstag begangen.
Und da war mein um ein Jahr und zwei Monate älterer Bruder, der seine Rolle als großer Bruder lange, lange Jahre für mich spielen sollte.
Ich war glücklich, in diesem Abteil mit dieser Zusammensetzung die Reise meines Lebens zu beginnen.
Es waren mittlerweile mehr als fünf Jahre vergangen, seit dieser verheerende Krieg zu Ende gegangen war.
Und doch war er noch überall gegenwärtig. Nicht nur äußerlich im Erscheinungsbild der Stadt, sondern auch im Bevölkerungsmix auf den Straßen.
Schwarz – Grau
Die Wunderwaffen kamen nicht mehr zum Einsatz. Die Übermacht war zu groß. Auch die letzten Reserven, die man wohlwissend einfach verheizt hatte, konnten das Unabdingbare nicht mehr abwenden. Es gab keinen Endsieg, nur das unbegreifliche Entsetzen.
War dies das Volk der Poeten, Philosophen und Musiker?
Arbeitsame und gottgefällige Leute wurden zu unbarmherzigen Maschinen. Fremdgesteuert von der Idee, durch das Blut in ihren Adern zu außergewöhnlichen Taten befähigt zu sein.
Klar gibt es in der Nachbetrachtung eine Erklärung, die geschichtlich auch nachvollziehbar ist. Aber ist dies die Legitimation für das, was dann kam?
Nach dem Heiligen Deutschen Reich Römischer Nationen war es um die Deutschen etwas still geworden.
Große Nationen hatten die europäische Bühne betreten. England blickte schon immer argwöhnisch zum Kontinent. Die Macht Spaniens, der Niederlande, Frankreichs musste geschwächt werden und wurde geschwächt, wenn es unabdingbar war.
Nach dem wiedererstarkten zweiten Deutschen Reich in Kombination mit der zentraleuropäischen Großmacht Habsburg-Österreich-Ungarn war es nur logisch, dass dies zu einem Konflikt führen würde.
Mit welchem Recht hätte Kaiser Ferdinand den Briten den Krieg erklären dürfen, wenn diese den Tod von Prinz Charles an den Separatisten in Cardiff gerächt hätten?
Wenn zwei dasselbe tun, ist dies nicht immer das Gleiche.
Am Ende stand der totale Zusammenbruch. Nicht nur territorial und wirtschaftlich – viel tiefgreifender war der moralische Wertezusammenbruch.
Keine noch so zaghaften Erklärungsversuche konnten standhalten gegen die Bilder des Unfassbaren.
Entschuldigungen waren aufgrund des Ausmaßes in diesen ersten Jahren auch kein Mittel, um die Last zu mindern, die auf den Schultern der Überlebenden lastete.
Die Verantwortlichen – Masterminds – hatten sich feige dem allen entzogen.
Das auserwählte Volk war in den Augen dieser Feiglinge nicht würdig weiterzuleben. Man entzog sich der Verantwortung und überließ das Schicksal seinem Lauf.
Neben dieser tiefen und schweren Last gab es noch den Überlebenskampf. Zur mentalen Schwere kam die körperliche Anstrengung hinzu – weitermachen, nicht um Mitleid bitten und auch kein Leid durch einen verzweifelnden Blick vermitteln.
Der Krieg war immer noch sehr präsent in den nächtlichen Träumen und in den Herzen vieler Menschen. Es war unbegreiflich, dass man dies alles mitgetragen hatte. Zu diesem Zeitpunkt war mir noch nicht bewusst, wie tief und schmerzvoll diese Erinnerungen waren. Wer hätte sich vorstellen können, zu welchem fatalen Entschluss dies letztendlich führen sollte?
Die ersten Jahre im Abteil mit meinen Eltern und meinem Bruder verliefen sehr friedlich. Ich entdeckte so viele kleine Dinge zum Spielen. Auch wenn es in der Tat immer wieder die gleichen unbemalten Bauklötzchen waren, so veränderten sich diese jedes Mal aufs Neue in meiner Fantasie.
Sie konnten die Form von Tieren oder von Personen, aber auch von Autos annehmen.
Besondere Freude bereitete meinem Bruder und mir, wenn unsere Mutter einen Kuchen backte und wir die Schüssel mit dem verbleibenden Kuchenteig auslecken durften.
Süße Puddinge hatten denselben Effekt, und unsere Herzen waren überglücklich.
Der Zug rollte durch die Tage und Nächte in gleichbleibendem, beruhigendem Rhythmus.
Es bahnte sich eine Veränderung an. Unsere Mutter, die immer eine liebevolle Art hatte, uns Jungs zu bemuttern, schien manchmal noch sentimentaler zu sein. Und wenn wir sie umarmten, so wurde es auch immer schwieriger, sie zu umgreifen. Ihr Körperumfang schien zuzunehmen. Und dann kam auch der Tag, an dem unsere Eltern uns mitteilten, dass wir sehr bald einen neuen Fahrgast in unserem Familienabteil bekommen würden.
Also das war die Erklärung – die Freude auf den neuen Gast wurde täglich größer. Und fast als Weihnachtsgeschenk, zwei Jahre nach meinem Einstieg in den Zug des Lebens, wurde uns unsere kleine Schwester präsentiert. Monika Margarete, ein kleines, zartes Geschöpf mit schwarzen Haaren. Ich schaute sie mit großen Augen an – versuchte, dies einzuordnen. Es hatte mir wohl die Sprache verschlagen, denn meine Mutter erwartete einen Kommentar und forderte mich dazu auf.
„Was sagst du, Lothar?“, fragte sie mich. „Ein kleines schwarzes Mädchen.“ Mit diesen Worten begrüßte ich unsere kleine Schwester. Im Zugabteil meines Lebens waren nun alle Sitzplätze besetzt – nicht ahnend, dass auf dem Platz meines Vaters zwei Personen unsichtbar mit uns reisten.
Da war mein großer Bruder, der zu Ehren seines Großvaters dessen Namen trug, dann unsere Schwester, die um die Weihnachtszeit 1952 die Familie bereicherte.
Eine Seelengemeinschaft, die noch nicht ahnte, wie tief man miteinander verwoben war.
Wir hatten einen Großvater, der sowohl für den Kaiser wie auch für den Führer sein Leben nicht geschont hatte. Zu seinem Leidwesen musste er ein fast abgeschlossenes Architekturstudium aufgrund fehlender finanzieller Mittel abbrechen. Und so verdiente er sich sein Geld als Außendienstmitarbeiter einer Tabakmanufaktur
Mein Vater war in dem Glauben und in den Normen des Großdeutschen Reiches erzogen worden. Mit vierundzwanzig Jahren hatte er seine ersten Kampferfahrungen gemacht. Geboren in einem kleinen Weindorf in der Rhein-Nahe-Region, aufgewachsen mit klaren und ehrlichen Familienbanden, sollte er viele Jahre vor seiner Zeit an dem Kommenden zerbrechen. Es war die dörfliche Welt. Jeder kannte jeden. Kinder gingen früh aufs Feld – man aß gemeinsam aus einem Topf. Er war der Kleinste von zwölf Geschwistern. Seine großen Geschwister kümmerten sich abwechselnd um ihn, sodass ihm emotional nichts fehlen sollte. Man war tiefreligiös, und gerne hätte seine Mutter es gesehen, dass er Priester würde.
Er war ein großer, stattlicher Bursche, wie viele in Tausenden von Dörfern im Reich. Sie wurden geformt zu den schnellen Windhunden, die zäh wie Leder und hart wie Kruppstahl wurden.
Er wurde kein Priester – er wurde ein Teil der Generation, die unbeirrbar an diesen großen historischen Moment und Führer glaubte.
Meine Mutter, knapp neun Jahre später geboren, kam aus einem behüteten Elternhaus – Mittelklasse. Ihre Erziehung war geprägt von der Tatsache, dass sie eine ordentliche Hausfrau und Mutter sein sollte. Sie besuchte eine Haushaltsfachschule, und natürlich war sie auch ein Mädchen des Deutschen Reiches (BDM).
Am Ende des Krieges war sie zarte einundzwanzig Jahre. Bilder und Ereignisse vom Glanz bis zum brutalen Ende hatten sich in ihren Erinnerungen eingegraben.
Sie arbeitete in den Kriegsjahren eine Zeitlang in einem Fotolabor, und dort entwickelte sie Filme, die sie erschütterten. Niemand sprach damals offen über Erlebtes oder Gesehenes. Weder wenn die Nachbarn abgeholt wurden noch über andere zweifelhafte Ereignisse.
Erst zu Ende ihres Lebens erzählte sie von diesen Dingen und auch, dass es sehr gefährlich war, in der Nachkriegszeit das Haus zu verlassen.
Wenn sie zu den Bauern fuhr, um Essbares einzutauschen gegen familiäre Erinnerungsstücke, so zog sie sich nicht nur die ältesten und stinkigsten Klamotten an. Sie parfümierte sich sogar noch mit ranzigem Fett in entsprechenden Körperpartien. Dem Überlebensduft vieler junger Frauen. Aud de Vivir.
Weitere Einzelheiten waren ihr nie zu entlocken. Sie nahm diese Erinnerungen mit in ihr Grab.
Zwei Menschen, die sich im Nachkriegsdeutschland trafen und eine Familie gründeten. Jeder trug seine persönlichen Erinnerungen verborgen in seinem Herzen.
Jeder Deutsche … jeder Mensch in Europa, der diesen Krieg erlebt hatte, war begleitet von Phantasmen. Es war nicht die Zeit für Psychotherapien.
Die ersten vier Jahre lebten wir in Bingerbrück – wo mein Vater als Bahnhofsvorsteher des Güterbahnhofs tätig war. Eine kleine Stadt am Zufluss der Nahe in den Rhein. Der Rhein, Vater Rhein nannte man diesen großen wichtigen Fluss. Der romantische Rhein aufgrund der vielen Burgen, die sich rechts- und linksseitig besonders ab Bingen finden ließen. Und da war auch die Germania, eine übergroße Frauenstatue, oberhalb von Rüdesheim, auf der Bergkante, umgeben von unendlich wirkenden Weinbergen. Germania, die große Mutterfigur, die voller Stolz, aber auch drohend über den Rhein schaute, um ihre Kinder vor der Aggression aus dem Westen zu schützen. Nach dem Krieg mit den Franzosen, der letztendlich zur Gründung des zweiten Deutschen Reiches führen sollte, wurde dieses Denkmal voller Stolz einer neu formierten europäischen Großmacht errichtet. Nachdem sich viele europäische Nachbarn bereits formiert hatten und ihre Macht auch auf außereuropäische Länder ausgedehnt hatten, wollte sich unser Vaterland gleichfalls einen Platz im Kreis der Dominierenden suchen und behaupten.
Sicher ist und war unser Vaterland immer eine große, wichtige Nation – nicht wegen seiner territorialen Ausdehnung oder seiner gewonnenen Kriege – nein, vielmehr wegen seines Beitrags im Bereich von Musik und Philosophie. Man hätte stolz sein sollen und weiterhin in diesen Bereichen Weltruhm suchen sollen – nein, man wollte mitmischen – mitmischen in einer neuen Weltordnung.
Bis zum bitteren Ende, das mit zunehmendem Alter auch für mich immer sichtbarer wurde.
Wir lebten in einer kleinen Mansardenwohnung. Was in meiner Erinnerung geblieben ist, sind die schrägen Wände unseres Kinderzimmers und der offene Flur. Die Treppen schienen nicht aufhören zu wollen. Bedingt durch die kleinen Fenster hatten wir auch nicht den Lichteinfall, der unsere Kinderfantasie hätte beflügeln können. Es gab das Kinderzimmer, das Zimmer unserer Eltern, die Küche und ein kleines Bad.
Um zu baden, musste man in einem Badeofen mit Holz und Briketts ein Feuer machen. Dieses Feuer erwärmte die ganze Wohnung und auch das Badewasser. Dieses Fest gab es aber nur samstagnachmittags.
Das Wasser musste für die ganze Familie reichen und so badeten wir drei Kinder gemeinsam.
Es war ein Spaß – auch ohne Schaum, eine Ente oder Barbiesirene.
Wenn man nachts zur Toilette musste, so musste man einen kleinen Flur überqueren. Ungern passierte ich den Flur, denn durch die Eingangstür, deren Glasscheiben mit kleinen Vorhängen versehen waren, trat Licht ein. Man hätte mich eventuell sehen und von außen beobachten können.
Ein unangenehmes Gefühl. Angst sollte ich etwas später erfahren. Tief und fest schlief ich, eingerollt in meine Bettdecke. Ich spürte, dass zwei große Hände unter meine Bettdecke griffen. Und dann wurde ich aus meiner warmen Umgebung hochgehoben. Ich fühlte die Kühle der Nacht und so erstarrte ich. Nicht einen Schrei konnte ich formen. Was war das ? Wer riss mich aus meiner geborgenen nächtlichen Reise in mein Inneres heraus?
Ich sträubte mich – wollte mich befreien von dieser Abhängigkeit. „Ludi, was machst du?“, hörte ich meine Mutter sagen. Der Klang ihrer Stimme sollte mich beruhigen, aber es war schon zu spät. Mein Vater, der mich eigentlich nur liebevoll umarmen wollte, bevor er sich zur Nachtruhe begeben würde, hatte den Zugriff verloren. Ich fiel aus seinen Händen – nicht in das warme, weiche Bett – nein, auf die Bettkante. Seit dieser Nacht hatte ich eine kleine, etwa einen Zentimeter lange genähte Narbe über der linken Augenbraue. Und auch seit dieser Zeit, bevor mein Vater mir seine Gute-Nacht-Wünsche gab, küsste er meine Narbe. Es war die erste kleine Narbe, die er mir zufügte – sehr, sehr klein im Vergleich zu der Narbe, die viele, viele Jahre später mein Herz und meinen Weg beeinflussen sollte.
Wenn ich meine Augen schließe und mich in diese Zeit versetze, so war das Leben grau – dunkelgrau. Eventuell hing das damit zusammen, dass Bingerbrück ein Knotenpunkt für Transportzüge der Deutschen Bundesbahn war. Alles änderte sich. Aus der Reichsbahn wurde die Bundesbahn – aus den Reichsämtern wurden Bundesämter.
Die Abgase, die aus den Schloten der Zugloks in den Himmel stießen, hatten extremste Ozonbelastungswerte.
Damals wusste, außer den Wissenschaftlern, kaum jemand, was Ozon ist. Die Häuser waren grau – die Kleider hatten traurige Farben. Die wenigen Autos, die man sah, hatten traurige Farben.
Fast schien es, als ob die Blumen sich für die Freude, die ihre Farben vermitteln konnten, schämten.
Meine Schuhe waren die meines Bruders – seine Hosen, obgleich noch zu groß, wurden mit Hosenträgern und Gürtel angepasst. Auch diese Kleidung hatte nichts von den fröhlichen Farben, die Kinder heute tragen. Schuhe waren aus Leder und wurden in einer Größe gekauft, dass sie auch noch das nächste Jahr passen würden. Wir Jungs hatten Lederhosen und wir liebten sie. Aber dies hatte einen praktischen Grund. Sie waren strapazierfähiger und wenn man sie groß genug kaufte, so hielten diese auch zwischen drei und fünf Jahre. Am Morgen gingen mein Bruder und ich in den Kindergarten. Es war eine kirchliche Einrichtung. Man lernte, zu beten und sich gut zu benehmen. Wir wussten nichts von dem, was unsere Eltern oder Nachbarn erlebt hatten. Und wenn man es uns erlaubte, tobten und rauften wir ausgelassen, wie alle Kinder dieser Welt.
Als ich vier Jahre alt war, bewegte sich der Zug von Bingerbrück nach Mainz. Mein Vater hatte eine neue Aufgabe bei der Bundesbahndirektion in Mainz. Wir zogen in eine große Vierzimmerwohnung – in einer Bahnwohnsiedlung – gegenüber dem städtischen Krankenhaus.
Das Tolle an diesem neuen Zuhause war für uns Kinder, dass es dort einen großen Innenhof mit einer Wiese gab. Und vor allem viele Kinder, mit denen man spielen und toben konnte. Und es gab das Plätzchen. Heute sicher zugestellt von parkenden Autos. Eigentlich fast schon ein Platz mit acht großen Kastanienbäumen – ein Platz, ideal, um Fußball zu spielen. Gegenüber unserer Wohnung gab es die Kanone – ein Kriegsdenkmal für die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkriegs. Mit einer großen Rasenfläche – die ebenfalls optimal zum Fußballspielen war. Vom Bolzplatz bis zum Rasenplatz war alles vorhanden.
Fußballspielen war die Freiheit für uns Jungs. Auch gab es Wettrennen um die Häuserblocks – Jahre später, für die, deren Familien das Geld hatten, Rollschuhe zu kaufen, wurde dies eine Rollschuhbahn. Der Bürgersteig wurde zur Gefahrenzone für die Passanten. Und da gab es auch noch die Gefahr der Autos. Und so kam es, dass ein Nachbarsjunge von einem Auto angefahren wurde. Es war zwar nur das Unterbein und er überlebte, aber sein Name änderte sich danach: Er war nun der Humpelhopser.
Wir wollten leben, uns ausleben. Und dort in Mainz war dies viel mehr gegeben. Deutschland schien den Aderlass an Menschen, den der Krieg verursacht hatte, auszugleichen. Auch gab es „Mothers little Helper“ noch nicht und so tobten wir, wie und wo wir konnten. Spielzeuge waren zu dieser Zeit Hüpfseil und Klicker – ein kleines Loch, und man spielte. Der, welcher Glasklicker hatte, war sehr hoch angesehen. Eisenklicker waren Statussymbole und noch höher im Wert. Man traf sich und jeder trug den Klickerbeutel zur Schau wie eine Trophäe.
Zur Hippiezeit waren es keine Klickerbeutel mehr, sondern bunt bestickte und mit Fransen versehene Haschischbeutel. Auch in dieser Zeit waren sie eine Art von Statussymbol.
Und da waren die Ruinen. Abenteuerspielplatz schlechthin. Zugeschüttete Räume im Inneren der Häuser. Da wir noch klein waren, konnten wir wie Mäuse durchschlüpfen. Teilweise gab es noch Freiräume, und wenn man eine Taschenlampe hatte, eröffnete sich das Abenteuer. Da waren Bücher, Kleider, Hausrat und auch immer die Gefahr, dass die Trümmer nachgeben würden und man darunter verschüttet werden konnte. Da war eine Tür, die wir öffneten, und was wir dort sahen, hatte sich wohl vor mehr als zehn Jahren ereignet.
Ein halbverwester Leichnam eines deutschen Soldaten. Gespenstisch sah uns dieser augenlose Schädel an. Uns fuhr die Angst in die Glieder und bewegungslos starrten mein Bruder und ich diesen Soldaten an. Wir schauten dem Tod direkt ins Auge. Wenige Jahre später sollte der Tod unsere Herzen noch intensiver umklammern.
Wir brachten das Maschinengewehr zur Oberfläche. Mein Bruder hatte eine Aktentasche gefunden. In dieser waren kleine Fläschchen. Sah aus wie kleine Schnapsfläschchen oder Essenzen, um chemische Reaktionen zu erstellen. Oder Drogen?
Wir empfingen eine furchtbare Schimpftirade unseres Vaters, der auch die Tasche an sich nahm. Niemals mehr würden wir in die Trümmer gehen, versprachen wir. Meine und auch die Eltern meiner Spielkameraden verboten eindringlich diesen Spielplatz. Aber das Abenteuer war einfach zu groß. Neben den Trümmern gab es noch ein anderes Plätzchen. Dieses Plätzchen hatte einen großen Bombenkrater. Allgemein wurde dieser Platz das Römerlager genannt. Und in der Tat, als wir beim Spielen dort Scherben fanden, kamen Mitarbeiter des Römisch-Germanischen Museums und befragten uns Kinder. Der Spielplatz wurde abgezäunt – ein Abenteuer weniger.
Und da waren auch noch diese Ungetüme – Fahrzeuge, die sich ab und an den Linsenberg heraufbewegten und an unserem Haus vorbeifuhren – alle Scheiben vibrierten und kündigten deren Erscheinen vorzeitig an.
Man hörte das Geratter dieser Monster schon von Weitem. Sie hatten keine Räder wie normale Fahrzeuge, nein, ihre Räder bewegten vielmehr ein Metallband. Es waren große, schwere Ungetüme – dunkelgrüne Farbe mit einem großen weißen Stern auf der Seite und auf der Front. Oberhalb dieses Bewegungsmechanismus gab es ein kleines bewegliches Gehäuse mit einer Luke – einem Deckel. Dieser Aufsatz konnte sich bewegen, und wie eine lange Pinocchionase war da ein Riesenrohr. Fast so wie das Denkmal der Kanone unseres Fußballplatzes.
Wann immer wir dieses Gedröhne der Fahrzeuge hörten, rannten wir Kinder alle zur Hauptstraße. Es war die Sensation, aus den Luken schauten sehr oft seltsam aussehende Personen. Sie hatten eine Art von Maskierung auf dem Kopf und in den Ohren – wie an Fasnacht – auch hatten viele dieser Außerirdischen ein anderes Aussehen. Ihre Lippen und Nasen und vor allem ihre Hautfarbe waren so unterschiedlich zu dem, was unsere Zuordnung bisher zeigte. Wenn sie lachten oder sprachen, so sah man ihre großen weißen Gebisse. Es war eine Art von Mensch-Tier-Maschine.
Jahre später las ich in einer Beschreibung der Indios über die Konquistadoren etwas Ähnliches. Man dachte in der Tat, dass die Pferde mit dem Reiter und deren Helm eine außerirdische Erscheinung seien. Und ihre Waffen, ähnlich den amerikanischen Panzern, etwas Tödliches, Bedrohliches brachten.
Was uns Kinder emotionalisierte, waren nicht die Panzer oder die Extraterrestres – nein, es ging um die kleinen, dünnen, in weißem Papier mit grünem Pfeil eingepackten Bonbons.
Nein, es waren keine Bonbons, denn man lutschte sie nicht, man kaute auf der Masse. Ohne dass sich diese verlor, zog man mit jedem Kauen Zucker aus dieser Masse.
Diese neuen außerirdischen Bonbons nannte man Chewing Gum – auf Deutsch Kaugummi.
Und so liefen wir parallel zu den außerirdischen Fahrzeugen und riefen immer und immer wieder: „Schu In Gam.“ Mein erstes englisches Wort – viele sollten noch folgen – denn sie waren der Schlüssel zu meinen Abenteuern.
Diese Außerirdischen waren danach oft auch das Thema während des Abendessens.
Unser Vater erklärte uns, dass diese Fahrzeuge und auch deren Besatzung nicht von außerirdischen Planeten kamen, sondern dass dies Amerikaner seien – es gab Amerikaner mit schwarzer, aber auch mit weißer Hautfarbe.
Amerikaner – klar kannte man die. Es war ein süßer, etwa zehn Zentimeter großer runder kleiner Kuchen, dessen Boden mit einem Zuckerguss oder Schokoladenguss überzogen war.
Und so ordnete ich mit dem Verständnis eines Fünf- bis Sechsjährigen die Großmacht USA ein.
Auch erklärte unser Vater, dass die schwarzen Amerikaner eigentlich Afrikaner seien. Afrika, ein Kontinent, in dem der größte Teil der Bevölkerung schwarz sei. Ein trauriger, armer Kontinent, und dass man diese Afroamerikaner nicht sehr gut behandeln würde – man würde sie für Amerika kämpfen lassen, obgleich sie in ihrem Herzen mehr Afrikaner als Amerikaner seien.
Irgendwie hatte ab diesem Tag der schwarze Mann Einfluss auf unsere Familie. Ich erinnere mich, dass, wenn ich unartig war, sogar mit dem schwarzen Mann gedroht wurde, der mich nach Afrika verschleppen würde. Aufgrund der Nähe zum Krankenhaus sah man auch ab und an einen schwarzen Mann in einem weißen Doktorkittel – aber diese waren nur aus der Entfernung zu sehen.
Die Entfernung zum Kindergarten in Zahlbach war sehr weit. Es waren nur mein großer Bruder und ich, die diesen Weg täglich alleine machten. Unsere Schwester war noch zu klein.
Wir mussten die stark befahrene Straße direkt vor unserem Haus überqueren. Dann führte ein längerer, hügeliger Weg durch einen Park zum Kindergarten.
Zur Verpflegung nahmen wir unser Butterbrot mit – für meinen Bruder mit einer Käsescheibe belegt und für mich mit einer Wurstscheibe. Jeder hatte eine kleine lederne Umhängetasche, in der das Frühstück verstaut wurde. Und wenn man es nicht schaffte, dies alles zu essen, so gab es am Nachmittag den Rest. Dies schmeckte gemäß unserer Mutter besonders gut, da dort das Vögelchen drüber gepfiffen hatte. Apfel zusätzlich, wenn es Erntezeit war. Das war’s.
Es kam der Tag, als mein Bruder und ich aus dem Kindergarten nach Hause gingen. Um unser Haus zu erreichen, mussten wir die Hauptstraße überqueren. Mein Bruder, schnell entscheidend, hatte eine Lücke im Verkehr genutzt, um auf die andere Seite zu gelangen. Ich schrie, dass er auf mich warten solle. Zumal ich plötzlich einen schwarzen Mann auf mich zukommen sah. Ich spürte Angst und schrie immer lauter: „Alfred, lass mich nicht allein!“
In diesem Moment schnappte mich der schwarze Mann an meiner Hüfte und, gegen seine Hüfte stemmend, trug er mich zur anderen Seite. Ich versuchte, mich zu wehren, und als ich wieder Boden unter meinen Füßen hatte, rannte ich so schnell ich konnte in Richtung Haus, die Treppen hoch und auf meine Mutter zu. Ich hatte es geschafft und konnte meiner Entführung nach Afrika entkommen.
Es war nicht St. Christopherus, der ein Kind ans andere Ufer brachte, nein, es war ein angehender schwarzer Arzt, der diese schützende Funktion übernahm. Auch wenn der Beschützte vor Angst fast in die Hose machte.
Heute, wenn ich diese Geschichte der Familie meiner zweiten Ehefrau erzähle, brechen diese in ein Gelächter aus. Die Frau, welche die Mutter meines einzigen Kindes ist, ist eine, wie sie sich selbst bezeichnet, Afro-Indio-Colombiana.
Am liebsten mochte ich die Amerikaner mit Zuckerboden – was nicht als Bewertung einzuordnen ist.
Es wurde aufgebaut auf den Mauerresten der Häuser und auch auf den seelischen Trümmern der Menschen.
Neuorientierung auch in der Schulausbildung – man zeigte Kindern Filme der Befreiungen von Konzentrationslagern. Furchtbare Bilder für Erwachsene, für Kinder traumatisierend. Wer waren unsere Eltern? Ist dies eventuell genetisch verankert und erbbar? Man konnte keinen Stolz empfinden für seine Herkunft.
Wir mussten stark sein – mental. Wir mussten ehrlich sein. Wir mussten arbeitsam sein, pünktlich und niemals klagen.
Mehr als andere Menschen mussten wir alle positive Eigenschaften leben und dokumentieren.
Ein Dieselabgasskandal in dieser Zeit wäre das Ende deutscher Produkte gewesen. „Das tut man nicht!“ begleitete mich in meiner Erziehung.
Deutschland hatte keine Freunde mehr in der Welt. Keiner empfand Sympathie – nein, es war, wenn, Achtung für die Leistung. Sehr oft auch Neid.
Deutschland nach dem Krieg musste all die Tugenden zeigen, um sich mit Respekt einen Platz in der sich neu formierenden Weltorganisation zu verdienen.
Die Deutschen stellten sich ihrer Verantwortung. Nicht nur, weil die Siegermächte mit aller Macht den Überlebenden diese Lektion einprügelten. Nein, die Generation hatte trotz allem den Charakter, hinzuschauen. „Autoreflexion“ heißt dies. Was vielen Nationen trotz schändlicher Taten in ihrer Geschichte niemals auch nur annähernd einfallen würde.
Aber es ist nicht in der Hand der Deutschen, dies einzuklagen. Es ist nur eine Tatsachenbeschreibung.
Letztendlich ging man auch zu einer anderen Tagesordnung über.
Leider ließen uns die Siegermächte nicht die Freiheit, unser Schicksal selbst zu bestimmen.
Zu viele gut ausgebildete Soldaten, Verwaltungsangestellte und Wissenschaftler konnte man gebrauchen, um sich den neuen Gefahren zu stellen. Nach dem Krieg wurden aus Waffenbrüdern Feinde. Erbitterte Feinde.
Es war vielen Strategen klar, dass, wenn es zu einer neuen Konfrontation kommen sollte, diese auf dem Territorium des erlegten Opfers stattfinden würde.
Also keine Neutralität – keine Selbstbestimmung – nein, das Einbinden in eine neue Kampfformation. Man baute und rüstete den alten Feind ökonomisch und militärisch wieder auf. Wir wurden „Brothers in Arms“.
Mein Bruder wurde eingeschult, und ein Jahr später war ich an der Reihe. Zum ersten Mal sah ich dieses riesige Gebäude – Gründerzeit, weite Steintreppen führten zu den einzelnen Stockwerken. Jedes Stockwerk hatte mindestens fünf Klassenzimmer.
Stolz hatte ich am Morgen mit Mutter und Vater meinen ersten Schulweg gemacht und trug den Ausdruck meiner Reife in Form einer Schultüte.
Eine sehr schöne Tradition. Viele Jahre später sollte ich die Tradition in einem anderen Erdteil für meine kleine Tochter fortsetzen.
Viele Kinder waren auf dem Schulhof, und es war ein Rennen und Lärmen. Meine Eltern führten mich in einen geschmückten Raum, der bereits gefüllt war mit meinen zukünftigen Klassenkameraden und deren Eltern. Man begrüßte uns, und ich sagte artig meinen Namen. Kinder in dieser Zeit waren artig, genügsam und folgsam – zumindest war dies die Ausrichtung.
Also dies sollte zukünftig meine morgendliche Bleibe sein. Schön war, dass neben mir noch zwei weitere Jungs unseres Hofes in der gleichen Klasse waren. „Hans“ und „Lotte“ waren die ersten Worte, die ich lernte zu schreiben und zu lesen. Geschrieben wurde damals auf einer Schiefertafel mit einem Griffel, und der Radiergummi war ein kleiner Schwamm. Den bunten Schulrucksack hatte man noch nicht erfunden, und so waren es Schulranzen aus Leder.
„Nimm deinen Griffel richtig in die Hand, sonst wirst du nie richtig schreiben lernen“ war das geflügelte Wort.
Es war für kurze Beine ein langer Schulweg, den meine „Freunde des Hofes“ und ich jeden Tag zu bewältigen hatten. Man ging alleine und gemeinsam. Der Tag begann um sieben Uhr – schnelles Waschen, Frühstücken und Anziehen. Um sieben Uhr dreißig sollte man den Schulweg antreten. Oft fehlte mir eine Stunde Schlaf am Morgen. Einmal auf dem Weg und dann in der Schule war man beschäftigt und aktiv.
Ich erinnere mich heute noch an die Namen der beiden Klassenlehrer, die wir hatten. Die Klassenlehrerin ab der dritten Klasse blieb mir in Erinnerung, denn wir Jungs waren von ihrer Weiblichkeit sehr beeindruckt. „Young teachers are subject of schoolboys’ fantasy.“
Es gab die Zeit des Kommunionunterrichts, der Kommunion und dann auch der Firmung.
Hätte ich eine Veränderung in mir spüren müssen? War ich nun erleuchtet oder besser beseelt? Nee, eigentlich nicht. Immer schon beteten wir vor dem Essen und auch vor dem Einschlafen.
Die Jahre gingen ins Land, und aus den Kindern wurden Jungs – eine heile, ausgeglichene Welt, in der alles seine Ordnung und seinen Weg hatte.
Es fehlte nur noch ein Tag, bis das Jahr 1961 beginnen sollte, und es war der Geburtstag unserer Mutter – ihr sechsunddreißigster Geburtstag.
Es war der Tag, an dem das Abteil des Lebenszugs der Familie aus den Gleisen geriet.
Nichts mehr sollte so sein, wie es war, oder so werden, wie man es sich vorgestellt hatte.
Eigentlich hatte es sich schon am Horizont abgezeichnet.
Es war Winter im Jahr 1960 – Weihnachten. Die letzten schönen Weihnachten im Familienkreis – bis heute, sechzig Jahre später.
Seit Wochen schon war unser Vater nicht mehr zur Arbeit gegangen. Er war gesund, ja, körperlich konnte man keine Krankheit ausmachen. Er kam mit seinem Leben nicht mehr zurecht, sagte man später. Es ging ihm scheinbar so schlecht, dass man ihn ins gegenüberliegende Krankenhaus einlieferte. Aus der Beobachtung wurden Wochen. Es war nicht so weit von zu Hause, und wir konnten ihn besuchen.
Weihnachten stand vor der Tür, und er erhielt Freigang unter Beibehaltung der täglichen Medizin. Für wenige Tage gab es so etwas wie ein normales Familienleben. Weihnachten verging mit schönen Erinnerungen und tollen Geschenken.
Für uns Kinder war diese Zeit angenehm, da wir mehr von unserem Vater hatten.
Wer mit seinen elf, zehn oder acht Jahren hätte sich vorstellen können, was in der Seele eines vierundvierzigjährigen Kriegsveteranen vorging?
Zwar erinnere ich mich, dass wir einmal mit unserem Vater am Tisch saßen. Er hatte ein Fotoalbum vor sich liegen. Von den amerikanischen Panzersoldaten erzählte er, und dann öffnete er sein Album. Und da war er zu sehen – in seiner Uniform. Es war nicht die grüne Tarnuniform mit einem weißen Stern, wie die der Amerikaner. Nein, es war das Sinnbild einer anderen Ausrichtung, ein anderes Symbol. Erst viele Jahre später begriff ich den eigentlichen Wert dieses Zeichens und den schändlichen Missbrauch.
Es gab im Wohnzimmer ein etwa zwanzig mal dreißig Zentimeter großes Bild unseres Vaters in Uniform und mit Kappe. Als Kind sah ich mehr das Gesicht, die Augen und den Mund, als dass ich auf die Uniform selbst geachtet hätte.
In diesem Fotoalbum gab es sehr viele Ablichtungen von diesen anders uniformierten Männern.
Da gab es hohe, schneebedeckte Berge, große Meeresbuchten, und da gab es einen Schäferhund. Er erzählte uns von einem Land hoch oben im Norden Europas – so wie er es beschrieb, hatte dies wohl eine tiefe Bedeutung und Erinnerung hinterlassen. Er sprach von seinem Rex – einem deutschen Schäferhund, den die Armeeführung ihm als Schutz und Begleitung gegeben hatte. Manchmal stockten seine Erzählungen, insbesondere wenn unsere Nachfragen ihn scheinbar aus dem Gleichgewicht brachten. Es gab Bilder, die er einfach überflog. Waren sie einfach nicht mehr erkennbar für ihn? Es waren Bilder von einer Frau – einer freundlich lächelnden Person. Sie tauchte immer und immer wieder neben den Bildern seiner Kameraden auf. Bis er dann überraschend das Album zuschlug, das Zimmer verließ und auch bis zum Abendessen nicht mehr erschien.
Deutschland hatte einen Neubeginn gestartet, und so deren Bewohner. Es gab keine Zeit der Reflexion oder Analyse. Zwar gab es die Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse – aber wer gab dem einzelnen Überlebenden seelischen Beistand? Nicht nur den zurückgekehrten Soldaten – nein, auch deren Familien. Junge Frauen wie meine Mutter, die nach dem Krieg ums Überleben kämpften. Viele, viele Jahre später erzählte sie von der Zeit des Knoddelns, wie sie es nannte. Sie fuhr mit ihrem Fahrrad aufs Land. In ihrer Tasche einige Familienschmuckstücke, die sie gegen Lebensmittel bei den Bauern eintauschen wollte.
Als Schutz hatte sie alte Klamotten angezogen – ihre Haare mit stinkendem Fett eingerieben. Ein zweiundzwanzigjähriges junges Fräulein wollte nicht das attraktive Ziel wie auch immer gearteter Männer sein. Konnte sie diese Zeit unbeschadet überstehen? Wir wissen es nicht, und sie nahm dies mit in ihr Grab. Aber sie traf wohl auf einer dieser Fahrten einen jungen Mann. Einen Mann, der sich von der stinkenden, dreckigen Knoddlerin nicht abschrecken ließ. Als sie ihm ihre Schönheit offenbarte, begann auch er einen Neuanfang – Weihnachten 1948.
Wohl dachte er, dass der Abstand von fast vier Jahren ausreichend sei. 1945 ging der Krieg zu Ende, wieso dann vier Jahre? Was war geschehen im Jahr 1944, in diesem Land im Norden – im Land der Mitternachtssonne?
Jahre später sollte meine Schwester, das kleine schwarze Mädchen, diese Zeitepoche analysieren.
In den Wehrmachtsunterlagen gab es Informationen über den Unteroffizier Ludwig Berg, seit dem vierundzwanzigsten Lebensjahr Angehöriger der deutschen Luftwaffe, Abteilung Spionageabwehr. Standort Norwegen.
Es gab einen Sabotageakt gegen die deutschen Streitkräfte, und dieser Unteroffizier war ein Teil oder aber auch der Beauftragte, um diesen Vorfall zu analysieren. Die Erkenntnisse aus dieser Ermittlung führten zu Ergebnissen, die für ihn so erschütternd waren, dass er entschieden hatte, seine Pulsadern aufzuschneiden. Er wollte mit der Erkenntnis und den Folgen dieser Ermittlungen nicht mehr weiterleben.
Sein Vorhaben hatte keinen Erfolg – er wurde in ein Hospital gebracht – als überlebender, aber unbrauchbarer Soldat ausgemustert.
Diese Erkenntnis erschütterte uns mittlerweile Dreißigjährige zutiefst. Was war der ausschlaggebende Punkt dieser Entscheidung zum Suizid? Viele, viele Jahre später, ich war bereits sechzig Jahre, sollte mein Vater mir dies mitteilen.
Im Spätjahr 1960 starben seine Eltern, und sein Herz war schwer – er hatte wohl die Ausrichtung in die Zukunft verloren. Die Tiefen der Vergangenheit mit ihren vielen Irrwegen hatten seinen Lebensweg versperrt – er fühlte sich verloren.
Der 30. Dezember 1960
Eine sehr kalte Dezembernacht ging zu Ende. Sie suchte die Körperwärme des neben ihr noch schlafenden Partners. Ludi, wie sie ihn nannte. Seit zwölf Jahren waren sie ein Paar. Er war der Vater der drei gemeinsamen Kinder, die noch fest im Nachbarzimmer schliefen.
Ludi schlief ruhig und tief, nachdem er fast die ganze Nacht sehr unruhig mit seinen im Unterbewusstsein stattfindenden Geschehnissen kämpfte.
Sie deckte ihn behutsam zu und küsste ihn auf seine Wange.
Die Bedürfnisse ihres Körpers trieben sie aus dem Bett. Sie schlüpfte in ihren Bademantel, während sie aus dem Fenster schaute. Das Zimmer, obgleich noch sehr früh, war bereits erhellt. Sie wischte mit dem Ärmel ihres Bademantels den Tau, der sich auf der Scheibe gebildet hatte, zur Seite.
Ja, es hatte geschneit. Es war alles weiß, und das Mondlicht reflektierte und erhellte die Dunkelheit. Auch auf dem Baum vor dem Fenster lagen große Flocken. Es war ein schöner, friedvoller Anblick.
Während sie auf der Toilette saß, kam ihr der Gedanke, dass ja heute ihr Geburtstag war. Ja, es war der 30. Dezember – für einige Momente schwebten ihre Gedanken in Erinnerung an zurückliegende Geburtstage. Sie fühlte sich traurig, ja, sehr melancholisch und traurig.
Die Wohnung hatte sich in der Nacht merklich abgekühlt. Daher ging sie direkt in die Küche, um nach dem Ofen zu schauen.
Die Küche hatte eine angenehme Temperatur. Sie öffnete die Ofenklappe und sah die heruntergebrannten Briketts. Es hatte noch ausreichende Glut, und sie glimmte ruhig vor sich hin.
Und wieder ergriff sie eine tiefe Melancholie. War es das Datum? Ihr Geburtstag? War es die Unruhe ihres Mannes, die sie ebenfalls sehr unruhig schlafen ließ? Oder war es sogar die Ahnung dessen, was dieser Tag bringen würde?
Gemeinsames Frühstück und Mittagessen. Man wollte kurz in die Stadt gehen, um einige Erledigungen zu machen.
Wir beiden Jungs hatten entschieden, zu Hause zu bleiben, um mit unserer elektrischen Märklin-Eisenbahn zu spielen. Ihre kleine achtjährige Tochter wollte mit ihren Freunden Schlitten fahren.
Nachdem man Monika zum gegenüberliegenden Hügel begleitet hatte, sodass sie dort mit den anderen Kindern Schlitten fahren konnte, ging man gemeinsam in die Stadt.
Es war ein gesprächsloser Gang in die etwa fünfzehn Minuten entfernt liegende Innenstadt. War es der Schal, den man über den Mund gezogen hatte, um sich vor der Kälte zu schützen? Oder war es einfach nur, dass jeder seinen eigenen Gedanken nachhing?
Während sie mit der Verkäuferin sprach, um dann anschließend an der Kasse zu zahlen, hatte Ludi sich herumgedreht und das Geschäft verlassen.
Es blieb ihr nicht die Zeit, um zu bezahlen. Sie spürte eine tiefe Unruhe, verließ das Geschäft und suchte nach ihm. Er war nicht mehr zu sehen.
„Ludi – wo bist du?“, fragte sie sich. Wo sollte sie ihn finden? War er auf dem Weg zurück nach Hause?
Nicht nur diese letzte Nacht war er sehr aufgewühlt … nein, schon seit Tagen war er sehr seltsam verschlossen. Sein Vater – ihr Schwiegervater – war vor einigen Tagen verstorben. War es dies, was ihn aus der Bahn warf?
War es der Tod, dem er so oft im Krieg begegnet war und der ihn durch dieses Ereignis wieder einholte?
Schnellen Schrittes, mit offenen Augen, irrte sie durch die Innenstadt. Irgendwo musste er doch sein. Intuitiv ging sie Richtung zu Hause. Ihr kam der Gedanke an den Bahnhof. Sie erreichte den Bahnhof, ging zur Schalterhalle. Nichts. Sie ging zu den Bahngleisen … auf und ab.
Da stand er und starrte vor sich hin. Er erschrak, als sie ihn ansprach.
Was ging in ihm vor? Wo war er?
Sie fragte ihn, wohin er wollte. Er schaute sie nur verständnislos an. Welche Frage? „Nach Hause“, sagte er. „Nach Hause? Wo?“
Nach Hause, wo er geboren wurde.
„Dieses Zuhause gibt es nicht mehr. Deine Eltern sind beide tot. Du hast ein Zuhause mit mir und unseren drei Kindern. Ludi … Komm zu dir. KOMM ZU DIR.“
Sie kämpfte um ihn – ihn aus dieser anderen Realität zurückzuholen.
Sie ergriff seinen Arm, und gemeinsam verließen sie den Bahnsteig, den Bahnhof und begaben sich auf den Heimweg.
Was ging in ihm vor? Wie konnte sie ihn in der Realität festhalten?
Ihr Herz war eng, war verkrampft und tief besorgt.
Viel hatten die Menschen dieser Zeit erlebt. Das Aufbrechen eines neuen Nationalstolzes, der Krieg, der Zusammenbruch, die Besatzungszeit, Überlebenskampf, Verlust und Tod.
Man hatte einen Neuanfang gesucht – aber die Bilder und Gefühle der nur wenige Jahre zurückliegenden Zeit waren noch lebendig. Sie wusste um die Ereignisse, die in den Kriegsjahren in Norwegen ihn dominierten – sicher wusste sie auch von der Entscheidung, sich das Leben zu nehmen. Damals wurde er vor dem Ausbluten seiner aufgeschnittenen Pulsadern gerettet. Aber all dies lag doch schon so viele Jahre zurück. Hatten sie dieses Thema nicht schon intensiv durchgesprochen? Hatte er nicht zu einem Neuanfang – neuer Beziehung und Familie – JA GESAGT?
Diese so scheinbar heile Welt sollte jäh zu Ende gehen. Die Schatten der Vergangenheit wurden länger, ähnlich den Nächten, die immer dunkler wurden.
Wir Jungs bekamen wieder einiges für unsere elektrische Eisenbahn geschenkt. Seit Heiligabend war diese auf einer sehr großen Spanplatte aufgebaut, und wir spielten von früh morgens bis spät in die Nacht. Meine Schwester zog es vor, den Schnee zu genießen und Schlitten zu fahren.
So war es auch an diesem Tag, an dem meine Mutter mit unserem Vater in die Stadt ging, um einzukaufen. Es war ihr sechsunddreißigster Geburtstag, als unsere Welt erschüttert wurde. Kein schönes Geschenk.
Es war schon fast dunkel, als sie klingelten. Wir betätigten den Türöffner und gewährten ihnen Einlass.
Meine Mutter brachte den Schlitten meiner Schwester in den Keller und betrat die Wohnung.
Mein Bruder und ich hatten immer wieder Zusammenstoßen gespielt. Zwei Züge, die in voller Geschwindigkeit aufeinander zufuhren, bis es zur Entgleisung kam.
Und so kam es dann auch „zu einer totalen Entgleisung“. Alles, was vorher auf vorgezeigten Schienen seinen Weg fuhr, wurde aus der Bahn geworfen.
Während sie den Schlitten in den Keller brachte, war mein Vater nicht, wie sie dachte, in die Wohnung gegangen. Sie bemerkte dies erst nach einiger Zeit und fragte uns Kinder nach dem Verbleib unseres Vaters. Ihre Stimme war sehr ernst, und ich denke, sie spürte den besonderen Moment. Er war doch eben noch im Haus. War er denn nicht in die Wohnung hochgegangen?
Keine Zeit für viele Fragen – wir drei Kinder verstanden gar nichts. Meine Mutter schlüpfte in Windeseile wieder in den warmen Wintermantel. Sie lief rechts, links, irrte von hier nach da, den Namen ihres Mannes rufend. Es fing an zu schneien, es war kalt … Ein Nachbar, der in diesem Moment nach Hause kam, sagte ihr, dass er meinen Vater vor einigen Minuten gesehen hatte. Er habe ihn gegrüßt, doch er sei nur in langen Schritten, ungeachtet des Grußes, an ihm vorbeigeeilt.
Und nun lief meine Mutter in die vom Nachbarn beschriebene Richtung – seinen Namen in die immer heftiger stürmende Schneenacht schreiend.





























