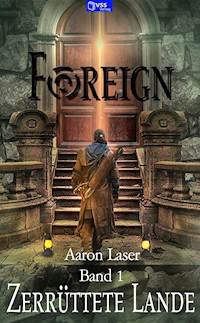
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: vss-verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Eigentlich führte Vayk ein sorgloses Leben. Als Jüngster der drei Prinzen des Königreichs Sargonei lebte er jahrelang in Saus und Braus am Hofe seines Bruders Johann. Selbst der Bürgerkrieg, der seit dem Tod ihres Vaters zwischen den beiden Thronfolgern Johann und Elwin tobte, hatte sich nur in geringem Maße auf sein eigenes Dasein ausgewirkt; zumindest bis jetzt. Denn noch weiß Vayk nicht, dass ihm eine unerwartete Wende des Schicksals unmittelbar bevorsteht. Eine todbringende Seuche ist auf dem Vormarsch und droht, die gesamte Insel und all ihre Bewohner in den Untergang zu reißen. Aus diesem Grund wird Vayk von seinem Bruder Johann durch das ganze Land gesandt, um einen Friedensvertrag mit Elwin zu schließen, damit sie gemeinsam der Epidemie Einhalt gebieten können. Nach kurzem Zögern, doch mit Mut im Herzen willigt Vayk schließlich ein und tritt ganz auf sich allein gestellt seine Reise an; eine Reise voller Gefahren und Unwägbarkeiten. Wird es ihm gelingen, allen Widerständen zu trotzen und sich den Gefahren der rauen Wildnis zu erwehren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Zerrüttete Lande
Foreign - Teil 1
Cover
Titel
Aaron Laser
Foreign – Teil 1
Zerrüttete Lande
Impressum
Aaron Laser – Zerrüttete Lande (Foreign – Teil 1)
1. Auflage – 2020
© vss-verlag, 60389 Frankfurt am Main
Titelbild: Hermann Schladt unter Verwendung eines Fotos von Pixabay
Lektorat: Chris Schilling
Prolog
Auf und nieder, auf und nieder, so pflügte die Salia durch die Wellen. Trotz des guten Wetters war das Meer aufgewühlt und der Seegang dementsprechend rau. Dennoch bahnte sich das Schiff zielstrebig seinen Weg durch die Wassermassen. Die Reise der Salia sollte gen Osten gehen, an unbekannte Ufer, die nie zuvor ein Mensch betreten hatte. Ein neues Leben und eine neue Zukunft warteten dort auf die Besatzung, die alles tat, um das bauchige Schiff auf Kurs zu halten. Jede größere Welle ließ das gesamte Schiff erzittern und den Menschen an Bord fiel es schwer, auf dem nassen Deck nicht den Halt zu verlieren.
„Große Welle Backbord, alle Mann festhalten!“, hallte die Warnung eines Seemanns über das Hauptdeck.
Schon im nächsten Moment ergoss sich das Salzwasser über die glitschigen Holzdielen und die Gischt raubte den Seeleuten für kurze Zeit die Sicht. Wie durch ein Wunder hatte es Jeder geschafft, sich irgendwo festzuhalten, sodass, trotz der Urgewalt des Wassers, Niemand über Bord gegangen war. Auch wenn sich im Moment nur die erfahrenen Seeleute auf dem Hauptdeck befanden, so war die Seefahrt doch immer ein Spiel mit dem Feuer. Die wenigen Männer und Frauen, die jahrelange Erfahrungen im Umgang mit den Gezeiten hatten, taten an Deck ihr Bestes, um das Schiff vor Seenot zu bewahren. Der Rest der Besatzung befand sich unter Deck, wo sie ausharrten und einen ruhigeren Seegang herbeisehnten. Während über Deck große Unruhe herrschte, stand ein einzelner Mann ein Stück abseits und strahlte, trotz des Chaos, das ihn und die Besatzung umgab, eine einzigartige Ruhe und Gelassenheit aus. Dieser Mann wollte sich dem Ozean nicht beugen, dieser Mann musste auch bei schwierigen Bedingungen an Deck stehen und der See trotzen, dieser Mann hatte die Pflicht, als strahlendes Beispiel voran zu gehen und seine Leute in eine neue Heimat zu führen. Der Name dieses Mannes war Adelar.
Seine langen schwarzen Haare hingen ihm in nassen Strähnen im Gesicht und sein edler Umhang hatte durch das Salzwasser eine dunkle Färbung angenommen. Doch Adelar scherte sich nicht darum, er stand breitbeinig und mit vor der Brust verschränkten Armen am Bug des Schiffes, den Blick fest auf den Horizont gerichtet. Mit versteinerter Miene schaute er in die Ferne, in ständiger Erwartung, dort das Ziel ihrer Reise zu erblicken. Keine Welle- und war sie noch so gewaltig gewesen- hatte es geschafft, ihn aus dem Gleichgewicht zu bringen und es machte fast den Anschein, als wäre der Mann eher die Gallionsfigur, als der Kommandant des Schiffes. Hinter ihm hörte er die Schritte eines sich nähernden Matrosen, der gekommen war, um ihm Neuigkeiten über die Lage an Deck zu überbringen. Einige Meter von Adelar entfernt machte der Mann Halt und erstattete Bericht.
„Sire, wir haben das Gröbste überstanden! Es sieht so aus, als würde sich die See in der nächsten Zeit etwas beruhigen, wir können also die Reise wie geplant fortsetzen.“
Ohne sich umzudrehen sagte Adelar mit fester Stimme:
„Gute Neuigkeiten! Wie geht es den Männern und Frauen an Deck, sind sie unversehrt?“
„Ja, Sire!“, antwortete der Mann pflichtbewusst. „Niemand trug schwere Verletzungen davon. Außer ein paar Prellungen und dem einen oder anderen aufgeschürften Knie ist alles in bester Ordnung!“
Auch wenn niemand sonst es sehen konnte, so entspannten sich die Züge Adelars nun ein wenig. Er hatte befürchtet, dass Teile der Besatzung zu Schaden gekommen waren und es freute ihn, zu hören, dass dies nicht der Fall war.
In gewohnt rauem Ton fragte er:
„Gibt es sonst noch etwas zu berichten, Matrose?“
„Ja, Sire! Wie mir der Steuermann soeben versichern konnte, werden wir unser Ziel voraussichtlich übermorgen erreichen!“,antwortete der Seemann.
„In zwei Tagen also...“, murmelte Adelar mehr zu sich selbst als zu dem Matrosen.
„Genau, Sire! Wenn der Wind sich nicht dreht, dann eventuell auch schon etwas früher. Ich muss sagen, Sie haben mit der Salia eine ausgezeichnete Wahl getroffen! Wohl kaum ein anderes Schiff hätte diese raue See so gut überstanden und wäre gleichzeitig so schnell an ihrem Ziel angekommen, wirklich hervorragend!“
Adelar bedankte sich bei dem Matrosen für den Bericht, wobei er dessen Schmeicheleien übergang, und befahl ihm wegzutreten. Nach einem kurzen „Zu Befehl!“, salutierte der Mann und verschwand unter Deck, Adelar war wieder allein.
Minuten vergingen, in denen er den Horizont nach dem kleinsten Anzeichen von Land absuchte, doch er wurde nicht fündig.
Zwei Tage noch! Nur noch zwei Tage und wir können ein neues Leben beginnen, genau wie wir es damals wollten!
Ohne dass er es gemerkt hatte, war das Meer tatsächlich ein wenig ruhiger geworden und die Salia glitt nun sehr viel weicher durch das Wasser. Sogar die Wolkendecke öffnete sich und die Sonne sandte ihre wärmenden Strahlen auf ihn und die gesamte Besatzung herab; es schien fast so, als wollte die Welt einen neuen Abschnitt im Leben der Menschen einläuten.
Adelar legte seine Hände auf die hölzerne Reling, schloss die Augen und genoss die angenehme Wärme der Sonne. Er war gewillt, mit seinem bisherigen Leben abzuschließen und ein neues Kapitel zu beginnen. Bei dem Gedanken an sein vergangenes Dasein verkrampfte er sich, seine Finger bohrten sich in das Holz und ein Schatten legte sich auf sein Gesicht. Töricht war er gewesen, töricht und dumm, dass er geglaubt hatte, er allein könne sich den uralten Traditionen widersetzen und mit den hergebrachten Regeln brechen. Was war er nur für ein Narr! In dem ewigen Kampf zwischen Liebe und Blut gab es keine Gewinner, sondern nur Verlierer. Er selbst hatte dies schmerzlich erfahren müssen und ihm war nun bewusst, dass es für einen Mann seiner Abstammung nur eine Wahl geben konnte: das Blut!
Doch er hatte sich für die Liebe entschieden, ihm war es egal gewesen, was alle Anderen, ja, sogar was seine eigene Familie von ihm hielt, er hätte alles für sie getan, für diese eine Frau, für Lorena! Es schmerzte in seiner Brust als er an sie dachte, an die Liebe seines Lebens und daran, wie sie ihm so abrupt aus seinen Armen gerissen worden war.
Sie war die schönste Frau gewesen, die Adelar in seinem Leben erblickt hatte, und er war ihr vom ersten Tag an verfallen. Auch wenn sie keine Adelige gewesen war und nur aus einem einfachen Kaufmannshaus stammte, so war sie dennoch eine kluge, junge Frau gewesen, und ihr Charme und ihre Ausstrahlung hatten auf Adelar eine magische Anziehungskraft ausgeübt. Ihr erstes Treffen war schnell vorübergegangen, damals, als er sie im Palast seines Vaters während einer Versammlung der Handwerker und Kaufleute getroffen hatte. Ihr schüchternes Lächeln hatte ihn sofort verzaubert und die wenigen Worte, die sie gesprochen hatte, klangen in seinen Ohren noch immer wie die schönste Melodie. Er musste sie einfach wiedersehen, das hatte er sich selbst geschworen, und so suchte er kurze Zeit später den Laden ihres Vaters auf, nur um in Lorenas Nähe zu sein. Noch am gleichen Tag gingen sie gemeinsam spazieren und es offenbarte sich, dass Lorena die Zuneigung Adelars teilte.
Von diesem Tag an trafen sie sich öfter, im Geheimen, da niemand von dieser Verbindung etwas erfahren dufte. Nicht auszudenken, was passiert wäre, wenn herauskäme, dass sich der Sohn des Königs mit einer Bürgerlichen eingelassen hatte, nicht nur sein Ruf, sondern die Stellung der gesamten königlichen Familie wäre in Gefahr gewesen!
Doch man sagt nicht umsonst: Liebe macht blind! Ihm war alles egal, er wollte nur noch Zeit mit seiner Geliebten verbringen und somit vernachlässigte er all seine Pflichten als Prinz, nur um bei Lorena sein zu können. Auch jegliche Versuche seines Vaters, ihn zu einer Trennung zu bewegen, scheiterten, obwohl Adelar genau wusste, dass er unter Umständen alles verlieren würde, sobald das Volk von ihm und Lorena erfuhr.
Eine ganze Zeit lang ging alles gut, sowohl das Königshaus, als auch Lorenas Familie setzen alles daran, um die Verbindung der Beiden geheim zu halten. Aber es kam, wie es kommen musste, Lorena wurde schwanger. Einen unehelichen Sohn, der zudem auch noch aus einer Liebschaft mit einer Bürgerlichen hervorgegangen war, konnte sich das Königshaus nicht leisten. Es blieb dem König keine andere Wahl, er musste handeln!
Andere Herrscher hätten nun wahrscheinlich den Weg des geringsten Widerstandes gewählt. Sie hätten Lorena und das ungeborene Kind ermorden lassen und sowohl über sie und Adelar als auch über das gemeinsame Kind Stillschweigen bewahrt. Auf diesem Wege wäre die Machtstellung des Königshauses nicht in Gefahr geraten und alles wäre so gewesen wie zuvor.
Doch Adelars Vater war nicht so wie die anderen Herrscher. Er war ein gütiger König und er konnte die Handlungen seines Sohnes nachvollziehen, denn auch er selbst war einmal jung und verliebt gewesen. Trotzdem musste er etwas unternehmen, also ließ er eines Tages Lorena und Adelar zu sich rufen und berichtete ihnen von seinem Vorhaben.
Sobald das gemeinsame Kind geboren sein würde, würden Adelar und Lorena zusammen mit einer ausgewählten Gruppe von fleißigen Männern und Frauen das Land mit einem Schiff verlassen. Sie würden niemals wieder in das Königreich zurückkehren können und das Volk durfte niemals über die Verbindung der beiden Liebenden erfahren. Ziel der Reise würde eine einsame, menschenleere Insel sein, auf die der König schon lange ein Auge geworfen hatte. Dort würden sie ein neues Leben beginnen und gemeinsam über das Land regieren.
Ohne zu Zögern willigten Adelar und Lorena ein und während Lorenas Bauch immer mehr wuchs, bereiteten sie langsam alles für ihre Abreise vor. Sie waren so glücklich, so unfassbar glücklich darüber, dass sie ihre Liebe schon bald öffentlich machen und in eine gemeinsame Zukunft starten konnten. Es hatte alles den Anschein, als würde die Liebe über das Blut siegen. Aber es kam anders!
Als der große Tag gekommen war, freuten sich alle Eingeweihten über das, was nun folgen würde und alles schien perfekt zu sein. Doch dann holte die grausame Realität die Liebenden ein und riss ihre Welt entzwei. Es kam zu Komplikationen bei der Geburt, denn Lorena hatte neun Monate lang nicht wie erwartet ein Kind ausgetragen, sondern sie gebar Zwillinge. Ihr Körper konnte den Anstrengungen einer doppelten Geburt nicht standhalten und während ihre beiden Söhne lebten, musste sie sterben. Bei dem Gedanken an den Verlust seiner Geliebten rann eine Träne Adelars Gesicht hinab. Er hatte Lorenas Tod nicht verkraften können und er war sich sicher, niemals wieder lieben zu können. Eine gemeinsame Zukunft war auf die grausamste Art und Weise zerstört worden, die ein Mensch sich nur vorstellen konnte. Doch trotz seines Verlustes war Adelar gewillt, den Plan, den sie gemeinsam mit dem König geschmiedet hatten, in die Tat umzusetzen. Lediglich die beiden Ringe an seiner Hand und die Krone auf seinem Kopf erinnerten ihn an vergangene Tage, denn die Zukunft sollte seinen Söhnen und den treuen Männern und Frauen gehören, die ihn auf seiner Reise begleiteten. Nur für seine verstorbene Geliebte trat er diese beschwerliche Reise an, denn er wollte in ihrem Namen für sich selbst, für seine Söhne und für alle anderen eine Heimat errichten, eine Heimat, die ihren Namen tragen sollte, den Namen von Lorena Sargoneh; Sargonei!
1. Zurückweisung
Wieso nur können sie es nicht begreifen?, fragte er sich selbst zum tausendsten Mal und ballte wütend die Fäuste.
Wie kann man nur so verblendet sein und die Augen vor der Wahrheit verschließen? Haben sie denn gar nichts aus der Vergangenheit gelernt?
Unzählige Male war er bereits zu ihnen gekommen und hatte versucht, sie von seiner Sache zu überzeugen, doch genauso oft hatten sie ihn abgelehnt. Er hatte nichts unversucht gelassen, um ihnen zu verdeutlichen, dass es nur den einen, seinen, Weg gab, damit sich die Geschehnisse der Vergangenheit nicht wiederholten. Seit der Ankunft der Fremden hatte er sein Anliegen immer wieder vorgetragen, hatte an die Vernunft seiner Leute appelliert und mit mahnendem Finger auf die Vorkommnisse verwiesen, die so viele von ihnen das Leben gekostet hatten. Doch seine Worte waren nur auf taube Ohren gestoßen. Sie wollten nicht kämpfen, wollten nicht ihr eigenes Dasein verteidigen, sondern lieber auf den unausweichlichen Tod warten.
Diese verfluchten Narren!, schimpfte er in Gedanken.
Wir hätten schon von Beginn an das Unkraut mitsamt Wurzel herausreißen sollen, um die Gefahr ein für alle Mal zu vernichten! Aber nein, sie wollten abwarten, sich verstecken, darauf hoffen, dass nichts passieren würde. Pah, dass ich nicht lache! Wir haben lange genug gewartet, jetzt ist es Zeit zu handeln! Wenn sie doch nur ein einziges Mal die Augen öffnen würden, dann würden sie erkennen, dass Krieg die einzige Sprache ist, die diese Barbaren sprechen und früher oder später werden sie diesen Krieg auch zu uns tragen!
Seine Fingerknöchel traten unter der zornigen Kraft, die in ihm tobte, weiß hervor, aber er bemerkte es nicht, da er vollkommen in Gedanken versunken war.
Doch soweit werde ich es nicht kommen lassen! Auch wenn ich offenbar der Einzige bin, der bei klarem Verstand ist, ich werde nicht tatenlos herumsitzen, ich werde etwas unternehmen!
Dass gerade Diejenigen, die er früher noch zu seinen Freunden gezählt hatte, ihn nicht unterstützten, ja ihn sogar mit Missachtung straften, hatte ihn anfangs schwer getroffen. Mittlerweile aber hatte er sich damit abgefunden und er wollte sie alle retten, ganz gleich wie schlecht sie ihn auch behandelt hatten, denn spätestens dann würden sie zu der Erkenntnis gelangen, dass er von Anfang an Recht gehabt hatte!
In den letzten Monaten hatte er ausgiebig die alten Schriften studiert und jeden einzelnen Abschnitt der antiken Chroniken genauestens geprüft, mit Erfolg! Vor wenigen Tagen war er auf den entscheidenden Hinweis gestoßen, der alles verändern würde. Bisher hatte er niemandem von seiner Entdeckung erzählt, denn er wollte zuerst genügend Beweise für seine Theorie sammeln. Er war sich zwar sicher, dass seine Nachforschungen nichts als die unerschütterliche Wahrheit hervorgebracht hatten, doch er wusste auch, dass handfeste Beweise immer besser als flüchtige Worte waren. Er würde diesen Beweis liefern, schon bald. Dann würden sie ihm endlich glauben und es bliebe ihnen gar nichts anderes übrig, als ihm zu folgen; dafür würde er schon sorgen.
2. Eine frühmorgendliche Störung
Dunkelheit, mehr konnte er nicht erkennen. Der Mond schien in schwachem Licht auf ihn herab und ließ Vayk nur die Umrisse von alten, toten Bäumen wahrnehmen, die vereinzelt um ihn herum standen und deren knorrige Äste wie dutzende Arme in den Nachthimmel ragten. Die allesverschlingende Finsternis ließ ihn nur wenige Meter weit sehen und Vayk wollte sich gar nicht ausmalen, was hinter der Wand aus Schwärze lauern konnte. Er wusste nicht, wo er war, doch Eines wusste er genau; er war nicht allein!
In den Schatten, die ihn umgaben war Etwas und dieses Etwas beobachtete ihn. Auch wenn Vayk es nicht sehen konnte, so spürte er eine Präsenz, eine Präsenz von Etwas, das kein Mensch war.
Er versuchte in der Dunkelheit etwas zu erkennen; vergebens. Nichts, rein gar nichts konnte er sehen und so wusste er auch nicht, wie er entkommen konnte. Aber ihm war klar, dass er fliehen musste, denn von diesem Wesen ging eine Aura aus, die so bedrohlich war, dass sie Vayk von Kopf bis Fuß mit Furcht erfüllte. Er fühlte, wie das Geschöpf in den Schatten sich ihm langsam näherte und Panik stieg in ihm auf.
Lauf, lauf um dein Leben!, hallte es in seinem Kopf und so folgte er seinen Instinkten und lief in die Dunkelheit hinein.
Doch das Schattenwesen verfolgte ihn und ganz egal wie schnell er auch lief, sein Verfolger war ihm dicht auf den Fersen und holte ihn langsam aber sicher ein. Es war so, als würde er nicht von einem einzelnen Wesen verfolgt werden, sondern als würde die gesamte Dunkelheit um ihn herum versuchen, ihn zu fassen zu bekommen. Das Atmen fiel ihm immer schwerer, die Muskeln in seinen Beinen brannten und er spürte, wie die Schatten an ihm zerrten und versuchten, ihn zu Fall zu bringen. Vayk wurde klar, dass es keinen Ausweg gab und als hätten die Schatten seine Gedanken gelesen, verstärkten sie ihren Griff und zwangen Vayk dazu, stehenzubleiben. Sein Verfolger kam nun unaufhaltbar auf ihn zu, Schritt für Schritt näherte sich das mordlüsterne Wesen ihm. Er versuchte noch einmal, alle seine Kräfte zu bündeln, doch er war zu erschöpft. Die Schatten hatten ihn fest in ihrer Gewalt und er konnte sich nicht rühren.
Das ist das Ende..., durchfuhr es Vayk, als er spürte, wie das schattenhafte Geschöpf an ihn herantrat und mit einer Klauen bewehrten Hand seinen Hals umschlang. Vayk wurde in die Luft gehoben und der feste Griff schnürte ihm die Kehle zu. Schwindel überkam ihn, seine Arme und Beine wurden schwer und das Leben wich langsam aus seinem Körper. Während seine Sinne schwanden und der letzte Lebensfunken in ihm erlosch, nahm Vayk noch das grausame Lachen der Kreatur wahr, bevor er leblos in dessen stählernem Griff in sich zusammensackte.
Dann... wachte er auf. Vayk schreckte hoch und atmete tief ein; wahrscheinlich der wohltuendste Atemzug seines Lebens. Es dauerte eine Weile bis er begriff, wo er sich befand. Er saß aufrecht in seinem Bett, sah sich um und wirklich, er war in seinem Zimmer.
„Nur ein Traum!“, sagte er mit bebender Stimme zu sich selbst und lächelte.
„Zum Glück nur ein Traum.“
Vayk stand auf, öffnete die Balkontür und trat hinaus in den kühle Morgen. Unter ihm erstreckte sich die Stadt Daradun und er konnte sie in ihrer ganzen Pracht betrachten.
Er ließ den Blick über die Dächer schweifen, sah den Hafen, den Marktplatz und die Stadtmauer, die in diesen Tagen schwer befestigt war. Sein Blick fiel auf das Amphitheater, in dem früher Schaukämpfe und großartige Aufführungen dargeboten worden waren. Nun fand dieses einst so stolze Bauwerk jedoch nur noch als Übungsplatz für die Soldaten Verwendung. Im Dämmerlicht des Morgengrauens war der Stadt nicht anzusehen, welche Qualen und welches Leid sie und ihre Bewohner in den letzten acht Jahren durchgemacht hatten. Von oben aus betrachtet hätte man annehmen können, Daradun sei immer noch die selbe Stadt wie früher, doch der Schein trog, das wusste Vayk nur zu genau. Die Stadt war, genau wie die Menschen, die in ihr lebten, während des Bürgerkrieges immer mehr heruntergekommen und nur noch ein Schatten ihrer selbst.
Die Turmglocken schlugen fünf Uhr und Vayk sah, wie die Sonne ihre ersten Strahlen über den Horizont schickte und somit einen neuen Tag ankündigte. In der Ferne waren dicke, graue Wolken zu sehen, die sich langsam in seine Richtung bewegten; es würde wahrscheinlich bald Regen geben.
Ein leichter Wind kam auf und erst jetzt bemerkte er, dass sein ganzer Körper schweißgebadet war. Ein eisiger Schauer lief ihm den Rücken hinab und es überkam ihn der Drang, wieder in sein warmes Bett zurückzusteigen. Als er das Zimmer wieder betrat, wurde ihm plötzlich schwarz vor Augen und seine Knie gaben nach. Vayk suchte mit seinem rechten Arm Halt und fand diesen in Form der Vorhänge, die vor seinem Fenster angebracht worden waren. Zwar riss er sie allesamt herunter, konnte dadurch aber einen Sturz auf den harten Fliesenboden verhindern. Völlig entkräftet setzte er sich auf das Bett und wischte sich mit einem Tuch den Schweiß von seinem blassen Gesicht. Vielleicht, dachte er sich, während er versuchte einen klaren Kopf zu bekommen, vielleicht war es doch nicht nur ein Traum, sondern viel mehr...
Dieser Gedanke beunruhigte ihn und er dachte über seine vergangenen Träume nach. Vayk träumte selten, zumindest seltener als die meisten Menschen und das wusste er auch. Doch diese Tatsache an sich war es nicht, was ihn beunruhigte. Es waren vielmehr die Intensität und die Echtheit seine Traumes, die ihm Sorgen bereiteten. Noch nie zuvor hatte er erlebt, dass ein Traum so real erschienen war und er total entkräftet aufwachte. Diese Erfahrung war vollkommen neu für ihn und ihm schauderte es, als er daran dachte, wie das Schattenwesen ihn durch die Dunkelheit gejagt hatte. Auch wenn er wusste, dass er nun wach und somit sicher war, so konnte er ein gewisses Gefühl der Beklemmung dennoch nicht ablegen.
Er nahm die Glaskaraffe, die neben seinem Bett stand, und trank einen großen Schluck Wasser, während er über das Erlebte nachdachte.
Was war das nur für ein merkwürdiger Traum gewesen? Hatte es die Dunkelheit etwa auf ihn abgesehen? Und dieses Geschöpf; kein Mensch, kein Tier, etwas Derartiges hatte Vayk noch nie zu Gesicht bekommen.
Er versuchte, seine Gedanken zu ordnen: wahrscheinlich war der Traum einfach nur ein Traum gewesen, nichts weiter!
Jetzt mach dich nicht verrückt, nur weil du einmal schlecht geträumt hast, verdammt! Dieser komische Traum war kein schlechtes Omen und hat auch keine weitere Bedeutung, fertig!
Auch wenn er versuchte, sich selbst Mut zu machen, so ganz wollte es ihm nicht gelingen. Glücklicherweise klopfte es in diesem Moment an der Tür und die düsteren Gedanken verschwanden aus seinem Kopf.
„Vayk, bist du wach?“, fragte eine Stimme durch die schwere Eichentür.
Die Worte drangen nur sehr gedämpft durch das massive Holz und Vayk konnte die Stimme nicht direkt einem bekannten Gesicht zuordnen.
Wer mag das wohl sein?, fragte sich Vayk und er machte sich daran, dies herauszufinden.
„Ich komme sofort“, antwortete er also und streifte sich hastig sein Morgengewand über.
Als er die Tür öffnete, erkannte er im Licht einer Öllaterne den Mann, der ihn zu dieser frühen Stunde gestört hatte. Vor ihm stand Albrecht, der Hauptmann der Wache und einer seiner engsten Freunde. Wie immer trug er seine schwere Eisenrüstung, die er nur in sehr privaten Momenten ablegte und die selbst in dem flackernden Lichtschein der Öllampe glänzte; fast so, als hätte Albrecht seine Ausrüstung gerade erst frisch poliert. Er nahm seine Pflichten als Oberhaupt der Leibwache wirklich sehr ernst und Vayk wusste, dass es einen triftigen Grund geben musste, aus dem Albrecht ihn zu dieser Uhrzeit aufsuchte.
„Wieso störst du mich so früh am Morgen, wenn ich fragen darf?“, erkundigte sich Vayk bei seinem Gegenüber.
„Ich bitte um Verzeihung“, entschuldigte sich Albrecht und deutete eine Verbeugung an, „aber dein Bruder wünscht, dich umgehend zu sprechen.“
Vayk runzelte daraufhin leicht verwirrt die Stirn.
Sein Bruder Johann, der Prinz des Landes und Stadthalter Daraduns, war nicht dafür bekannt, Audienzen im Morgengrauen abzuhalten.
Trotzdem schien sein Anliegen wirklich wichtig zu sein, denn Albrechts Miene war angespannt und in seinem Blick konnte Vayk die Besorgnis des Mannes erkennen.
„Wenn Johann sich mit mir unterhalten möchte, wieso kommt er dann nicht selbst, sondern schickt dich?“, fragte Vayk ein wenig verwundert.
„Und vor allem, wieso möchte er mich zu so einer frühen Stunde sprechen? Kann das nicht bis zum Mittag warten?“
„Es wäre zu umständlich, das Anliegen deines Bruders hier zwischen Tür und Angel zu besprechen! Begleite mich einfach in den Thronsaal und Johann wird dir alles persönlich darlegen“, erwiderte Albrecht, ehe er rätselhaft hinzufügte:
„Ich kann dir nur sagen, dass wir keine Zeit verlieren sollten.“
„Nun gut“, gab Vayk als Antwort zurück.
„Es wird wohl das Beste sein, wenn wir meinen Bruder nicht warten lassen. Gib mir eine Minute, ich ziehe mich schnell um.“
Mit diesen Worten schloss Vayk die Tür, ging zu seinem Kleiderschrank und schlüpfte im Handumdrehen in eine angemessene Aufmachung. Während er die letzten Knöpfe seines reich bestickten Hemdes zuknöpfte, fragte er sich, was wohl der Anlass für das gewünschte Treffen war. Seines Wissens nach hatte sich die Lage im Bürgerkrieg in der letzten Zeit nicht verändert und ein Ende war auch nicht in Sicht. Aber was wusste er schon? Er saß nur tagein tagaus im Schloss und ließ es sich gut gehen. Manchmal ging er auch in die Stadt und mischte sich unter die einfachen Leute, aber das war es dann auch schon. Sein Leben war zwar leicht und es gab keine Gefahren, die ihn hier in den sicheren Schlossmauern hätten bedrohen können, aber es war auch sehr eintönig und mit der Zeit wurde es etwas langweilig. Von Zeit zu Zeit wünschte er sich, nicht als Sohn des Königs auf diese Welt gekommen zu sein, sondern als Sohn eines fahrenden Händlers oder von sonst Irgendjemandem, der die Welt bereist und jeden Tag neue Abenteuer erlebt. Doch diese Gedanken verschwanden dann auch meistens so schnell wieder wie sie gekommen waren, denn alles in allem führte Vayk ein sehr angenehmes Leben, um das ihn ein Großteil der Bevölkerung beneidete.
Als er so in seiner Kammer stand und letzte Handgriffe an seine Kleidung legte, wusste er selbst noch nicht, dass dieses beschauliche Leben bald ein jähes Ende finden würde.
So, fertig!, dachte er und betrachtete sich im Spiegel. Sieht doch eigentlich ganz schick aus!
Er zupfte seinen Hemdkragen zurecht, öffnete die Tür und trat auf den Gang hinaus, um gemeinsam mit Albrecht seinen Bruder Johann aufzusuchen. Die Gänge des Palastes waren lang und dunkel. Albrechts Öllampe war die einzige Lichtquelle, die den beiden Männern den Weg erhellte, doch auch sie warf nur einen schwachen Schein die langen Korridore hinab und Vayk wurde es ein wenig mulmig zu Mute. Die Erinnerungen an seinen Alptraum holten ihn ein, während er schweigend hinter Albrecht den steinernen Flur entlang ging; und Vayk erschauderte, als er die Schatten an den Wänden tanzen sah.
Nur ein Traum!, wiederholte er entschlossen in Gedanken und er versuchte, das Gedankenspiel in seinem Kopf ein für alle Mal zu beenden. Er sollte sich viel mehr auf das Hier und Jetzt konzentrieren, als irgendwelchen nächtlichen Hirngespinsten nachzujagen.
Vayk wusste, dass er aus Albrecht keine weiteren Informationen bezüglich des Treffens mit seinem Bruder heraus bekommen würde, also blieb ihm nichts anderes übrig, als dem Soldaten bis zum Thronsaal zu folgen. Natürlich kannte Vayk sich in dem Schloss so gut aus wie in seiner Westentasche und er wusste somit auch, dass es nicht lange dauern würde, bis sie an ihrem Ziel angekommen sein würden. Dennoch wäre es ihm lieber gewesen, wenn er nun bereits dort gewesen wäre.
Das gesamte Schloss schien noch in tiefem Schlaf zu liegen, denn die Schritte der beiden Männer waren die einzigen Geräusche, die Vayk vernehmen konnte. Anscheinend waren die einzigen Bewohner des Schlosses, die um diese Zeit schon auf den Beinen waren, Albrecht, Johann und Vayk, aber schon bald würde der Palast aus seinem Schlummer erwachen und es würde auf den Gängen nur so von Wachpersonal und Bediensteten wimmeln, deren einzige Aufgabe es war, den beiden Prinzen das Leben so angenehm wie möglich zu gestalten.
Klick- klack, klick-klack gaben Albrechts eisenbesetzte Stiefel ihren monotonen Klang von sich, während Vayks lederne Schuhe kaum Geräusche erzeugten. Er war ganz froh darüber, dass die Rüstung seines Begleiters solchen Lärm machte, denn alles war besser, als in vollkommener Stille durch die dunklen Gänge des Palastes zu schleichen. Nach wenigen Minuten waren sie in der Vorhalle des Schlosses angekommen, die von einem großen Kerzenleuchter erhellt wurde; offenbar war noch jemand außer ihnen auf den Beinen und hatte sich die Mühe gemacht, die Kerzen zu entzünden. Während sie die Halle durchquerten und unter dem Kronleuchter entlang gingen, fiel Vayk allerdings auf, dass die Kerzen bereits weit heruntergebrannt waren; ein paar wenige waren sogar schon erloschen. Es war anscheinend doch kein anderer Schlossbewohner wach, sondern die Kerzen brannten schon seit dem Vorabend. Erst jetzt wurde Vayk klar, dass Johann ganz bewusst zu dieser Zeit mit ihm sprechen wollte, bevor die anderen Bewohner des Schlosses erwachten.
Wahrscheinlich möchte er ausschließen, dass irgendjemand mitbekommt, was er mit mir bereden will, überlegte er. Muss ja wirklich wichtig sein, wenn er so einen Aufwand macht.
Nun war Vayk tatsächlich neugierig geworden und er wollte wissen, was um alles in der Welt sein Bruder mit ihm besprechen wollte. Während er nachgedacht hatte, war er immer mehr hinter Albrecht zurückgefallen, der schon an der Tür zum Thronsaal stand und Vayk beschleunigte seinen Schritt, um zu ihm aufzuschließen. Bevor er allerdings bei ihm angekommen war, fiel Vayk ein Gemälde ins Auge, das seine Aufmerksamkeit auf sich zog. Er hielt inne und betrachtete das alte Bild, von dem er angenommen hatte, dass es vor langer Zeit zerstört worden war. Allem Anschein nach hatte er sich geirrt und über diesen Umstand war er mehr als überrascht. Zwar waren die Farben verblasst und das Gold des Rahmens begann bereits abzublättern, aber es bestand kein Zweifel daran, dass es sich um dasselbe Bild handelte, welches viele, viele Jahre lang an diesem Platz gehangen hatte, ehe der Streit zwischen Johann und Elwin eskaliert und Krieg zwischen den beiden Brüdern ausgebrochen war.
Das Bild zeigte König Adelar, wie er lachend auf dem Thron in Ashtaloeh saß, und drei Jungen, die alle nicht älter als 10 Jahre waren. Natürlich handelte es sich bei diesen Kindern um die Söhne des Königs, von denen der kleinste zwischen den Beinen Adelars stand, während die beiden älteren jeweils auf einem Bein des Herrschers von Sargonei Platz genommen hatten. Zwar war das Gemälde schon über 20 Jahre alt und sollte vorrangig Adelar und seinen Söhne Elwin, Johann und Vayk darstellen, aber bei genauerer Betrachtung des Bildes konnte man erkennen, welche Absichten der König schon damals für die Zukunft seiner Söhne gehabt hatte. Adelar hatte nämlich schon sehr früh danach gestrebt, nicht nur einen seiner Söhne zum Herrscher von Sargonei zu machen, sondern die Spitze des Reiches sollte zweigeteilt werden, sodass die Zwillinge Elwin und Johann gleichermaßen Könige werden sollten. Deshalb saßen sie auf dem Bild auch auf jeweils einem Bein des damaligen Herrschers, während Vayk nur zwischen diesen stand. Er, als jüngster Sohn, hatte sowieso keinen Anspruch auf die Krone und das hatte Adelar ihm auch sein ganzes Leben lang so vermittelt. Vayk war dieser Umstand sehr recht gewesen, denn er wollte nie ein Herrscher oder gar der König eines ganzen Reiches sein und er ließ seinen beiden Brüdern in dieser Hinsicht gerne den Vortritt. Ihm genügte ein Leben ohne viel Mühe und er strebte nicht nach oben, schon gar nicht nach der Königskrone. So hatte Vayk schon zu Kindertagen viel Freizeit gehabt, während Johann und Elwin in der Kunst der Diplomatie, der Rechtssprechung und in allen anderen Fähigkeiten unterrichtet worden waren, die einen guten Herrscher auszeichneten. Schon früh hatte der König Vayks großen Brüdern ein hohes Maß an Verantwortung übertragen und sie als Stadthalter eingesetzt; Johann regierte von da an die Hafenstadt Daradun, wohingegen Elwin über die Stadt in den Bergen, Kelodor herrschte. Auf diese Weise hatte Adelar die Fertigkeiten seiner Söhne testen und sie in die Praxis als zukünftige Königs einführen wollen.
Knapp fünf Jahre lang war alles gut gegangen und die Zwillingsbrüder hatten über ihre jeweilige Stadt geherrscht, während Adelar als König im Hintergrund die Geschicke des Reiches gelenkt hatte. Es hatte tatsächlich so ausgesehen, als würde das Vorhaben des Königs aufgehen.
Aber obwohl Adelar wirklich alles daran gesetzt hatte, die Zwillinge so gut wie möglich auf ihre Zukunft als gemeinsame Herrscher Sargoneis vorzubereiten, war sein Plan gescheitert. Die Jahre der Königsherrschaft waren lang und hart gewesen und auch an einem gestandenen Mann wie Adelar nicht spurlos vorübergegangen. Mit fortschreitendem Alter war ihm klar geworden, was er in all der Zeit seinem Körper aufgebürdet hatte und seine rastlosen Jugendjahre hatten ihren Tribut eingefordert. Adelar war krank geworden, sehr krank und sein Gesundheitszustand hatte sich mit der Zeit drastisch verschlechtert. Alle Bemühungen der Ärzte und Heiler waren ohne Erfolg geblieben und so war Adelar, der Begründer und König von Sargonei im Alter von 56 Jahren gestorben.
Normalerweise hätte ein Herrscher nach seinem Ableben in einem Testament festgehalten, wer ihm als König nachfolgen sollte. Adelar jedoch hatte bewusst kein Testament aufgesetzt, da er darauf vertraut hatte, dass er seine beiden Zwillingssöhne in angemessener Art und Weise in allen herrscherlichen Dingen unterwiesen hatte und sie nach seinem Tod gemeinsam über das Königreich herrschen würden. Doch in dieser Hinsicht hatte sich der verstorbene König Sargoneis geirrt und dieser Irrtum hatte das ganze Land in Elend und Verderbnis gestürzt. Denn anders als Adelar es geplant hatte, hatte sich keiner der beiden Thronfolger mit einer mickrigen Teilherrschaft über das Reich zufrieden gegeben, sondern jeder von ihnen wollte die eigene Machtstellung erweitern und strebte nach der Alleinherrschaft. So kam es, wie es kommen musste, Vayks ältere Brüder hatten sich zerstritten und auch Vayks Versuche, die Einigkeit zwischen ihnen wiederherzustellen, waren gescheitert. Ein gemeinsames Herrschaftsmodell, in dem - wie von Adelar vorgesehen - Johann und Elwin gemeinsam in der Königsburg Ashtaloeh regierten, war in weite Ferne gerückt. Stattdessen hatten sich die Fronten verhärtet und eines Tages war es an Vayk gewesen, sich für eine Seite zu entscheiden. Diese Wahl war ihm damals sehr schwer gefallen, da eine Entscheidung für den einen Bruder gleichzeitig eine Entscheidung gegen den anderen war und Vayk hatten keinen seiner Brüder verlieren wollen. Aber ihm war nichts Anderes übrig geblieben und so hatte sich Vayk nach langer Überlegung dazu entschieden, bei Johann in Daradun zu leben. Dadurch hatte sich Elwin widerum vor den Kopf gestoßen gefühlt und der Streit hatte sich noch mehr ausgeweitet.
Vor ungefähr acht Jahren war dann der bisher dunkelste Tag in der Geschichte des Königreichs Sargonei gekommen. Eines Morgens hatte eine Botschaft von Elwin Johann in Daradun erreicht, in welcher Elwin seinem Bruder den Krieg erklärte. Lange genug sei der Thron verwaist und die Zukunft des Reiches ungewiss gewesen, so stand es in dem Schreiben. Elwin hatte eine Entscheidung mit aller Macht erzwingen wollen und Johann hatte nicht klein beigegeben, sondern die Kriegserklärung akzeptiert. Beide Männer waren davon überzeugt gewesen, in einer entscheidenden Schlacht einen glorreichen Sieg und somit die Alleinherrschaft erringen zu können und nur wenige Wochen später waren die Heere der beiden Prinzen aufeinander getroffen. Aber statt eines deutlichen Sieges zugunsten einer Seite, hatten beide Parteien herbe Verluste einstecken müssen und es konnte kein Sieger ermittelt werden.
Seither waren acht Jahre vergangen und immer noch herrschte in dem einst so idyllischen Inselkönigreich Sargonei Bürgerkrieg. In unregelmäßigen Abständen zogen die Heere der beiden Thronfolger gegeneinander in die Schlacht, ohne dass ein Gewinner aus den Gefechten hervorging. Die Kriegssituation belastete besonders das einfache Volk, das tagtäglich um das eigene Überleben kämpfen musste. Die gemeinen Leute waren es, die für die Prinzen kämpften und starben und nicht nur die Soldaten an der Front lernten die Schrecken des Krieges kennen, sondern der Bürgerkrieg streckte seine kalten Finger bis in die Wohnzimmer aller Häuser des Königreiches aus.
Bei der Betrachtung des Gemäldes überkam Vayk ein seltsames Gefühl. Er wurde von Nostalgie gepackt und erinnerte sich an die schöne Zeit, die er, seine beiden Brüder und ihr Vater damals gehabt hatten. Fernab von allen Sorgen und Pflichten hatten sie in den Tag hinein gelebt, während Adelar sich um die Belange des Reiches gekümmert hatte. Verglich man die auf dem Bild dargestellte Einigkeit zwischen den Königssöhnen mit den herrschen Umständen, so konnte man nur den Kopf schütteln. Nach Adelars Tod war von dem einstigen Zusammenhalt nichts mehr zu spüren gewesen und anstatt das Reich gemeinsam zu lenken, hatten es die Prinzen an den Rand des Untergangs gebracht.
Wie konnte es nur so weit kommen?, fragte sich Vayk bedrückt.
Wie konnten wir nur so blind sein und zulassen, dass all das, wofür Vater sein ganzes Leben lang gekämpft hat, in kürzester Zeit niedergerissen wird?
Ein Schatten legte sich auf Vayks Gemüt und er wandte sich von dem Bild ab, als er sich plötzlich wieder daran erinnerte, wieso er sich das Gemälde überhaupt angesehen hatte.
Genau! Wieso hängt es hier?
Gestern noch war Vayk durch die Vorhalle gegangen und er hätte schwören können, dass es noch nicht an dieser Stelle gehangen hatte.
Merkwürdig... Aus welchem Grund sollte Johann ausgerechnet dieses Bild wieder aufhängen lassen?
Das in die Jahre gekommene Porträt war kurz nach Beginn des Bürgerkrieges abgehangen worden und seitdem hatte Vayk es nicht mehr gesehen. Wieso wurde gerade jetzt das Gemälde wieder hervorgeholt und in der Mitte der Halle platziert, wo es von Jedermann gesehen werden konnte?
Es musste eine Bedeutung haben, so viel stand fest und in Vayk keimte eine leise, hoffnungsvolle Ahnung auf, der er nun auf den Grund gehen wollte. Also riss er sich endgültig von dem Bildnis los, ging zu Albrecht hinüber, den er sowieso schon viel zu lange am Eingang zum Thronsaal hatte warten lassen, und gemeinsam gingen sie hinein, um sich dort mit Johann zu treffen.
3. Die Audienz- Johanns geheimer Plan
Der Saal, dessen Mittelpunkt der prunkvolle Thron bildete, war nur in spärliches Licht getaucht, sodass ein Großteil des Raumes im Dunkeln verborgen blieb. Natürlich wusste Vayk genau, wie der Thronsaal eingerichtet war, denn im Gegensatz zu den meisten Bediensteten des Schlosses konnte er hier frei ein und aus gehen. Die gesamte Halle war mit den schönsten Vorhängen, Gemälden und sonstigen Kunstwerken geschmückt und sollte den Glanz und die Würde der Herrscherfamilie repräsentieren. Wahrscheinlich war der Thronsaal der einzige Raum Daraduns, der in den letzten Jahren seine Pracht trotz des Krieges nicht verloren hatte, während der Rest der Stadt langsam verkommen war. So mancher Bürger, der das Glück hatte, diesen Saal einmal betreten zu dürfen, kam aus dem Staunen über die dargestellten Reichtümer nicht mehr heraus und auch Vayk musste zugeben, dass diese Hallen wirklich von außergewöhnlicher Schönheit waren.
Trotzdem hielt er sich nicht gerne hier auf, denn jedes Mal, wenn er diesen Ort betrat, kam es ihm so vor, als würde er in eine andere Welt eintauchen, eine Welt, in der es nur um Eines ging: um Macht. Vayk konnte sich dieser Welt nicht entziehen, denn er war von Geburt an untrennbar mit ihr verbunden, doch er versuchte, ihr so gut es eben ging aus dem Weg zu gehen. Aus diesem Grund verbrachte er seine Tage viel lieber in anderen Teilen des Schlosses, während sein Bruder auf dem Thron saß und über Daradun und dessen Bewohner regierte. Vayk kam nur hierher, wenn es sich wirklich nicht vermeiden ließ, beispielsweise wenn Johann seinen Rat einholen wollte oder wenn es Neuigkeiten bezüglich des Bürgerkrieges gab. In letzter Zeit waren diese Ereignisse allerdings rar gesät, sodass Vayk schon lange nicht mehr im Thronsaal gewesen war.
Obwohl nur wenige Kerzen brannten und unzureichend Licht spendeten, konnten sich Vayk und Albrecht einigermaßen gut zurechtfinden, da durch die vielen Fenster des Saals das Dämmerlicht des Morgengrauens hereinfiel. Festen Schrittes ging Vayk durch den Raum, geradewegs auf den Thron zu, auf dem er seinen Bruder vermutete. Je näher er aber dem Sitz des Prinzen kam, desto mehr wurde ihm klar, dass dort niemand saß. Er blieb stehen und sah sich verwirrt in dem großen Raum um. Wie Vayk feststellte, hatte auch Albrecht bemerkt, dass sich Johann nicht auf dem Thron befand, denn der Hauptmann der Wache ließ ebenfalls seinen Blick suchend durch den Thronsaal schweifen. Schon nach wenigen Sekunden fiel den beiden Männern ein Schatten auf, der sich als dunkle Silhouette vor einem der großen Fenster abzeichnete.
Genug mit dem Versteckspiel!, befand Vayk und näherte sich zusammen mit Albrecht seinem Bruder.
Erst lässt mein werter Bruder mich zu dieser unmenschlichen Stunde zu sich rufen und dann spielt er mit mir Katz und Maus? Was ist nur los mit ihm?, dachte er stirnrunzelnd und er wusste selbst nicht, ob er nun sauer oder besorgt sein sollte.
Mit jedem Schritt, den sie sich der Gestalt näherten, hoben sich ihre Konturen ein bisschen mehr von den dunklen Fensterscheiben hinter ihr ab. Johann hatte den beiden Männern den Rücken zugewandt und sah hinunter auf die Stadt. Um seine Schultern hatte er seinen dicken Herrschermantel geschlungen, der bis auf den Boden hinabreichte und das Wappen Daraduns trug. Ob es von dem Gewicht des schweren Mantels kam, wusste Vayk nur schwer zu sagen, aber ihm fiel auf, dass die Schultern seines Bruder tiefer hingen als normalerweise. Ungewöhnlich war auch, dass Johann zwar seinen Mantel, nicht aber seine Krone trug und das machte Vayk stutzig.
Bevor er etwas sagen konnte, nahm Albrecht Haltung an und sprach im Soldatenton:
„Prinz Johann, wie gewünscht habe ich Vayk hierher geleitet!“
Langsam drehte sich Johann zu den beiden Männern um und sein langer Umhang wischte dabei über den kalten Boden. Vayk fuhr zusammen, als er die Gesichtszüge seines Bruders sah, doch er ließ sich seine Bestürzung nicht anmerken. Johann, der nur ein bisschen älter als er selbst war, bot einen desolaten Anblick. Große dunkle Ringe hingen unter den Augen und sein Gesicht war blass und eingefallen. Johanns Stirn lag in tiefen Falten und in seinem schwarzen Haar waren erste graue Strähnen zu erkennen. Es sah so aus, als hätte der Prinz von Daradun schon seit Wochen nicht mehr richtig geschlafen, denn seine blauen Augen, die normalerweise vor Tatendrang und Lebenslust nur so strahlten, waren matt und glanzlos.
Das Gewicht des Mantels drückte schwer auf seinen Schultern und man hätte meinen können, er würde jeden Moment unter der Last des schweren Stoff zusammenbrechen.
Nichtsdestotrotz rang sich Johann ein Lächeln ab, mit dem er seinen Bruder und den Wachhauptmann begrüßte. Er sah Vayk einen Augenblick lang an, bevor er sich Albrecht zuwandte und an diesen gerichtet knapp sagte:
„Ich danke dir, Albrecht, mein Freund.“
Die Stimme des Herrschers von Daradun passte zu seinem momentanen Erscheinungsbild. Sie war kraftlos, brüchig und Hoffnungslosigkeit schwang in ihr mit; Johann war nur noch ein Schatten seiner selbst.
Als Antwort nickte Albrecht wortlos.
Nun war Vayk an der Reihe und er wollte endlich wissen, was Johanns Begehr war.
„Also Bruder, da bin ich!“, platzte es aus ihm heraus. „Was gibt es denn so Dringendes?“
Der Tonfall seiner Stimme war schärfer gewesen als er es beabsichtigt hatte, also fügte er in sanfterer Art und Weise hinzu:
„Ich hoffe doch, dir geht es gut... ?“
„Mach dir keine Sorgen um mich“, antwortete sein Bruder milde. „Das Wohl eines einzelnen Mannes ist nichts im Vergleich zu dem Wohl eines ganzen Landes. Und genau darum geht es!“
Vayk schwieg. Was auch immer sein Bruder von ihm wollte, er würde es sicherlich jetzt erzählen.
„Du fragst dich bestimmt“, setzte Johann an, „wieso ich dich zu mir rufen ließ und das auch noch zu so früher Stunde. Nun ich werde es dir erklären. Schon seit geraumer Zeit hadere ich immer mehr mit meinen Entscheidungen, die ich vor Jahren getroffen habe und die uns letzten Endes dahin gebracht haben, wo wir jetzt sind.“
„Du meinst den Bürgerkrieg, nehme ich an“, schlussfolgerte Vayk.
„Genau!“, bestätigte Johann mit einem schwachen Nicken.
„Wie du und Albrecht bestimmt schon bemerkt habt, habe ich schon bessere Tage gesehen, genauer gesagt: Ich bin am Ende. Seit Wochen kriege ich nachts kein Auge mehr zu und tagsüber fühle ich mich zerschlagen und erschöpft. Die ganze Zeit will mir die Frage nicht mehr aus dem Kopf gehen, ob es die Sache überhaupt wert ist und ich bin mittlerweile zu der Überzeugung gelangt, dass sie es nicht ist! So wie es jetzt ist, kann es nicht weitergehen, sonst wird Sargonei eines Tages untergehen und ich befürchte, dieser Tag ist nicht mehr fern. Die Zeit des Wartens ist vorbei, wir müssen jetzt handeln!“
Während seiner Rede hatte die Stimme des Prinzen immer mehr an Festigkeit gewonnen und sowohl Vayk als auch Albrecht schwiegen, weil sie Johann auf keinen Fall unterbrechen wollten.
Ruckartig drehte sich Vayks Bruder um, wobei sein langer Mantel einen großen Halbkreis beschrieb und er blickte auf die düstere Stadt hinunter. Einen Moment lang stand er schweigend da, ehe er fortfuhr:
„In unseren Adern fließt das Blut König Adelars! Unser Vater hat sein Leben für Sargonei und seine Bewohner eingesetzt und sein eigenes Wohl immer hinten angestellt. Es darf nicht sein, dass die Torheit seiner Söhne das gesamte Königreich zugrunde richtet und somit sein Lebenswerk zerstört. Das haben weder Vater, noch das Volk, das ihm all die Zeit lang treu ergeben war, verdient! Nun ist es an uns, das Wohl alter Zeiten wiederherzustellen; das sind wir unserem Vater und unseren Untertanen schuldig!“
Mit den letzten Worten hatte sich Johann wieder zu Vayk und Albrecht umgewandt und alle Erschöpfung schien von ihm abgefallen zu sein. Stattdessen klang seine Stimme viel kraftvoller als vorher und Vayk meinte, auch den alten Glanz in Johanns Augen wiederentdeckt zu haben. Er fixierte Vayk mit seinem Blick und Vayk wusste, dass dieses Gespräch über das Schicksal Sargoneis entscheiden würde.
„Ich habe schon vor etwas mehr als einer Woche meinen Plan mit Albrecht gesprochen“, offenbarte Johann.
„Und ich muss dir danken!“, fügte er an den Hauptmann der Wache gerichtet hinzu.
„Du hast mir deine ehrliche Meinung gesagt und auch einige Bedenken geäußert. Diese wichtige Entscheidung wollte und konnte ich nicht alleine treffen und ich bin dir für deine Hilfe sehr dankbar, mein Freund!“
Was denn für eine wichtige Entscheidung?, fragte sich Vayk fieberhaft und er spürte nun, dass nicht nur Johann ihn aus seinen tiefblauen Augen heraus anschaute, sondern dass auch der feste Blick Albrechts auf ihm ruhte.
Er konnte nicht anders, er musste die offensichtliche Frage stellen und den Grund erfahren, wieso Johann so dringlich mit ihm sprechen wollte.
„Bei welcher Entscheidung hat dir Albrecht geholfen?“, fragte Vayk also vorsichtig.
„Der Krieg, den Elwin und ich seit acht Jahren führen, muss enden!“, befahl Johann mit einer Stimme, die keinen Widerstand duldete.
Stille trat ein. Keiner der Männer rührte sich oder sprach ein Wort. Die Blicke Johanns und Albrechts waren immer noch auf Vayk gerichtet, der zöger-lich antwortete:
„Das... ist gut!“
Er wusste nicht, was er sonst sagen sollte, also sprach Vayk einfach das aus, was ihm gerade durch den Kopf ging.
„Ich war von Anfang an gegen diesen Streit, das weißt du und auch ich wünsche mir ein Ende des Bürgerkrieges herbei! Du hast deine Entscheidung, wie du selbst sagt, schon getroffen und ich bin selbstverständlich bereit dich in jeder Hinsicht zu unterstützen, aber ich weiß nicht so genau, was du jetzt von mir willst.“
Ein seltsames Gefühl machte sich in Vayk breit, als ihm langsam klar wurde, dass es einen Haken an der Sache geben musste und ihm dämmerte es, dass dieser Haken irgendetwas mit ihm zu tun hatte. Trotzdem sagte er nichts weiter, sondern ließ seinen Bruder zu Wort kommen.
„Nach acht Jahren Krieg“, begann Johann, „und unzähligen Verlusten auf beiden Seiten kann ich, wie du dir vorstellen kannst, nicht einfach nach Kelodor reisen und den Krieg als beendet erklären. Selbst wenn ich in die Stadt gelangen würde, geschweige denn mit Elwin sprechen könnte, dann würde er mir nicht zuhören. Er war schon immer der dickköpfigere von uns Beiden und wenn ich schon so viele Jahre gebraucht habe, um meine eigenen Fehler einzusehen, dann will ich mir gar nicht erst vorstellen, was in Elwin vorgeht. Mit Sicherheit ist er immer noch felsenfest davon überzeugt, den Krieg für sich entscheiden zu können. Nein! Ich selbst kann nicht zu meinem Bruder aufbrechen! Außerdem werde ich hier in Daradun gebraucht, ich muss in diesen schweren Zeiten meinen Untertanen beistehen, damit sie nicht vollends die Hoffnung verlieren.“
Johann war von jeher ein Meister der großen Reden gewesen, aber wenn er Vayk schon in aller Früh zu sich rufen ließ, dann sollte er auch endlich mit der Sprache herausrücken.
„Genug drum herum geredet!“, befand Vayk stirnrunzelnd. „Was hast du vor?“
„Nach reiflicher Überlegung“, die Stimme des Prinzen klang jetzt sehr eindringlich, fast schon verschwörerisch, „bin ich zu dem Schluss gekommen, dass es nur einen Weg gibt, wie dieser Krieg beendet werden kann.“
Eine kurze Pause folgte, in der Johann seinem Bruder fest in die Augen schaute.
Dieser Weg bist du!“, offenbarte er ihm dann.
„Ich?!?“, fragte Vayk erstaunt. „Wie soll ich denn den Bürgerkrieg beenden?“
„Das wirst du jetzt erfahren, also hör mir gut zu!“, gab Johann zurück.
„Wie gesagt kann ich die Stadt im Moment nicht verlassen, weil ich hier gebraucht werde. Du allerdings trägst keine Verantwortung den Bürgern gegenüber und bist ungebunden. Der Plan sieht vor, dass du dich nach Kelodor zu Elwin begibst und ihn davon überzeugst, sich mit mir zu treffen. Sollte er zustimmen, was ich stark hoffe, so werden wir über einen Waffenstillstand verhandeln und das lange überfällige Ende des Krieges besiegeln.“
Vayk war sprachlos. Völlig perplex stand er im Thronsaal des Palastes und versuchte zu begreifen, was sein Bruder da gerade von ihm verlangte.
War das wirklich sein Ernst? Vayk sollte über die gesamte Insel bis nach Kelodor reisen, dort mit seinem Bruder sprechen und ihn davon überzeugen, den Krieg plötzlich nach acht Jahren zu beenden? Wie konnte Johann nur annehmen, dass auch nur die geringste Chance auf Erfolg bei diesem wahnwitzigen Plan bestünden?
Nur langsam konnte Vayk wieder klar denken und nun schossen ihm dutzende Fragen durch den Schädel.
„Mo-moment mal!“, stammelte er verunsichert. „Hast du dir das wirklich gut überlegt? Im Gegensatz zu euch beiden hat Vater mich nicht in Diplomatie unterrichtet, ich habe davon nicht den Hauch einer Ahnung! Wieso sollte ausgerechnet ich Elwin zu Friedensverhandlungen bewegen können?“
Mit einem sanften Lächeln antwortete Johann:
„Ganz einfach! Weil du du bist! Elwin und ich sind von Kindesbeinen an Rivalen und wir standen schon immer in ständiger Konkurrenz miteinander. Wir beide sind von Natur aus hitzköpfig und stur. Du hingegen bist einer der besonnensten Menschen, die ich kenne; du hättest es niemals soweit kommen lassen, dass ein Krieg ausbricht. Zwar hast du dich vor Jahren für mich und somit gegen Elwin entschieden, aber letzten Endes bin ich sein Kontrahent und nicht du! Wir alle sind Söhne Adelars und wir hatten es oftmals nicht leicht miteinander, aber dennoch bin ich davon überzeugt, dass du der Einzige im gesamten Königreich bist, dem Elwin Gehör schenken wird. Außerdem wird er die Schwere der Lage erkennen, wenn er sieht, dass du die Strapazen einer Reise nach Kelodor auf dich nimmst, um ihm eine Botschaft zu überbringen.“
Zwar war Vayk immer noch nicht ganz von dem Vorhaben seines Bruders überzeugt, aber den höheren Sinn dahinter konnte er erkennen. Der Krieg musste beendet werden, da konnte es keine zwei Meinungen geben! In Vayk begann still und heimlich die Flamme der Abenteuerlust zu lodern und sie ergriff immer mehr Besitz von ihm. Schon lange wollte er wieder einmal die Stadt verlassen und etwas erleben. Was kam da gelegener als mit einer Delegation Soldaten auf den Straßen des Königreichs unterwegs zu sein? Die Möglichkeit, dass er von Banditen überfallen oder von irgendwelchen bösartigen Kreaturen angegriffen werden würde, bestand schließlich nicht, wenn ein Zug Bewaffneter ihn begleitete.
In Gedanken malte sich Vayk schon aus, wie er in Kelodor ankommen würde, umgehend mit Elwin sprechen könnte und dieser auf der Stelle und ohne irgendwelche Widerworte seinem Anliegen Folge leisten würde. Kaum zwei Wochen würden vergehen und schon wäre der Frieden im Königreich wiederhergestellt und Vayk hätte entscheidenden Anteil daran gehabt.
„Also gut, ich mache es!“, sagte Vayk voller Eifer.
„Wer wird mich begleiten? Zwei Dutzend Soldaten müssten es mindestens sein, um sicher nach Kelodor zu gelangen. Du weißt ja was man sich erzählt, die Banditen machen die Wildnis unsicher und alle Arten von Untieren streifen durch die Wälder.“
Am liebsten hätte Vayk die dritte Garde als Geleitschutz mitgenommen. Er wusste, dass Falfarians Männer gut ausgebildet waren und sie sich außerhalb der Stadt bestens auskannten.
Doch Johann zögerte mit seiner Antwort und Vayk wusste sofort, dass dieses Zögern nichts Gutes bedeuten konnte.
„Leider“, begann Vayks Bruder langsam seine Erklärung, „sieht es so aus, als müsstest du deine Reise alleine antreten...“
Er musste sich verhört haben. Hatte Johann gerade wirklich gesagt, dass Vayk ALLEINE nach Kelodor aufbrechen sollte?
„Wie bitte? Alleine?“, Vayk war völlig fassungslos. „Ich soll ohne jegliche Begleitung durch ganz Sargonei spazieren? An Banditen, Ungeheuern und was weiß ich nicht noch alles für Gefahren vorbei? Ist das dein Ernst, Bruder?“
Dass Johann überhaupt auf die Idee kam, ihn zu so einem Selbstmordkommando überzeugen zu wollen, verärgerte Vayk maßlos.
„Es ist mein Ernst!“, erwiderte Johann knapp. „Gäbe es einen anderen Weg, dann würde ich das nicht von dir verlangen, aber es geht nicht anders!“
„Was ist denn mit den ganzen Soldaten, wenn ich fragen darf? Es lassen sich doch mit Sicherheit einige finden, die mich begleiten können“, warf Vayk ein, doch Johann fegte diesen Einwand bestimmt beiseite.
„Nein! Die meisten Männer sind erst vor kurzem heimgekehrt. Die Kämpfe auf dem Plateau sind dieses Mal härter als gewöhnlich ausgefallen. Diejenigen, die es überhaupt bis hierher geschafft haben, müssen sich erst einmal erholen und ihre Wunden versorgen lassen.“
„Dann warten wir eben, bis die Soldaten wieder einsatzbereit sind!“, schlug Vayk vor. „In ein bis zwei Wochen sollte zumindest ein Dutzend von ihnen wieder soweit genesen sein, dass sie mich begleiten können. Auf die paar Tage mehr oder weniger kommt es doch nun wirklich nicht mehr an. Der Krieg dauert mittlerweile schon über acht Jahre an, was machen da ein, zwei Wochen für einen Unterschied?“
Der Gedanke, alleine eine mehrere Tage dauernde Reise nach Kelodor zu unternehmen und dabei den Gefahren der Wildnis schutzlos ausgeliefert zu sein, schickte Vayk einen eisigen Schauer über den Rücken. Unter keinen Umständen würde er diese Reise alleine antreten, da konnte Johann sagen was er wollte.
„Es macht einen großen Unterschied!“, entgegnete Johann. „Hast du dich nicht gefragt, wieso ich nach acht Jahren ausgerechnet jetzt den Krieg beenden will und das so schnell wie möglich?“
„Ähmm...“, machte Vayk bloß. Ehrlich gesagt hatte er sich diese Frage nicht gestellt und wusste keine passende Antwort darauf. Also schaute er Johann nur fragend an und wartete auf dessen Erklärung.
„Wäre es nur der Krieg, der mir Sorgen macht, dann könnten wir selbstverständlich noch warten, aber diese Zeit haben wir nicht!“
Vayk legte den Kopf schief, der fragende Audruck in seinem Gesicht verstärkte sich.
„Was verschweigst du mir, Johann?“, wollte er wissen.
„Es ist etwas vorgefallen, was unseren Plan, den Bürgerkrieg zu beenden, unaufschiebbar macht“, sprach der Herrscher Daraduns.
Johann machte eine kurze Pause, atmete tief ein und verriet Vayk, wieso es so wichtig war, den Krieg ausgerechnet jetzt zu beenden.
„Wie du weißt, ist im Verlauf des Bürgerkriegs der Schiffsverkehr im Hafen fast vollständig zum Erliegen gekommen“, erklärte er.
„Umso erstaunter waren wir, als vor Kurzem ein kleines Schiff in den Hafen einlief. Wie sich herausstellte, war die Mannschaft in einen Sturm geraten und wäre fast mitsamt dem Schiff gesunken. Nur mit Mühe konnten sie sich in den Hafen von Daradun retten und genau damit fing das ganze Übel an.“
Vayk war verwirrt. Wie konnte irgendein Schiff mit dem Ende des Bürgerkriegs in Verbindung stehen?
„Was um alles in der Welt hat das mit dem Krieg zu tun?“, erkundige er sich folgerichtig.
„Warte, du wirst es gleich hören!“,kam es als Antwort zurück.
„Wir versorgten die Besatzung des Schiffes so gut wir konnten und während sich die Männer und Frauen in einem Gasthaus von den Anstrengungen auf See erholten, lag ihr Schiff im Hafen vor Anker. Wie es sich gehört, habe ich mich mit ihrem Kapitän unterhalten, um herauszufinden, wo sie herkommen und was sie geladen haben. Schon nach wenigen Worten mit dem Kapitän oder besser gesagt mit der Kapitänin wurde mir klar, dass mit diesen komischen Vögeln irgendetwas nicht stimmte. Sie konnte mir nicht einmal den Heimathafen ihres Schiffes nennen, geschweige denn, was sie genau an Bord hatten. Irgendwann hat sie mir dann erzählt, dass sie Freibeuter seien und sofort wieder in See stechen würden, sobald ihr Schiff repariert worden sei.“
„Schön und gut“, ergriff Vayk das Wort. „Aber das erklärt immer noch nicht, inwiefern diese Sache mit dem Bürgerkrieg zusammenhängt.“
„Dazu komme ich jetzt“, erläuterte Johann. „Denn wenige Tage später wurden die ersten Bewohnder Daraduns krank und in kürzester Zeit breitete sich eine verheerende Seuche in der Stadt aus.“
„Was denn für eine Seuche?“, fragte Vayk verwundert. Er hatte in der letzten Zeit kein Wort von einer Seuche gehört, die die Stadt heimsuchte.
„Wir nennen sie: Die blaue Pest. Zuerst treten die Adern auf den Handflächen der Betroffenen stärker hervor, dann die auf den Armen und Beinen und schließlich die im Gesicht. Mit der Zeit ist der ganze Körper von blauen Linien überzogen, ein schrecklicher Anblick kann ich dir sagen!“, sprach Johann mitgenommen.
„Du hast schon Menschen gesehen, die sich damit angesteckt haben?“, brach es aus Vayk heraus und er wich unwillkürlich einen Schritt zurück.
Johann beachtete die erschrockene Geste seines Bruders nicht und antwortete trocken: „Ja. Angefangen hat es mit zwei Männern im Hafen, doch die Krankheit breitete sich mit enormer Geschwindigkeit innerhalb des Hafenviertels immer mehr aus.“
„Konntest du mit den beiden Männern sprechen? Vielleicht sind sie mit irgendetwas Ungewöhnlichem in Kontakt gekommen?“, gab Vayk zu bedenken.
„Auf diesen Gedanken kam ich auch schon,“ entgegnete Johann. „Aber es war zu spät, die Männer waren bereits tot!“
„Tot?!?“, rief Vayk entsetzt.
Johann nickte betroffen.
„Die blaue Pest verläuft schon nach kurzer Zeit tödlich und wir wissen momentan weder, wie sie sich überträgt noch wie sie geheilt werden könnte.“
Vayk war schockiert. Er hatte von rein gar nichts etwas mitbekommen, nichts von den Freibeutern und erst recht nichts von der tödlichen Bedrohung, die sich in der Stadt breit machte.
In den letzten Wochen hatte er seine Tage fast ausschließlich in der Schlossbibliothek verbracht und sich in die alten Schriften vertieft, die in Reih und Glied in den Regalen standen.
„Wie?... Was?...“, stammelte er mit vor Unglaube weit aufgerissenen Augen vor sich hin, aber Johann fuhr ungerührt fort:
„Als nächstes hat Albrecht dieses verfluchte Weibsstück verhört, um herauszufinden, ob sie irgendetwas über diese Krankheit weiß. Vergebens! Natürlich hat sie bestritten, mit dem Ausbruch der Seuche in Verbindung zu stehen, aber diesen Lumpen darf man kein Wort glauben. Sie würden ihre eigene Mutter verraten, um ihren Hintern zu retten... Jedenfalls sitzen sie jetzt erst einmal im Kerker, stellen sich dumm und streiten weiterhin alles ab.“
„Das kann doch nicht sein!“, brauste Vayk auf.
„Sie muss doch etwas wissen!“
Er wandte sich an Albrecht, der neben ihm stand, doch dieser schüttelte nur verneinend den Kopf.
Vayk wollte noch etwas erwidern, doch sein Bruder fiel ihm ins Wort:
„Wir wissen nur, dass die ganze Stadt in höchster Gefahr ist. Ich musste schon drastische Maßnahmen unternehmen, sonst wäre schon längst Chaos ausgebrochen...“
Vayk horchte auf.
„Und was für Maßnahmen sind das genau?“, erkundigte er sich vorsichtig.
Wenn sein Bruder in dieser Art und Weise redete, konnte das nichts Gutes bedeuten.
„Du willst es also wirklich wissen?“, seufzte Johann.
„Also gut... Um zu verhindern, dass schon bald die ganze Stadt infiziert sein würde, musste ich alle Soldaten, die sich noch in Daradun befanden, zusammenziehen und den Hafen unter Quarantäne stellen. Niemand darf das Hafenviertel betreten oder verlassen. Ich habe angeordnet, dass jeder, der gegen diesen Erlass verstößt, mit sofortiger Wirkung hingerichtet wird!“
„Du hast die Leute im Hafen eingesperrt? An dem Ort, wo sie dem Tod auf Gedeih und Verderb ausgeliefert sind?“,fragte Vayk erschrocken, obwohl er die Antwort schon kannte.
„Ich weiß, was du jetzt denkst und du hast Recht!“, gestand Johann ein. „Aber mir blieb nichts Anderes übrig. Ich kann nicht zulassen, dass sich diese Seuche in ganz Daradun ausbreitet, sonst wären wir alle wahrscheinlich bereits tot. Und wenn wir nicht bald etwas unternehmen, dann wird diese Krankheit früher oder später nicht nur Daradun ausgelöscht haben, sondern auch das Leben der Menschen auf der ganzen Insel in Gefahr bringen!“
In Vayks Kopf drehte sich alles und nur mit Mühe konnte er einen klaren Satz herausbringen.
„Was können wir dagegen tun?“, war die einzige Frage, die jetzt von Bedeutung war.
„Ich habe dir meinen Plan schon erklärt“, sagte Johann.
„Du wirst nach Kelodor reisen und Elwin von einem Treffen mit mir überzeugen. Berichte ihm von der blauen Pest. Er wird die Dringlichkeit der Lage erkennen, wenn er einsieht, dass es hier um mehr als nur um die Königskrone geht. In Kelodor wurden schon immer die besten Ärzte und Heiler des Königreichs ausgebildet, sie werden mit Sicherheit ein Mittel gegen diese Seuche finden. Das ist der einzige Weg, um unser geliebtes Sargonei zu retten! Glaubst du, Bruder, du bist dieser Aufgabe gewachsen?“
Vayk fühlte sich dieser Aufgabe alles andere als gewachsen. Am liebsten wäre er wieder in seine Kammer zurückgekehrt und hätte sich erst einmal hingelegt. Doch er tat es nicht, sondern er blieb im Thronsaal des Schlosses stehen, während er versuchte, das Gehörte zu verarbeiten. Zwar konnte er das ganze Ausmaß der Situation noch nicht erfassen, aber ihm war trotzdem bewusst, dass es nur eine richtige Antwort auf die Frage seines Bruders geben konnte.
Vayk sammelte all seinen Mut und legte ihn in die folgenden Worte.
„Ich mache es!“, gelobte er, während er den linken Arm hob, um seinem Schwur Ausdruck zu verleihen.
„Ich werde alles dafür tun, dass diese Mission ein Erfolg wird und wenn es das Letzte ist, was ich tue!“, fügte Vayk hinzu und ballte die Hand zur Faust.
Bei der Ausführung eines Auftrages zur Rettung des Königreiches zu sterben ist immer noch um Längen besser als an irgendeiner Krankheit elendig zu verrecken, dachte Vayk und allein dieser Gedanke machte ihm Mut und gab ihm ein Stückchen Zuversicht.
Ein breites Grinsen machte sich auf Johanns Gesicht breit, als er die Worte seines Bruders vernahm und auch Albrecht, den Vayk schon beinahe vergessen hatte, klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter.
„Ich bin überglücklich, dass auch du, Bruder, die besondere Wichtigkeit unseres Anliegens erkennst und dass du bereit bist, alles dafür zu geben!“,sagte er ergriffen und Vayk konnte sehen, wie seine Augen feucht wurden.
Diese Art von Gefühlsregung kannte Vayk von seinem Bruder nicht. Johann war noch nie sonderlich emotional gewesen, sondern eigentlich immer sehr gefasst und distanziert. Dass er nun den Tränen nahe war, bewies Vayk, dass die Vorfälle der letzten Zeit seinen Bruder sehr mitgenommen hatten. Mit der rechten Hand wischte sich der Herrscher von Daradun kurz über die Augen, um dann in gewohnt besonnener Art fortzufahren:
„Vayk, niemand sonst darf von deinem Auftrag etwas mitbekommen! Das ist auch der Grund, aus dem ich zu so früher Stunde mit dir reden wollte. Im Verlauf des Krieges haben sich immer mehr Menschen von uns abgewandt und verfolgen ihre eigenen Ziele. Unter Umständen macht ein baldiges Kriegsende diesen Leuten einen Strich durch die Rechnung und sie könnten versuchen, dich aufzuhalten. Ich hoffe natürlich, dass es nicht soweit kommt, aber je früher du aufbrichst und je weniger du mit anderen Menschen auf deiner Reise sprichst, desto größer sind die Aussichten auf Erfolg! Am besten machst du dich sofort bereit zur Abreise und brichst so schnell es geht auf.“
Je weniger Leute etwas von ihrem Vorhaben wussten, desto besser, da war Vayk ganz Johanns Meinung. Sein Bruder hatte sich während seiner Herrschaft nicht nur Freunde im Volk gemacht und mit Sicherheit gab es auch in Kelodor einige Emporkömmlinge, die die aktuelle Situation zu ihrem Vorteil nutzten und alles dafür tun würden, um ihre Macht zu vergrößern. Auch wenn Vayk noch immer viele unbeantwortete Fragen hatte, konnte er die Gedankengänge seines Bruders nachvollziehen.
Schon in wenigen Stunden werden die Straßen Daraduns voll mit Menschen sein, da wird es schwer werden, ungesehen aus der Stadt zu kommen, überlegte er.
Um nicht noch mehr kostbare Zeit zu vergeuden, antwortete Vayk knapp:
„Da muss ich dir Recht geben! Gib mir nur noch einen Moment Zeit, um meine Sachen zu packen.“
„Gut! Wir treffen uns in zehn Minuten in der Einganshalle. Ich habe auch noch etwas zu erledigen, bis gleich!“, entgegnete Johann.
„Bis gleich!“





























