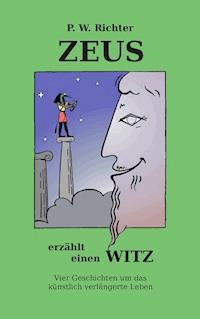
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
In wenigen Jahrzehnten wird es wohl der medizinische Fortschritt erlauben, das menschliche Leben bedeutend, ja bis ins Unendliche zu verlängern. Wie würde das die Menschen, ihr Handeln und ihr Zusammenleben verändern? Dieser Frage gehen die vier Geschichten nach, in denen die DURATION - so soll das neue Verfahren hier genannt werden - eine entscheidende Rolle spielt. Stilistisch bewegen sie sich auf recht unterschiedlichen Ebenen; sie reichen von einer nüchtern-realistischen Kurzgeschichte über Science-Fiction und Krimi bis hin zur philosophisch inspirierten Groteske. ETWAS MEHR ZEIT: Irmgard Rominski erhält das Angebot, als erste ihr Leben verlängern zu lassen. GAMMABLITZ: Das Raumschiff "Goldene Verheißung" ist seit 210 Jahren unterwegs zum Sternenystem Alpha Centauri, als ein Mitglied der Crew von einem Gammablitz erfasst wird. BOMBENLAGER: Sirlanas selbstfahrendes Auto wird gehackt und entführt. Schließlich findet sie sich mit den Entführern in einem alten Bombenlager wieder. ZEUS ERZÄHLT EINEN WITZ: Den Göttern geht es schlecht, weil keiner mehr an sie glaubt. Steckt etwa wieder Prometheus dahinter? Am Ende werden selbst die Götter fromm.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
In wenigen Jahrzehnten wird es wohl der medizinische Fortschritt erlauben, das menschliche Leben bedeutend, ja bis ins Unendliche zu verlängern. Wie würde das die Menschen, ihr Handeln und ihr Zusammenleben verändern? Dieser Frage gehen die vier Geschichten nach, in denen die DURATION - so soll das neue Verfahren hier genannt werden - eine entscheidende Rolle spielt. Stilistisch bewegen sie sich auf recht unterschiedlichen Ebenen; sie reichen von einer nüchtern-realistischen Kurzgeschichte über Science-Fiction und Krimi bis hin zur philosophisch inspirierten Groteske.
ETWAS MEHR ZEIT: Irmgard Rominski erhält das Angebot, als erste ihr Leben verlängern zu lassen. GAMMABLITZ: Das Raumschiff „Goldene Verheißung“ ist seit 210 Jahren unterwegs zum Sternensystem Alpha Centauri. BOMBENLAGER: Sirlanas selbstfahrendes Auto wird gehackt und entführt. ZEUS ERZÄHLT EINEN WITZ: Die unsterblichen Götter siechen dahin, weil keiner mehr an sie glaubt.
Peter Werner Richter, geboren 1946 in Schleswig-Holstein, wuchs in Freiburg auf. Er studierte Volkswirtschaft und Regionalplanung und siedelte nach der Wende in den Osten Deutschlands über, wo er in einer mittelgroßen Stadt als Stadtplaner arbeitete. Nicht zuletzt diese Tätigkeit, die oft Züge einer Realsatire trägt, regte ihn an, seine insgeheim gehegten literarischen Ambitionen umzusetzen und zu schreiben. Seine Berufserfahrungen sind wohl auch dafür verantwortlich, dass er seine Themen in realistischen Entwicklungen der näheren Zukunft sucht.
Heute lebt P.W. Richter in einem kleinen Dorf in Brandenburg und widmet sich nur noch dem Schreiben.
Inhalt
Etwas mehr Zeit
Gammablitz
Bombenlager
Zeus erzählt einen Witz
Nachwort
Etwas mehr Zeit
Der Dienstwagen der Charité kam eine Viertelstunde eher als vereinbart. Doch für Irmgard Rominski hätte er ruhig noch zeitiger kommen können – sie stand schon seit einer Stunde mit Mantel und Hut am Fenster und wartete. Vor einigen Tagen hatte sie die Mitteilung erhalten, dass man sie um zehn Uhr vor ihrem Haus in der Carl-von-Ossietzky-Straße abholen werde, und seitdem hatte sie kaum noch etwas Vernünftiges zustande gebracht, geschweige denn geschlafen. Als der Wagen endlich eine Parklücke gefunden hatte, stand sie schon auf der Straße, und der Fahrer beeilte sich, ihr sogleich die hintere Türe zu öffnen und beim Einsteigen zu helfen.
Nach einem kurzen Blick in den Fond des Mercedes, der ihm bestätigte, dass die alte Dame angeschnallt war und bequem saß, steuerte er den Wagen aus der Parklücke, durchquerte die holprigen Gassen der südlichen Vorstadt von Eberswalde und bog schließlich nach links auf die schnurgerade Bundesstraße 167 ein, die zur Autobahn führte.
Der Fahrer fuhr ruhig und konzentriert. Er wirkte wie jemand, der seinen Job schon lange machte. Irmgard Rominski schätzte ihn auf Ende fünzig.
„Wohin fahren Sie mich?“, fragte sie.
„Nach Berlin, zur Charité.“
„Das weiß ich. Ich meine, wohin genau?“
„In den Campus Mitte. Das ist in der Nähe des Reichstages.“
Irmgard überlegte, ob er ihr das genaue Ziel nicht nennen wollte oder es nicht konnte, weil er sich an die exakte Bezeichnung des Institutes, die für Laien vermutlich genauso abstrus und beliebig war wie die Hunderter anderer wissenschaftlicher Einrichtungen, nicht erinnern konnte. Sie entschied sich für Letzteres.
„Ist es vielleicht das Institut für Zell- und Neurobiologie?“, fragte sie.
„Genau, so heißt es. Um elf Uhr dreißig werden Sie dort erwartet.“
Sie nickte zurfrieden. Natürlich kannte sie Ort und Zeit; es hatte ja in der Einladung gestanden. Aber es beruhigte sie, die Bestätigung des Fahrers zu hören.
Der Wagen fuhr nahezu lautlos; er besaß einen Elektromotor wie die meisten neueren Fahrzeuge. Vor den Fenstern zogen die alten Gebäude des Eberswalder Kranbaues gemächlich vorbei wie in einem Film. Nur die leichten Schaukelbewegungen, die vom schlechten Straßenzustand herrührten, verdeutlichten ihr, dass sie in Bewegung war.
Irmgard spürte, wie sich ihre tagelange Anspannung langsam löste. Jetzt ist ein erster Schritt getan, dachte sie. Jetzt läuft die Sache. Die Tatsache, dass sie sich noch entscheiden musste, erschien ihr nur noch als Formsache.
Das Institut für Zell- und Neurobiologie kannte sie gut. Selbst Professorin für Evolutionsbiologie an der Humbold-Universität hatte sie öfter an Vorträgen ihrer fachlichen Kollegen teilgenommen, um über die neuesten Erkenntnisse der Zellforschung auf dem Laufenden zu bleiben. Das Institut war in den letzten Jahren mit seinen Erfolgen in der Stammzellenforschung ziemlich groß herausgekommen und hatte besonders mit neuen Ansätzen zur Therapie der Volkskrankheit Alzheimer weltweite Beachtung gefunden. Alzheimer gehörte zwar nicht ihn ihr Fachgebiet und betraf sie auch trotz ihre siebzig Jahre nicht persönlich, doch die Forschungen dazu waren von so allgemeiner Bedeutung, dass man stets gut informiert bleiben sollte. So lange es noch geht, dachte sie.
„Wir sind gleich auf der Autobahn“, sagte der Fahrer, als sie dem eleganten Schwung der Straße über den gesäumten Finowkanal folgten und in die nächste Ortschaft einfuhren. Die Gebäude rückten hier nahe an die Fahrbahn heran, und der Wagen verlangsamte das Tempo. Es kam ihr vor, als würden sie nur noch in Schrittgeschwindigkeit durch das Sammelsurium kleiner Häuser rollen, die zum Teil aus der DDR-Zeit, zum Teil noch aus der Zeit davor stammten. Die herbstlich bunten Sträucher und Bäume der winzigen Vorgärten milderten die Schmucklosigkeit der Fassaden nur wenig.
„Hier wäre eine Umgehungsstraße angebracht“, bemerkte der Fahrer, sichtlich bemüht, ein wenig Small Talk zu treiben.
„Ja, sie planen sie schon seit fünfunddreißig Jahren.“
„Oh! Und immer noch nicht fertig?“
„Nein. Es vergehen wahrscheinlich noch einmal fünfunddreißig Jahre, bis es so weit ist!“
„Das erleben wir wohl nicht mehr.“
Sie vielleicht schon, dachte sie und seufzte. Ich vielleicht nicht.
Vor ihnen tauchten große blaue Wegweiser auf, und als sie die Auffahrt passiert hatten, lag das graue Band der Autobahn vor ihnen – gerade und langgestreckt wie die Abfahrt einer Sprungschanze, ausgerichtet auf das Anatomische Zentrum der Charité im Herzen Berlins. Der Elektromotor zog lautlos, aber kräftig an und drückte Irmgard in die Polster.
Worauf lasse ich mich da ein, dachte sie. Wenn sie es recht bedachte, hätte sie das erste Vorzeichen schon an ihrem siebzigsten Geburtstag bemerken können. Denn unter den Gratulanten hatte sich ein Gast befunden, dem sie vorher noch nie begegnet war.
An diesem Tag, er lag schon vier Wochen zurück, hatte die Sonne noch einmal ihre ganze Kraft zusammengenommen und im späten September einen Sommertag herbeigezaubert, der es erlaubte, die Feier im Garten hinter dem Haus zu veranstalten. Ihre beiden Töchter hatten ihre ewigen Zwistigkeiten für ein paar Tage vergessen und die gesamte Organisation alleine bewerkstelligt. Das heißt, sie hatten fast überall selbst Hand angelegt und ihre Mutter freundlich, aber bestimmt aus Küche und zu schmückenden Räumen hinauskomplimentiert. Ihre Ehemänner waren ebenfalls für kurze Zeit erschienen und hatten sich um die technischen Installationen gekümmert, was Irmgard als nicht selbstverständlich und als besonderen Ausdruck familiärer Harmonie empfunden hatte.
Am eigentlichen Festtag waren dann fast zwanzig Personen im Garten versammelt, der engere Kreis ihrer Familie. Sie war glücklich – bis auf jene Momente, in denen sie an ihren Mann denken musste. Er war nicht mehr dabei, er war vor zwei Jahren „nach langer schwerer Krankheit“ – in seinem Fall hatte die übliche Umschreibung für „Krebs“ auf schlimme Weise zugetroffen – gestorben.
Und dann gab es da noch einige unerwartete Gäste, die von den Übrigen mit großem Hallo begrüßt wurden. Sie hatte sie zwar nicht eingeladen, freute sich aber gleichermaßen über ihren Besuch. Das war zum einen der Redakteur der örtlichen Tageszeitung, den sie schon von früheren Interviews kannte, zum anderen eine Abordnung ihrer Professorenkollegen der Humboldt-Universität. Sogar der Dekan der zuständigen Fakultät hatte es sich nicht nehmen lassen, ihr persönlich zu gratulieren. Mit theatralischer Geste überreichte er ihr ein großes flaches Päckchen, das, wie sie sofort und richtig vermutete, den neuesten Bildband zur Universitätsgeschichte enthielt. Eine Allerweltsgabe, die eigenlich als Aufmerksamkeit für auswärtige Ehrengäste der Universtität gedacht war, aber gerne bei allen möglichen Anlässen als Verlegenheitsgeschenk Verwendung fand.
Doch dieses Päckchen war keine Allerweltsgabe, denn auf seiner Oberseite war mit Klebestreifen eine skurrile weißliche Form befestigt. Sie war etwa zwanzig Zentimeter groß und trug lange Fortsätze, die man beinahe Stacheln nennen konnte. Sie waren mit zahlreichen roten Schleifchen geschmückt, was dem Ganzen eine karnevaleske Erscheinung verlieh und Irmgards Meinung über den ästetischen Geschmack ihrer Kollegen wieder einmal leidvoll bestätigte. Aber die Idee, ihr diese Skulptur quasi mit der Universität als Basis zu überreichen, gefiel ihr außerordentlich.
Es war das Gehäuse einer Meeresschnecke, einer Murex Alabaster oder auch Alabasterschnecke. Man konnte sie kitschig finden oder auch geheimnisvoll – jedem der Anwesenden war klar, dass dieses Ding eine tiefere Bedeutung haben musste.
Die Alabasterschnecke gehört zur Familie der Stachelschnecken. Sie besteht fast mehr aus Stacheln als aus Gehäuse, was für Schnecken, die sich kriechend fortbewegen – und wie in diesem Fall auch noch in räuberischer Absicht –, eigentlich eher hinderlich ist, denn sie können überall hängen bleiben. Warum begnügen sich diese Tiere also nicht mit einem einfachen Gehäuse wie ihre Verwandten, zum Beispiel die berühmten Kauri-Schnecken? Gar nicht zu denken an die maritimen Nacktschnecken, die, wie der Name schon sagte, ganz auf ein Gehäuse verzichten.
Die Frage war ihr plötzlich während einer Diskussion über Evolutionsmechanismen in den Sinn gekommen und hatte sie seitdem nicht mehr losgelassen.
Ihre ganze wissenschaftliche Arbeit hatte sich seitdem um diese Frage gedreht: Wie war es möglich, dass manche Lebewesen einen Wust von Körperteilen mit sich herumschleppten, die offensichtlich von geringem Nutzen waren, aber eine große Menge an Nährstoffen und Energie verbrauchten und sich im Zweifel zu einer großen Gefahr auswachsen konnten? Waren wir Menschen einfach zu beschränkt, den Sinn zu erkennen?
Nein, hatte sie gesagt. Es gibt keinen Sinn. Es ist vielmehr so, dass auch „sinnlose“ Eigenschaften von der Natur nicht ausgemerzt werden, sofern sie sich im täglichen Überlebenskampf nicht nachteilig auswirkten. Wie es zum Beispiel dem Riesenhirsch Megaloceros widerfuhr, einem Zeitgenossen von Mammut und Wollnashorn. Dieser Hirsch bildete wie seine heutigen Kollegen jedes Jahr ein neues Geweih – im Unterschied zu diesen aber mit einer Spannweite von bis zu vier Metern! Er hatte es nicht, weil er es brauchte – er hatte es, weil er es sich leisten konnte. Zum bloßen Protzen sozusagen.
In ihren Vorlesungen vergaß sie an dieser Stelle nie, den Vergleich mit den Fahrern großer Nobelkarossen zu ziehen, was stets zu großer Heiterkeit im Saal führte. Bei den Megaloceriden war der Spuk allerdings in jener Zeit zu Ende, als die letzte Eiszeit sich nach Norden zurückzog, die Wälder wieder dichter wurden und die Bäume sich weigerten, Zwischenräume von vier Metern zwischen ihren Stämmen freizulassen. Ein ähnliches Schicksal würden auch die Nobelkarossen und die Stachelschnecken erleiden, sobald es ihnen in ihrem Biotop zu eng werden würde. In der Natur, so folgerte sie, ist also alles erlaubt, was nicht verboten ist.
Ein schöner Satz, den die Studenten gerne als allgemeine Lebensweisheit mit auf den Weg nahmen. Er galt, wie sie betonte, gewissermaßen auch für das Leben überhaupt, das auf dem Planeten ebenso überflüssig sei – oder auch nicht – wie die Stacheln der Alabasterschnecke oder das Hirschgeweih und quasi nur deswegen existiere, weil die unbelebte Natur es auf diesem Planeten nicht verhindern konnte, einmal abgesehen davon, dass sie das nicht einmal wollen konnte.
Die Erinnerungen an ihre wissenschaftliche Tätigkeit wärmten ihr Herz. Dem Fahrer, der regelmäßig in den Rückspiegel schaute, um zu sehen, ob seine Passagierin sich wohlfühlte, entging ihr versonnenes Lächeln nicht.
„Ist es ein angenehmer Besuch, den Sie bei uns machen?“, fragte er. Ihre heitere Stimmung verwirrte ihn, denn die meisten älteren Leute suchten die Charité auf, um sich medizinisch behandeln zu lassen, also nicht gerade aus einem erfreulichen Anlass. Aber diese Leute kamen mit eigenen Mitteln oder wurden mit dem Rettungswagen gebracht – nicht von einem Dienstwagen mit Fahrer, und das auch noch über diese Entfernung! Diese Irmgard Rominski schien ihm auch noch recht „rüstig“ zu sein, wie man bei älteren Leuten sagte, das war ihm gleich aufgefallen, als sie in Eberswalde auf seinen Wagen zugestürmt war. Also eher kein Fall für die Klinik. Aber dass er sie zu einer dienstlichen Verabredung brachte, erschien ihm auch wieder unwahrscheinlich. Kaum einer seiner Fahrgäste lächelte, wenn er zu einem Termin fuhr.
„Das kann ich noch nicht sagen.“ Ihr Lächeln verschwand und machte einer nachdenklichen Miene Platz. „Das kommt darauf an, was man mir erzählen wird.“ Der Fahrer war sichlich neugierig, aber sie hatte keine Lust, ihm die ganze Problematik auseinanderzusetzen. Zumal er sie wohl auch nicht verstanden hätte. Oder doch? Sie wurde unsicher. Vielleicht gerade er?
In der Abordnung der Universität hatte sich auch eine Person befunden, die sie vorher noch nie gesehen hatte. Es handelte sich um einen zierlichen Mann um die fünfzig, der zwar genauso leger gekleidet war wie die anderen Gäste, durch seine asiatischen Gesichtszüge und sein zurückhaltendes Benehmen aber deutlich von ihnen abstach. Er wurde Irmgard als Professor Yi aus Seoul vorgestellt, der seit einigen Jahren einen Lehrstuhl an der Charité inne habe. Trotz ihrer guten Kontakte zum Klinikum war ihr dies bisher entgangen, aber immerhin meinte sie, sich dunkel an einige Fachartikel unter dem Namen Yi erinnern zu können. Der obligatorische Small Talk mit ihm fiel ihr nicht schwer, denn die Medien waren in diesen Tagen voll von Berichten und Spekulationen über Korea.
„Glauben Sie, dass sich ihre beiden Landesteile bald vereinigen werden?“, fragte sie.
Immerhin hatte sich der Norden politisch in den vergangenen Jahren diskret auf den Süden zu bewegt, auf dessen militärische Manöver relativ gelassen reagiert – das heißt, nicht sofort mit dem dritten Weltkrieg gedroht – und sogar die Zensur ein wenig gelockert. Die westlichen Medien hatten dies im vergangenen Sommerloch als Schwerpunktthema entdeckt; seitdem beherrschte das Wort „Wiedervereinigung“ die Titelzeilen.
„Nun, der Anfang ist die Hälfte des Weges“, antwortete Yi vieldeutig. „Wir lernen viel von Deutschland“, fügte er lächelnd hinzu.
„Ich hoffe, Sie nutzen unser Vorbild, um es besser zu machen.“
„Oh, die Koreaner glauben, Sie haben es sehr gut gemacht. Und Sie haben es vor allen Dingen schnell gemacht! Das ist sehr wichtig!“
„Wir haben in Deutschland erst einmal die Bürokratie vereinigt. Das sieht man in Korea hoffentlich etwas großzügiger.“
„Oh, ich fürchte, nein.“
Sie lächelten, und er entschwand nach einer angedeuteten Verbeugung zu den Grüppchen im hinteren Teil des Gartens.
Irmgard Rominski wurde das Gefühl nicht los, dass er sie insgeheim beobachtete.
Am späten Nachmittag kam es dann zu einem zweiten Gespräch. Yi setzte sich mit einem Glas Mineralwasser neben sie an den Gartentisch und sagte unvermittelt: „Ich habe Ihr Buch über die Steuerungsmechanismen der Evolution gelesen. Es ist hochinteressant, muss ich sagen.“
Sie fühlte sich etwas überrumpelt. „Ich sehe, die Koreaner schmeicheln genauso unverschämt wie die Deutschen“, sagte sie.
„Nein, im Ernst. Ich finde, Sie führen die Ideen von Darwin konsequent weiter. Die Thesen zur „selektionsfreien Mutation“ zum Beispiel werden auch bei uns diskutiert. Sie sollten Ihre Vorträge unbedingt auch bei uns in Seoul halten, wir würden uns sehr freuen …“
Irmgard sah ihm in die Augen, die hinter der Brille verschmitzt lächelten. Man könnte ihm beinahe glauben, dachte sie. „Ach, wissen Sie“, murmelte sie nachdenklich, „Korea … liegt das nicht mehr oder weniger auf der anderen Seite der Erde?“
„Nicht ganz. Aber wenn Sie darauf bestehen – wir würden Sie im Rahmen unserer Zusammenarbeit mit Neuseeland natürlich ebenfalls gerne unterstützen, wenn Sie auch dort …“
„Ach, hören Sie auf, Herr Yi, ich bin eine alte Frau! Gerade siebzig geworden. Siebzig! Ich reise nicht mehr gerne. Ich bin wackelig auf den Beinen und nicht mehr ganz richtig im Kopf!“
„Nein, Frau Rominski, Sie sind jung, glauben Sie mir!“ Wieder strahlte er sie an wie ein Schuljunge. „Sie sind so jung. Ich kann es sehen!“
Damit hatte er erreicht, dass sie sich genau so fühlte, wie sie es eben beschrieben hatte. Wackelig auf den Beinen und wirr im Kopf. Mit Komplimenten zu ihrer Gesundheit und ihrem Aussehen konnte sie normalerweise gut umgehen, aber bei diesem fünfzigjährigen Herrn Yi war es etwas anderes. Etwas, das sie nicht einordnen konnte.
„Ich habe noch Frage.“ Jetzt klang er wieder vollkommen sachlich. „Eine Frage zu Ihrem Fachgebiet. Darf ich?“
„Na gut. Wenn Sie künftig bei den Tatsachen bleiben. Fragen Sie.“
„Ich denke zum Beispiel an Symbiosen. Was meinen Sie, kann man mit Mutation und Selektion tatsächlich diese speziellen Anpassungsleistungen einzelner Organismen erklären, wie wir sie überall finden können? Die so aussehen, als würden beide Seiten sich genau kennen und aufeinander zu entwickeln?“
Sie sah ihn scheel von der Seite an. Meinte er es ernst, oder fing er schon wieder an zu flirten? „Sind Sie Kreationist?“, fragte sie barsch.
„Ich meine nur – diese Frage stellt sich doch. Wäre dies nicht sozusagen das nächste Kapitel Ihrer Forschungen?“
Sie wandte ihr Gesicht zur Seite. Sein tiefgründiges Lächeln, diese unendliche Zuversicht in seinem Blick … sie hätten sie vollends aus der Fassung gebracht. Natürlich hatte er sie genau an ihrem wunden Punkt erwischt. War es denn so offensichtlich, wovon sie in ihren stillen Stunden träumte? War er vielleicht einer dieser allwissenden Symbionten, von denen er gerade gesprochen hatte? Sie spürte das Verlangen, abrupt aufzustehen und in der Küche nach dem Rechten zu sehen, ließ es dann aber doch bleiben.
„Wissen Sie, es sind zwar meine Forschungen, aber sie stehen jedem offen. Es darf sie nicht nur jeder lesen, es darf sie auch jeder weiterführen. Und es gibt viele junge Wissenschaftler, die sich hier ihre Sporen verdienen können. Und es auch bereits tun.“ Sie nippte an ihrem Glas. „Man muss wissen, wann man seinen Platz frei machen muss. Auf mich kommt es wahrhaftig nicht mehr an.“
Yi widersprach. „Es kommt auf jeden Einzelnen an. Sagt man das nicht bei Ihnen, hier in Berlin?“
Eine Woche später kam das Schreiben, das ihr Leben von Grund auf erschüttern sollte. Es war keine E-Mail, sondern ein richtiger Brief aus Papier. Und er war nicht von der Post zugestellt worden, sondern von einem speziellen Boten, der das Schreiben nur gegen Vorzeigen des Ausweises und Unterschrift der Empfängerin ausgehändigt hatte. Als Absender war das „Institut für Zell- und Neurobiologie“ in Berlin genannt. Als sie den Umschlag aufriss, bestätigte sich ihre Vorahnung, dass es sich um ein Schreiben von Professor Yi handelte. Er schrieb:
Liebe, verehrte Frau Rominski,
zu Ihrem sehr gelungenen Geburtstagsfest möchte ich Sie noch einmal herzlich beglückwünschen. Ich möchte mich bedanken, dass Sie mich als ungeladenen Gast so freundlich aufgenommen haben. Ich darf feststellen, dass mich unser Gespräch in Ihrem Garten tief beeindruckt hat.
Sie sagten, dass Sie Ihren Platz in der Forschung freimachen müssen. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass Sie dies aus Respekt und Demut vor der Natur sagten, die uns hervorgebracht hat und somit auch das Recht hat, uns wieder zu sich zu nehmen. Diese Einstellung ehrt Sie. Ich hoffe, dass Sie es mir nicht verübeln, wenn ich dennoch glaube, dass dies nicht die ganze Wahrheit ist. Unser Gespräch hat mir gezeigt, dass Sie sehr wohl gerne weiter arbeiten würden, wenn sich Ihnen eine entsprechende Perspektive böte.
Es ist mir eine Ehre, Ihnen miteilen zu dürfen, dass unser Institut Ihnen diese Perspektive nunmehr bieten kann.
Das Folgende bitte ich mit höchster Diskretion zu behandeln …
Irmgard Rominski las nicht weiter und ließ das Schreiben sinken. Sie stand immer noch neben der Eingangstüre ihres großen Hauses und starrte in den Spiegel der Garderobe, ohne sich wahrzunehmen. Was war das für ein ominöser Professor Yi! Während ihre Gedanken zur Situation im Garten schweiften, spürte sie ein leichtes Schwindelgefühl und beeilte sich, in ihr Wohnzimmer zu gelangen, wo sie sich auf einen Sessel sinken ließ. Sie hatte es ja gleich geahnt, dass mit dieser Person etwas nicht stimmte! Im Nachhinein schien es ihr, seine Freundlichkeit, ja man konnte sogar von einem gewissen Charme sprechen, habe auch etwas Zudringliches an sich gehabt, etwas unerlaubt Vertrauliches, vor allem, wenn man bedachte, dass er als Fremder auf ihre Party gekommen war. Sie könnte sich ohrfeigen, dass sie nicht misstrauisch geworden war …
Wer konnte denn ahnen, dass auf ihrer Feier, die sie genießen wollte, auf der sie sich im Kreise ihrer Lieben und Freunde noch einmal richtig wohl fühlen wollte, denn wer wusste, was in ihrem hohen Alter noch kommen sollte … dass da solch zweifelhafte Gratulanten wie dieser Yi aufkreuzen würden. Er hatte sie gecheckt und gleichzeitig seelisch weichgeklopft wie ein Versicherungsvertreter, wie ein ausländischer Agent. Aber vielleicht sah sie alles zu schwarz. Sie hatte das Schreiben ja nicht einmal zu Ende gelesen. Sie rückte ihre Brille zurecht und nahm es wieder auf.
Unser Institut forscht seit über einem Jahrzehnt in einem abgeschirmten Forschungstrakt an der Möglichkeit, Leben zu verlängern. Wir sind damit nicht an die Öffentlichkeit getreten, weil es sich um hochsensible Entwicklungen handelt, die in den Händen bösartiger Interessengruppen zu gefährlichem Missbrauch führen können. Die kriminellen Machenschaften beim Handel mit menschlichen Organen sind ein allseits bekanntes und sehr trauriges Beispiel.
Es wird Sie sicher freuen zu hören, dass unser Berliner Institut in Kooperation mit dem Clinical Research Institute des SNUH, Seoul, schon vor mehreren Jahren einen Durchbruch in dieser Richtung erzielt hat. Wir haben die Methode (Anti Aging Approach – AAA) bereits im Laborversuch getestet. Alle Experimente haben zu einer erheblichen Verlängerung der durchschnittlichen Lebensdauer der Versuchstiere geführt.
SNUH, dachte sie. Seoul National University. Und was bedeutete das „H”? Hospital vielleicht? Dann wäre das eine ähnliche Organisation wie die Charité. Sie fand es hocherfreulich, wie weltweit vernetzt die hiesigen Institute waren. Ohne einen rationalen Grund sah sie diesen Yi wieder in einem etwas wärmeren Licht. Vielleicht beruhte ihr Eindruck ja nur auf der Unterschiedlichkeit der Mentalitäten.
Auch der abschließende Versuch mit Primaten verlief bisher äußerst erfolgreich. Sie verstehen, dass diese Versuche erst endgültig bewertet werden können, wenn die Primaten versterben. Danach sieht es bis jetzt nicht aus. Sie erfreuen sich nicht nur bester Gesundheit, es sind auch deutliche Zeichen einer Verjüngung erkennbar.
Wir sind uns sicher, dass AAA jetzt in der Humanmedizin einsatzbereit ist. Naturgemäß handelt es sich noch nicht um ein zugelassenes Verfahren. Unsere Kooperationspartner sind jedoch der Meinung, dass die Vorzüge der Methode bereits jetzt einem ausgewählten Personenkreis zu Gute kommen sollen.
Ich erinnere mich gerne an unser Gespräch auf Ihrer Party. Dort habe ich den Eindruck gewonnen – nein, ich bin mir ganz sicher, dass auch Ihr geistiges Streben unserem gemeinsamen Ziel gilt – der Verbesserung des menschlichen Lebens. Ich möchte Sie bitten: Machen Sie weiter auf diesem Weg! Gönnen Sie Ihren Plänen etwas mehr Zeit! Ich erlaube mir, sinngemäß aus Ihren Schriften zu zitieren: Was die Natur nicht ausdrücklich verbietet, ist erlaubt!
Schwerenöter! Versucht er doch tatsächlich, mich mit meinen eigenen Worten zu schlagen! So etwas, dachte sie, geht immer schief. Jedenfalls bei mir. Niemand lässt sich gerne mit Hilfe seiner selbst zwingen. Und überhaupt argumentiert er doch reichlich suggestiv. Was heißt denn: unser gemeinsames Ziel der Lebensverbesserung? Das hörte sich ja beinahe so seriös an wie die Beteuerungen der agrarischen Gentechnik-Industrie, sie würden den Hunger in der Welt bekämpfen.
Bei Anwendung von AAA würde sich Ihre Lebenserwartung voraussichtlich um zwanzig bis dreißig Jahre verlängern. Genügend Zeit, um zu erleben, wie all Ihre Wünsche und Pläne Wirklichkeit werden.
Sicher haben Sie Fragen. Dies können wir alles vor Ort in der Charité besprechen. Ich habe für Sie eine Fahrt in einer Woche reserviert. Unser Fahrer wird sich vorher telefonisch mit Ihnen in Verbindung setzen.
Ich darf mich nochmals für Ihr Verständnis und Ihre Diskretion bedanken!
Mit freundlichem Gruß
Prof. Dr. Yi Hae-Chan
Institut für Zell- und Neurobiologie
Charité Berlin
Und nun saß sie in diesem großen grauen Wagen, der sie in gleichmäßiger Fahrt näher und näher an ihr Ziel brachte. Wieso hatte Sie diese Einladung überhaupt angenommen? Sie konnte es sich selbst nicht recht erklären. Sie erinnerte sich, dass sie noch stundenlang wie betäubt im Sessel sitzen geblieben war, bis es draußen dämmrig geworden war, dabei nicht etwa rational das Für und Wider dieses Vorhabens abgewogen hatte.
Nein, in ihrem Kopf war ein Gewitter von Bildern abgelaufen, die alle Seinsmöglichkeiten von neuer Verliebtheit bis zu endlosem Siechtum aufblitzen ließen und ihr abwechselnd den Schweiß auf die Stirn und die kalten Schauer über den Rücken trieben. Schließlich hatte sie zum Rotwein gegriffen, um ihren Gedanken die schärfsten Kanten und Spitzen zu nehmen, was am Ende natürlich grandios schiefgegangen war. Bis zum Anruf des Fahrers, der erst gestern Vormittag stattfand, hatte sie sich zu keiner Entscheidung durchgerungen.
Sie war gesund, sie fühlte sich wohl, sie war geistig topfit – sie verspürte jede Lust der Welt, weiterzuleben, nicht zuletzt um ihre wissenschaftlichen Arbeiten voranzutreiben, sondern auch zum Beispiel, um ihre Enkelkinder aufwachsen zu sehen. Sie wollte reisen, vielleicht sogar einmal nach Seoul, um dort tatsächlich ihre Vorträge zu halten. Oder mit einem dieser neuen Touristenraumschiffe einen Trip ins All machen.
Jeden Tag passierten aufregende Dinge, die entweder gut oder schlecht, beglückend oder verheerend waren, auf jeden Fall aber interessant. Der Sieg der Medizin über zwei Geißeln der Menschheit, nämlich Krebs und Multipler Sklerose, zum Beispiel. Oder das holografische Fernsehen, plastische Produkte, hergestellt am eigenen PC-Drucker, Spuren von Leben auf dem Mars … Aber auch die Kernschmelze im Atomkraftwerk San Onofre in Kalifornien, die Tausende das Leben gekostet und endlich auch die USA zum Umdenken im Umweltschutz veranlasst hatte.
Es gab so vieles Neues, das schon existierte, und noch viel mehr, das noch kommen sollte. Ja, sie wollte noch viel erleben, wollte wissen, wie es weitergeht, wollte nicht einfach mitten im Film hinausgehen, ohne das Ende zu kennen. Hatte nicht ein berühmter Dichter – war es nicht Elias Canetti? – gesagt, der Tod sei ein Skandal?
Sie war sich allerdings nicht im Klaren, wie sie es verkraften würde, wenn um sie herum alle älter würden, nur sie nicht. Wenn sie zusehen müsste, wie Klara, ihre beste Freundin, langsam verginge, womöglich nach schwerer Krankheit wie damals ihr Mann. Oder, noch schlimmer, wenn ihre eigenen Töchter sie im Alterungsprozess quasi überholten und bestattet würden, während sie selbst in bester Verfassung an ihrem Grab stünde. Gibt es etwas Schlimmeres, als die eigenen Kinder zu beerdigen?
Natürlich, vielleicht konnte sie es einfädeln, dass ihre Töchter als Nächste in den Genuss der Therapie kämen … und ihre Schwiegersöhne … und ihre Enkelinnen mit Anhang … Ob sie es schaffen würde, all den Fragen, die mit Sicherheit kommen würden, auszuweichen oder mit allgemeinen Floskeln zu antworten?
Sie merkte es kaum, wie die Welt um den Wagen herum immer langsamer vorbeiglitt, und erst als er mit einem sanften Ruck mitten in einer Autoschlange zum Stehen kam, erwachte sie aus ihren Träumen und kämpfte sich in die Wirklichkeit der Autobahn 11 zurück.
„Ein Stau?“, bemerkte sie ängstlich.
„Keine Angst, es wird nicht lange dauern“, sagte der Fahrer. „Ich kann die Baustelle schon sehen.“
„Was bauen sie denn schon wieder?“
„Sie verlegen Induktionsleitungen. Haben Sie schon von Smacar gehört?“
„Heißt es nicht Smart Car?“
„Eigentlich heißt es Smart Caravaning. Es geht darum, dass in die Fahrbahn ein Stromkabel eingelassen wird, das die Steuerung der Kraftfahrzeuge übernimmt. Sie folgen dann automatisch dem Kabel, ohne dass der Fahrer eingreifen müsste. Er kann sich zurücklehnen und ein Nickerchen machen oder ganz zu Hause bleiben.“
„ Hmm … aber gibt es das nicht schon lange?“, fragte sie verwundert.
„Sicher, selbstfahrende Autos gibt es eigentlich schon lange“, bestätigte der Fahrer. „Aber Sie wissen doch selbst, wie unberechenbar die waren. Da hat es ständig gekracht, und hinterher hat man sich herumgestritten, wer schuld war … der Besitzer, der Hersteller, der Erbauer der Straße … Jedenfalls kam man dann auf die Idee mit dem Kabel. Dieser Wagen hier ist übrigens auch schon dafür vorbereitet. Er hat alle möglichen Sensoren und automatischen Steuerungen. Aber bisher fehlen die passenden Straßen.“
„Und das ist jetzt sicherer?“
„… Jein. Neben dem Kabel gibt es noch ein zweites System, eine Kette von Transpondern an den Leitplanken. Für alle Fälle. Es funktioniert am Anfang ja nie, wie es soll. Was wäre zum Beispiel, wenn der Strom ausfiele?“
„Hmm … verstehe“, murmelte Irmgard nachdenklich.
„Wenn ich Sie in zwei Jahren abholen müsste, würde ich womöglich nur noch den leeren Wagen schicken. Sie müssten dann allerdings mit dem Taxi zur Autobahn kommen. Und in Berlin wäre es dann umgekehrt.“
„Wie praktisch“, antwortete sie.
Sie erreichten kurz darauf den Berliner Ring, und Irmgard spürte, wie die anberaumte Besprechung mit Professor Yi immer mehr den Charakter der fasslichen Wirklichkeit annahm. Ihr hoffnungsfroher Optimismus schwand immer mehr und machte einem Gefühl der Bedrängtheit Platz. Es ist ja gar nicht gesagt, dass alles so reibungslos funktioniert, dachte sie. Nichts funktioniert von Anfang an. Sollte sie sich vielleicht nicht so sehr als Pionier, sondern eher als Opfer begreifen? Als Versuchskaninchen?
Es wäre ja nicht einmal nötig, dass die Therapie versagt. Selbst wenn sie wunderbar funktionieren würde, gäbe es dann nicht zahlreiche Probleme, an die jetzt keiner denkt? Was wäre zum Beispiel, wenn sie krank würde? Oder einfacher: wenn sie einen mittelschweren Unfall hätte, der sie an den Rollstuhl fesselte? Säße sie dann vielleicht fünzig Jahre oder länger im Rollstuhl? Was wäre dann mit ihren ganzen Zukunftsträumen?
Oder noch einfacher: Wer sollte diese lange Pflege eigentlich bezahlen? Würden sich die Versicherungen nicht weigern? Würden sie das nicht schon in ihrem Fall tun? Schließlich hatten sie ja schon genug mit der normalen Überalterung der Gesellschaft zu tun. Sie stellte sich vor, wie sie von einem netten Pflegeroboter umsorgt wird, der sie jeden Morgen mit den Worten „Haben wir heute schon geforscht?“ zum Frühstück holte. Sie fand sich mitten in einer Gerölllawine schwerer, schwarzer Gedanken.
Mit schmalen Lippen verfolgte sie, wie die Gebäude der Stadt langsam anwuchsen und zusammenrückten. In Pankow wurde die Autobahn zur sechsspurigen Stadtstraße, und bald darauf bogen sie nach rechts in die Torstraße ein, die zum Oranienburger Tor führte.
„Wir sind gleich da“, bemerkte der Fahrer.





























