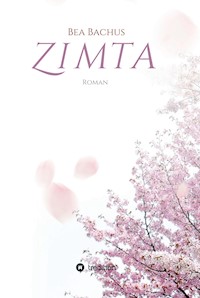
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Ein kleines Mädchen muss sich in die phantastische Welt von Zimta wagen, um ihrer Mutter, die von einem tödlichen Fluch heimgesucht wurde, zu retten. Gemeinsam mit ihrer besten Freundin und Verbündeten aus Zimta muss sie sich ihren schlimmsten Ängsten stellen, riskante Abenteuer bestehen und einem namenlosen Feind die Stirn bieten. Ihr Ziel: Eine magische Arznei, die es nur in Zimta gibt. Zimta ist eine fantasievolle Geschichte voller eigentümlicher Gesellen. Sie zeigt die nahlose Verbindung zwischen Mutter und Tochter und die Bedeutung von Freundschaft und tiefer Feindschaft. Sie soll die LeserInnen in eine sinnliche Welt voller Aromen und Düfte entführen, berauscht vom Zauber Zimtas. Aber auch die Konfrontation mit dem Tod, mit tiefem Schmerz und der Angst vor Verlust wird in diesem Roman thematisiert. Dennoch erleben die LeserInnen eine magische Reise in eine zauberhafte Welt, die am Ende eine heilsame Kraft enfaltet. Wer am Ende unsere Welt mit anderen Augen sieht, Blumenwiesen und Kräuter, Gewürze und Aromen intensiver wahrnimmt und das Leben in all seinen Facetten spürt, sowohl den Tod als auch das Diesseits, wurde von Zimta berührt. Altersempfehlung: Ab ca. 12 Jahren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Bea Bachus
Zimta
© 2021Bea Bachus
Illustration: Bea Bachus/ Bearbeitung Umschlag: Raoul Keller
Verlagund Druck:
tredition GmbH, Halenreie40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-7482-6932-8
Hardcover:
978-3-7482-6933-5
e-Book:
978-3-7482-6934-2
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Prolog
Sie fiel.
Einfach aus dem Stand fiel sie auf den Boden und schlug dabei hart auf die blanken Küchenfliesen, aber es schmerzte kaum. Sie fühlte eigentlch gar nichts mehr.
Der Schmerz hätte bohrend, tosend ihren Kopf zerbersten müssen, aber da war nichts.
Nur eine entsetzliche Leere, die sie erfüllte und ihr eine schreckliche Angst einjagte.
Es war niemand zu Hause, doch das war im Grunde auch egal, denn sie wusste, was gerade geschah.
Während sie da so auf dem Boden lag, den Teig, den sie angefangen hatte zu rühren, auf ihrer Küchenschürze verteilt, griff die Dunkelheit um sie. Bösartig schlangen sich schwarze Fäden um ihr Bewusstsein, hüllten sie nach und nach ein, betäubten sie.
Die Gedanken, die sie noch vorsichtig erfassen konnte, galten ihrer Familie, ihrem geliebten Kind. Angst und Sorge überkamen sie nun mit voller Wucht und erbarmungslos. Es war so bitter, was nun passierte, und doch hatte sie es gewusst- schon immer. Und trotzdem erschien es ihr wahnsinnig unfair. Wieso passierte es wieder und wieder? Wieso konnte es keine Ausnahme oder gar ein Ende geben?
Doch das dachte sie nicht um ihrer selbst willen. Nein, es ging um jemanden, um den sie sich nun viel größere Sorgen machte als um sich.
Die Angst wurde zunehmend lähmender und erstickender. Keuchend griff sie sich an den Hals, der innerlich zu glühen und zu brennen schien.
Es beginnt…
Nur noch schemenhaft lag dieser Gedanke vor ihr, der nun immer mehr in der um sich greifenden Dunkelheit verschwand, die pulsierend ihren Körper eroberte.
Die Hitze schien sich weiter von ihrem Hals zu ihren Ohren, ihren Augen und Extremitäten auszuweiten.
Und dann kam er.
Der Schmerz, tief und qualvoll.
Bis sie Schließlich alles an Bewusstsein verlor, auch den letzten gedanklichen Funken, der einzig und allein dem Menschen galt, den sie am meisten liebte. Und dann brach das Feuer über sie ein, drang durch jedes ihrer Organe, Sehnen, Muskeln und Adern.
Sie verbrannte von innen.
1
Sechs Wochen später
»Es ist soweit«, flüsterte Margarethe von Hellingen und schaute dabei ängstlich aus dem Wohnzimmerfenster. An diesem späten Abend hatte es zu schneien begonnen und dicke Flocken verschleierten ihr die Sicht nach draußen. Leise schlich die alte Frau durch das Wohnzimmer, das nur schwach von einer kleinen Lampe beleuchtet wurde. Margarethe spürte, wie sich die blanke Angst auf ihre Brust setzte und drohte ihr den Atem zu rauben. Vorsichtig setzte sie sich auf den veralteten Sessel am Fenster und versuchte tief einzuatmen. Eben hatte sie den Anruf von Anton erhalten und nun verstand sie langsam, dass sich ihre schlimmsten Befürchtungen bewahrheiten würden.
»Sie ist doch noch so jung, wie soll ich ihr das bloß begreiflich machen?«, murmelte sie und schüttelte dabei zerstreut ihren Kopf, der von ihren langen weißen Haaren umrahmt wurde. Plötzlich blitzten ihre verdunkelten Augen auf und richteten den Blick auf die andere Seite des Raumes.
Zielsicher stand Margarethe auf und ging auf einen der uralten Schränke zu. Blasse Schnörkel verzierten die kleinen und großen Schubladen, die nur selten geöffnet wurden. Eine dieser Schubladen hatte sie eigentlich nie wieder öffnen wollen, sie hatte gehofft, dass sie das nie wieder tun müsste. Doch diese Hoffnung starb, als sie den Anruf ihres Schwiegersohns, Anton, erhielt. Die Hoffnung starb, als ihre Tochter ganz überraschend ins Krankenhaus gebracht wurde und die Ärzte Anton ihre Ohnmacht und Ratlosigkeit mitteilen mussten. Die Hoffnung starb, als er ihr sagte, dass die Ärzte noch nach sechs Wochen keine Ahnung hätten, was mit Isabell los sei. Dass keine Medikamente das hohe Fieber senken könnten. Dass das Bluten aus ihrer Nase und ihren Ohren nicht zu stoppen sei und dass Isabell daran sterben würde. Margarethe glaubte zu wissen, was mit ihrer einzigen Tochter passierte, doch sie hatte bis eben gehofft, dass sie sich irrte und der Kelch an Isabell vorbeigehen würde. Sie wusste, dass kein Arzt dieses Leben retten konnte und erinnerte sich noch ganz genau daran, wie sie selbst damals von innen heraus regelrecht ausblutete. Wie sie mit jedem Tag so viel Blut verlor, dass das Leben mit jedem Tropfen aus ihr wich und die Halluzinationen des Fiebers sie an den Rand des Wahnsinns trieben.
Die Trugbilder von damals stiegen plötzlich wieder in ihr auf und schnürten ihr die Kehle zu. Japsend stand Margarethe vor dem alten Schrank mit den vielen Schnörkeln und hielt sich krampfhaft daran fest. Ihre sonst so warmen Hände wurden eiskalt und feucht, die Handknöchel deuteten sich klar unter ihrer faltigen Haut ab. Heißes Blut floss ihr aus der Nase und den Ohren. Eine qualvolle Hitze überkam sie und vernebelte ihr die Sinne, sie hatte das Gefühl innerlich zu verbrennen. Margarethe fiel zu Boden, sah sich in die Blutlache fallen, die sie selbst erzeugt hatte, und schrie ihre Angst in die Nacht hinaus.
»Es tut mir leid, Herr Schwarz, wir kriegen das Fieber Ihrer Frau einfach nicht in den Griff«, sagte Herr Doktor Brunner zu Anton, der den verzweifelten Blick des alten, aber erfahrenen Arztes durchaus registrierte.
»Was hat das alles zu bedeuten? Wieso blutet meine Frau aus? Was passiert hier, Herr Doktor?«, fragte er aufgewühlt und in dem Wissen, dass er die Antworten bereits kannte. Doktor Brunner runzelte seine faltige Stirn und massierte sich die Schläfen. Was sollte er dem verzweifelten Mann vor sich nur sagen?
»Wir kriegen weder die Blutungen gestoppt noch konnten wir feststellen, wo oder wie sie ausgelöst wurden. Unsere technischen Möglichkeiten sind gänzlich ausgeschöpft, Herr Schwarz. Ich denke, dass wir hier nichts weiter tun können.«
»Was ist mit den anderen Fachärzten? Wo sind die und wieso weiß keiner von ihnen, was hier passiert?« Anton schrie diese Worte bereits. Er merkte nicht, dass sich fast alle Patienten, Schwestern und Besucher, die sich in unmittelbarer Nähe befanden, nach ihm umdrehten. Einige schüttelten empört den Kopf. Ein Patient schaute neugierig zu ihnen herüber und kaute dann nervös an seinen Nägeln. Als er den strengen Blick des Arztes bemerkte, verschwand er geduckt in seinem Krankenzimmer. Ein schäbiges Grinsen huschte dabei über sein blasses Gesicht.
Doktor Brunner schob Anton in die angrenzende Stationsküche, um noch mehr Unruhe zu vermeiden. »Kommen Sie bitte hier herein, Herr Schwarz.«
Anton ließ sich von dem Arzt in die Küche schieben. Eine kleine Krankenschwester saß auf einem der hässlichen Krankenhausstühle und wartete mit müdem Blick darauf, dass der Kaffee endlich fertig durchlaufen möge.
»Schwester Marie, bitte verlassen Sie einen Augenblick die Küche, ich muss hier kurz in Ruhe mit Herrn Schwarz sprechen.«
Der Blick der Schwester wanderte zu Anton, der neben Doktor Brunner stand. Sie musste die Angst und Sorge in seinem traurigen Gesicht wohl erkannt haben, stand schnell auf und drückte sich durch die Tür, die sich dann leise hinter hier schloss.
»Möchten Sie einen Kaffee, Herr Schwarz?«, fragte der Arzt und griff nach zwei Tassen aus dem Hängeschrank über der Spüle.
»Nein, nein… ein Wasser vielleicht?«, entgegnete Anton, der spürte, dass die Angst um seine Frau ihn sehr müde und immer schwächer machte.
Isabell war nun schon fast sechs Wochen im Krankenhaus. Er hatte seitdem kaum geschlafen, fühlte sich ausgelaugt, und keiner konnte ihm Antworten geben.
Der Arzt nahm ein Glas und füllte es mit kaltem Wasser. Anton nahm es dankend entgegen.
»Helfen Sie meiner Frau, Doktor Brunner! Sie blutet nun schon seit so langer Zeit und sie sieht diese schlimmen Dinge…« Jetzt kam nur noch ein schwaches Flüstern aus dem Mund des verzweifelten Mannes.
»Herr Schwarz, wir haben hier alles versucht. Wir haben die besten Fachärzte hierher bestellt, weil es sich um eine gänzlich unbekannte Krankheit handeln muss. Es sind keine uns bekannten Viren- oder Bakterienstämme zu finden. Die Blutwerte ihrer Frau sind gänzlich normal! Die Organe sind unauffällig und alle Messungen der Gehirnströme sind ebenfalls unauffällig. Rein von diesen Gesichtspunkten aus, ist Ihre Frau kerngesund! Es ist ein medizinisches Phänomen. Wir wissen nicht das Geringste!«
Anton hörte das nicht zum ersten Mal, das hatte man ihm bereits viele Male gesagt und er konnte es nicht mehr hören. Ungläubig fragte er weiter: »Wie soll das möglich sein? Sie blutet und blutet, wie kann sie überhaupt noch am Leben sein?« Doktor Brunner nippte an seinem Kaffeebecher, der die Aufschrift »The BOSS« trug. Seine Augenbrauen kräuselten sich nachdenklich, als er sagte: »Das ist das nächste Phänomen. Ihre Frau hätte theoretisch schon ausgeblutet sein müssen. Die Blutungen stoppen hin und wieder, aber nicht durch uns. Es scheint so, dass der Körper sich zwischenzeitlich wieder selbst regeneriert, um dann wieder bluten zu können. Es ist verrückt! Die Blutkonserven bringen überhaupt nichts, der Körper Ihrer Frau nimmt nichts an. Auch keine Medikamente! Sie ist quasi in der Lage, selbst wieder Blut herzustellen, was sie dann wieder verliert. Wie ein Kreislauf, der aber absolut unmöglich ist. Und das Fieber! Auch das hat bisher keiner von uns in dieser Form erlebt. Sie reagiert auf nichts, was wir ihr bisher verabreicht haben. An dieser Hitze hätte sie ebenfalls schon sterben müssen, und sie hat Halluzinationen in heftigster Form, als ob sie vom Teufel besessen wäre.«
Anton wurde wieder wach. »Was wollen Sie bitte damit sagen? Dass Sie jetzt den Exorzisten holen wollen? Kommt hier gleich ein Pfarrer hereinspaziert und will meiner Frau den Teufel austreiben?«
Der Arzt schüttelte seinen Kopf. »Herr Schwarz, ich weiß, dass das verrückt klingt! Ich bin Schulmediziner und glaube an solche Dinge nicht. Aber ich kann Ihnen im Augenblick nicht mehr sagen!«
Anton fühlte sich verraten und wurde zunehmend wütender. Auch hatte er das Gefühl, dass der Arzt ihm etwas zu verheimlichen schien. Doktor Brunner benannte zwar die Auswegslosigkeit der Situation, war dabei aber für Antons Geschmack zu gefasst. Schließlich kannte er die Familie schon seit einer Ewigkeit! Im Grunde hatte er Isabell aufwachsen sehen. Müsste er da nicht viel besorgter sein? Oder bildete Anton sich das alles nur ein? Konnte er seinen Sinnen nach den vielen schlaflosen Nächten überhaupt noch trauen? Eigentlich, so dachte er, konnte er das nicht. Anton griff sich unglücklich in sein dichtes Haar und versuchte gedanklich zurückzukehren, um sich zu besinnen. Plötzlich kam ihm eine Idee.
»Sie sagten doch gerade, dass meine Frau auf nichts reagiert? Keine Medikation könne helfen und auch die Blutkonserven seien unbrauchbar, richtig?«, hakte er nach.
»Ja, das ist korrekt«, antwortete der Arzt. »Dann«, begann Anton »könnte ich sie doch nach Hause holen. Ich meine, wenn sie ohne medizinische Hilfe hier liegen kann, dann kann sie das auch bei uns, zumal ich unsere zwölfjährige Tochter nicht auf Dauer mit meiner Schwiegermutter alleine lassen kann, die selbst ganz krank vor Sorge ist.«
Doktor Brunner starrte Anton ungläubig an. »Theoretisch ist das möglich, ja. Haben Sie sich das genau überlegt? Sie wissen absolut nicht, was sie sich da ins Haus holen. Es könnte für alle sehr gefährlich werden!«
Anton hörte aufmerksam zu. »Theoretisch ist es also möglich, haben Sie gesagt. Na bitte! Dann werde ich meine Frau nach Hause bringen. Da ist sie in ihrer gewohnten Umgebung. Wenn Sie Isabell für eine mögliche Gefahr für sich selbst halten, schlage ich vor, dass regelmäßig ein Arzt zu uns kommt, um nach ihr zu sehen. Falls sich ihr Zustand verschlimmern sollte, ist jemand da und meine Frau kann dann rechtzeitig wieder zurück ins Krankenhaus gebracht werden.«
Der Arzt zuckte mit den knochigen Schultern. »Nun, dagegen kann ich nichts sagen, zumal das Ihre Entscheidung ist, Herr Schwarz. Ich werden täglich nach meiner Arbeit bei Ihnen reinschauen und nach Ihrer Frau sehen.«
Anton stellte sein Glas in die Spüle und schaute dem Doktor in die nachdenklichen Augen. Und wieder war da dieses eigenartige Gefühl. »Ich darf meine Frau einfach so mitnehmen? Sie wollen mich trotz der Gefahren, die von ihr ausgehen könnten, nicht daran hindern?« Doktor Brunner schüttelte hilflos den Kopf. »Ich kann Ihnen doch hier nicht helfen! Ich hätte Sie gerne schon früher gebeten Isabell mitzunehmen, aber das darf ich doch in Anbetracht der schrecklichen Symptome nicht vorschlagen! Sie haben es doch eben selbst gesagt: Bei Ihnen ist sie in ihrer gewohnten Umgebung. Vielleicht hat das irgendwelche Auswirkungen. Hier passiert nichts mehr.« Anton verstand die Welt nicht mehr, aber zu gleich war er unendlich dankbar. Endlich konnte er seine geliebte Frau wieder zu sich holen. Doch wusste er, worauf er sich da einließ?
Ein grauenhafter Schrei riss Amelie aus dem Schlaf. Sie saß aufrecht in ihrem Bett und versuchte zu lokalisieren, woher der Schrei kam. Hatte sie nur geträumt? Ist Mutter wieder da? Amelie entschied sich nachzusehen und kroch müde aus ihrem warmen Bett mit der geblümten Bettwäsche, die sie so liebte. Langsam tastete sie sich durch ihr kleines Zimmer zur Tür, öffnete sie und lauschte. Sie hielt den Atem an und schaute sich in dem nur sehr schwach beleuchtetet Flur um. Es war nichts zu hören oder zu sehen. Sie ging einige Schritte weiter den Flur entlang und langte am Treppengeländer an. Auch weiterhin nichts Ungewöhnliches, fand sie. Es war still im Haus.
Großmutter war wahrscheinlich auch schon zu Bett gegangen. Vater war wohl noch im Krankenhaus bei Mutter, dachte Amelie und war dabei sich wieder umzudrehen, als sie ein leises Stöhnen hörte. Ihr wurde entsetzlich heiß. Kalter Schweiß schoss ihr aus den Poren.
Amelie suchte verängstigt den Lichtschalter, um besser sehen zu können, doch in ihrer Aufregung konnte sie ihn zunächst nicht finden. »Mutter? Vater? Seid ihr da unten? Großmutter? Wer ist da unten?«, rief sie und traute sich kaum zu atmen. Was war passiert? Wer stöhnte da unten so unheimlich? Wer hatte nur geschrien? Oder träumte sie in diesem Augenblick? Amelie schossen tausend Fragen durch den Kopf und noch immer tastete ihre kleine Hand nach dem Lichtschalter.
Ihr Puls raste.
Margarethe öffnete die Augen. Sie hörte ein Geräusch von oben und merkte, dass es etwas heller wurde, da im oberen Flur das Licht angemacht worden war.
Sie fand sich auf dem Boden sitzend vor und schaute sich verwirrt um. Sie fasste sich an die Nase und an die Ohren, tastete den Boden ab und fand aber nicht das Blut, das eben noch aus ihr herausgequollen war. »Ich muss völlig die Nerven verloren haben…«, flüsterte sie zu sich selbst und überlegte, was geschehen war.
Sie erinnerte sich an den Anruf ihres Schwiegersohns und dass sich die unglaubliche Angst um ihre Tochter damit bestätigt hatte. Dann war sie zu dem Schrank gegangen und hatte plötzliche diese furchtbaren Erinnerungen gehabt, die sich so echt angefühlt hatten. »Aber das hatte ich mir nur eingebildet! Grete, du dummes Ding!«, schimpfte sie mit sich selbst und starrte den Schrank an. Langsam richtete sie sich auf. »Uff, mein Rücken!«, stöhnte sie und hielt sich genervt am Schrank fest. Ich bin einfach nicht mehr die Jüngste!
Margarethe griff nach dem Schlüssel und drehte ihn um. Die Schublade ließ sich noch ganz leicht öffnen. Ängstlich und gleichzeitig neugierig schaute sie hinein. »Da seid ihr ja, ihr zwei. Ich glaube, ihr werdet wieder gebraucht!«
Amelie ging langsam die Treppe hinunter und lauschte zwischendurch. Sie hörte jemanden im Wohnzimmer murmeln und schimpfen.
Das muss Großmutter sein, dachte sie und marschierte schnurstracks Richtung Wohnzimmer.
Sie sah ihre Großmutter seltsam krumm gegen den alten Schrank gelehnt. Sie blickte dabei in ihre Hände und murmelte vor sich hin. Eine Schublade war geöffnet.
Seltsam! Dieser Schrank wurde normalerweise kaum benutzt.
»Großmutter? Alles in Ordnung bei dir?«, fragte Amelie und ging auf Margarethe zu. Sie stellte sich neben sie und streichelte ihr über das wunderschöne weiße Haar, das sie abends und nachts immer offen trug.
»Ja… nein, es ist nichts. Ich bin etwas umgeknickt und ärgere mich gerade über meine eigene Tollpatschigkeit! Wieso bist du wieder aufgestanden?«, fragte Margarethe, schob die Schublade wieder zu und verschloss sie. Dabei ließ sie etwas in ihrer Rocktasche verschwinden, das aber so klein war, dass Amelie es nicht erkennen konnte.
»Ich bin von einem Schrei aufgewacht und wusste nicht, ob ich das geträumt habe oder ob im Haus jemand gerufen hat. Warst du das?« Amelie schaute ihre Großmutter erwartungsvoll an. Sie verhielt sich seltsam, fand Amelie. Etwas war hier eigenartig.
»Ach, meine Kleine, tut mir leid, dass ich dich geweckt habe. Ich habe vor Schreck beim Sturz wohl etwas geschrien. Weißt du, in meinem Alter zu stürzen ist nicht ganz ungefährlich. Ich muss einfach besser aufpassen«, sagte sie und richtete sich langsam aus ihrer schiefen Haltung wieder auf. Dabei schnaufte sie angestrengt und hielt sich weiterhin gut fest. Sie merkte, wie ihr schwindelig wurde, hielt einen Augenblick inne und wartete ab. Als die klitzekleinen Sternchen vor ihren Augen schließlich nachließen, traute sie sich, sich wieder ganz aufzurichten. »Puh, mein Rücken macht mir zu schaffen. Das sage ich dir!«, sagte sie und ging langsam auf den alten Sessel zu.
Amelie sah dabei zu, wie sich ihre geliebte Großmutter erschöpft darin niederließ und tief durchatmete. Interessiert wandte sich sie dem Schrank zu, drehte den Schlüssel um und öffnete die Schublade, doch Amelie schaute in die Leere. »Was war da drin?«, fragte sie und schloss die Schublade sofort wieder.
»Du bekommst aber auch alles mit! Es ist schon so spät, Liebes. Ich erkläre es dir morgen in aller Ruhe. Heute bin ich zu erschöpft. Komm aber noch mal kurz zu mir«, bat Margarethe und hielt ihrer Enkelin die Hand hin. Amelie wackelte müde zu ihrer Großmutter.
»Dein Vater hat vorhin angerufen. Es geht deiner Mutter weiterhin nicht besonders gut, weißt du. Er macht sich große Sorgen«, erklärte sie und streichelte Amelies Hand.
»Ich habe auch Angst um Mutter, aber wieso verhältst du dich so eigenartig? Ich glaube dir nicht, dass du gestürzt bist! Du hast keine Schmerzen, du hast Angst!«, entschied Amelie und beobachtete den erschrockenen Blick ihrer Großmutter ganz genau.
»Natürlich habe ich Angst! Das ist meine Tochter, die da im Krankenhaus liegt! Aber unterstelle mir ja nicht, dass ich lüge, Kind!«, schimpfte sie, drehte ihren Kopf zur Seite und schaute stur zum Fenster hinaus. Die großen Laternen, die draußen standen, erleuchteten den Hof und machten die vielen Schneeflocken sichtbar. »Siehst du, Amelie, es schneit jetzt. Ist das nicht wunderschön?«
»Was ist so wichtig daran?«, entgegnete Amelie, denn sie verstand nicht, was das für eine Rolle spielen sollte. Es gab doch im Augenblick nichts, was wichtiger als ihre Mutter sein könnte. Schon gar nicht der Schnee!
Margarethe wandte den Blick vom Fenster wieder ab und flüsterte: »Oh, das ist sehr wichtig, Amelie. Es ist der erste Schneefall in diesem Winter und bedeutungsvoller, als du dir das im Moment vorstellen kannst!« Dann sah sie im Augenwinkel das Licht von Scheinwerfern auf den Hof gleiten, das immer näher kam und schließlich Halt machte. Dann hörte sie eine Autotür. »Das ist dein Vater. Geh wieder ins Bett, Kind. Ich kriege mächtig Ärger mit ihm, wenn er mitbekommt, dass du so spät noch auf bist!«, sagte sie und scheuchte Amelie mit diesen Worten zurück zum Treppenaufgang.
Amelie ging mit hängendem Kopf die Treppe hoch, um in ihr Zimmer zu gehen. Sie hatte das Gefühl, dass ihre Großmutter sie anlog und das gefiel ihr überhaupt nicht.
Margarethe sah dabei zu, wie ihre Enkelin traurig die Treppe hinaufstieg und in ihrem Zimmer verschwand. Tränen standen ihr in den Augen. Ich werde dir morgen alles sagen, meine kleine Amelie, dachte sie und ging Richtung Eingangstür. Anton stand bereits draußen davor und wollte sie gerade öffnen, als seine Schwiegermutter ihm zuvorkam. »Hallo mein Lieber!«, sagte sie, griff nach ihm und zog ihn in den warmen Hausflur. Anton ließ sich das zweite Mal an diesem Tag einfach führen und ging mit seiner Schwiegermutter in die Küche. Sie verschloss die Küchentür, damit Amelie nicht heimlich lauschen konnte. Dann ging sie zur Küchenzeile und setzte Wasser auf, nahm zwei Tassen und eine Auswahl von Teesorten aus dem Schrank und setzte sich zu Anton an den Küchentisch.
»Wieso hast du die Küchentür denn zugemacht? Amelie schläft bestimmt schon«, sagte Anton und schaute müde seine Schwiegermutter an.
»Man kann ja nie wissen, sie ist sehr klug und wachsam«, sagte Margarethe unschuldig und wühlte zwischen den Teebeuteln herum, um für sich die passende Sorte zu finden. »Herr Gott nochmal! Wieso haben wir hier denn keinen Kirschtee mehr?!«, schnaubte sie unzufrieden und nahm sich stattdessen einen Teebeutel mit Pfefferminzgeschmack heraus. »Was hättest du gerne
für einen Tee, Anton?«, fragte sie und hielt ihm die Auswahl unter die Nase.
»Egal, irgendeinen, ist mir wirklich vollkommen egal!«, brummte er erschöpft, legte sein Gesicht in seine Hände, schüttelte den Kopf und wiegte sich hin und her.
Margarethe hörte das Wasser kochen, stand auf und machte zwei Pfefferminztees fertig. »Hier, mein Junge«, sagte sie und stellte den dampfenden Becher vor ihm ab. Der heiße und nach frischer Minze duftende Geruch stieg Anton bekömmlich in die Nase, und er ließ die Hände wieder von seinem Gesicht sinken. Dann umfasste er den Becher und spürte die angenehme Wärme, die sich durch seine Hände zog. Er hatte nicht gemerkt, wie durchgefroren er war. Nun genoss er für einen kurzen Augenblick die wohltuende Wärme, die von dem heißen Becher ausging und starrte in die dampfende Flüssigkeit.
Margarethe betrachtete schweigend ihren Schwiegersohn. Er sieht furchtbar aus! Er ist blass, ungewaschen, durchgefroren und hat seit Tagen kaum geschlafen, dachte sie bei sich.
»Ich werde sie morgen nach Hause holen!«, sagte er plötzlich und starrte dabei weiterhin in die Tasse.
»Sehr gut!«, sagte Margarethe und dachte dabei, dass ihr da einiges erspart geblieben war. Sie musste ihn nicht überreden Isabell nach Hause zu holen. Eine innere Zufriedenheit überkam sie. »Das lassen die Ärzte einfach so zu?«, fragte sie.
Anton war überrascht, er hatte damit gerechnet, dass seiner Schwiegermutter der Plan überhaupt nicht gefallen würde. Nun befürwortete sie sein Handeln sogar.
Einen kurzen Moment lang war er sprachlos, und ein eigenartiges Gefühl kroch in ihm hoch. »Anton?« fragte sie noch einmal und wiederholte ihre vorherige Frage.
Anton löste sich aus seiner Trance. »Doktor Brunner war erst mäßig begeistert, er hatte Sorge, dass es gefährlich werden könnte. Aber schließlich hat er mir seine Unterstützung zugesichert, was ich auch irgendwie eigenartig fand. Ich hatte mit viel mehr Gegenwind gerechnet, aber er ist absolut meiner Meinung und hätte das gerne selbst vorgeschlagen. Und er will täglich nach seinem Feierabend vorbeikommen, um nach ihr zu sehen. Ich weiß bloß nicht, was ich mit dem ganzen Blut machen soll.«
Margarethe hörte zu und dachte dann über das Gesagte nach. »Hm, ja, da müssen wir uns was einfallen lassen. Aber besser sie ist bei uns als bei diesen Stümpern! Die Ärzte würden ohnehin nicht herausfinden, was ihr fehlt.«
Anton blickte überrascht auf. »Was sagst du da, woher willst du das wissen? Weißt du denn, was sie hat?«
Margarethe winkte ab. »Ach was! Woher soll ich das wissen. Ist nur so ein Gefühl. Du hattest doch erzählt, dass sämtliche Fachärzte nicht mehr weiter wissen«, versuchte sie sich zu retten.
»Ja, das ist auch wieder wahr. Du benimmst dich irgendwie eigenartig heute, Margarethe«, sagte Anton und schaute sie fragend an.
Margarethe spürte, dass sie kurz unsicher wurde, riss sich dann jedoch wieder zusammen. »So? Findest du nicht, dass wir alle derzeit etwas anders sind?«, fragte sie spitz und wandte sich dabei beleidigt ab.
»Es tut mir leid, wirklich. Ich benehme mich grade echt daneben. Ich werde unfair, wenn ich mir Sorgen mache«, entschuldigte Anton sich.
Margarethe wandte sich ihm wieder zu. »Du brauchst dich nicht zu entschuldigen! Geh jetzt bitte mal unter die Dusche und schlafe dich aus. Morgen sehen wir weiter. Ich helfe dir bei allem«, sagte sie entschieden und nippte an ihrem Tee.
Anton verließ gehorsam die Küche und verschwand wie ein grauer Schatten im Flur. Margarethe hörte ihn leise schlurfend die Treppe hinaufgehen, dann gingen eine Tür und das entfernte Rauschen der Dusche.
»Puuuh!«, stöhnte sie erleichtert. »Das ging ja gerade noch gut aus!« Margarethe hätte nicht gewusst, wie sie, ohne etwas zu verraten, Isabell nach Hause hätte holen können und nun hatte ihr Schwiegersohn ihr diese Bürde abgenommen. Für das, was ihrer kleinen Amelie bevorstand, war es besser, wenn Isabell im Haus war. Margarethe musste sie in ihrer Nähe behalten, um die Situation überblicken zu können, denn schließlich war sie die Einzige, die wusste, was hier tatsächlich vor sich ging.
Anton stand unter der Dusche und ließ sich den heißen Strahl auf den Körper rieseln. Er wurde das Gefühl nicht los, dass seine Schwiegermutter sich etwas eigenartig verhielt. Wieso ließ sie zu, dass er Isabell einfach nach Hause holte? Das konnte nicht stimmen! Das durfte einfach nicht wahr sein! Und das war auch das seltsame Gefühl, das er sich nicht erklären konnte. Es hatte eben keinen Widerstand gegeben und das musste bedeuten, dass seine Schwiegermutter ihre eigene Tochter abgeschrieben hatte! Und Doktor Brunner? Auch er hatte Isabell aufgegeben. Dieser Gedanke erschütterte Anton so sehr, dass er weinend in die Knie ging und nun schluchzend und verzweifelt in der Duschwanne hockte. Alles um ihn herum drehte sich, die Sorge und Ratlosigkeit fraßen ihn auf. Er fühlte sich ohnmächtig und schwach. Anton hatte keine Ahnung, wie er das weiterhin schaffen sollte, ohne vor Angst den Verstand zu verlieren. Und eigentlich weinte er nicht, weil der Arzt und seine Schwiegermutter Isabell aufgegeben hatten, sondern eigentlich weinte er, weil er selbst seine Frau aufgegeben hatte.
Er war so kraftlos geworden, dass er bereit war, sie in diesem Haus sterben zu lassen. Jetzt schämte er sich für seinen Egoismus. »Wie soll ich das bloß meiner kleinen Amelie erklären?« schluchzte er und sein verzweifeltes Weinen erschütterte seinen energielosen und müden Körper.
Unten in der Küche saß Margarethe und lauschte dem gequälten Schluchzen ihres Schwiegersohns. Tränen liefen ihr über die rosigen Wangen. Mein armer Junge!
Sie ließ die Hand langsam in ihre rechte Rocktasche gleiten und befühlte mit wachsender Hoffnung zwei kleine Spielfiguren.
2
Der Morgen brach an und Amelie öffnete nach einer kurzen Nacht ihre Augen. Sie fühlte die Schwere in ihrem Körper, die mit jeder Nacht, die sie kaum noch geschlafen hatte, immer stärker Besitz von ihr ergriff.
Seit ihre Mutter im Krankenhaus war, war Stille und Leere in das alte Landhaus eingezogen. Ihre Mutter hatte es am Leben erhalten. Ihr Lachen konnte lauter kleine Engel durch die Räume schweben lassen und alles an diesem Ort zum Blühen und Leuchten bringen. Mittlerweile hatte sich ein dunkler, grauer Schleier über das Haus und die Wiesen und Felder ringsherum gelegt. Es war, als ob alles ersticken würde, dachte Amelie unglücklich. Sie versuchte an die schönen Momente zu denken und drückte sich noch einmal tief unter ihre warme Bettdecke. Ihr zartes Gesicht verschwand dabei im von ihren Tränen getränkten Kissen.
Sie erinnerte sich plötzlich an ihren ersten schweren Sturz draußen im großen Garten.
Amelie war damals acht Jahre alt und spielte, wie immer, mit ihrer besten Freundin Rosa. Sie versteckten sich gerne in dem bunten Meer von Blumen, die ihre Mutter liebevoll pflegte. Eines Tages kam Amelie die Idee, sich lieber auf dem Kirschbaum, dem Lieblingsbaum ihrer Mutter, zu verstecken. Die wunderschönen Blüten sollten sie dabei verbergen, damit Rosa sie auch ja nicht finden konnte. Amelie stieg also den Baum hinauf, doch übersah dabei, dass der Zweig, den sie als Leiter benutzen wollte, morsch und brüchig war. Zunächst nahm sie nur ein leises Knacken wahr und hielt inne, um an dem Stamm hinunter zu schauen. Als sie jedoch feststellte, dass sich nichts rührte, stieß sie sich ab, um noch weiter hinauf zu gelangen. Auch wenn Amelie ein zierliches Kind war, so konnte der morsche Zweig sie nicht mehr halten. Das Abstoßen führte schließlich dazu, dass er gänzlich nachgab und sie abrutschte. Sie versuchte zwar noch sich festzuhalten, doch ihre kleinen Hände fanden einfach keinen Halt mehr. Stattdessen führte es nur dazu, dass sie sich ihre Handinnenflächen aufriss und einige Fingernägel lösten sich schmerzlich aus dem Nagelbett heraus. Dann fiel Amelie zu Boden.
Sie erinnerte sich noch ganz genau an das laute und deutliche Knacken, als sie auf dem Grund aufschlug, und dass sich dann ein scharfer und stechender Schmerz durch ihren Knöchel bohrte, der plötzlich vollkommen unnatürlich verdreht aussah. Amelie schrie laut und schmerzerfüllt durch den wunderschönen Garten nach ihrer Mutter.
So schlimm dieses Ereignis auch war, Amelie hatte daraufhin die schönsten Wochen ihres Lebens. Sie brauchte einige Tage nicht in die Schule gehen und verbrachte die meiste Zeit mit ihrer Mutter im Garten. Diese richtete ihr einen schönen Platz neben einem der wilden Blumenbeete ein und Amelie konnte ihr von dort bei der Arbeit zusehen.
Vor ihrem inneren Auge sah sie ihre Mutter vor sich, wie diese sich, mit von der Blumenerde verschmutztem Gesicht, durch den Garten wühlte und voller Liebe um ihre heiligen Blumen kümmerte. Ihre Mutter liebte die Natur von ganzem Herzen. Es war fast so, als ob sie selbst ein Teil davon wäre.
Leise lief eine kleine Träne aus Amelies Augen in das weiche Kissen. Schniefend wischte sie sich über die Wangen.
Die nächste Stadt war einige Kilometer entfernt und nur mit dem Auto erreichbar. Amelies Mutter war in dem alten Landhaus aufgewachsen und erzählte stets, dass sie es niemals wieder verlassen würde. Es war umgeben von bunten Wiesen und weiten Feldern. An manchen Tagen lief Amelie stundenlang einfach nur über die weiten Wiesen und strich mit ihren kleinen Fingern entlang der Halme und Blumen. Sie mochte das Kitzeln auf der Haut und das Flüstern der Gräser, wenn diese von dem Wind aneinander gerieben wurden. Und sie liebte die stets wechselnden Gerüche der Blumen sowie das Summen und Tanzen der Bienen und Schmetterlinge. Im Sommer rannte sie immer mit Rosa durch die naheliegenden Kornfelder. Und obwohl diese ständig piksten und juckende Flecken hinterließen, so berauschend waren aber auch die Geräusche, die entstanden, wenn sie durch sie hindurchjagten. Und niemand hatte sie je darin finden können.
Als sie noch ein Baby war, hatte ihre Mutter sie bereits häufig mit in die Natur genommen, mit ihr in den bunten Wiesen gesessen und das kleine Bündel dabei liebevoll in ihren warmen Armen hin und her geschaukelt. Und immer, wenn sie wieder zurück zum Haus ging, nahm sie einen kleinen Blumenstrauß mit.
Heute machte Amelie es genauso. Jedes Mal, wenn sie im Wald oder entlang der Wiesen spazieren ging, pflückte sie einen kleinen Strauß und stellte ihn mit einer Vase auf den Wohnzimmertisch. Doch nun brachte ihr der Gedanke daran keine Freude mehr. Es erinnert sie einfach zu schmerzhaft an die Leidenschaft und Liebe ihrer Mutter zur Natur. Ich werde nie wieder rausgehen! Ich werde nie wieder in die Felder und Wiesen gehen, wenn Mutter stirbt!
Wieder liefen ihr Tränen über das Gesicht und Amelies Gedanken wanderten weiter.
Sie dachte nun an die Geschichte, als sich ihre Eltern näher gekommen waren. Sie kannten sich bereits seit der Schulzeit und sollen damals schon sehr gute Freunde gewesen sein, doch hatten dann an unterschiedlichen Orten studiert und sich somit für einige Zeit aus den Augen verloren. Als ihre Mutter nach dem Medizinstudium wieder zurückgekehrt war, stieß sie auch wieder auf ihren alten Schulfreund, der später ihr Ehemann und Amelies Vater werden sollte. Er arbeitete damals als Architekt in der nächsten Stadt und bekam von ihr den Auftrag, sich das veraltete Dach ihres Elternhauses anzusehen.
Anton hatte seiner Tochter irgendwann einmal erzählt, dass er schon bald nicht mehr des Daches wegen auf das Land gefahren sei. Er habe sich immer mehr technische Auflagen ausdenken müssen, um in der Nähe dieser Frau sein zu können. Amelies Mutter behauptete immer, dass sie das zunächst gar nicht bemerkt habe, sie sei viel zu sehr damit beschäftigt gewesen, das alte Landhaus wieder in Schuss zu bringen.
Isabells Eltern ließen das alles gerne über sich ergehen. Amelies Großmutter erwähnte oft, dass sie und ihr Mann sehr froh gewesen seien, dass ihre einzige Tochter endlich wieder im Hause war.
Amelies Mutter hatte damals eigentlich geplant, in der nächsten Stadt als Ärztin zu arbeiten, merkte dann jedoch schnell, dass sie sich viel mehr für das alte Haus und den Garten begeisterte. Also beschloss sie, nur eine kleine Teilzeitstelle in der Stadt anzunehmen und sich ansonsten ihrer Leidenschaft zu widmen. Amelies Vater kam dann irgendwann an den Punkt, sich keine weiteren Auflagen und Berechnungen mehr für das marode Dach ausdenken zu können und unternahm schließlich den ersten Schritt: Er besorgte sich einen Anhänger, kaufte eine riesige Auswahl von Gartenpflanzen ein und fuhr damit schließlich auf den Hof zu Isabell. Amelies Mutter erzählte an dieser Stelle der Geschichte immer gerne, dass ihr in diesem Augenblick erst bewusst geworden sei, was für ein wundervoller Mann er eigentlich war. Gemeinsam pflanzten sie dann die Bäume, Büsche und Blumen ein. An diesem Tag soll Anton dann nicht wieder nach Hause gefahren sein.
Nach etwa drei Jahren zog er schließlich in das alte Landhaus ein. Sie hatten eine wundervolle Zeit.
Bis zum ersten Schicksalsschlag, der die kleine Familie stark zerrüttet hatte.
Kurz nachdem Amelies Eltern geheiratet hatten, war ihr Großvater überraschend bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Er übersah eines Abends in seinem Auto, eine der wuchtigen landwirtschaftlichen Maschinen, die sich stets wie riesige Ungetüme aus den Feldern heraus auf die Straßen und Feldwege kämpften, um die Ernte einzufahren.
Der Bauer aus der Nähe verließ in diesem Augenblick gerade sein Feld und fuhr auf die Straße. Amelies Großvater sah den alten Frederick selbst erst viel zu spät und fuhr ungebremst in das riesige Ungetüm. Dem Bauern stieß, bis auf wenige Blessuren, nichts zu, aber er verkraftete es bis zu seinem eigenen Tod niemals, seinem alten Freund und Nachbarn das Leben ausgelöscht zu haben. Er hatte ihn einfach nicht kommen sehen.
Dieser Tag brach Amelies Großmutter das Herz.
Erst als ihre Enkelin einige Jahre später auf die Welt gekommen war, fing das traurige Herz der alten Frau wieder an zu schlagen.
Seitdem lebten sie zu viert in dem alten, aber urgemütlichen Haus, und Amelies Mutter verbrachte jede freie Minute in ihrem Garten.
So auch an dem Tag, als Amelie ihren gebrochenen Knöchel auskurieren musste. Fast täglich bekam sie frische Limonade und warme Eierkuchen zu essen. Ihre Mutter laß ihr die spannendsten Geschichten vor, während bunte Schmetterlinge um ihre langen braunen Haare herumtanzten. Und Rosa kam jeden Tag vorbei, um ihr die Hausaufgaben vorbeizubringen.
Was habe ich doch für ein tolles Leben und für eine wundervolle Familie, dachte Amelie. Doch nun war alles anders. Jetzt war ihre Mutter im Krankenhaus und ihr Vater kümmerte sich nicht mehr um sie. Und Großmutter verhielt sich ängstlich und seltsam. Und sie selbst hatte auch eine furchtbare Angst.
Amelie wollte sich gerade aus ihrem Bett wühlen, als sie verwundert innehielt. Irgendetwas ist hier eigenartig, dachte sie. Sie nahm einen Geschmack in ihrem Mund wahr, der dem von Zimt ähnelte. Zimt?
Der Geschmack in ihrem Mund wurde zunehmend stärker. Amelie nahm einen Schluck aus ihrer Wasserflasche, die am Bett stand und einen Augenblick verschwand der Zimtgeschmack. Doch dann stieg dieser wieder in ihr auf, und sie war sich sicher, dass sie Zimt im Mund hatte. Und dann roch sie es plötzlich auch, sie roch es in ihrem ganzen Zimmer. Ein süßlicher Zimtgeruch hüllte sie ein und wurde immer intensiver. Also, das ist jetzt wirklich komisch, dachte sie und stieg, ummantelt von einem unerklärlichen Zimtaroma, aus ihrem Bett. Amelie ging zum Fenster und öffnete es, sie ließ die eisige Luft hinein und wartete darauf, dass der Geruch verschwinden würde. Schließlich wurde es so kalt, dass sie bibbernd das Fenster wieder schließen musste. »Das gibt es doch gar nicht!«, stellte sie fest, denn der Geruch verschwand einfach nicht. Amelie fand langsam, dass der Duft und Geschmack zwar immer aufdringlicher, aber auch immer berauschender wurde. Sie ging durch ihr Zimmer und suchte sämtliche Ecken ab, schaute in Schränke und Schubladen, fand aber die Quelle nicht. Der Duft wurde nun so intensiv, dass sie glaubte, er durchströme sie sintflutartig.
Amelie fühlte, wie das eigenartige Aroma durch ihre Nase hindurch in ihren Körper floss und sie von innen heraus angenehm zu wärmen schien. Ihr Herz schien zu rasen. Es war nicht nur unfassbar köstlich, sondern auch angenehm feurig. Ein unbeschreibliches Gefühl des Genusses kroch langsam in ihr hoch. Wie kann das denn nur sein?
Vollkommen irritiert blickte sie sich suchend, um die eigene Achse drehend, in ihrem Zimmer um.
Plötzlich hörte sie ein Geräusch im Flur und riss die Tür auf. Draußen fand sie ihren blassen Vater, der wie ein Geist durch den Flur zum Badezimmer schlich. »Komm mal bitte in mein Zimmer!«, forderte sie ihn auf und zog an seinem Ärmel. Verdutzt ging Anton hinter seiner Tochter her in ihr Zimmer. Amelie stellte sich, mit den Armen in die kleinen Hüften gestemmt, mitten ins Zimmer. Ihre dunklen Augen schienen zu glühen und zu funkeln.
»Riechst du das?«, fragte sie erwartungsvoll. Anton zog tief die kalte Luft durch seine Nase ein. »Was sollte ich denn riechen, Amelie? Es ist einfach verdammt kalt hier.«
»Du riechst das nicht? Schmeckst du denn wenigstens irgendetwas?«, konterte sie und glotzte ihren Vater erstaunt an.
Anton ging durch das Zimmer und sah sich um. »Ich schmecke, dass ich mir jetzt dringend die Zähne putzen sollte, und das solltest du auch tun!« Grinsend ging er auf sie zu.
»Das kann nicht sein! Hier riecht es total nach Zimt, und schmecken tue ich es auch. Das musst du doch auch merken?«, rief Amelie. Das konnte sie sich doch nicht eingebildet haben, dachte sie.
»Komm, wir gehen jetzt ins Bad, putzen Zähne und waschen uns. Dann wirst du den Geschmack und Geruch schon los. Hier ist nichts«, sagte Anton, nahm seine Tochter liebevoll auf den Arm und trug sie durch den Flur ins Badezimmer.
»Ich will gar nicht, dass das aufhört, das riecht und schmeckt so lecker!«, lachte Amelie und freute sich, auch wenn sie schon zwölf war, auf den Armen ihres Vaters sein zu können.
Margarethe war bereits wach und bereitete das Frühstück vor. Sie hatte mal wieder kaum geschlafen. Aber wer kann das schon in so einer Zeit, dachte sie.
Margarethe von Hellingen war eine stolze Frau. Sie war in ihrer Jugend schon für die damalige Zeit ungewöhnlich modern gewesen, weshalb sie sich bei der Hochzeit geweigert hatte, den Nachnamen ihres Mannes anzunehmen. Ihrem geliebten Ben machte das damals nicht das Geringste aus, er hatte sie abgöttisch geliebt, aber es war sehr schwierig gewesen, dieses Anliegen überall durchzusetzen. Besonders innerhalb der Gesellschaft. Margarethe wurde stets misstrauisch beäugt und hinter ihrem Rücken zerrissen sich die Frauen ihre Münder. Doch sie trug ihren Nachnamen mit viel Stolz, genauso wie ihre eigene Mutter es getan hatte. Nun, eigentlich war er Fluch und Segen zugleich, dachte Margarethe nachdenklich.
Isabell war da etwas anders. Sie hatte nicht auf ihren Nachnamen bestanden. Aber das machte Margarethe nichts aus. Im Gegenteil, vielleicht, so hoffte sie, würde das eines Tages etwas ändern. Vielleicht würde es eines Tages für Amelie etwas ändern. Doch diese Hoffnung starb noch im selben Moment.
Das letzte Mal, dass es Margarethe derart schlecht ging, war, als ihr geliebter Ehemann von ihr gegangen war. Niemals würde sie diesen tiefen Schmerz vergessen, der damals über sie kam und ihr Herz vergiftete. Ohne Isabell und Anton hätte sie sich wohl das Leben genommen.
Sie wollte damals nicht mehr existieren. Alles hatte sie mit diesem Mann geteilt. Einfach alles. Jeder einzelne Augenblick war so lebenswert mit ihm gewesen! Und dann kam dieser düstere Tag, der alles veränderte, dachte sie bitter. Sie hörte damals auf zu essen, zu trinken und schließlich wollte sie auch nicht mehr atmen, denn es war nicht mehr dieselbe Luft ohne ihren geliebten Ben.
Doch aus dem tiefsten Nebel der Trauer und Verzweiflung tauchte hin und wieder das liebevolle Gesicht ihrer Tochter auf und zwang sie mit ihrer strengen, aber geduldigen Art zu trinken und zu essen. Und Anton tat alles dafür, damit Isabell sich hingebungsvoll um sie kümmern konnte, indem er alle anstehenden Arbeiten selbst erledigte. Er brachte eine lange Zeit alleine das Geld nach Hause. Manchmal wurde es finanziell knapp, aber er verlor kein Wort darüber. Er kümmerte sich um den Garten und um das Haus. Und abends, wenn alles erledigt war, nahm er seine Frau einfach nur lange und intensiv in die Arme, damit auch sie sich mal fallen lassen und um ihren Vater trauern konnte. Margarethe war zwar in dieser Zeit in einer langen und sehr mächtigen Ohnmacht gefangen, aber die Liebe, die das Haus durch das sich so zugewandte Paar erfüllte, war ihr nicht entgangen.
Gestärkt durch Anton hatte sich Isabell mit aller Geduld immer wieder ihrer trauernden Mutter zuwenden können, die noch viele, viele Monate nicht in der Lage war, auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Trotzdem wollten Anton und Isabell ihr alles mitteilen. Sie berichteten ihr von den Blumen im Garten und den Vögeln vor dem Haus. Im Herbst erzählten sie ihr von den wunderschönen goldenen Farben der Bäume und im Winter von den dicken Schneeflocken, die die Wiesen und Felder mit einem wunderschönen weißen Mantel bedeckten. Margarethe erinnerte sich an alle Geschichten, die sie ihr erzählt hatten, denn das waren damals die einzigen Augenblicke, die ihren Schmerz einen kurzen Moment lang betäuben konnten. Wenn sie sie wieder alleine lassen mussten mit ihren schwarzen Gedanken, dann konnte sie nur noch diese in sich wahrnehmen. Sie hatten ihr zugeflüstert, sie ermahnt und reglementiert. Sie wollten ihr aufdrängen, dass sie sich nun endlich das Leben nehmen solle, denn ohne ihren Mann würde sie ohnehin nur verkümmern. Diese elenden Stimmen in ihrem Innersten, sprachen sehr lange Zeit immer wieder zu ihr, doch sie waren am Ende nicht stark genug, um gegen das Licht, das Isabell und Anton immer wieder in ihre graue Welt brachten, anzukommen.
Und eines Tages waren eben diese Stimmen endgültig verstummt!
Margarethe erinnerte sich noch genau an den Tag, als Anton sich aufgeregt zu ihr auf die Bettkante setzte und ihr mit leuchtenden Augen mitteilte, dass sie bald Großmutter werden würde. Die dunklen Nebelschwaden, die Margarethe bis dahin umhüllten, begannen sich langsam aufzulösen. Sie spürte damals, wie ein altes und bis dahin verloren geglaubtes Gefühl wieder in ihr aufkeimte: Sie empfand Glück! Sie spürte plötzlich das erste Mal wieder so etwas wie ein Glücksgefühl in sich, das die Schwärze um sie herum erfolgreich verdrängen konnte. In diesem Augenblick liefen ihr die Freudentränen über die ausgemergelten Wangen und sie erhob sich langsam aus ihrer Liegeposition, um ihren Schwiegersohn in die Arme nehmen zu können. Voller Freude fiel dieser ihr in die zittrigen Arme. Etwas Schöneres, so dachte sie jetzt, hätte sie sich damals nicht vorstellen können und betätigte dabei lächelnd die Kaffeemaschine.
Und somit brach ein neues Zeitalter für die kleine Familie an. Margarethe wurde mit jedem Tag etwas stärker, nahm an Gewicht zu und bekam wieder Appetit auf das Leben. Sie war erfüllt mit der Freude auf das kleine Wesen, das da in ihrer Tochter schlummerte und auf die große weite Welt wartete. Nach wenigen Wochen war sie wieder so gestärkt, dass sie Isabell und Anton unter die Arme greifen konnte. Sie fing an zu kochen, zu backen und im Garten mit zu helfen. Als Isabell dann hochschwanger war, übernahm sie alle Tätigkeiten im Haushalt, sodass sich ihre Tochter ausruhen und auf die Geburt vorbereiten konnte. Isabell erledigte damals nur noch Arbeiten, die ihr gefielen und sie nicht überlasteten. So richtete sie in aller Ruhe Amelies Kinderzimmer ein. Eines Tages, als sie mit ihrem dicken Bauch zwischen den bunten Blumenbeeten herumwatschelte, war es dann soweit und die ersten Wehen kamen in regelmäßigen Abständen. Isabell brüllte damals lauthals nach ihrem Mann und ihrer Mutter, dass diese sich beeilen mögen, damit sie schnell ins Krankenhaus fahren konnten. Und so kam dann einige Stunden später die kleine Amelie auf die Welt.
Margarethe liebte dieses bezaubernde Mädchen mit den braunen Haaren und den dunklen Augen. Sie ist genau wie ihre Mutter, dachte sie und schmunzelte dabei vor sich hin. Das Aussehen, die Liebe zur Natur und überhaupt das ganze Wesen. Und nun muss sie sich auch derselben Aufgabe stellen, dachte Margarethe bitter. »Aber sie wird es schaffen!«, murmelte sie, versuchte ihre Angst zu ersticken und wandte sich wieder dem Frühstückstisch zu.
Der Geruch vom frisch aufgebrühten Kaffee hüllte langsam die Küche ein und verströmte einen angenehmen Duft. Sie hörte Amelie und Anton die Treppe hinunterkommen und Richtung Küche gehen.
Amelie steckte als erste den Kopf durch die Tür. »Guten Morgen, liebe Großmutter!«, begrüßte sie sie und kam auf sie zugelaufen.
»Guten Morgen, meine Liebe!«, sagte Margarethe und nahm ihre Enkelin in die Arme. »Konntest du denn einigermaßen schlafen?«
Amelie überlegte kurz und sagte dann: »Naja, es ist anders hier ohne Mutter. Ich kann im Moment nicht so gut schlafen. Aber weißt du was?«, fragte Amelie und schaute ihre Großmutter mit großen Augen an. »Als ich heute Morgen aufgewacht bin, da hatte ich einen ganz eigenartigen Zimtgeschmack im Mund und mein ganzes Zimmer hat nach Zimt gerochen. Und Vater glaubt mir das einfach nicht!«, rief sie und musste dabei lachen.
Sie bemerkte nicht, dass ihrer Großmutter bei diesen Sätzen fast alle Gesichtszüge entglitten und diese sich mächtig zusammenreißen musste, sich nichts anmerken zu lassen.
»Das habe ich nie gesagt!«, lachte Anton und drückte dabei seiner Schwiegermutter einen Kuss auf die blass gewordene Wange. »Ich habe nur gesagt, dass ich in deinem Zimmer nichts rieche oder schmecke.« Dann ging er Richtung Kaffeemaschine und nahm die Kanne mit an den Küchentisch. »Mmh! Der frische Kaffee duftet herrlich. Kann ich dir auch was einschenken, Margarethe?«, fragte Anton und goss sich schon einmal frischen Kaffee in seine Tasse ein.
»Ja, gerne. Mach das«, antwortet sie und wandte sich dann wieder ihrer Enkelin zu. »Amelie, was magst du trinken?«
»Ich mach mir einen Kakao«, überlegte Amelie und langte in den Küchenschrank. Als sie damit fertig war, das braune Pulver mit Milch zu verrühren, setzte sie sich damit an den Küchentisch. »Ich glaube, dass ich mir heute Mittag Eierkuchen mit Zimt und Zucker wünsche«, verkündete sie und biss nachdenklich in ihr Käsebrot.
»Das dürfte kein Problem sein«, sagte ihre Großmutter und lächelte.
Sie frühstückten ausgiebig, dann teilte Anton seine Entscheidung mit. »Amelie, ich werde gleich ins Krankenhaus zu deiner Mutter fahren. Ich habe gestern lange mit Doktor Brunner gesprochen…«, begann er.
»Ist das der mit der komischen Nase und dem weißen Schnauzbart?«, unterbrach Amelie ihren Vater. »Ja, genau, das ist er. Den kennst du ja schon von klein auf.«
Amelie erinnerte sich noch sehr gut an die erste Begegnung mit Doktor Brunner, er hatte ihr diese gruselige Spritze verpasst. Seitdem mochte sie ihn nicht mehr besonders, auch wenn er ihr damals noch so viele Wiedergutmachungsbonbons schenken wollte.
»Er unterstützt uns, dass wir Isabell heute nach Hause holen können«, erzählte er weiter.
Amelie hörte augenblicklich auf zu kauen und schaute erfreut auf. »Heute? Das ist ja toll! Dann muss es ihr ja schon wieder viel besser gehen!«, rief sie erfreut und sprang vor Freude von ihrem Stuhl auf.
»Nein, Amelie. So verhält es sich leider nicht«, schaltete sich Margarethe ein, die sah, wie machtlos ihr Schwiegersohn der Situation gegenüberstand. »Deine Mutter ist noch immer sehr, sehr krank. Aber wir halten es für das Beste, wenn sie in dieser schweren Zeit bei uns ist. Die Ärzte können ohnehin nicht viel ausrichten und hier fühlt sie sich wenigsten wohl.«
Anton schaute sie dankbar an. Er besaß gerade nicht die Kraft, gegen die plötzlich aufgekeimte Freude seiner Tochter anzukommen und diese zu ersticken. Amelie hielt erschrocken inne und hörte auf, um den Tisch zu tanzen. »Natürlich, das wäre ja auch irgendwie seltsam, wenn sie einfach so über Nacht wieder gesund wäre, nicht?«, flüsterte sie und verschwand traurig aus der Küche. Ihr Brot ließ sie liegen.
Margarethe schaute zu ihrem Schwiegersohn. »Ich kümmere mich um sie, Anton. Du kannst auf meine Hilfe zählen. Nun fahr schon los und hole meine Tochter nach Hause!«
Anton stand auf und umarmte sie zärtlich. »Ich danke dir. Danke, dass du so stark bist!« sagte er. »Ich wüsste nicht, wie ich das alleine schaffen sollte.«
Margarethe klopfte ihm fürsorglich die immer schmaler werdende Schulter. »Mein Junge, ihr habt mir mein zweites Leben geschenkt. Jetzt bin ich dran euch zu helfen. Ich werde alles tun, um euch zu helfen«, erklärte sie entschlossen. Anton griff nach seinem Schlüsselbund, zog sich an und verschwand durch die Haustür nach draußen. Margarethe sah ihm durch das Küchenfenster nach, wie er zwischen den tanzenden Schneeflocken verschwand und dann in sein Auto stieg. Dann wandte sie sich um und deckte den Frühstückstisch ab.
Ich muss helfen!
Rosa fühlte sich seltsam getrieben, innerlich unglaublich angespannt und war zutiefst verzweifelt. Die Gedanken an ihre beste Freundin ließen sie mittlerweile kaum noch schlafen. Eben hatte sie mit ihren Eltern versucht zu frühstücken, hatte aber kaum einen Bissen herunterbekommen. Sie überlegte, was sie tun könnte.
Es waren Winterferien und gestern hatte es endlich zu schneien begonnen. Normalerweise hätte sie große Lust gehabt Amelie zu besuchen, um mit ihr im Schnee zu toben. Das hatten sie bisher jeden Winter getan. Sie trafen sich dann bei Amelie und verbrachten den ganzen Tag im Schnee bis es dunkel wurde. Dort bauten sie die größten Schneemänner, und Amelies Mutter kam dann abends kurz dazu mit einer Handvoll Möhren und Kohlestücken, damit sie den weißen Gestalten ein Gesicht geben konnten. Doch diesen Winter war alles anders.
Vor etwa sechs Wochen hatte Amelie sie urplötzlich angerufen und bitterlich geweint. Sie erzählte ihr, dass ihre Mutter plötzlich stark bluten würde und hohes Fieber habe. Dann sei sie ins Krankenhaus gebracht worden. Seither hatte Rosa nur noch wenig von Familie Schwarz gehört und traute sich auch nicht dort anzurufen. Sie hatte Angst, etwas Falsches zu sagen. Sicherlich nerve ich dann nur alle, dachte sie. Und reden will Amelie jetzt bestimmt auch nicht, sonst würde sie sich doch melden? Nun dachte Rosa verzweifelt darüber nach, wie sie ihr eine Hilfe sein konnte. Mit jedem Tag trieben sie die Gedanken der Hilflosigkeit und Ohnmacht immer mehr an. Es wurde zu einer quälenden Gewissheit, dass sie handeln musste. Wir sind doch beste Freundinnen, dachte sie, da muss ich ihr doch irgendwie helfen! Sie entschied sich dann doch, bei Familie Schwarz anzurufen und tippelte ins Wohnzimmer, wo das Telefon stand. Es tutete genau zweimal, dann meldete sich Großmutter von Hellingen am anderen Ende der Leitung.
»Hier ist Rosa, ich wollte wissen, wie es Amelie geht? Sie war so lange nicht mehr in der Schule und eigentlich würden wir jetzt die Winterferien zusammen verbringen, aber ich höre einfach gar nichts mehr von ihr. Das ist alles so schrecklich! « Am anderen Ende wurde es still, dann vernahm sie ein Seufzen.
»Rosa, wie schön, dass du dich meldest. Amelie ist gerade in ihr Zimmer gegangen. Weißt du, es geht ihr den Umständen entsprechend. Anton wird Isabell heute nach Hause holen, da die Ärzte nicht viel tun können, und so ist sie wenigstens bei uns«, erzählte Amelies Großmutter.
Rosa überlegte kurz. »Ich vermisse Amelie ganz schrecklich und würde ihr so gerne helfen! Was kann ich denn bloß tun?«
»Du kannst da nicht viel tun. Komm mal vorbei und rede mit ihr, wenn du für sie da sein möchtest, aber ansonsten müssen wir das hier irgendwie selbst durchstehen«, antwortete Margarethe der besten Freundin ihrer Enkelin.
Rosa genügte das nicht und sie sprach nun etwas lauter: »Sie verstehen das nicht! Ich muss etwas tun für Amelie, sonst werde ich verrückt! Ich kann seit Tagen nicht mehr schlafen und fühle mich so nutzlos. Ich würde alles für sie tun, damit es ihr oder ihrer Mutter wieder besser geht! Es muss doch irgendetwas geben, was ich machen kann!«, rief sie unglücklich.
Einige Sekunden der Stille vergingen. Rosa glaubte schon, sie habe sich vollkommen falsch verhalten, als Amelies Großmutter ihre Meinung plötzlich änderte. »Ich denke, ich weiß, was du für Amelie tun könntest, meine Kleine«, sagte sie da plötzlich. »Komm einfach mal heute Abend vorbei!«
Die kleine Rosa konnte am anderen Ende der Leitung nicht sehen, dass die blassen Augen der alten Frau plötzlich anfingen zu funkeln. Und sie sah natürlich auch nicht, dass sie versuchte ein aufkeimendes Lachen zu ersticken. Sie konnte nur diese Stimme hören, die sie eigentlich schon lange kannte, die sich aber eben am Telefon plötzlich ganz anders angehört hatte.
Ein seltsames und diffuses Gefühl beschlich Rosa, als sie den Hörer wieder auflegte.
3
Er spürte, dass es nicht mehr lange dauern konnte.
Ein angenehmes Gefühl der Befriedigung überkam ihn, und sein eisiger Blick verfing sich zufrieden an der feuchten Decke, die sich tropfend über ihm ergoss. An die Kälte hatte er sich schon lange gewöhnt, er brauchte die Wärme nicht mehr. Ein dicker Tropfen fiel schwer auf seine lange Nase und blieb daran haften. Jeder einzelne Tropfen erinnerte ihn daran, wo er war und dass er hier nicht hingehörte. Jedes Mal, wenn einer dieser Tropfen auf dem Boden aufkam, war es, als ob dieses klare Geräusch ihn erinnern wollte. Ein leises Rufen aus der Dunkelheit, das sich für ihn anfühlte, als ob sich jedes Mal ein langer Dorn durch sein Herz bohren würde. In dieser Zeitlosigkeit wusste er nicht, wie lange er hier schon hauste, aber es fühlte sich an wie die Unendlichkeit. Eine Ewigkeit voller dunkler Gedanken an diese einzige Person, die ihn hierhergebracht und seiner Zukunft beraubt hatte. Die dafür gesorgt hatte, dass man ihn ausgestoßen und verurteilt hatte. »Ihre Schuld… Es ist alles ihre Schuld!«, gurgelte er wütend und blickte sich in seinem kühlen Reich um. »Alles hat sie mir genommen!« Blinder Zorn durchflutete ihn. Er konnte es kaum noch aushalten, sich endlich dafür zu rächen, was ihm wiederfahren war. Sein von Rache vergiftetes Blut pulsierte donnernd und brachte sein Herz zum Rasen.
Doch er musste noch etwas Geduld haben. Zitternd schloss er seine Augen und versuchte sich zu besinnen.
Vor seinem inneren Auge sah er seine Familie. Er sah, wie sie ihn klagend betrachteten. An seiner Seite lag sein sterbender Vater, der sich qualvoll in seinem eigenen Blut wälzte. In dieser Erinnerung war er klein und schwach. Er schaute ängstlich hoch in die zornigen Augen seiner Verwandten und flehte sie um Vergebung an. Doch er erkannte, dass er verloren war. Dann schlugen sie auf ihn ein und nannten ihn einen Bastard, sodass er sich panisch an die blutverschmierte Brust seines Vaters kauerte und betete, dass dieser erniedrigende Moment bald vorbei sein möge. Sie ließen von ihm ab. Einer von ihnen beugte sich ein letztes Mal tief über ihn. Er sagte: »Verschwinde hier du kleiner, elendiger Köter!«
Und so verschwand er und lief um sein Leben. Seinen toten Vater ließ er zurück, nahm aber die entsetzlichen Gefühle der Einsamkeit und des Hasses mit. Er durchlebte diese grausamen Erinnerungen wieder und wieder, und es war, als ob es soeben erst passiert war.
Nachdem er sich an seinen Erinnerungen geweidet hatte, riss er seine funkelnden Augen wieder auf. Nun fühlte er sich etwas ruhiger. Denn immer, wenn er sich seinen schmerzenden Gedanken stellte, wusste er wieder, was er zu tun hatte, und das entspannte ihn. Die erlösende Rache wird mir direkt in die Arme laufen, dachte er, und ein wohliges Kribbeln durchfuhr ihn, als er feststellte, wie einfach sein Plan doch eigentlich war.
In freudiger Erwartung an den Krieg, den er eröffnen wollte, stand er langsam auf und ging ruhig dem Ausgang entgegen, der sich an seine feuchte Behausung anschloss. Geschmeidig verließ er die Kälte und Finsternis und machte sich grinsend auf den Weg, um einem kleinen Mädchen den Kopf abzureißen.
Anton stand vor dem Krankenbett seiner Frau und überlegte fieberhaft, wie er sie überhaupt transportieren sollte. Er wollte gerade kehrtmachen, um Doktor Brunner zu suchen, als dieser plötzlich vor ihm stand.
»Herr Schwarz! Da sind Sie ja. Ich habe sie schon erwartet. Wir haben alles organisiert, damit ihre Frau jetzt nach Hause kann. Es wurde ihr ein starkes Beruhigungsmittel gespritzt. Das hält jetzt nicht sehr lange an, aber es wird für den Transport reichen«, plauderte er und erweckte in Anton den Eindruck, dass er es ausgesprochen eilig hatte, Isabell aus dem Krankenhaus zu bekommen.
»Sie scheinen es aber jetzt sehr eilig zu haben, Doktor Brunner!«
»Ja, wissen Sie, Sie haben Recht. Ich will Sie aber keineswegs loswerden, wirklich nicht! Nur ist es so: Scheinbar sickert etwas zur Presse durch. Irgendein vermaledeiter Patient, oder wer auch immer, muss Informationen an eine Zeitung weitergegeben haben. Wir hatten hier heute früh schon zig Anrufe von einer Reporterin, die sich für die unbekannte Erkrankung ihrer Frau interessiert. Herr Schwarz, ich möchte, dass Sie mit ihrer Frau hier ganz schnell verschwinden. Diese Person ist eine Blutsaugerin! Es ist ihr egal, wie es Ihnen oder Ihrer Frau geht. Sie will nur eine Sensation, und das ist das Letzte, was Sie und Ihre Familie jetzt gebrauchen können!«
Doktor Brunner verschwand kurz auf dem Flur und kam mit einem Rollstuhl wieder. Dann half er Anton, die bleiche Frau in den Rollstuhl zu hieven. »Ich denke, dass Sie den Rest alleine schaffen, Herr Schwarz. Ich komme morgen Abend nach meiner Schicht nochmal bei Ihnen vorbei und schaue nach Ihrer Frau. Wenn Sie zwischendurch irgendetwas brauchen, rufen Sie mich an. Jederzeit!« Mit diesen Worten drückte der Arzt Anton die Hand und wandte sich um.
Anton schaute ihm dankbar nach. Dann packte er die Tasche seiner Frau mit all den Habseligkeiten, die er ihr zuvor eingepackt hatte, und schob seine Isabell leise aus dem Krankenhaus, ohne sich dabei noch einmal umzublicken.
Eine junge Frau betrat den Eingangsbereich des Krankenhauses, das gerade von einem blassen Mann verlassen wurde, der seine offensichtlich kranke Frau hinausschob. Interessiert schaute sie dem traurigen Paar hinterher, dann konzentrierte sie sich wieder auf ihr Ziel. Sie hatte einen Notizblock in ihrer Hand und einen Kameramann im Schlepptau. Zielsicher ging sie auf das Krankenzimmer der Frau zu, die den anonymen Angaben zufolge, eine unbekannte Erkrankung haben soll. Die junge Frau erhoffte sich ihren persönlichen Durchbruch durch die Geschichte und stürmte selbstbewusst das Krankenzimmer.
Der Arzt Doktor Brunner betrachtete die Szenerie aus einigen Metern Entfernung. Er hätte der Journalistin natürlich schon vorher sagen können, dass die Patientin nicht mehr im Krankenhaus war, aber dann hätte er den wirklich amüsanten Wutausbruch der jungen Frau verpasst, und das wollte er sich wahrhaftig nicht entgehen lassen. »Das geschieht dir recht, du selbstgefälliges Stück Journalistendreck!«, grinste er, als er sah, wie sie sich über das leere Zimmer aufregte. Dann ging er schwingenden Schrittes auf die zeternde Frau zu, um ihr mitzuteilen, dass sie umsonst gekommen war. Und der Arzt freute sich darauf, diese Nachricht persönlich zu überbringen.
Als Anton im Auto saß, seine stark benebelte Frau an seiner Seite, musste er erst einmal tief durchatmen. Dieser Schritt, den er jetzt bereit war zu tun, machte ihm eine unglaubliche Angst. Er nahm sie tatsächlich mit! Er holte sich seine totkranke Frau einfach mit nach Hause, ohne zu wissen, wie er das eigentlich schaffen sollte. Ohne die Hoffnung auf Genesung. Ohne die geringste Ahnung, was sie hatte und wie gefährlich es für Amelie werden könnte. War es ansteckend? Würde Amelie traumatisiert werden, wenn sie ihre Mutter in diesem Zustand sah? Lauter Fragen jagten Anton wie unruhige Gespenster durch den Kopf und erschwerten ihm, einen klaren Gedanken fassen zu können. Verzweifelt griff er sich durch seine zotteligen Haare. Dann schloss er die Augen und versuchte sich zur Besinnung zu rufen, schließlich war sie noch nicht tot und Amelie war ein starkes Kind. Außerdem hatte er ja noch Margarethe, die ihm bei allem half. Oh, was täte er bloß ohne sie? Anton fühlte sich für einen kurzen Moment etwas besser und drehte sich zu seiner Frau um, die im Halbschlaf auf dem Beifahrersitz saß. »Isabell, wir fahren jetzt nach Hause«, flüsterte er, aber von seiner Frau kam nur ein leises Stöhnen. Er griff in seine Jackentasche und holte sein Handy heraus, um seine Schwiegermutter anzurufen. Es tutete nur kurz. »Margarethe? Ich bin's, Anton. Ich habe Isabell jetzt im Auto sitzen und fahre los. Machst du mir bitte gleich die Tür auf?« Margarethe fragte etwas. »Ja, danke und bis gleich.« Anton legte auf und startete den Wagen.
Margarethe sprang aufgeregt im Wohnzimmer hin und her. Ihre Gedanken überschlugen sich und sie wusste vor Aufregung nicht, was sie tun sollte. Dann fiel ihr ein, dass sie das Gästezimmer für Isabell noch herrichten musste. Schließlich konnte sie nicht einfach neben Anton im Ehebett schlafen. Sonst bekommt der Arme ja gar kein Auge zu, dachte sie und flitzte in die Wäschekammer, um frische Bettwäsche zu holen.





























