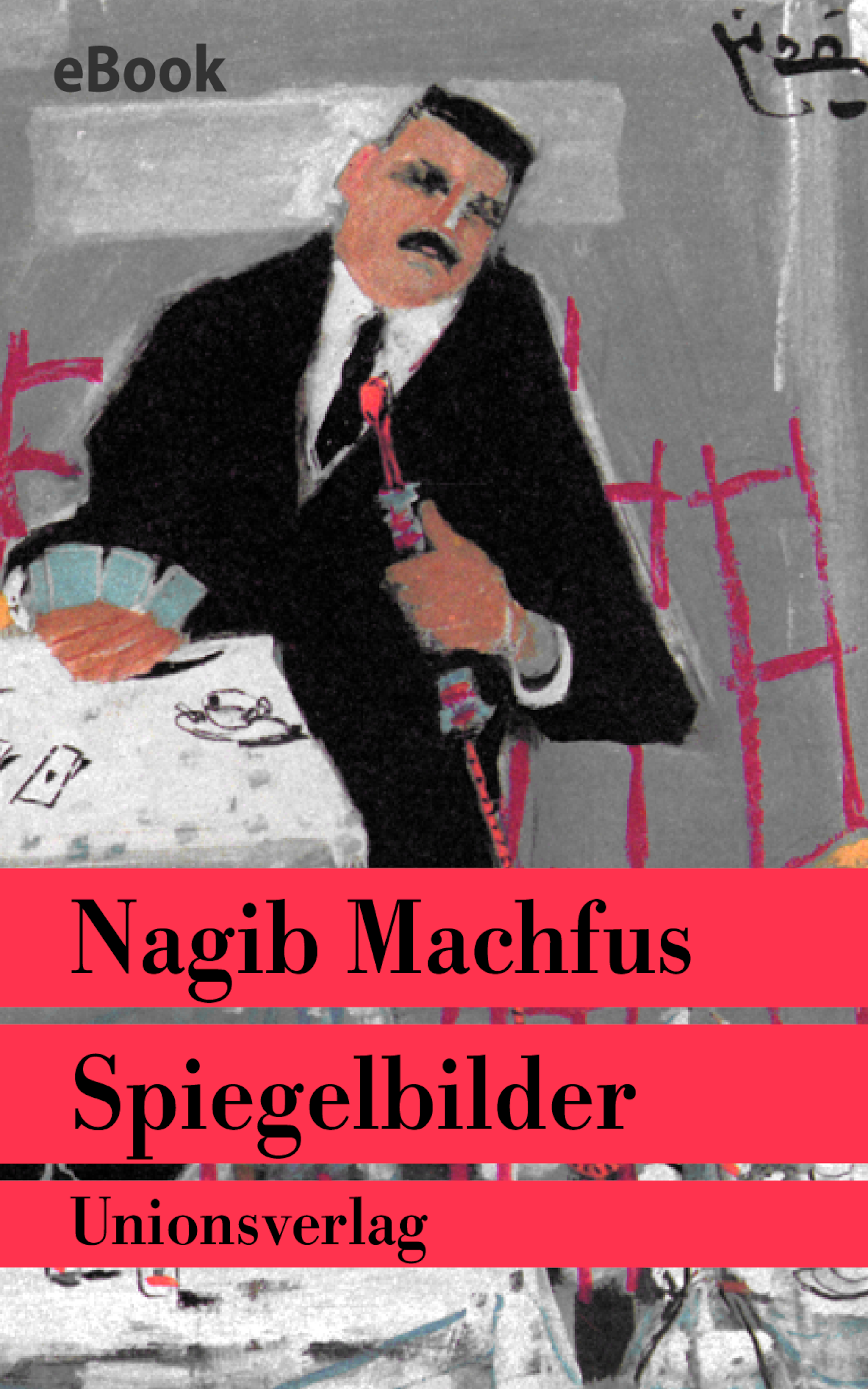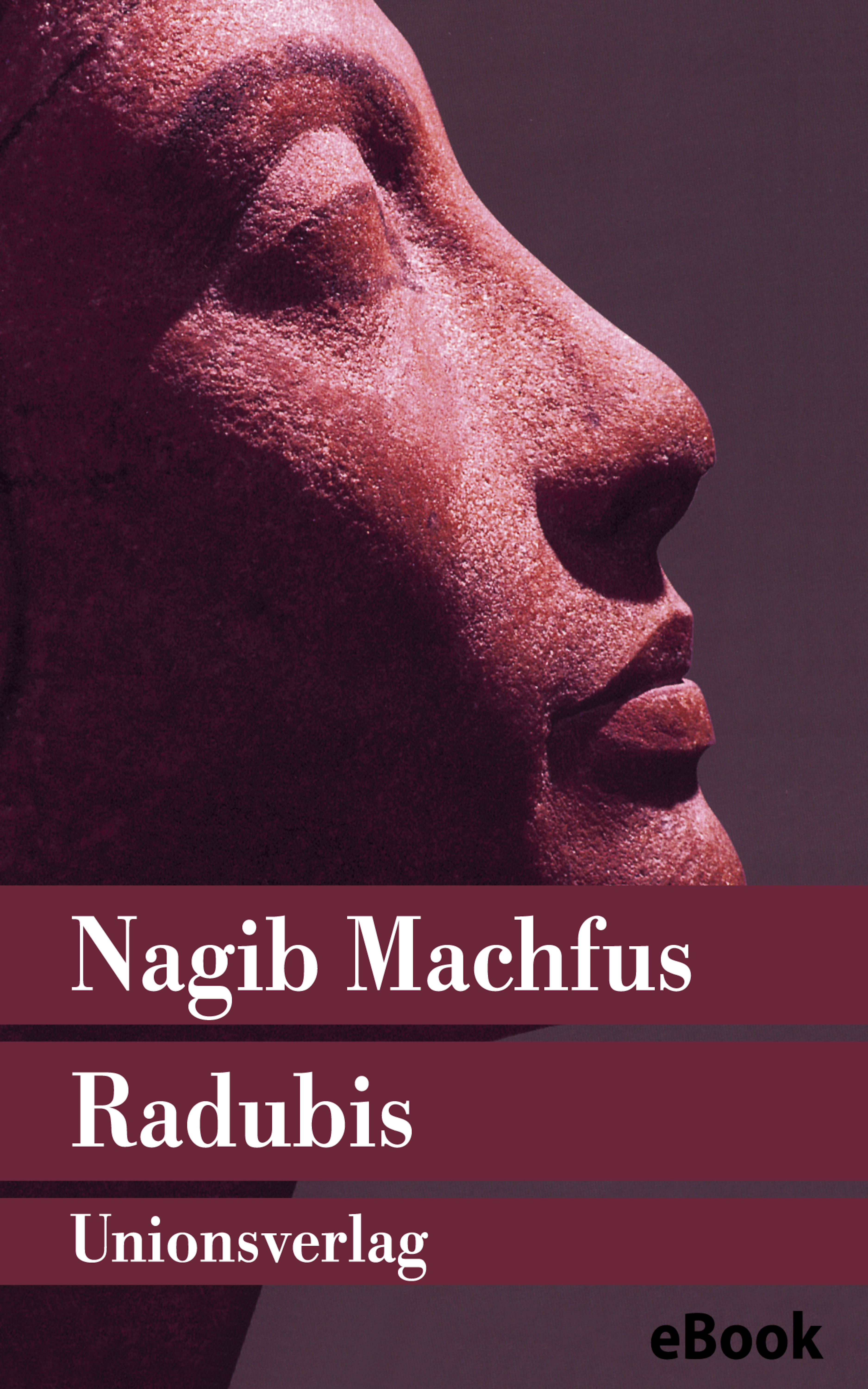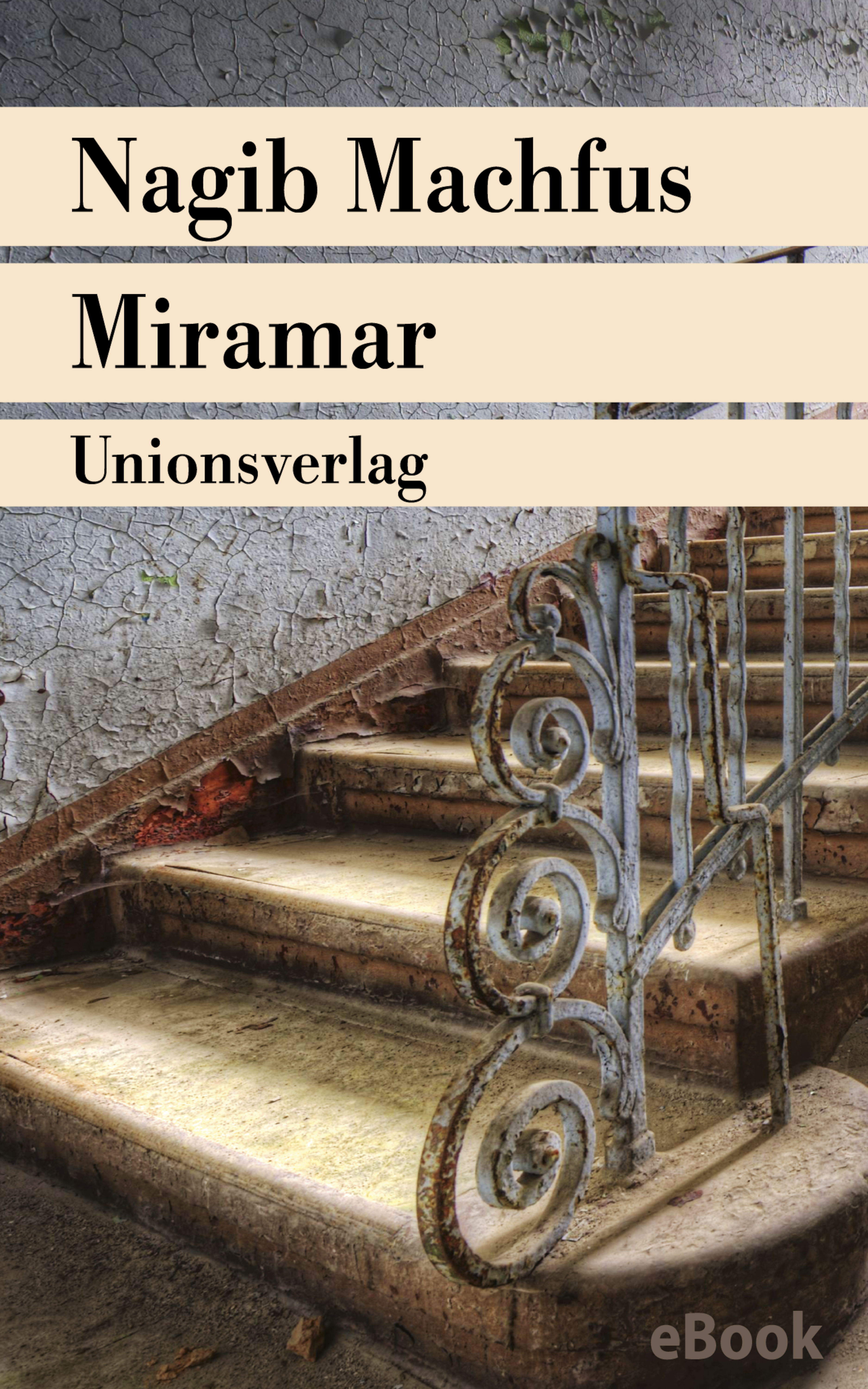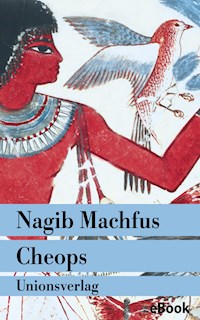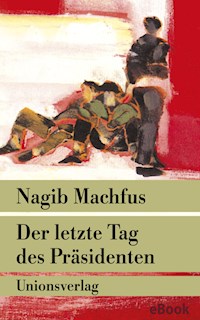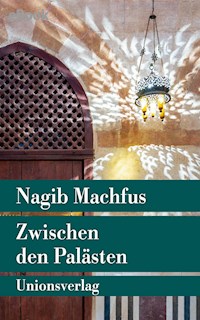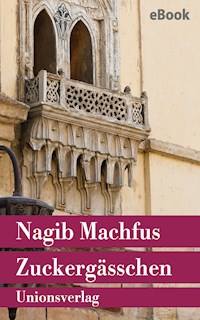
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Unionsverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der einst stolze Herrscher der Familie, Abd al-Gawwad, verfolgt, gealtert und durch Krankheit gezähmt, das Straßentreiben vor seinem Palast. Die gute alte Zeit ist für ihn dahin und die Kinder sind längst erwachsen: Chadiga lebt glücklich verheiratet in der Zuckerstraße; Aisha hat durch Typhus ihren Mann und ihre Söhne verloren; Yasin fühlt sich bei der ehemaligen Mätresse geborgen, während Kamal seine Leiden in den Armen einer Prostituierten zu stillen sucht. Als der Zweite Weltkrieg Ägypten erreicht, beginnt auch für Abd al-Gawwads Familie eine schwierige Zeit, die zur Zerreißprobe wird.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 638
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über dieses Buch
Gealtert und durch Krankheit gezähmt, verfolgt Abd al-Gawwad, der einst so stolze Herrscher der Familie, auf dem Balkon seines Palastes das Straßentreiben. Da erreicht der Zweite Weltkrieg Ägypten. Luftangriffe auf Kairo! Der Riss, der durchs Land geht, bricht auch in Abd al-Gawwads Familie auf.
Zur Webseite mit allen Informationen zu diesem Buch.
Nagib Machfus (1911–2006) gehört zu den bedeutendsten Autoren der Gegenwart und gilt als der eigentliche »Vater des ägyptischen Romans«. Sein Lebenswerk umfasst mehr als vierzig Romane, Kurzgeschichten und Novellen. 1988 erhielt er als bisher einziger arabischer Autor den Nobelpreis für Literatur.
Zur Webseite von Nagib Machfus.
Doris Kilias (1942–2008) arbeitete als Redakteurin beim arabischen Programm des Rundfunks Berlin (DDR). Nach der Promotion war sie als freie Übersetzerin tätig.
Zur Webseite von Doris Kilias.
Dieses Buch gibt es in folgenden Ausgaben: Taschenbuch, E-Book (EPUB) – Ihre Ausgabe, E-Book (Apple-Geräte), E-Book (Kindle)
Mehr Informationen, Pressestimmen und Dokumente finden Sie auch im Anhang.
Nagib Machfus
Zuckergässchen
Roman
Aus dem Arabischen von Doris Kilias
Die Kairo-Trilogie III
E-Book-Ausgabe
Unionsverlag
HINWEIS: Ihr Lesegerät arbeitet einer veralteten Software (MOBI). Die Darstellung dieses E-Books ist vermutlich an gewissen Stellen unvollkommen. Der Text des Buches ist davon nicht betroffen.
Impressum
Dieses E-Book enthält als Bonusmaterial im Anhang 6 Dokumente
Die arabische Originalausgabe erschien 1957 unter dem Titel as-Sukkariya in Kairo
Dritter Teil der Kairo-Trilogie
Die Übersetzung aus dem Arabischen wurde unterstützt durch die Gesellschaft zur Förderung der Literatur aus Afrika, Asien und Lateinamerika e. V. in Zusammenarbeit mit der Schweizer Kulturstiftung PRO HELVETIA
Ich danke Herrn Ahmed Ezzeldin für die hilfreiche Erläuterung schwieriger Textstellen. Doris Kilias
Originaltitel: as-Sukkariya (1957)
© by Nagib Machfus 1957
© by Unionsverlag, Zürich 2022
Alle Rechte vorbehalten
Umschlag: Erwin Wodicka (Shotshop.com)
Umschlaggestaltung: Martina Heuer
ISBN 978-3-293-30592-2
Diese E-Book-Ausgabe ist optimiert für EPUB-Lesegeräte
Produziert mit der Software transpect (le-tex, Leipzig)
Version vom 27.06.2022, 21:29h
Transpect-Version: ()
DRM Information: Der Unionsverlag liefert alle E-Books mit Wasserzeichen aus, also ohne harten Kopierschutz. Damit möchten wir Ihnen das Lesen erleichtern. Es kann sein, dass der Händler, von dem Sie dieses E-Book erworben haben, es nachträglich mit hartem Kopierschutz versehen hat.
Bitte beachten Sie die Urheberrechte. Dadurch ermöglichen Sie den Autoren, Bücher zu schreiben, und den Verlagen, Bücher zu verlegen.
Unsere Angebote für Sie
Allzeit-Lese-Garantie
Falls Sie ein E-Book aus dem Unionsverlag gekauft haben und nicht mehr in der Lage sind, es zu lesen, ersetzen wir es Ihnen. Dies kann zum Beispiel geschehen, wenn Ihr E-Book-Shop schließt, wenn Sie von einem Anbieter zu einem anderen wechseln oder wenn Sie Ihr Lesegerät wechseln.
Bonus-Dokumente
Viele unserer E-Books enthalten zusätzliche informative Dokumente: Interviews mit den Autorinnen und Autoren, Artikel und Materialien. Dieses Bonus-Material wird laufend ergänzt und erweitert.
Regelmässig erneuert, verbessert, aktualisiert
Durch die datenbankgestütze Produktionweise werden unsere E-Books regelmäßig aktualisiert. Satzfehler (kommen leider vor) werden behoben, die Information zu Autor und Werk wird nachgeführt, Bonus-Dokumente werden erweitert, neue Lesegeräte werden unterstützt. Falls Ihr E-Book-Shop keine Möglichkeit anbietet, Ihr gekauftes E-Book zu aktualisieren, liefern wir es Ihnen direkt.
Wir machen das Beste aus Ihrem Lesegerät
Wir versuchen, das Bestmögliche aus Ihrem Lesegerät oder Ihrer Lese-App herauszuholen. Darum stellen wir jedes E-Book in drei optimierten Ausgaben her:
Standard EPUB: Für Reader von Sony, Tolino, Kobo etc.Kindle: Für Reader von Amazon (E-Ink-Geräte und Tablets)Apple: Für iPad, iPhone und MacModernste Produktionstechnik kombiniert mit klassischer Sorgfalt
E-Books aus dem Unionsverlag werden mit Sorgfalt gestaltet und lebenslang weiter gepflegt. Wir geben uns Mühe, klassisches herstellerisches Handwerk mit modernsten Mitteln der digitalen Produktion zu verbinden.
Wir bitten um Ihre Mithilfe
Machen Sie Vorschläge, was wir verbessern können. Bitte melden Sie uns Satzfehler, Unschönheiten, Ärgernisse. Gerne bedanken wir uns mit einer kostenlosen e-Story Ihrer Wahl.
Informationen dazu auf der E-Book-Startseite des Unionsverlags
Inhaltsverzeichnis
Cover
Über dieses Buch
Titelseite
Impressum
Unsere Angebote für Sie
Inhaltsverzeichnis
ZUCKERGÄSSCHEN
1 – Die Köpfe schoben sich über dem Kohlebecken zusammen …2 – Die Bücher durchsehen, die Rechnungen kontrollieren, die Bilanz …3 – Der Freitag war der Tag, an dem die …4 – In der überfüllten Straßenbahn gab es kaum noch …5 – Für Achmed Abd al-Gawwad bot das Haus von …6 – In einer der Nischen in Achmed Abduhs Kaffeehaus …7 – Ein guter Platz, auch wenn du dir nicht …8 – Radwan war, als er langsam durch die Ghurija …9 – Das Haus von Abd ar-Rahim Pascha Isa lag …10 – Wie an jedem Donnerstag versammelte sich nach dem …11 – In Muski herrschte fürchterliches Gedränge. Nicht nur …12 – Gegen acht Uhr abends kehrte Abd al-Munim ins …13 – Endlich hatte Achmed die Straße gefunden, die zum …14 – Kamal saß im Arbeitszimmer, als Umm Hanafi hereinkam …15 – Die Zeitschrift Der Gedanke war in der Nummer …16 – Die neuen Freunde verabschiedeten sich am Ataba-Platz …17 – Eingehüllt in den warmen Mantel, kehrte Abd al-Munim …18 – Im alten Haus in der Baina l-Kasrain gab …19 – Gleich am nächsten Tag stattete Aischa dem Zuckergässchen …20 – Wie soll man die Natur genießen, wenn in …21 – Im Haus von Abd ar-Rahim Pascha Isa herrschte …22 – Gemächlichen Schritts und schwer auf den Stock gestützt …23 – In der Ghurija-Gasse wurden die Läden geschlossen …24 – Im Zuckergässchen, genauer gesagt, in der Wohnung von …25 – Achmed saß im Lesesaal der Universitätsbibliothek, vertieft in …26 – Obwohl Jasin dagegen ankämpfte, hielt ihn Unruhe gefangen …27 – Herr Abd al-Gawwad saß in einem bequemen Sessel …28 – Bedeutsam und denkwürdig – so sollte Chadiga im …29 – Achmed hatte zwar ohne große Mühe in al-Maadi …30 – Wahrscheinlich habe ich einen Fehler gemacht«, sagte Ismail …31 – Im Lauf der Zeit hatte der Alltag im …32 – Was für ein kalter Winter! Es hatte schon …33 – Am späten Nachmittag kam Kamal ins Zuckergässchen und …34 – Jussuf al-Gamil kam nur ein- oder zweimal in …35 – Guten Abend, Tantchen«, sagte Kamal und geleitete Frau …36 – Erst morgens um halb drei verließ Kamal Galilas …37 – Es war schon spät, als Kamal die Besucher …38 – Mein Herr ist gegangen, mein Heim, vertraut aus …39 – Ich werde, im Vertrauen auf Gott, um die …40 – Es war kalt, und das feuchte Wetter machte …41 – Zwanzig Minuten vor Beginn des Vortrags war der …42 – Kamal saß inmitten der Studenten und Studentinnen des …43 – Der Teegarten, mit dem Himmel aus Ästen und …44 – Es geht um den Ruf der Familie …45 – Was für entsetzliche Unschlüssigkeit! Ein Zustand wie eine …46 – Karima, im Brautkleid, fuhr in Begleitung von Eltern …47 – Kamal schlenderte durch die Fuad-Straße. Es war Freitagmorgen …48 – Besorgt fragte Chalo, der Besitzer der »Stern«-Taverne in …49 – Chadiga fühlte sich oft einsam. Seit ihr Gatte …50 – In der Villa von Abd ar-Rahim Pascha Isa …51 – An der Kreuzung der Scharif- und Kasr-an-Nil-Straße …52 – Durch die Stille der späten Nacht drang der …53 – Der Ruf zum Gebet drang durch die morgendliche …54 – Der Arzt ging hinaus, Kamal folgte schweigend …Über Nagib MachfusMehr über dieses Buch
Über Nagib Machfus
Nagib Machfus: Das Leben als höchstes Gut
Nagib Machfus: Rede zur Verleihung des Nobelpreises 1988
Tahar Ben Jelloun: Der Nobelpreis hat Nagib Machfus nicht verändert
Erdmute Heller: Nagib Machfus: Vater des ägyptischen Romans
Gamal al-Ghitani: Hommage für Nagib Machfus
Hartmut Fähndrich: Die Beunruhigung des Nobelpreisträgers
Über Doris Kilias
Andere Bücher, die Sie interessieren könnten
Bücher von Nagib Machfus
Zum Thema Ägypten
Zum Thema Arabien
Zum Thema Großstadt
1
Die Köpfe schoben sich über dem Kohlebecken zusammen, die Hände streckten sich über der Glut aus: Aminas mager und stark geädert, Aischas wie aus Stein gemeißelt, Umm Hanafis mit der Haut einer Schildkröte. Doch es gab auch ein strahlend weißes, schönes Händepaar – das von Naima. Die Januarkälte wollte sich schier als Eis im Salon festsetzen, jenem Raum, der mit den bunten Matten und den Kanapees sein altes Aussehen bewahrt hatte. Einzig die alte Gaslampe gab es nicht mehr, stattdessen strahlte elektrisches Licht von der Decke herab. Nicht nur die Kaffeerunde wurde wieder im ersten Stockwerk abgehalten, sondern alles Leben spielte sich nun unten ab, konnte doch damit dem Vater geholfen werden, dessen schwaches Herz es nicht mehr erlaubte, die steile Treppe hinaufzusteigen. Auch die anderen Mitglieder der Familie waren von tiefgehenden Veränderungen gezeichnet. Amina war abgemagert, ihr Haar leuchtete schlohweiß. Obwohl sie die sechzig noch nicht erreicht hatte, sah sie wie eine Siebzigjährige aus, was aber unerklärlich war, verglich man Aminas Zustand mit dem Aischas, der von Zusammenbruch, ja, Verfall sprach. War es zum Lachen oder zum Weinen, dass sie noch immer blondes Haar und blaue Augen hatte? Denn ihr Blick wirkte wie erloschen, ließ einen kaum glauben, dass noch Leben in ihr war. Die blasse Haut – von welcher Krankheit kündete sie? Dieses Gesicht, in dem die Knochen scharf hervortraten, die Augen in tiefen Höhlen lagen und die Wangen eingefallen waren – sollte das das Gesicht einer Frau von vierunddreißig Jahren sein? Doch da war noch Umm Hanafi, und sie schien trotz aller Bejahrtheit nichts von ihrer Kraft verloren zu haben. Beleibt wie eh und je, schob sich das Fett an Nacken und Kinn zu Polstern und Wulsten zusammen. Ihr ernster Blick aber sprach davon, wie sehr sie die stille Trauer der Familie teilte. Naima wirkte in diesem Kreis wie eine frische Rose, die an einem Grab blüht. Ein schönes Mädchen von sechzehn Jahren, und mit dem blonden Haarschopf und den blauen Augen war sie hübsch wie Aischa in ihrer Jugend, vielleicht sogar noch reizvoller. Doch zart und schlank gewachsen, hatte sie etwas vom durchscheinenden Wesen eines Gespensts. Die Augen blickten sanft und träumerisch drein, sprachen von Unschuld und Naivität, als fühlte sie sich fremd in dieser Welt. Sie schmiegte sich an ihre Mutter, wollte sich keinen Moment von ihr trennen.
Umm Hanafi rieb die Hände über dem Kohlebecken und sagte: »In dieser Woche werden die Bauleute fertig, nach anderthalb Jahren.«
»Das Haus von Amm Bajumi, einem Saftverkäufer«, machte sich Naima lustig.
Aischa blickte kurz auf, ohne aber etwas zu bemerken. Seit Langem war bekannt, dass das Haus, das einst Herrn Mohammed Radwan gehörte, abgerissen werden sollte und Amm Bajumi ein neues, vierstöckiges bauen wollte. Alte Erinnerungen stiegen auf – Marjam und Jasin, und wo mochte Marjam heute sein? Marjams Mutter und Amm Bajumi, der es teils durch Erbschaft, teils mit Geld geschafft hatte, als einfacher Saftverkäufer sich des Hauses zu bemächtigen. Damals – das waren noch Zeiten, die es lohnte zu leben, Tage, in denen das Herz noch sorglos schlug.
»Das Schönste, meine Herrin«, fuhr Umm Hanafi fort, »ist das neue Geschäft von Amm Bajumi, mit Säften, Eis und Süßigkeiten, und alles ist voller Spiegel und elektrischer Lampen, und das Radio spielt Tag und Nacht. O weh, die anderen, Friseur Hassanein, Bohnenverkäufer Darwisch, Milchmann al-Fuli, Röstereibesitzer Abu Sari, sie alle stehen in ihren schäbigen Läden und starren zum Geschäft und Haus ihres alten Kameraden hinüber.«
Amina zog das Tuch straffer über die Schultern. »Dank deinem Gott, dass er dir genügend Gutes tut.«
Naima umschlang ihre Mutter mit den Armen. »Das Gebäude versperrt von einer Seite die Dachterrasse; wenn da lauter Leute wohnen, wie sollen wir dann noch oben sitzen und plaudern?«
Um Aischa zu schonen, wollte Amina die Frage der Enkelin nicht einfach überhören, und so erwiderte sie: »Was gehen dich die neuen Bewohner an? Tu einfach das, was dir gefällt.« Sie schaute verstohlen zu Aischa hinüber, um zu sehen, wie diese die wohlwollende Antwort aufnahm. Es war, als fühlte sie vor lauter Angst um Aischa schon wieder Furcht vor ihr. Aber Aischa war damit beschäftigt, in den Spiegel über der Anrichte zu schauen, die zwischen dem Zimmer des Vaters und ihrem stand. Noch immer besah sie sich gern in Spiegeln, auch wenn es sinnlos geworden war. Im Verlauf der Zeit hatte sie sich daran gewöhnt, vor dem ausgemergelten Gesicht nicht mehr zu erschrecken. Wann immer eine innere Stimme sie nach der Aischa von einst fragte, fiel als Antwort die Gegenfrage, wo denn Mohammed, Othman und Chalil geblieben seien. Wenn Amina Aischa beobachtete, verkrampfte sich ihr Herz, und es dauerte nicht lange, da spürte auch Umm Hanafi Beklemmung, gehörte sie doch so sehr zur Familie, dass deren Sorgen auch sie bedrückten.
Naima erhob sich und ging zum Radio, das zwischen Salon und Esszimmer stand. Sie stellte es an und sagte: »Jetzt kommt Schallplattenmusik, Mama.«
Aischa zündete sich eine Zigarette an und zog heftig. Amina sah dem Rauch nach, der über dem Kohlebecken als kleines Wölkchen schwebte. Im Radio sang jemand: »Gefährten aus schönen Zeiten, wie gern säh ich euch wieder …«
Naima kehrte auf ihren Platz zurück, strich sich das Kleid glatt. Wie ihre Mutter, damals, in unbekümmerten Tagen, liebte auch sie den Gesang. Sie verstand, genau hinzuhören, sich die Melodie zu merken und sie mit hübscher Stimme wiederzugeben. Dieses Vergnügen wurde nicht durch die tiefe Gläubigkeit gedämpft, die ansonsten all ihr Fühlen beherrschte. Sie betete mit Eifer, hielt seit dem zehnten Lebensjahr das Fasten im Ramadan streng ein, sann verträumt über die Welt des nicht Fassbaren nach und stimmte mit übergroßer Freude zu, wenn die Großmutter sie zum Besuch der Grabstätte al-Hussains einlud. Trotzdem hätte sie nie aufs Singen verzichten wollen, und wann immer sie allein war, in ihrem Zimmer oder im Bad, tat sie es auch.
Aischa war mit allem einverstanden, was ihre Tochter, das einzige Licht der Hoffnung am dunklen Horizont, machte. Sie bewunderte ihre tiefe Gläubigkeit ebenso wie ihren Gesang, und auch in ihrer Anhänglichkeit, die grenzenlos zu sein schien, ermunterte sie sie; sie mochte es so sehr, dass sie keinerlei Bemerkung darüber ertragen konnte. Überhaupt vertrug Aischa keine Kritik, selbst wenn es dabei um Belangloses ging und in bester Absicht geäußert wurde. Dabei bot sie viel Anlass zu Unmut, denn sie tat nichts im Haus, hockte nur herum, trank Kaffee und rauchte. Bat die Mutter sie tatsächlich einmal um Hilfe, und zwar nicht so sehr, weil sie sie brauchte, sondern um Aischa aus ihren Grübeleien herauszureißen, dann reagierte sie verärgert und sprach den schon berühmten Satz: »Uff, lass mich in Ruhe!«
Auch Naima durfte keine Hand rühren, als fürchtete Aischa bei der geringsten Bewegung um sie. Wäre es möglich gewesen, statt ihrer zu beten, hätte es Aischa, um ihr die Mühe zu sparen, getan. Wie oft hatte die Mutter darüber schon mit ihr gesprochen, auch gesagt, dass Naima eine »Braut« sei und sich deshalb mit den häuslichen Pflichten vertraut machen müsse. Aber auf so etwas erwiderte Aischa nur mit deutlichem Unwillen: »Siehst du nicht, dass sie zart wie ein Gespenst ist? Meine Tochter verträgt keine Anstrengung, also lass sie in Frieden. Sie ist mein einziger Trost in dieser Welt.«
Amina beharrte nicht auf ihrer Meinung. Mit Trauer im Herzen bangte sie um Aischa, und wenn sie sie betrachtete, sah sie in ihr die fleischgewordene Enttäuschung aller Hoffnungen. Beim Anblick dieses unglücklichen Gesichts, das nur noch von der Sinnlosigkeit des Lebens sprach, wurde ihre Seele von tiefem Kummer ergriffen. Deshalb vermied sie es, Aischa zu behelligen, wie sie sich auch daran gewöhnte, großzügig alle Grobheiten und bissigen Bemerkungen zu überhören.
Noch immer tönte die Stimme im Radio: »Gefährten aus schönen Zeiten …« Aischa rauchte und hörte zu. Sie liebte dieses Lied von jeher. Aller Schmerz, alle Verzweiflung hatten ihr die Melodie nicht verleiden können, ja, vielleicht erfasste sie sie erst jetzt richtig, weil unendliche Trauer, unermessliches Leid darin mitschwangen. Daran änderte auch das Wissen nichts, dass keine Macht der Welt imstande war, die Gefährten aus guter alter Zeit zurückzubringen. Zuweilen fragte sich Aischa sogar, ob es die gute alte Zeit überhaupt gegeben hatte, ob nicht alles ein Traum, ein Wahn gewesen war. Wo war das von lustigem Treiben erfüllte Haus? Wo der gütige Gatte? Wo Othman? Wo Mohammed? Sollten wirklich nur acht Jahre vergangen sein?
Amina fand selten Gefallen an solchen Liedern. Ihrer Meinung nach bestand der Nutzen eines Radios zuallererst darin, dass ihr die Möglichkeit geboten wurde, die Koran-Rezitation und die Nachrichten zu hören. Die schwermütigen Lieder machten sie traurig, und sie bekam Angst, wenn Aischa ihnen immer wieder lauschte. Ja, eines Tages hatte Amina sogar Umm Hanafi gefragt: »Findest du nicht auch, dass das wie eine Totenklage klingt?« Da all ihre Sorge Aischa galt, kümmerte sie sich nur wenig um sich selbst, zum Beispiel um die Beschwernisse, die ihr der Blutdruck verursachte. Ihre einzige Freude bestand darin, die Grabstätte al-Hussains und anderer Heiliger aufzusuchen. Dank der Großzügigkeit des Herrn Gemahls, der ihr den Ausgang nicht mehr verbot, durfte sie ganz nach Belieben die Gotteshäuser aufsuchen. Doch sie war nicht mehr die Amina früherer Zeiten; Kummer und Unwohlsein hatten sie sehr verändert. Ihren bewunderungswürdigen Fleiß, die erstaunliche Fähigkeit, alles zu ordnen, zu pflegen und zu planen, hatte sie verloren. Außer um den Herrn Gemahl und Kamal kümmerte sie sich um nichts mehr. Die Küche und den Ofenraum hatte sie Umm Hanafi anvertraut und begnügte sich mit der Beaufsichtigung, wobei sie selbst darin nachlässig war. Sie brachte Umm Hanafi unendliches Vertrauen entgegen, war sie doch für Familie und Haus lebenslange Gefährtin in Glück und Unglück. Umm Hanafi hatte sich so sehr in die Familie eingefügt, dass sie ein Teil von ihr geworden war und von ganzem Herzen deren Freud und Leid teilte.
Für eine Weile herrschte Schweigen, als stünden noch alle unter dem Eindruck des Lieds. Schließlich brach Naima die Stille. »Ich habe heute meine Freundin Salma aus der Grundschule getroffen. Nächstes Jahr wird sie das Abitur machen.«
»Wenn dein Großvater dir erlaubt hätte, weiter zur Schule zu gehen, hättest du sie überrundet«, wehrte Aischa unwillig ab. »Aber nein, er musste es dir ja verbieten.«
Amina hörte sehr wohl den Protest heraus, sodass sie sich bemüßigt fühlte zu sagen: »Ihr Großvater hat seine Ansichten, und von denen geht er nicht ab. Wärst du etwa einverstanden gewesen, die Kleine weiter zur Schule zu schicken, obwohl du weißt, dass sie, zart, wie sie ist, keinerlei Anstrengung verträgt?«
Aischa schüttelte den Kopf, ohne etwas zu sagen. Aber Naima seufzte: »Ich hätte gern weitergemacht. Alle Mädchen gehen heutzutage genauso lange zur Schule wie die Jungens.«
»Doch nur, weil sie keinen Bräutigam finden«, warf Umm Hanafi verächtlich ein. »Aber wenn eine so hübsch ist wie du …«
Amina nickte zustimmend. »Du bist gebildet, meine kleine Prinzessin, hast den Grundschulabschluss. Was willst du mehr? Du hast es nicht nötig, eine Arbeit zu finden, also bitten wir Gott, dass er dich stärkt und deine bezaubernde Schönheit in Wohlergehen, Fett und Fleisch hüllt.«
»Gesund soll sie sein, aber nicht fett«, entgegnete Aischa scharf. »Dick sein ist heute ein Makel, vor allem für Mädchen. Ihre Mutter war früher ein Bild von Frau, ohne dick zu sein.«
Amina lächelte. »Deine Mutter, Naima, war wirklich die Zierde ihrer Zeit.«
»… bevor sie abschreckend wurde«, seufzte Aischa.
»Möge dich Gott mit seiner Huld erfreuen«, murmelte Umm Hanafi.
»Amen, und Dank dem Herrn der Welten«, sagte Amina und streichelte Naima zärtlich über den Rücken.
Es trat wieder Schweigen ein, und alle lauschten auf ein anderes Lied im Radio: »Am liebsten sähe ich dich Tag für Tag …« Plötzlich war zu hören, wie die Haustür geöffnet und wieder geschlossen wurde. »Der alte Herr«, sagte Umm Hanafi und lief eiligst hinaus, um Licht zu machen. Wenig später ertönte das vertraute Klopfen des Stocks, und als Herr Abd al-Gawwad an der Tür zum Salon erschien, standen alle höflich auf. Für einen Moment verharrte er, schaute die Frauen an, während er verschnaufte, und sagte schließlich: »Guten Abend.« Wie mit einer Stimme tönte es: »Einen glücklichen Abend auch Ihnen.«
Amina eilte voraus in sein Zimmer, und er folgte ihr mit der Würde des weißhaarigen Alters. Er setzte sich hin, um zu Atem zu kommen. Es war noch nicht einmal neun Uhr. An der früheren Eleganz mangelte es nicht – die Gubba aus feinem Tuch, der Kaftan aus Satin und die Kufija aus Seide, alles wie in alten Zeiten. Aber da – das schneeweiße Haar, der silbergraue Schnurrbart, der schlanke, entschlackte Körper, all das waren, wie auch die frühe Heimkehr, Anzeichen eines neuen Zeitalters. Darauf verwiesen zudem die Schüssel Joghurt und die Orange, die dem Herrn Gebieter als Abendmahlzeit vorbereitet worden waren. Kein Alkohol mehr, keine Appetithäppchen, kein Fleisch, keine Eier, auch wenn der Glanz der großen blauen Augen davon sprach, dass der Lebenswille noch nicht erschlafft war.
Wie gewohnt half Amina ihm beim Ablegen der Kleidung, dann streifte er den wollenen Gilbab über, hüllte sich in die Abaja ein und setzte das Käppchen auf. Er hockte sich aufs Kanapee und aß ohne alle Begeisterung das Abendessen. Amina reichte ihm ein Glas, das bis zur Hälfte mit Wasser gefüllt war, und er nahm ein Fläschchen Medizin und gab sechs Tropfen hinein. Widerwillig verzog er das Gesicht, schluckte alles hinunter und murmelte: »Lob sei Gott, dem Herrn der Welten.«
Oft genug hatte ihm der Arzt erklärt, dass er die Medizin zwar nur eine Zeit lang nehmen müsse, die Diät aber ständig einzuhalten habe. Immer wieder warnte er ihn davor, die Vorschriften nur saumselig zu beachten oder gar zu übergehen, denn der Blutdruck sei gefährlich hoch und das Herz bereits angegriffen. Die Erfahrung hatte Herrn Abd al-Gawwad gelehrt, den Anweisungen des Arztes Glauben zu schenken, denn immer, wenn er es nicht getan hatte, war es ihm schlecht bekommen. Kaum hatte er die ihm gesetzte Grenze überschritten, musste er umgehend dafür büßen. So hatte er sich schließlich dem Ratschlag des Arztes gefügt, aß und trank nur noch das, was ihm erlaubt worden war, und kehrte am Abend um neun Uhr heim. Doch insgeheim hegte er die Hoffnung, eines Tages – durch die Hilfe eines wie immer gearteten glücklichen Umstands – wieder gesund zu werden und sich eines guten, sorglosen Lebens zu erfreuen, auch wenn das pralle Leben der Vergangenheit ein für alle Mal vorüber war.
Entspannt lauschte er dem Gesang, der aus dem Radio herüberscholl, während Amina, wie immer auf der Matte zu seinen Füßen sitzend, über die Kälte und den Regen am Vormittag sprach. Er hörte nicht hin, stattdessen unterbrach er sie und erklärte freudig: »Man hat mir erzählt, dass heute Abend einige alte Lieder gebracht werden.«
Sie lächelte zustimmend, denn auch sie mochte diese Musik, allein schon deshalb, weil ihr Gebieter sie liebte. Für einen kurzen Moment glänzte Fröhlichkeit in seinen Augen, doch gleich darauf überkam ihn ein Schwächeanfall. Es sollte nicht sein, dass er ungestüme Freude empfand. Wann immer ihm danach war, kehrte sich das Glücksgefühl gegen ihn, und er wurde aus seinem Traum gerissen und in die Wirklichkeit zurückgestoßen. Die ließ ihn niemals und nirgendwo los, und die Vergangenheit blieb ein Traum. Was sollte ihn noch erheitern, wenn die Tage von Geselligkeit, Berauschtheit, Wohlergehen endgültig vorbei waren? Wohin hatte sich der Genuss an Essen, Trinken verflüchtigt? Was war aus seinem Gang, fest aufsetzend wie der eines Kamels, geworden, was aus seinem dröhnenden Lachen aus tiefster Tiefe? Wo gab es noch morgendliche Strahlen, die ihn, berauscht von vielfältigstem Vergnügen, beschienen? Jetzt hatte er um neun heimzukehren, damit er um zehn im Bett lag und schlief. Alles – Essen, Trinken, Gehen – stand, ärztlich verordnet, auf einem Papier. Hinzu kam, dass er dem von Schwermut erfüllten Haus Herz und Halt sein musste. Die arme Aischa, deren Unglück sich wie ein Dorn in sein Fleisch bohrte – er konnte nicht wiedergutmachen, was ihr das Leben vergiftet hatte, und schlimmer noch, er konnte ihrer Zukunft nicht gewiss sein. Hielt nicht das Morgen leidvolle Einsamkeit für sie bereit, wenn sie allein, ohne Vater und Mutter, auskommen musste? Er fühlte die ständige Bedrohung, dass sich sein gesundheitlicher Zustand noch verschlechtern könnte. Dann käme das, was er am meisten fürchtete – kraftlos wie ein Toter das Bett zu hüten, ohne tatsächlich, wie schon so viele seiner Freunde und Bekannten, tot zu sein. Wie Fliegen umsummten ihn die trüben Gedanken, sodass er Zuflucht zu Gott nahm und betete, ihn vor dem Übel zu bewahren. Ja, er wollte heute die alten Lieder hören, und sollte er dabei auch einnicken. »Lass das Radio spielen, selbst wenn ich einschlafe.«
Amina neigte den Kopf und lächelte.
»Das Treppensteigen fällt mir sehr schwer«, seufzte er.
»Sie sollten auf jedem Absatz verschnaufen, Herr.«
»Aber die Luft ist dort schrecklich feucht, und dann dieser verfluchte Winter …« Fragend schaute er auf sie hinunter. »Ich wette, du bist heute trotz der Kälte wieder zu al-Hussain gelaufen.«
Verschämt und auch ein wenig verlegen antwortete sie: »Besucht man Ihn, dann wird das Schwere wieder leicht, Herr.«
»Alles nur mein Fehler.«
Bemüht, den Gebieter versöhnlich zu stimmen, erklärte Amina: »Ich wandle um das hehre Grabmal und bete für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlergehen.«
O ja, auch er sollte aufrichtig beten. Alles Gute wendete sich von ihm ab, und selbst die kalte Dusche, mit der er sich morgens immer erfrischt hatte, wäre, wie es hieß, beim Zustand seiner Arterien gefährlich. Wenn alles Gute sich ins Schlechte verkehrt, dann gnade Gott!
Wenig später war zu hören, dass die Haustür ins Schloss fiel. Amina schaute auf und murmelte: »Kamal.«
Keine fünf Minuten, und Kamal trat ein, ohne den schwarzen Mantel abgelegt zu haben, in dem er noch länger und magerer als sonst aussah. Der sorgfältig gestutzte, dichte Schnurrbart verlieh ihm Würde und Männlichkeit. Durch die Gläser seiner goldumrandeten Brille schaute er zum Vater, dann beugte er sich zum Gruß über dessen Hand. Der forderte ihn auf, sich zu setzen, um gleich darauf lächelnd zu fragen: »Wo hast du gesteckt, Herr Professor?«
Kamal liebte diesen freundlichen, umgänglichen Ton ungemein, der ihm erst in vorangeschrittenem Alter zuteilwurde. Er setzte sich auf das Kanapee und erwiderte: »Ich war mit einigen Freunden im Café.«
Was mochten das für Freunde sein? Kamal wirkte viel zu ernst und gesetzt für sein Alter, und die meiste Zeit verbrachte er nur mit seinen Büchern. Wie sehr unterschied er sich von Jasin, auch wenn keiner von beiden ohne Fehler war. Noch immer lächelnd, fragte er: »Warst du heute beim Kongress der Wafd-Partei?«
»Ja. Mustafa an-Nahhas hat gesprochen, ein denkwürdiger Tag.«
»Man hat mir gesagt, dass es ein großartiges Ereignis sein würde, aber da ich nicht hingehen konnte, habe ich meine Einladung einem Freund gegeben. Meine Gesundheit lässt es nicht zu, dass ich mich belaste.«
Von Mitleid ergriffen, sagte Kamal leise: »Möge Gott dir wieder Kraft geben.«
»Gabs keine Vorfälle?«
»Nein, der Tag verlief friedlich. Im Unterschied zu sonst hat sich die Polizei mit der Überwachung begnügt.«
Erleichtert nickte der Vater, bevor er mit gehobener Stimme erklärte: »Sprechen wir über das alte Thema. Hältst du an deiner Meinung über Privatstunden fest?«
Noch immer fühlte sich Kamal verwirrt und unwohl, wenn er sich gezwungen sah, gegenüber dem Vater einen eigenen Standpunkt zu vertreten. Mit sanfter Stimme entgegnete er: »Wir hatten das Thema beendet.«
»Jeden Tag bitten mich Freunde, dass du ihren Kindern Privatunterricht gibst. Verachte nicht einen ehrbaren Broterwerb, Privatstunden werfen für Lehrer eine Menge ab. Die nach dir fragen, gehören zu den angesehenen Persönlichkeiten des Viertels.« Da Kamal mit keinem Wort darauf einging und sein Gesicht von höflicher Ablehnung sprach, fuhr der Vater mit Bedauern fort: »Du weigerst dich nur, weil du deine Zeit mit endlosem Lesen und brotlosem Schreiben vergeuden willst. Du bist ein kluger Mensch, ist das etwa vernünftig?«
»Du musst«, wandte sich die Mutter an Kamal, »das Geld genauso lieben wie das Wissen.« Und mit stolzem Lächeln sagte sie zum Herrn Gemahl: »Er ist wie sein Großvater. Über seine Liebe zum Wissen geht ihm nichts.«
»Schon wieder der Großvater«, stöhnte Herr Abd al-Gawwad. »Wahrscheinlich war er gar Imam Mohammed Abduh höchstpersönlich?!«
Da die Mutter über diesen Imam nichts wusste, erwiderte sie begeistert: »Warum nicht, Herr? Alle Nachbarn berieten sich mit meinem Vater, wenn sie über religiöse Dinge und weltliche Sachen etwas wissen wollten.«
Herr Abd al-Gawwad konnte nicht verhehlen, wie sehr ihn ihr Geschwätz amüsierte. Lachend erklärte er: »Solche wie ihn kannst du heute im Dutzend kriegen.«
Das Gesicht der Mutter kündete von Widerspruch, aber sie hielt den Mund. Kamal lächelte verlegen, dann entschuldigte er sich und ging hinaus.
Im Salon baute sich Naima vor ihm auf. Sie wollte unbedingt ihr neues Kleid holen, um es ihm zu zeigen. Also setzte er sich neben Aischa und wartete. Wie alle in der Familie verhielt er sich wegen Aischa besonders nett zu Naima. Doch davon abgesehen, hegte er für die Schönheit des Mädchens die gleiche Bewunderung, die er einst ihrer Mutter entgegengebracht hatte. Als Naima mit dem Kleid kam, breitete er es aus, betrachtete es eingehend, ganz so, als könne er nicht genug staunen. Liebevoll sah er Naima an, betroffen von dieser einzigartigen, unschuldigen Zartheit, von der geradezu ein Leuchten ausging.
Als er den Raum verließ, war ihm das Herz schwer. Eine Familie alt werden zu sehen, machte traurig. Es war quälend, den mächtigen, allgewaltigen Vater schwach und kraftlos zu erleben. Die Mutter welkte dahin, schützte bei Unwohlsein ständig ihr Alter vor. Und dann Aischa, die sich in ihrer selbstzerstörerischen Stimmung zusehends gehen ließ. Es lag etwas wie eine Warnung in der Luft, eine Ahnung von Unheil und Ende.
Kamal stieg hinauf ins zweite Stockwerk, in seine Wohnung, wie er es nannte. Dort lebte er für sich allein, bewegte sich zwischen Schlaf- und Arbeitszimmer, mit dem Blick auf die Baina-l-Kasrain-Straße. Er legte den Anzug ab, zog den Gilbab an, schlüpfte in den Morgenrock und ging hinüber ins Arbeitszimmer. Vor dem Holzerker stand ein großer Schreibtisch, und an beiden Seiten befanden sich Bücherregale. Er wollte zumindest noch ein Kapitel in Bergsons »Die zwei Quellen der Moral und der Religion« lesen und ein letztes Mal seinen monatlichen Beitrag für die Zeitschrift Der Gedanke durchsehen, in dem er sich mit dem Pragmatismus beschäftigte. Diese wenigen Stunden bis Mitternacht, die er der Philosophie widmete, gehörten zur glücklichsten Zeit des Tages. Da fühlte er sich, so sein Ausdruck, als menschliches Wesen. Die übrige Zeit, die er als Lehrer in der Silahdar-Grundschule verbrachte oder mit den verschiedensten Erfordernissen des Alltags füllte, stellte für ihn das Quantum dar, das der Absicherung und Befriedigung der Bedürfnisse diente und nur dem Tier verpflichtet war, das jedem, wie er meinte, im Verborgenen innewohnte. Weder liebte er seine »offizielle« Arbeit, noch achtete er sie. Aber diese Unzufriedenheit behielt er für sich, sprach schon gar nicht zu Hause darüber, um niemandem Anlass zur Schadenfreude zu geben. Dennoch war er ein ausgezeichneter Lehrer. Er erfreute sich großer Achtung, was sich auch daran zeigte, dass der Direktor ihm einige besondere Aufgaben übertragen hatte. Kamal machte sich über sich selbst lustig, indem er sich als Sklaven bezeichnete. War nicht jeder ein Sklave, der seiner Arbeit korrekt nachkam, obwohl er sie nicht ausstehen konnte? In der Tat, einzig der Ehrgeiz – ihm seit der Kindheit eigen – trieb ihn dazu, sich unermüdlich anzustrengen und vor anderen auszuzeichnen. Von Beginn an war er entschlossen gewesen, bei Schülern und Lehrern eine geachtete Persönlichkeit darzustellen. Das hatte er erreicht, ja, mehr noch, er war – trotz des gewaltigen Schädels und der enormen Nase – sogar beliebt. Diesem Aussehen oder, besser gesagt, dem schmerzlichen Bewusstsein seines Aussehens verdankte er zweifelsohne die Gnade starker Entschlossenheit, die ihn zu einer respektierten Persönlichkeit machte. Im Wissen darum, dass sein Schädel und seine Nase zum Spott herausforderten, war er seit jeher entschlossen gewesen, jede körperliche Verhöhnung, die er als Angriff auf seine Person verstand, zurückzuweisen. Gewiss, in mancher Unterrichtsstunde oder Pause konnte er nicht verhindern, dass es ein Zwinkern oder eine versteckte Andeutung gab, doch solchen Übergriff wehrte er mit aller Entschiedenheit ab, um ihn gleich darauf mit der ihm eigenen Milde zu lindern. Dank seiner Fähigkeit, den Schulstoff überzeugend darzustellen und verständlich zu machen, dank der Begeisterung, die ihn hier und da ergriff, wenn er interessante, begeisternde Fragen des Nationalbewusstseins aufwarf oder Erinnerungen an die Revolution heraufbeschwor – dank dieser Fähigkeiten galt ihm die allgemeine Anerkennung der Schüler. Abgesehen von der jähen Bereitschaft, energisch durchzugreifen, stellte die Zuneigung der Schüler den besten Garanten dafür dar, rebellische Verlockungen im Keim zu ersticken. Wie hatte es geschmerzt, als er das erste Zwinkern beobachten musste, wie schmerzlich stiegen in jenem Moment Erinnerungen an längst vergessen geglaubten Kummer auf. Doch letztendlich hatte er es geschafft, sich einer hohen Wertschätzung zu erfreuen, die die Schüler mit Bewunderung, Liebe und Ehrerbietung zu ihm aufschauen ließ.
Ein anderes Problem setzte ihm zu – der monatliche Beitrag für die Zeitschrift Der Gedanke. Hier hatte er nicht die Schüler, wohl aber den Direktor und die Lehrer zu fürchten. Die kritische Sicht auf gültige Normen und anerkannte Traditionen, mit der er alte und neue Themen der Philosophie behandelte, konnte ihren Unwillen hervorrufen und ihm schaden. Ein solches Tun vertrug sich nicht mit der Autorität eines Lehrers. Bisher hatte er Glück gehabt, denn unter den Verantwortlichen gab es keinen, der zu den Lesern der Zeitschrift gehörte. Vielleicht lag es daran, dass sie in einer geringen Auflage erschien. Nur tausend Exemplare wurden gedruckt, und von denen ging die Hälfte in andere arabische Länder. Die mangelnde Resonanz ermutigte ihn weiterzuschreiben, und so konnte er seinen Glauben an sich und seine Berufung hochhalten. In den Nachtstunden, die ihm allein gehörten, verwandelte er sich vom Lehrer der englischen Sprache in den Wanderer, der frei und ohne Grenzen die Gefilde des Denkens durchstreifte. Er las, dachte nach, notierte Gedanken, die er später in den Artikeln verwendete. Was ihn zu unermüdlichem Eifer trieb, waren Wissensdurst, Wahrheitsliebe, Neugier auf geistige Abenteuer, aber auch Sehnsucht nach Trost und Erlösung von Wehmut und Einsamkeit, beides in seinem Innern tief verwurzelt. Aus dem Alleinsein flüchtete er sich in die Einheit des Seins bei Spinoza, über die eigene Unbedeutendheit tröstete er sich durch die Mitwisserschaft um Schopenhauers Sieg über den Willen hinweg, das Maß seines Mitleids mit Aischas Unglück besänftigte er mit einem Schluck aus der leibnizschen Erklärung des Bösen, sein nach Liebe dürstendes Herz tränkte er mit der poetischen Sprachgewalt Bergsons. Doch so unablässig er sich auch mühte, er vermochte es nicht, der Ungewissheit die Krallen zu schneiden, die ihm Folterqualen bereiteten. Die Wahrheit erwies sich als ebenso kokette Geliebte wie eine Frau aus Fleisch und Blut. Sie zierte sich, verdrehte einem den Kopf, ließ einen zweifeln, machte eifersüchtig und gaukelte einem im gleichen Moment verführerisch Besitz und Vereinigung vor. Wie eine Geliebte war sie schillernd, launisch, wankelmütig, und nur allzu oft neigte sie zu List, Verrat, Grausamkeit, Hochmut. Kam am Ende nur Ratlosigkeit heraus, fühlte er keine Kraft mehr, dann sprach er sich Trost zu mit den Worten: »Ja, vielleicht leide ich wirklich, aber auf jeden Fall bin ich am Leben, bin ein lebender Mensch. Wer das von sich behaupten will, muss den Preis zahlen.«
2
Die Bücher durchsehen, die Rechnungen kontrollieren, die Bilanz vom vorigen Tag saldieren – das waren Aufgaben, denen Herr Achmed Abd al-Gawwad immer mit Fleiß und Genauigkeit nachgekommen war. Nun aber, da ihm Alter und Krankheit zusetzten, machte ihm diese Tätigkeit zu schaffen. Wenn er gebeugt unter der eingerahmten Basmala saß, mit der großen Nase, die den silberfarbigen Schnurrbart fast verdeckte und das magere Gesicht noch gewaltiger wirken ließ, bot er einen geradezu mitleiderheischenden Anblick. Sah man allerdings seinen Prokuristen Gamil al-Hamzawi an, der auf die siebzig zuging, musste man wahre Trauer empfinden. Kaum hatte er einen Kunden abgefertigt, ließ er sich schwer atmend auf einen Stuhl fallen, sodass Herr Achmed verbittert vor sich hin murmelte: »Wären wir Beamte mit Pension, müssten wir Alten uns nicht mehr dermaßen abplagen.«
Jetzt jedenfalls sah Herr Abd al-Gawwad vom Rechnungsbuch auf und erklärte: »Die Wirtschaftskrise wirkt sich noch immer auf die Geschäftslage aus.«
Al-Hamzawi verzog unwillig die blassen Lippen. »Kein Zweifel, aber immerhin ist dieses Jahr besser als das vorige, und das war wiederum besser als das davor. Auf jeden Fall muss man Gott danken.«
Das Jahr 1930 war das erste gewesen, mit dem für die Kaufleute, wie sie es nannten, die Zeit des Schreckens begann. Ismail Sidki hielt eigenmächtig das politische Leben in der Hand, und die Flaute beherrschte das wirtschaftliche Leben. Von morgens bis abends war nichts anderes zu hören als Nachrichten über neuerliche Bankrotterklärungen und Räumungsverkäufe. Man streckte die Hände gen Himmel und fragte sich, was das Morgen wohl bringen würde. Herr Abd al-Gawwad gehörte zweifelsohne zu den wenigen Glücklichen, denn der von Jahr zu Jahr bänglich erwartete Bankrott hatte sich nicht eingestellt.
»Gewiss, man muss Gott danken«, sagte Herr Abd al-Gawwad. Er merkte, dass Gamil al-Hamzawi ihn seltsam anschaute – zögerlich und verlegen zugleich. Was könnte mit ihm sein? Plötzlich stand Gamil al-Hamzawi auf, schob seinen Stuhl dichter an den Schreibtisch heran und setzte sich verwirrt lächelnd hin. Trotz strahlenden Sonnenscheins war es bitter kalt. Heftige Windstöße ließen Tür und Fenster beben, ein heulendes Sausen war zu hören. Herr Achmed setzte sich aufrecht hin und sagte: »Erzähl schon, was du hast. Ich bin mir sicher, dass gleich etwas Wichtiges kommt.«
Al-Hamzawi schlug die Augen nieder. »Ich bin nicht zu beneiden. Wie soll ichs nur sagen …?«
»Ich habe mit dir mehr Zeit verbracht als mit der Familie«, ermunterte ihn Herr Abd al-Gawwad. »Also kannst du mir alles anvertrauen, was dich bewegt.«
»Gerade das ist es, das lange Miteinander, Herr.«
Das lange Miteinander? Sollte al-Hamzawi …? Darauf wäre er nie gekommen. »Willst du etwa wirklich …?«
»Es ist Zeit, Herr«, meinte al-Hamzawi bekümmert. »Gott bürdet einem nur so viel auf, wie man tragen kann.«
Herrn Abd al-Gawwads Herz verkrampfte sich. Wenn al-Hamzawi mit der Arbeit aufhörte, zeichnete sich auch für ihn ab, in den Ruhestand zu treten. Wie sollte er, alt und krank, sich allein um das Geschäft kümmern? Ratlos sah er ihn an.
»Es tut mir sehr leid«, meinte al-Hamzawi gerührt. »Aber ich schaffe es nicht mehr. Die Zeit ist reif. Ich habe vorgesorgt, allein kann ich Sie doch nicht lassen. Meinen Platz wird jemand einnehmen, der besser ist als ich.«
Das Vertrauen, das er in al-Hamzawi setzen konnte, hatte ihm immer den Rücken freigehalten. Wie sollte er, ein Mann von dreiundsechzig Jahren, von morgens bis abends das Geschäft in Gang halten? »Wenn man aufhört zu arbeiten und nur noch zu Hause herumsitzt, gehts mit einem viel eher bergab. Hast du das nicht bei den pensionierten Beamten beobachtet?«
Al-Hamzawi lächelte. »Mit mir gehts schon jetzt bergab, schon vor dem Ruhestand.«
Herr Abd al-Gawwad lachte laut auf, als wollte er die Peinlichkeit dessen, was ihm auf der Zunge lag, überspielen. »Ach, du alter Schlaukopf, willst mich ja nur verlassen, weil dein Sohn Fuad darauf besteht.«
»Da sei Gott vor!«, rief al-Hamzawi entrüstet. »Jeder sieht, wie es mir gesundheitlich geht, und das allein ist der Grund.«
Wer konnte schon wissen? Fuad war jetzt Staatsanwalt, und in dieser Stellung konnte er vielleicht nicht damit einverstanden sein, dass der Vater als einfacher Angestellter arbeitete. Da spielte es wohl keine Rolle mehr, dass es der Chef des Vaters gewesen war, der dem Sohn das Studium und demzufolge die Stellung bei der Staatsanwaltschaft ermöglicht hatte. Doch da Herr Abd al-Gawwad das Gefühl hatte, seinen gutherzigen Prokuristen schon mit der letzten Bemerkung verletzt zu haben, begnügte er sich damit, freundlich zu fragen: »Steht schon fest, wann Fuad nach Kairo versetzt wird?«
»In diesem Sommer, auf jeden Fall aber nächsten Sommer.«
Es herrschte verlegenes Schweigen, dann erklärte al-Hamzawi, bemüht, ebenso freundlich zu bleiben: »Wenn er in Kairo ist, muss man an seine Heirat denken, nicht wahr? Bei sieben Töchtern ist er der einzige Sohn, also muss man eine Frau für ihn finden. Immer, wenn ich daran denke, fällt mir das Fräulein, Ihre gut erzogene Enkelin ein …« Verstohlen blickte er Herrn Abd al-Gawwad an, dann murmelte er: »Natürlich sind wir nicht von gleichem Rang …«
Was blieb da Herrn Abd al-Gawwad weiter übrig, als zu sagen: »Behüte Gott, Gamil. Wir waren von jeher Brüder!«
Ob Fuad den Vater angestachelt hatte, mal auf den Busch zu klopfen? Ein Staatsanwalt stellte etwas Bedeutendes dar, und das Wichtigste – der junge Mann war ein guter Mensch. Aber war jetzt der Moment, über Heirat zu reden? »Sag mir erst mal, ob du wirklich entschlossen bist, mit der Arbeit aufzuhören.«
In diesem Augenblick tönte es von der Tür her: »Einen recht schönen guten Morgen!«
Herr Abd al-Gawwad lächelte höflich, auch wenn er sich ärgerte, dass das wichtige Gespräch unterbrochen wurde. »Hallo, herzlich willkommen!« Er wies auf den Stuhl, den al-Hamzawi im Nu geräumt hatte. »Bitte schön.«
Zubaida nahm Platz. Sie sah aufgedunsen aus, und das Gesicht war dick mit Schminke bedeckt. Kein Schmuck mehr, weder Ohrringe noch Ketten noch Armbänder, und die alte Schönheit war auch geschwunden. Herr Abd al-Gawwad begrüßte Zubaida nicht weniger freundlich als die anderen Kunden, aber auch nicht herzlicher. Im Grunde verabscheute er ihren Besuch, denn wann immer sie auftauchte, bedrängte sie ihn mit Forderungen.
Auf die Frage nach der werten Gesundheit begnügte sie sich mit der nichtssagenden Antwort: »Gott seis gedankt.« Nach kurzem Schweigen wiederholte er: »Tja, herzlich willkommen.« Trotz des dankenden Lächelns war ihr anzumerken, dass sie aus den Höflichkeitsfloskeln die laue Herzlichkeit herausgehört hatte. Noch immer lächelnd, tat sie, als spürte sie die kühle Atmosphäre nicht. Im Verlauf der Jahre hatte sie gelernt, ebenso kalt zu reagieren.
»Ich will nicht deine Zeit vergeuden, aber du bist der nobelste Mann, den ich je im Leben traf. Entweder gibst du mir noch ein Darlehen, oder du findest für mein Haus einen Käufer. Am liebsten wäre mir, wenn du es selbst kaufen würdest.«
Herr Abd al-Gawwad seufzte. »Ich? … Wenn ichs nur könnte! Die Zeiten haben sich geändert, Sultanin. Wie oft habe ich dir nun schon gesagt, wie die Dinge stehen, aber offensichtlich glaubst du mir nicht.«
Mit einem Lachen überspielte sie die Enttäuschung. »Die Sultanin ist pleite. Was kann man da tun?«
»Letztes Mal habe ich dir gegeben, was ich konnte. Aber meine Situation lässt es nicht zu, dir nochmals zu helfen.«
»Kannst du nicht wenigstens einen Käufer für mein Haus finden?«, fragte sie besorgt.
»Ich werde mich bemühen, das verspreche ich.«
»Nichts anderes habe ich von dir erwartet, du Hochherzigster aller Hochherzigen«, erklärte sie dankbar, und traurig fügte sie hinzu: »Nicht nur, dass sich die Welt gewandelt hat, die Menschen haben sich noch viel mehr verändert, Gott vergebe ihnen. Zu Zeiten des Ruhms haben sie darin gewetteifert, mir die Schuhe zu küssen, aber wenn sie mich jetzt auf der Straße sehen, wechseln sie auf die andere Seite hinüber.«
Sicher vermisst der Mensch immer etwas im Leben, manchmal sogar mehreres auf einmal – Gesundheit, Jugend, andere Menschen. Doch wo ist die herrliche Zeit geblieben, die erfüllt war von Kraft und Ansehen? Wohin haben sich die Tage verflüchtigt, da man sich an Gesang und Liebe berauschte? »Eins muss ich dir sagen, Sultanin, du hast nie für die Zukunft vorgesorgt.«
Mit einem Seufzer des Bedauerns antwortete sie: »Ja, leider. Ich bin nicht wie deine Freundin Galila, die mit der Ehre anderer Handel treibt und auf diese Weise zu Geld und Häusern kommt. Ganz abgesehen davon lässt mich Gott an einer Menge Gauner leiden, was so weit geht, dass Hassan Anbar für eine Prise Kokain, wenn es auf dem Markt schwer zu haben ist, ein Pfund bezahlt haben will.«
»Da soll doch Gottes Fluch dreinschlagen!«
»Auf Hassan Anbar? Dann gleich tausend Flüche.«
»Aber nein – aufs Kokain.«
»Bei Gott, warum das? Kokain ist barmherziger als der Mensch.«
»Unsinn! Es ist äußerst betrüblich, dass du dem Zeug verfallen bist.«
Als müsste sie sich diesem Schicksal bedingungslos fügen, meinte sie: »Die Kraft ist weg und das Geld auch. Da kann man nichts machen. Wann hast du einen Käufer für mein Haus?«
»So Gott will, bei nächster Gelegenheit.«
Im Aufstehen begriffen, erklärte sie vorwurfsvoll: »Hör mal, wenn ich das nächste Mal komme, möchte ich dich aus vollem Herzen lachen sehen. Ich kann alles ertragen, nur nicht, wenn du nicht nett bist zu mir. Ich weiß genau, dass ich dir mit meinen Forderungen auf die Nerven falle, aber Gott allein weiß, in welcher Klemme ich stecke. Für mich bist du der beste Mensch.«
»Vermute nicht mehr, als da ist«, entschuldigte er sich. »Als du hereinkamst, war ich gerade mit einer wichtigen Sache beschäftigt. Die Sorgen eines Kaufmanns nehmen kein Ende, wie du weißt.«
»Möge Gott sie dir nehmen.«
Dankend neigte er den Kopf, geleitete sie zur Tür, und beim Verabschieden erklärte er: »Du bist mir zu jeder Zeit herzlichst willkommen.« O ja, jeglicher Glanz war in ihren Augen erloschen, kummererfüllt der Blick. Da konnte man nur noch Mitleid empfinden. Bedrückt ging er an seinen Platz, drehte sich zu Gamil al-Hamzawi um und sagte: »Was für eine Welt!«
»Möge Gott Ihnen das Schlechte der Welt ersparen und nur noch Gutes spenden.« Al-Hamzawis Stimme bekam einen harten Klang, als er fortfuhr: »Eine gerechte Strafe für eine Frau, die dermaßen leichtfertig ist.«
Herr Abd al-Gawwad schüttelte heftig den Kopf, als wollte er angesichts der Härte dieser Moralpredigt stummen Protest anmelden. Gleich darauf nahm er wieder den geschäftsmäßigen Ton auf und fragte: »Bist du noch immer entschlossen, mich zu verlassen?«
»Es ist doch kein ›Verlassen‹«, meinte al-Hamzawi verlegen. »Ich gehe lediglich in den Ruhestand. Es tut mir auch zutiefst leid.«
»Mit solch liebenswürdigem Gerede habe ich vor ein paar Minuten Zubaida hinauskomplimentiert.«
»Gott bewahre, ich spreche aufrichtigen Herzens! Sehen Sie nicht, Herr, dass mich das Alter fast schon zum Greis gemacht hat?«
Ein Kunde betrat das Geschäft, und al-Hamzawi ging zu ihm.
Von der Tür her erscholl die Stimme eines alten Mannes, der lockend rief: »O welcher Jüngling, schön wie der Mond, sitzt dort hinterm Schreibtisch?«
Scheich Mitwalli Abd as-Samad erschien, bekleidet mit einem groben, abgetragenen, ausgeblichenen Gilbab und zerrissenen Schuhen. Den Kopf hatte er turbanartig mit einem Stück Kamelfell umwickelt. Er stützte sich auf seinen Stock, und im Glauben, auf Herrn Abd al-Gawwad zu schauen, blinzelte er mit geröteten Augen in Richtung der Wand, die sich seitlich von dessen Schreibtisch befand. Trotz aller Sorgen musste Herr Abd al-Gawwad schmunzeln. »Kommen Sie, Scheich Mitwalli, wie geht es Ihnen?«
Der riss den Mund auf, eine zahnlose Höhle, und rief: »Weg mit dir, du böser Blutdruck, und her mit dir, Gesundheit, damit es dem Edelsten aller Menschen wieder gut geht.«
Als Herr Achmed auf ihn zuging, schien sich der Blick des Scheichs auf ihn zu richten. Doch was war das? Plötzlich wich der Scheich vor ihm zurück, als wäre er auf der Flucht. Er begann, sich um die eigene Achse zu drehen, und in alle vier Himmelsrichtungen weisend, kreischte er: »Hier hinaus die Sorgen und da hinaus die Sorgen! Und hier und da …« Er rannte hinaus auf die Straße und rief: »Heute nicht! Vielleicht morgen oder übermorgen! Gott ist der Allwissende.« Mit weit ausholenden, energischen Schritten, die wenig zu seinem abgerissenen Eindruck passten, machte er sich auf den Weg.
3
Der Freitag war der Tag, an dem die Vögel wieder ins Nest schwirrten und das alte Haus sich mit Kindern und Enkelkindern füllte. Von dieser schönen Gewohnheit ließ niemand ab, auch wenn Amina am Freitag nicht mehr die große Heldin war, sondern Umm Hanafi die Küche beherrschte. Dafür wurde aber Amina nicht müde, alle Welt daran zu erinnern, dass Umm Hanafi ihre Schülerin war. Je stärker Amina das Gefühl hatte, kaum noch Lob zu verdienen, desto stärker offenbarte sich die Sucht danach. Was alles noch schlimmer machte, war, dass Chadiga, obwohl sie als Gast ins Haus kam, nicht davon abließ, ihre Hilfe anzubieten.
Bevor der Hausherr ins Geschäft aufbrach, scharten sich die Gäste um ihn: Ibrahim Schaukat mit den Söhnen Abd al-Munim und Achmed, Jasin mit Sohn Radwan und Tochter Karima, und allen war jene Scheu eigen, die aus lautem Lachen ein Lächeln, aus heftiger Rede ein Flüstern werden ließ. Der Herr Vater indes, der, je älter er wurde, umso mehr Freude an der Gegenwart von Kindern und Kindeskindern empfand, schalt Jasin aus, weil dieser nur noch am Freitag ins Haus, während der Woche aber nicht mehr ins Geschäft kam. Konnte dieser Esel nicht verstehen, dass er ihn jederzeit gern um sich hatte? Und wie gut dessen Sohn Radwan aussah – große, dicht bewimperte Augen und eine rosige Haut. Seine mannigfaltige Schönheit ließ das Bild vom jugendlichen Jasin erstehen, erinnerte aber auch bisweilen an Hanija, Jasins Mutter, oder gar an seinen Freund Mohammed Iffat, den anderen Großvater des Jungen. Radwan war ihm das liebste Enkelkind. Doch auch die kleine achtjährige Karima würde zu einem wunderbaren Geschöpf heranreifen. Das verrieten die schwarzen Augen, die sie von ihrer Mutter Zanuba hatte. Er, der Großvater, konnte ihnen immer nur mit einem verlegenen Lächeln, reich an Erinnerungen, begegnen. Was die Jungen Abd al-Munim und Achmed betraf, so erfreute es ihn nicht wenig, sie mit einer ähnlich gewaltigen Nase wie der seinigen zu sehen und mit den kleinen Augen Chadigas. Die beiden Burschen zeigten im Übrigen am meisten Mut, ihn in ein Gespräch zu verwickeln. Alle Enkel lernten erfolgreich, worauf er als Großvater stolz war, auch wenn nicht zu übersehen war, dass sie mit sich beschäftigt waren und sich wenig um ihn kümmerten. Einerseits fand er es tröstlich, dass durch sie sein Lebenswerk weder jetzt noch in Zukunft beendet sein würde, andererseits machte ihm ihr Erwachsenwerden bewusst, dass er allmählich die führende Stellung verlor, die ihm zukam – ein Vorgang, den er als weniger schmerzlich empfand, als er vermutet hätte. Das vorgerückte Alter hatte ihm nicht nur Schwäche und Krankheit eingebracht, sondern auch Weisheit, was aber noch lange nicht hieß, dass er die Flut von Erinnerungen hätte stoppen können, die sich für ihn mit dem Heranwachsen der Enkelkinder verband. Da war das Jahr 1890, als er, der junge Bursche, wenig Lust zum Lernen hatte, sich dafür umso mehr in den Vergnügungsstätten in al-Gamalija und seinen Lieblingskneipen in al-Ezbekija amüsierte, immer mit Mohammed Iffat, Ali Abd ar-Rahim und Ibrahim Alfar im Schlepptau. Sein Vater, der sich mit ganzer Seele um den Laden kümmerte, schimpfte zwar mit ihm, verwöhnte ihn, den einzigen Sohn, aber noch mehr. Das Leben schien ein zusammengerolltes Blatt Papier zu sein, das die schönsten Hoffnungen barg. Ja, und dann kam Hanija … doch halt! Wozu sollte es gut sein, sich von Erinnerungen fortreißen zu lassen.
Herr Abd al-Gawwad erhob sich, um das Nachmittagsgebet zu sprechen, woraus zu schließen war, dass er dann das Haus verlassen würde. Und tatsächlich, wenig später war er angekleidet und ging ins Geschäft. Die anderen scharten sich um das Kohlebecken der Großmutter. Die Zeit der Kaffeerunde war gekommen, und da konnte man nach Herzenslust plaudern und schwatzen. Auf dem Kanapee, das in der Mitte thronte, saßen Amina, Aischa und Naima, auf dem rechten Jasin, Zanuba und Karima und auf dem linken Ibrahim Schaukat, Chadiga und Kamal. Radwan, Abd al-Munim und Achmed machten es sich auf den Stühlen bequem, die in der Mitte des Salons, unter der Deckenlampe, standen. Ibrahim Schaukat ging aus Gewohnheit seiner Lieblingsbeschäftigung nach – er lobte die unterschiedlichen Gerichte, die ihm alle geschmeckt hatten. Allerdings war er in den letzten Jahren dazu übergegangen, sich auf die Vortrefflichkeit der Meisterin – Amina – gegenüber ihrer verdienstvollen Schülerin – Umm Hanafi – zu beschränken. Zanuba diente ihm als Echo, ließ sie doch keine Gelegenheit aus, sich um die Gunst eines Mitglieds von Jasins Familie zu bemühen. Seit ihr die Tore geöffnet worden waren und sie mit der Familie Umgang haben durfte, arbeitete sie mit äußerster Geschicklichkeit darauf hin, ihre Beziehungen zu festigen. Dass sie im Haus verkehren durfte, bedeutete ihr die lang erhoffte Anerkennung ihrer Stellung, nachdem sie unendlich viele Jahre die Einsamkeit einer Ausgestoßenen hatte ertragen müssen. Der Tod eines Neugeborenen hatte ihr Jasins Familie, ein reiner Kondolenzbesuch, ins Haus gebracht, und da hatte man ihr zum ersten Mal seit der Hochzeit die Hand gereicht. Das hatte ihr genügend Mut gemacht, das Zuckergässchen zu besuchen, und als der Herr Vater so schwer erkrankte, war auch sie in der Baina l-Kasrain zu Besuch erschienen, wobei beide, Herr Abd al-Gawwad und Zanuba, als sie sich in seinem Zimmer begegneten, taten, als würden sie sich zum ersten Mal begegnen, als hätten sie keine gemeinsame Vergangenheit. Auf diese Weise hatte sich Zanuba allmählich in die Familie eingegliedert, was schließlich dazu führte, dass sie Amina »Tantchen« nannte und Chadiga »Schwester« rief. Beispielhaft in ihrer Bescheidenheit, putzte sie sich sogar, wenn sie aus dem Haus ging, weniger heraus als die Frauen der Familie. Infolgedessen wirkte sie älter, als sie war, ein Eindruck, der vom vorzeitigen Schwinden ihrer einstigen Schönheit noch verstärkt wurde. Chadiga konnte kaum glauben, dass Zanuba erst sechsunddreißig Jahre alt sein sollte. Jedenfalls hatte sie allgemeine Achtung gewonnen, und selbst Amina bekannte eines Tages, dass Zanuba wahrscheinlich doch aus »gutem Hause« stamme und sie, selbst wenn ihre Erziehung weit zurückliege, dennoch ein anständiges Mädchen sei; immerhin habe sie es als Einzige verstanden, Jasin ein Heim zu bieten.
Chadiga hatte, was Körperfülle betraf, allmählich selbst Jasin übertroffen, wobei sie nicht einmal abstritt, auf das viele Fett und Fleisch auch noch stolz zu sein. Mit Glück erfüllten sie die Söhne Abd al-Munim und Achmed, und sie genoss mit Behagen das Eheleben, auch wenn sie nie aufhörte zu jammern, wie sehr sie das Auge des Neids fürchten müsse. Ihr Umgang mit Aischa hatte sich grundlegend verändert. In all den acht Jahren war ihr kein einziges grobes Wort, keine einzige höhnische Bemerkung entschlüpft, nicht einmal aus Spaß. Äußerst behutsam war Chadiga darauf bedacht, mit Aischa nett und freundlich, ja, liebenswürdig umzugehen. Nicht nur, dass Aischas Elend sie demütig machte und die Schicksalsmächte fürchten ließ, die der Schwester das Beschiedene beschieden hatten, sie war auch besorgt darüber, dass dieses geplagte Wesen ihrer beider Geschicke vergleichen könnte. Deshalb hatte Chadiga mit einer großzügigen Geste ihrem Mann Ibrahim Schaukat auferlegt, das ihm zustehende Erbe an der Hinterlassenschaft seines verstorbenen Bruders Naima zu überschreiben, damit beide – Aischa und Naima – ungeteilt in dessen Genuss kamen. Chadiga hatte lange gehofft, dass diese gute Tat lobend erwähnt werden würde, doch Aischa war wie betäubt und nahm die Großzügigkeit der Schwester nicht zur Kenntnis. Chadiga blieb dennoch gütig und fürsorglich und kümmerte sich um Aischa, als wäre sie ihr eine zweite Mutter geworden. Nichts lag ihr mehr am Herzen, als Aischa versöhnlich und freundschaftlich zu stimmen, glaubte sie sich doch damit das Wohlgefallen auf Dauer zu sichern, das ihr Gott beschert hatte.
Ibrahim Schaukat holte eine Schachtel Zigaretten hervor, und als er Aischa davon anbot, nahm sie dankend an. Beide rauchten still vor sich hin. Oft genug gab es Bemerkungen über Aischas übermäßiges Rauchen und Kaffeetrinken, aber darauf reagierte sie gewöhnlich nur mit einem Achselzucken. Ihre Mutter beschränkte sich darauf, im Tonfall eines Gebets zu sagen: »Möge Gott sie standhaft machen.« Jasin traute sich bei seinen Ratschlägen am weitesten vor, denn er glaubte, sich durch den Verlust seines Sohns das Recht dafür erworben zu haben. Für Aischa zählte das nicht, ja, sie hielt es sogar für unangemessen, ihn in den Rang eines Leidtragenden zu erheben, da sein Sohn, im Unterschied zu Othman und Mohammed, bereits im ersten Lebensjahr verschieden war. Überhaupt schien das Gespräch über Schicksalsschläge ihre Lieblingsbeschäftigung zu sein; offenbar glaubte sie, auf diese Weise ihre Einzigartigkeit in der Welt des Unglücks zu betonen.
Kamal hatte aus ein paar Sätzen herausgehört, dass sich Radwan, Abd al-Munim und Achmed über die Zukunft unterhielten. Lächelnd horchte er hin. Radwan sagte gerade: »Wir besuchen alle nicht den naturwissenschaftlichen Zweig, also bleibt als einzig ordentliches Studium nur Jura«, worauf Abd al-Munim den großen Kopf, der ihn am ehesten von allen dreien Kamal ähneln ließ, schüttelte und mit tiefer Stimme nachdrücklich bestätigte: »Na klar, selbstverständlich, aber er will das nicht einsehen.« Bei dem »er« wies er auf seinen Bruder Achmed, der spöttisch grinste.
An dieser Stelle mischte sich der Vater, Ibrahim Schaukat, ein. »Soll er meinetwegen an der Philosophischen Fakultät studieren, aber da muss er mich vorher überzeugen, wozu das gut sein soll. Jura verstehe ich auf Anhieb, aber was er mit der Philosophischen Fakultät will, verstehe ich nicht.«
Kamal blickte niedergeschlagen zu Boden. Erinnerungen an ein weit zurückliegendes Gespräch über Jura und Lehrerstudium holten ihn ein. Er lebte noch immer in der Welt alter Hoffnungen, aber das Leben warf ihm jeden Tag Steine in den Weg. Ein Staatsanwalt musste nirgendwo erklären, was er machte, wohl aber jemand, der für eine Zeitschrift wie Der Gedanke schrieb, vor allem dann, wenn er Artikel verfasste, die ihm selbst manchmal unverständlich erschienen.
Achmed richtete die kleinen, hervorstehenden Augen auf Kamal und riss ihn aus seiner Nachdenklichkeit mit den Worten: »Ich überlasse es Onkel Kamal, euch zu antworten.«
Ibrahim Schaukat überspielte sein unangenehmes Berührtsein mit einem Lächeln, während Kamal ziemlich gleichgültig erwiderte: »Studier das, was dir liegt.«
Auf Achmeds Gesicht zeichnete sich Genugtuung ab; der schlanke Kopf drehte sich mal zum Bruder, mal zum Vater. Doch da sprach Kamal schon weiter: »Eins musst du allerdings wissen: Das Jura-Studium eröffnet dir in der späteren Tätigkeit ausgezeichnete Perspektiven, das Studium an der Philosophischen Fakultät nicht. Wenn du etwas Schöngeistiges wählst, wirst du als Lehrer arbeiten müssen, ein schwerer und wenig geachteter Beruf.«
»Ich will ja zur Presse.«
»Journalist werden?!«, rief Ibrahim Schaukat. »Er weiß nicht, was er redet.«
»In unserer Familie«, stieß Achmed scharf hervor, »hat das Denken den gleichen Wert wie das Lenken eines Karrens.« Er blickte Kamal an, von dem er sich Unterstützung erhoffte.
»Bloß dass die führenden Denker unseres Landes Jura studiert haben«, bemerkte Radwan spöttisch, was Achmed hochmütig mit der Bemerkung abtat: »Was ich unter Denken verstehe, ist etwas völlig anderes.«
Abd al-Munim runzelte die Stirn. »Und zwar etwas, was einem Angst macht und zerstörerisch ist. Ich weiß nur allzu gut, wovon du sprichst.«
Ibrahim Schaukat schaute, auch wenn er Achmed meinte, die anderen beschwörend an. »Denke nach, bevor du etwas unternimmst. Du bist erst im vierten Jahr. Jedenfalls wird dir dein Erbe nicht mehr als hundert Pfund jährlich bringen, und etliche meiner Freunde klagen bitterlich darüber, dass ihre Söhne nach dem Studium keine Arbeit finden oder als schlecht bezahlte Angestellte tätig sind. Du kannst dich frei entscheiden.«
Jasin griff ein und schlug vor: »Lasst uns hören, was Chadiga dazu meint. Immerhin war sie Achmeds erste Lehrerin. Wer könnte besser als sie die Auswahl zwischen der Juristischen und Philosophischen Fakultät treffen?«
Alle schmunzelten, auch Amina, die eifrig mit der Kaffeekanne beschäftigt war. Als selbst noch Aischa lächelte, fühlte sich Chadiga ermuntert. »Ich werde euch eine hübsche Geschichte erzählen«, erklärte sie. »Gestern, am späten Nachmittag, kam ich im Dunkeln, denn jetzt im Winter wird es ja schnell dunkel, von der Darb al-Achmar zum Zuckergässchen zurück. Plötzlich hatte ich das Gefühl, dass mir ein Mann folgt, und tatsächlich – im Durchgang des Mitwalli-Tors ist er neben mir und fragt: Wohin, meine Schöne? Ich drehe mich mit einem Satz um und gebe zur Antwort: Nach Hause, werter Herr Jasin!«
Lautes Gelächter erschütterte den Raum, nur Zanuba warf Jasin einen vielsagenden Blick zu, gleichermaßen von Vorwurf wie von Verzweiflung erfüllt. Jasin hingegen fuchtelte mit der Hand, um die Lacher zum Schweigen zu bringen, und fragte verstört: »Sollte ich schon dermaßen mit Blindheit geschlagen sein?«
»Pass auf«, warnte ihn Ibrahim Schaukat.
Die kleine Karima griff nach der Hand ihres Vaters und lachte noch immer, als hätte sie, die Achtjährige, alles verstanden. Zanuba bemerkte: »Es sind immer die schlimmen Dinge, über die man lachen muss.«
Bei diesen Worten warf Jasin Chadiga einen wütenden Blick zu. »Du hast mich ganz schön reingerissen, du kleines Sonst was«, fuhr er sie an.
»Wenn hier jemand etwas über Lebensart lernen müsste, dann du und nicht mein Sohn Achmed, dieser Wirrkopf.«
Zanuba stimmte ihr zu, während Radwan den Vater verteidigte und meinte, er würde zu Unrecht beschuldigt werden. Achmed starrte noch immer Kamal an, als setzte er all seine Hoffnung auf ihn, während Abd al-Munim verstohlen Naima betrachtete, die, an ihre Mutter geschmiegt, wie eine weiße Rose aussah. Wann immer sie zufällig bemerkte, dass seine kleinen Augen auf sie gerichtet waren, rötete sich die blasse, zarte Haut ihres Gesichts.
Ibrahim Schaukat wollte das Gespräch wieder in andere Bahnen lenken, also wandte er sich an Achmed und sagte: »Sieh dir doch nur mal an, was dank des Jura-Studiums aus dem Sohn von al-Hamzawi geworden ist – ein angesehener Staatsanwalt.«