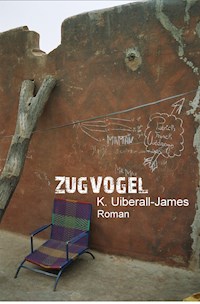
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Afrika im Oktober. Der impulsive, temperamentvolle Amadou geht für ein Jahr nach Deutschland, um dort als traditioneller Tänzer Karriere zu machen. Seine besten Freunde begleiten ihn, sozusagen als Notbremse, um den Idealisten vor Fehlern zu bewahren und um bei der Gelegenheit für sich selbst eine Existenzgrundlage für zuhause zu erarbeiten. Bei der Verfolgung seines Zieles sieht Amadou sich mit unvorhergesehenen Hindernissen konfrontiert. Unrealistische Träume und ein fremder, aufreibender Alltag durchkreuzen seine Pläne. Nichts ist so, wie er es sich vorgestellt hatte. Die Rückzahlung seines Kredites nach Afrika wird zum Beispiel zu einem Rennen gegen die Zeit; zwischen den Freunden gibt es Streit. Amadou nimmt aus Stolz lieber Hilfe von dubiosen Geschäftsleuten an, die ihn für ihre Zwecke benutzen. Und die Beziehungen zu den deutschen Frauen gestalten sich als doppelt schwierig, weil auch sie ihren Klischeevorstellungen von einem Afrikaner und seinem Land unterliegen. Ibrahim und Sekou unterliegen nicht ganz den klischeehaften Vorstellungen vom paradiesischen Europa. Sie versuchen das Beste aus ihrer Situation zu machen. Ibrahim, der Pragmatiker unter den Freunden verharrt nach reiflicher Überlegung m Gedankengut des eigenen Kulturkreises; Sekou, der stets Kompromissbereite schafft es, mit beiden Kulturen zurecht zu kommen, weil er seine Kultur nicht tabuisiert. Der Kreis schließt sich nach vier Jahreszeiten wieder in Afrika. Ein sinnliches Abenteuer, lösungsorientiert, kritisch, bissig und witzig, dramatisch, philosophisch und spannend bis zum Ende.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 1081
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
K. Uiberall-James
ZUGVOGEL
Eine deutsch-afrikanische Geschichte
Dieses eBook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Westafrika, ein Dorf im Landesinneren in der Nähe einer Kleinstadt - Feierabend
Ein ganz normaler Tag
Dörfliches Wochenendvergnügen
Kontaktaufnahme für alle Fälle
Lagebesprechung unterm Mangobaum
Warnung und Chance
Unlogische Konsequenz
Euphorie und Überzeugungskraft
Reisevorbereitungen
Abschied auf afrikanisch
Flug ins wirtschaftliche Eldorado
Ankunft in Deutschland
Exterritoriales Gebiet
Aus erster Hand
Erstes Frühstück bei Malik
Das Gesicht der Stadt Ende Oktober
Die Neulinge allein zu Haus
Toucou als Fremdenführer
Wichtige Begegnung
Amadou ist motiviert
Wiedersehen mit Emily
Wetterkapriolen
Amadou bekommt seine Unvernunft zu spüren
Das ‚Baobab‘, melting pot und Treffpunkt
Sonntag in der WG
Austausch der ersten Eindrücke
Novemberblues
November-Highlight
Das leidige Geld
Emily, ein anderes Wort für Verwirrung
Zeit, die sich kleinlaut davonschleicht
Post für Amadou und die WG
Im ‚Baobab‘, da, wo alles möglich ist
Vater und Sohn Sonntag
Tinas freier Nachmittag
Ibrahims erstes Date
Zeitgleich
Der erste Schnee
Abstecher zu den Freunden
Konfrontation mit der Realität
Der bequemste Weg
Das Leben zu zweit
Emilys deutsche Vorstellung von einer Beziehung
Amadou wird ins Gebet genommen
Adventszeit
Heiligabend
1. Weihnachtstag
Amadou und Emily zu Besuch in der Enklave
2. Weihnachtstag
Miriam
Toucou versucht sich als Ratgeber
Vera
Guter Rat ist teuer
Der Tag vor Silvester
Silvester
Neujahr
2. Januar, die Rückversicherung
3. Januar, Amadou belügt seine Freunde
Rike holt Emily aus ihrem Tief
4. Januar, Amadou bekommt Post
Amadou versetzt die WG in Alarmbereitschaft
5. Januar, Emilys Leben ohne Amadou
Paradies Bremen
Sonntagmorgen bei Emily in Hamburg
Sue trifft eine Entscheidung
Amadou ruft endlich in Hamburg an
Miriam wird ungeduldig
Amadou zerfließt vor Selbstmitleid
Carla und Sekou
Das ‚Roots’ in Bremen
Montagmittag in der Hamburger WG
Mitte Februar macht Amadou endlich das, wozu er Lust hat
Ende Februar, Besuch kündigt sich an
Mitte März und noch kein Frühling in Sicht
Die Ernüchterung
Eine neue Erfahrung
Toucou in Verlegenheit
Amadou findet Gefallen am Leben auf dem Lande
Der Tanzkurs
Nacht in Afrika
Amadou und Betty
WG Hamburg
Die Wende
Sekou fragt Carla
Malik fragt Tina
Karfreitag
Miriam trifft eine Entscheidung
Endlich Frühling
Der Verrat
Annäherung an die andere Kultur
Tanz in den Mai
Die Kursparty
Ein schwerer Gang
Es ist noch nicht vorbei
2. Mai, Ibrahim stellt klar, was er will
Amadou versucht, sein europäisches Leben zu ordnen
Ibrahim handelt wider seine Vernunft
Das Ding mit der Abhängigkeit
Ibrahim hat wieder einmal recht
Amadou fühlt sich nutzlos
Hamburg, Tina besucht Carla
Amadou langweilt sich
Das Picknick
Zurück nach Bremen
Amadou und das Wattenmeer
Der Überland-Nachtbus
Der große Regen
Sehnsucht nach dem Paradies
Vertreibung aus dem Paradies
Eine fragwürdige Chance
Sekou und Carla nutzen den Sommertag
Anfang September, Pflaumenkuchen bei Tina
Ein dreckiger Job ist besser als gar kein Job
Versuch eines diplomatischen Telefongespräches
Aufbruch nach Dänemark
Amadou kommt unter Leute
Anfang Oktober, Countdown
Countdown auch für Amadou
Die Weichen werden gestellt
Planänderung
Die Misere
Miriam bereitet sich auf ein Leben ohne Amadou vor
Moussa redet Amadou ins Gewissen
Krisensitzung in Hamburg
Das Blatt wendet sich
Fazit
Asyl bei Irma la Douce
Afrika in Not
Bei Amadous Eltern
Notfalltelefon Hamburger Enklave
Der große Coup
Bei Moussa
Stunde der Wahrheit
Der Eklat
Ibrahims Rückblick
Sekous Gedankengänge
Rückkehr in den Schoss der Familie
Ende und Anfang
Nachwort
Amadous Heimat
Impressum
Westafrika, ein Dorf im Landesinneren in der Nähe einer Kleinstadt - Feierabend
Die Abenddämmerung treibt die widerspenstige Sonne gelassen vor sich her. Dieses allabendliche Machtspiel geht immer gleich aus; am Ende ist sie die Gewinnerin. Ihre Kontrahentin kann die Lehmwände der Rundhütten noch so wichtigtuerisch in ein Flammenmeertauchen, die Abendbrise hat ihr Mütchen heruntergekühlt und ihr Feuer aufs Dekorative reduziert.
Ibrahim ist auf dem Heimweg. Den ganzen Tag hat er bei der Feldarbeit unter der erbarmungslosen Sonne gelitten. Seine trockenen Augen brennen und er spürt die Müdigkeit in allen Knochen. Doch ein wenig kühles Wasser und eine anständige Mahlzeit werden ihn wieder fit für den Feierabend machen.
Der einzige Zugang zum Hof seiner Familie, ein zweieinhalb Meter hohes, verbeultes Blechtor, quietscht in den verrosteten Angeln, als Ibrahim es aufstößt und den Hof betritt. Er nickt den Anwesenden im Hof einen Gruß zu und geht geradewegs zu seiner Hütte.
Mit der Feldhacke noch auf der Schulter hebt er den verblichenen Vorhang und beugt müde den Kopf, um den Eingang zu betreten. Dabei streift sein Blick missmutig die Wand neben der Tür. Dort, wo die Lehmziegel verputzt sind, zeigen sich Risse wie feines Gespinst; kleine Insekten haben sich dort eingenistet und ein Gecko lauert bewegungslos auf die Chance einer Mahlzeit. Schweißperlen lösen sich von seiner Stirn und bahnen sich ihren Weg am Hals entlang. Er spitzt die Lippen und macht den typischen Schnalzlaut für Unmut, während er die Hütte betritt. ‚Ich muss die Risse noch vor der Regenzeit ausbessern.'
Als er wieder herauskommt, hat er ein buntes Tuch locker um die Hüften geschlungen, einen Handtuchfetzen über der Schulter und ein Bröckchen Seife in einer Hand. In abgetretenen Plastiksandalen schlappt er zu dem großen Tonkrug in der Ecke des Hofes, der jeden Tag vom Wasserlieferanten mit frischem Wasser aufgefüllt wird. Eine geblümte, mit kleinen Rostflecken gesprenkelte Emailschüssel deckt das kühle Nass ab. Ibrahim nimmt die Schüssel in die Hand und schöpft mit einer im Behälter schwimmenden Kalebasse Wasser in sie hinein. Als sie halb voll ist, stellt er sie auf der Mauer ab, die die Hütten und den Hirsespeicher seiner Familie umschließt.
Nachdem er auch das Hüfttuch auf der Mauer abgelegt hat, klatscht er sich prustend etwas Wasser ins Gesicht und seift sich dann akribisch ein. Seine wie in Zeitlupe ablaufenden Bewegungen haben dabei einen zeremoniellen, fast rituellen Charakter. Immer wieder füllt er die kleine Kalebasse mit dem Wasser aus der Schüssel und spült die Seife mit einem dünnen Strahl sorgfältig wieder von seinem Körper. Das letzte Licht des sinkenden Sonnenballs lässt seine Haut durch die in ihr gespeicherte Glut des Tages kupferrot aufleuchten, und bei jeder Bewegung versprühen die auf ihr perlenden Wassertropfen funkelnde Blinklichter in die ausgetrocknete Umgebung. Ibrahim streift sie mit der flachen Hand vom Körper und benötigt so kaum noch das Handtuch. Mit sparsamen Bewegungen schlägt er das Tuch wieder um die Hüften. Seine schmalen Hände haben auffallend lange, feingliedrige Finger, denen man die Arbeit auf dem Feld kaum zutraut, doch deren lederartige, rissige Haut verrät ihre wahre Tätigkeit. Ibrahim breitet das Handtuch zum Trocknen auf der Mauer aus und schüttet den Rest des Waschwassers mit Schwung und einem satten Platsch unter den staubigen Oleanderbusch.
Die dort dösende buntgefleckte Hauskatze hechtet fauchend aus dem dürftigen Schatten des Busches mitten unter die Frauen im Hof. Ibrahims Mutter springt, trotz ihres stattlichen Gewichtes, in Windeseile von ihrem Hocker bei den Kochsteinen auf, wo sie das Gemüse in ihrer Hand klein geschnitten hatte.
„Pass doch auf, was du tust“, schimpft sie und deutet mit dem Kochmesser in der Hand auf die umgefallene Blechschüssel mit dem schon geputzten Gemüse, „jetzt muss ich alles noch einmal waschen.“ Sie schnalzt ärgerlich mit der Zunge und klaubt das Gemüse aus dem Sand. „Tz, tz, da soll doch …“ Sie richtet sich schwerfällig auf und starrt auf vier Katzenbabys, die klatschnass und kläglich miauend orientierungslos zwischen den Kochutensilien herumwuseln. Ihre Mutter hat sie schmählich in Stich gelassen, als die ‚große Flut‘ über sie hereinbrach. Mit rollenden Augen und wild mit dem Messer fuchtelnd, versucht Ibrahims Mutter sie zu verscheuchen.
„Morgen kommt ihr weg!“, blafft sie die erbärmlich aussehenden Knäuel an, und zu Ibrahim gewandt: „Sieh nur was du angerichtet hast.“ Sie muss sich einfach Luft machen, um die durch den Schreck aufgebaute Spannung loszuwerden. Ibrahim eilt herbei und scheucht die Katzenbabys mit einem seiner ausgezogenen Latschen aus der Kochzone; dabei fällt die ohnehin schon brüchige Sandale vollends auseinander. Ein Teil von ihr fliegt haarscharf am Kochtopf vorbei, ‚und Action’, denkt Ibrahim und grinst.
„Das ist nicht witzig“, tobt seine Mutter mit gefährlich verrutschendem Pagne über den prallen Brüsten und erneuert den Knoten ihres Tuches. Ibrahim wirft ärgerlich die andere Hälfte der Sandale hinterher und entzieht sich jeder weiteren Diskussion, indem er in seiner Hütte verschwindet.
Die vierzehnjährige Aissatou kichert hinter vorgehaltener Hand. Ein Blick von Ibrahims Mutter genügt, und Aissatou schnappt sich die nassen Katzenbündel, rubbelt sie mit einem Zipfel ihres Pagne trocken und setzt sie in sicherer Entfernung bei ihrer aus dem Versteck wieder aufgetauchten Mutter ab.
Ibrahims zweijährige Nichte Fatou und sein knapp dreijähriger Neffe Marufo sitzen auf dem Sandboden und schauen dem Treiben mit großen Augen zu. Die Mutter der beiden, seine Schwester Dzuera, ist mit ihrem Baby beschäftigt. Die Kleinen lassen spielend Sand und Blätter aus ihren über dem Kopf erhobenen Händchen rieseln. Dabei bekommt Fatou Sand in die Augen. Schreiend reibt sie sich die kleinen Fäuste ins Gesicht. Aissatou lässt wieder ihre Töpfe in Stich und eilt tröstend an Fatous Seite. Sie nimmt sie auf den Arm und wischt ihr mit der flachen Hand den Sand aus dem Gesichtchen, drückt ihr die Augenlider zu und pustet liebevoll noch verbliebene Sandkörner um die Augen herum fort.
„Müsst ihr denn immer gleich so ein Geschrei machen?“, zetert Ibrahims gebrechlicher Vater von der ebenso hinfälligen Holzbank im Schatten der Hauswand. Kopfschüttelnd, die Hände auf seinen Stock gestützt, murmelt er: „Dieser Junge, wo der hinkommt, gibt es Unruhe“; und etwas lauter in Richtung Ibrahims Hütte: „Wo bleibt der Respekt gegenüber deinem alten Vater? Habe ich nicht das Recht auf einen ruhigen Abend im Kreise meiner Familie?“ Keine Antwort.
Stattdessen trägt die Abendbrise nun die friedlichen Geräusche der Nachbarn in die eintretende Stille seines Hofes. Nebenan wird Hirse gestampft, Kinder planschen mit dem Waschwasser, die Blechtore knarzen von den heimkehrenden Männern und Gesprächsfetzen wehen herüber.
‚So sollte es auch hier sein’, denkt Ibrahims Vater neidisch und steht mühsam auf. Eigentlich ist dies die angenehmste Stunde seines sonst eher eintönigen Tages; alle sind zu Hause und sein Sohn muss Rechenschaft über die ihm aufgetragenen Arbeiten ablegen. Das gibt ihm das Gefühl, noch der Herr im Hof zu sein. Außerdem schätzt er es, wenn die leichte, fast ätherische Abendluft sanft über sein zerfurchtes Gesicht streicht und ihm das Atmen erleichtert; er genießt die verführerischen Kochdünste, die seine Sinne wieder beleben, wenn er den Frauen beim Kochen zuschaut; aber vor allem liebt er es, von der kleinen Anhöhe den Blick über den Hof in die Savanne bis zum Horizont schweifen zu lassen und dabei seinen Gedanken nachzuhängen. Das alles hat ihm Ibrahim durch sein unbedachtes Handeln verdorben.
Der alte Ärger über seinen Sohn kommt wieder hoch: „Wir reden noch“, ruft er in Richtung Ibrahims Hütte und stakst steifbeinig zu seiner eigenen Hütte; dabei wendet er noch einmal den Kopf zu den Frauen und knurrt über die Schulter: „Ruft mich, wenn das Essen fertig ist.“
Schon ist die Nacht den verblassenden Rottönen des Tages hart auf den Fersen, während das Treiben im Hof wieder seinen normalen Gang geht. Dzuera ist dabei, das Tragetuch mit Baby Jean Léopold neu zu ordnen, um sicherzugehen, dass ihr das Kind, wenn sie sich beim Kochen bückt, nicht verrutscht. Während dieser Prozedur schwankt Baby Jean
Léopolds Kopf halsbrecherisch hin und her; aber Baby ‚Jelo’, so nennen es alle der Einfachheit halber, hält es nicht einmal für nötig, die Augen zu öffnen, denn es hat seit seiner Geburt die Erfahrung gemacht, dass es auf dem Rücken der Mutter sicher ist und viel interessanter als allein auf dem großen Bett in der Hütte, wo die älteren Kinder auf es aufpassen sollen, es kitzeln und an den Zehen ziehen, liebevoll, aber nicht gerade zimperlich.
Inzwischen ist das Essen fertig. Aissatou hat den Boden mit einem alten Stück Stoff ausgelegt, die gefüllte große Kalebasse und einen kleinen Topf mit Soße bereitgestellt und zwei Stangen Baguette danebengelegt. Die Holzschemel werden im Kreis darum angeordnet und wer keinen hat, hockt sich auf den Boden, sitzt seitwärts auf dem Tuch. So auch Ibrahim.
„Willst du noch weg?“, fragt ihn seine Mutter und mustert ihren Jüngsten von der Seite, der gebügelte Jeans und sein bestes T-Shirt trägt.
„Hm“, antwortet ihr Sohn einsilbig, was so viel wie ‚ja’ heißen soll.
Es gibt Reis mit Gemüse, Fisch und Huhn. Für diejenigen, die es scharf mögen, gibt es noch eine kleine Schüssel mit scharfer Soße. Fürsorglich lösen die männlichen Familienmitglieder, Ibrahims Schwager Massamba ist inzwischen auch zu ihnen gestoßen, Stückchen vom Fisch oder Fleisch und legen es den Frauen und Kindern dorthin, wo sie ihre Hand in die Schüssel tauchen. Es wird schweigend gegessen. Nur gelegentliches, zufriedenes Schmatzen, das Rascheln der Stoffe, wenn die Frauen sich bewegen und Fatous leises Quengeln ist zu hören. Ibrahim langt kräftig zu; er leistet die Schwerarbeit auf dem Feld und muss daher mehr essen. Als die Schüssel fast leer ist, löst sich die Runde nach und nach auf; die Frauen räumen auf. Sie werfen dem Hund die Reste hin, der sich mit einem Huhn darum streitet. Ibrahim verscheucht das Huhn, und, bevor wieder etwas passiert und er die Schuld daran trägt, oder sein Vater noch etwas sagen kann, verlässt er mit langen federnden Schritten erfrischt und gestärkt den Hof. Das alte Tor scheppert und rumpelt unter Protest gegen die grobe Behandlung.
Die Nacht wirft nun gemächlich ihr schwarzes Tuch über den Himmel. Am Straßenrand erhellen die kleinen Petroleumlampen der Händler und die Kohlefeuer der Garküchen notdürftig die angebotene Ware und werfen lange, von unzähligen Schlaglöchern unterbrochene Schatten auf die holprige Sandpiste. Die Garküchen haben Hochbetrieb und vor den aus alten Brettern zusammengenagelten Verkaufsständen drängen sich große und kleine Kinder, um ein Bonbon oder zwei Zigaretten für den Vater zu erstehen. Es gibt dort Kekse, Kaugummi und Moskitospiralen zu kaufen; eben alles, was der Mensch so zum Feierabend braucht.
Ibrahim weicht geschickt den im Schatten liegenden Löchern der Straße aus. Zielstrebig geht er auf die kleine Bar an der Ecke zu, eine Bretterbude, die an zwei Seiten die Luken geöffnet hat. Dort warten seine Freunde schon auf ihn. Sie hocken auf einer windschiefen Holzbank, jeder mit einem einheimischen Softdrink vor sich.
Zur Begrüßung klatschen sie sich grinsend mit erhobener Hand in die Handflächen. Die coole Begrüßung täuscht aber nicht über die latent vorhandene schlechte Laune der schon Anwesenden hinweg.
Ibrahim stützt seine Ellenbogen auf den hohen Holztresen, ordert eine Limonade und mustert seine Freunde über die Schulter von der Seite. „Was gibt’s Neues, alles okay?“ Er schiebt ein paar kleine Münzen über die Theke und setzt sich mit dem Getränk zu seinen Freunden.
„Ja, ja, was soll schon sein?“, kommt etwas unwirsch von Amadou zurück. „Immer dasselbe“, ergänzt Sekou und nimmt ergeben einen Schluck aus seiner Flasche.
Jeder hängt seinen Gedanken nach, bis Amadou in trotzigem Ton das Schweigen bricht: „Ich hab Lust auf eine Zigarette; habt ihr noch ein paar Münzen?“ Er schaut Sekou und Ibrahim fordernd mit geöffneter Hand an. Sekou krempelt bedauernd seine Hosentaschen nach außen und Ibrahim gesteht, dass er auch pleite ist. Die Freunde verfallen in unheilvolles Schweigen.
Sekou studiert aufmerksam das Etikett der Flasche in seiner rechten Hand; Amadou säuselt ohne Erfolg einer vorbeigehenden Dorfschönheit Komplimente hinterher.
„Vergiss es. Bei der wirst du nie landen“, belehrt Sekou seinen Freund, und mit verächtlicher Stimme: „Die geht nur mit einem Typen aus, der ein Auto hat und ihr Geschenke machen kann.“
Mit dieser Aussage tritt er nichts ahnend eine Lawine von angestautem Frust los. „Oh Mann“, stöhnt Amadou, „ich kann so nicht weitermachen. Jeden Tag, den Gott mir schenkt, arbeite ich von morgens bis abends, putze den Touristen das Klo, mache jede Dreckarbeit in der Herberge, und wofür? Für einen Hungerlohn! Und am Ende eines harten Tages kann ich mir nicht mal eine Zigarette leisten.“
„Aber du rauchst doch gar nicht“, versucht Sekou ihn zu beruhigen.
„Na und?“, schnarrt Amadou, „darum geht’s doch gar nicht.“
Die grellen Scheinwerfer eines luxuriösen Jeeps streifen für den Bruchteil einer Sekunde sein wütendes Gesicht und degradieren es zu einer Fratze; sie tauchen im unregelmäßigen Rhythmus der Schlaglöcher immer wieder auf und ab. Mit hochgekurbelten Fenstern bahnt sich der Jeep wie ein ungelenkes Erkundungsmobil auf dem Mars im Schritttempo seinen Weg an der Bar vorbei.
Die Augen der Freunde folgen wie hypnotisiert diesem fahrenden Alien, so nah und doch Lichtjahre entfernt.
„Die haben‘s gut“, mault Amadou, „da drinnen gibt es weder Staub noch Hitze.“ Dann springt er auf und kreischt: „Das glaub ich nicht. Seht mal, wer da neben ‚Mr. Right’ sitzt.“ Er will auf die Straße laufen und das Auto anhalten, doch Ibrahim und Sekou halten ihn fest. Die Insassen des Jeeps haben ihre Blicke stur nach vorne gerichtet, während das Fahrzeug langsam an ihnen vorbeizieht und sich an der Ecke den Blicken der drei Freunde entzieht.
Völlig fertig von seinem Ausbruch, lehnt Amadou sich an die Bretterwand der Bar. „Kein Wunder, dass Miriam auf den Affen reinfällt; ich kann ihr ja nicht mal ne Fanta spendieren“, fügt er, etwas ruhiger geworden, hinzu. „Das bisschen, dass ich verdiene, reicht kaum für Lebensmittel und die Medikamente meiner Mutter.“
„Ach beklag dich nicht immer“, wirft Sekou mürrisch ein, „du hast wenigstens noch Arbeit. Sieh mich an, ich renn den ganzen Tag durch die Stadt auf der Suche nach irgendwelchen Gelegenheitsarbeiten; und wenn ich dann todmüde nach Hause komme, fragt mein Alter mich, wovon ich denn müde sei, ich hätte ja den ganzen Tag nichts getan. Dann bin ich erst richtig frustriert. Wenn mein Onkel mir nicht hin und wieder etwas zustecken würde, dann könnte ich mich gar nicht mehr zu Hause sehen lassen.“
„Hey, hört auf damit“, wirft Ibrahim beschwichtigend ein, „lasst uns nicht Trübsal blasen; das führt doch zu nichts.“ Er blickt seine Freunde mit ruhigen, dunklen Augen an. Nur die immer präsente senkrechte Falte zwischen seinen Brauen und die nahezu chronisch nach unten gezogenen Mundwinkel zeugen von seinem eigenen, schon lange währenden Frust.
„Ich verstehe nicht, wie du das aushältst“, poltert Amadou und projiziert seinen Ärger über die fahnenflüchtige Freundin auf den immer geduldigen, besonnenen Ibrahim. „Du schuftest tagein tagaus auf dem Feld, tanzt wie ein Sklave nach der Pfeife deines Vaters und darfst obendrein auch noch die Verantwortung für alles tragen. Ich an deiner Stelle wäre schon längst abgehauen.“
„Eines Tages …“, beginnt Ibrahim, aber Amadou schneidet seinem Freund ungeduldig das Wort ab, „eines Tages, eines Tages, wie lange willst du noch warten? Du bist der Älteste von uns. Glaubst du wirklich, dass sich etwas ändert, wenn dein Vater dir auch offiziell die Verfügungsgewalt über Hof und Feld gibt?“
„Nein, das wohl nicht, aber eines Tages, so Gott will, werde ich das Dorf verlassen und einen eigenen Laden in der Stadt haben.“
„Klar, und ich bin dein bester Kunde“, witzelt Amadou übertrieben optimistisch, „und als dein langjähriger Freund habe ich selbstverständlich lebenslangen Kredit, oder?“ Alle drei lachen.
Seit der Schulzeit sind sie unzertrennlich, und, obwohl sie sich nicht nur äußerlich sehr voneinander unterscheiden, haben sie doch eines gemeinsam: Sie sorgen für ihre Familie und leben am Existenzminimum.
„Ach Leute, was ist nur aus unseren Träumen geworden?“, seufzt Amadou.
„Was für Träume?“, stichelt Ibrahim, „Träume sind Schäume und wir haben es mit der harten Realität zu tun.“ Als Antwort breitet Amadou die Arme aus und erhebt sich halb von der wackeligen Bank, als wolle er abheben. Sekou kann gerade noch seine halb volle schwankende Flasche festhalten.
„Die Welt dreht sich und wir sitzen hier wie der Pickel am Arsch fest“, tönt Amadou theatralisch und richtet den Blick dann wütend in die Runde.
„Was kannst du denn nicht ab, das Drehen oder das Festsitzen?“, fragt Sekou ironisch grinsend und zieht seinen Freund zurück auf die Bank.
Amadou lässt aber nicht locker. „Ich komme mir vor wie eine blöde Ameise in ihrer Mini Welt von Arbeit und Familie. Es gibt doch auch noch Anderes im Leben.“
Sekou und Ibrahim klopfen dem Freund beruhigend auf die Schulter. „Ich bin aber ein Mensch“, insistiert Amadou bockig, die Hände der Freunde von seinen Schultern abschüttelnd.
„Klar, wissen wir doch …“, feixen Sekou und Ibrahim.
„Ich will Spaß haben und etwas von der Welt sehen, und tolle Klamotten kaufen.“ Jetzt reißt Ibrahim der Geduldsfaden.
„Aber sonst geht’s dir gut?“ Sie schweigen wieder.
Später versucht der Barkeeper, ihnen die leeren Flaschen abzunehmen, doch sie finden noch ein paar Tropfen auf dem Boden des Glases. „Für heute ist Feierabend, Jungs; geht nach Hause“, sagt er väterlich und fängt ohne zu drängen an, die Holzklappen herunterzulassen.
„Ich muss in ein paar Stunden schon wieder aufstehen“, sagt Ibrahim und erhebt sich.
Vor der Bar trennen sich die Freunde. Jeder geht in eine andere Richtung. Schon nach ein paar Metern hat die afrikanische Nacht ihre Gestalten verschluckt; die kleinen Feuer der Garküchen verglühen langsam, während sich der Rand des Mondes in die Nacht schiebt. Es sind nur noch wenige Menschen unterwegs.
Auf dem Heimweg denkt Ibrahim mit gesenktem Kopf darüber nach, wie schlecht seine Chancen stehen, in absehbarer Zeit seinen Traum vom Import- und Exportladen zu verwirklichen.
‚Sekou und Amadou haben recht; ich werde das Startkapital nie zusammenbekommen’, denkt er verzweifelt, ‚trotz der harten Arbeit. Wenn Papa mir wenigstens erlauben würde, etwas anzubauen, das mehr Geld einbringen könnte. Aber nein. Das wäre ja ein Risiko.’ Wütend kickt er einen Stein aus dem Weg und knickt im nächsten Schlagloch mit dem Fuß um.
„Au! Verdammter Mist!“ Noch etwas humpelnd erreicht er das heimatliche Tor. Seine Wut verraucht, als er seine Mutter sieht, die die letzte Wäsche von der Leine nimmt und ihm über die Schulter mit erhobenen Armen zulächelt. „Mama können wir reden?“
„Wann, jetzt?“, fragt sie mit einem forschenden Blick in sein Gesicht.
„Ja, wenn du fertig bist.“
Sie sitzen nebeneinander auf der schmalen Holzbank, lauschen in die Nacht hinein; alle Hühner sind nun still, nur die Grillen zirpen und der Wind spielt mit dem dürren Laub des Oleanderbusches. „Du brauchst nichts zu sagen, mein Sohn; ich verstehe dich.“
„Ja, aber …“
„Warte noch ein wenig, wir müssen erst noch das Dach vor der Regenzeit reparieren und die Wände ausbessern“, flüstert sie, „danach werde ich mit deinem Vater reden.“
„Ach Mama, es wird immer etwas dazwischen kommen“, stellt Ibrahim mit harter Stimme klar, so als wäre er dabei, die Geduld zu verlieren, „und Papa erwartet von mir, dass ich die Landwirtschaft auch in Zukunft in den Mittelpunkt meines Lebens stelle. Du weißt doch, was er immer sagt, wenn ich mal wieder einen Vorstoß in Richtung Selbstständigkeit wage, ‚von deinen Flausen im Kopf werden wir nicht satt.’ Und damit ist für ihn das Thema erledigt, ich halte wie immer den Mund und gehe lustlos wieder an die Arbeit.“
Seine Mutter seufzt und schaut in den schwarzen Nachthimmel. Dort ist nicht viel zu sehen; Hilfe ist von dort auch nicht zu erwarten, also wendet sie sich wieder ihrem Sohn zu. Mitleid und sehr viel Liebe schwingen in ihrer Stimme, als sie vorsichtig sagt:
„Vielleicht kannst du das alles viel besser ertragen, wenn du endlich heiratest.“
„Ach Mama, fang doch nicht wieder damit an. Warum habe ich wohl nicht einmal eine feste Freundin? Weil ich mich erst gar nicht auf ein Leben im Dorf einstellen will.“
Enttäuscht über den Ausgang des Gesprächs und etwas ärgerlich erhebt Ibrahim sich; seine Mutter hält ihn besorgt am Ärmel fest.
„So Gott will, wird schon alles gut werden, mein Sohn“, versucht sie ihn wieder versöhnlich zu stimmen.
Ibrahim hält seine Mutter liebevoll bei den Schultern, schaut ihr fest in die Augen und sagt: „Keine Angst Mama, ich werde immer für dich sorgen; aber ich muss meinen Weg gehen.“
Er verschwindet, von den sorgenvollen Blicken seiner Mutter begleitet, in seiner Hütte. ‚Morgen ist auch noch ein Tag’, denkt Ibrahims Mutter und wischt verstohlen eine Träne aus dem Augenwinkel.
Amadou überlegt, ob er noch bei Miriam vorbeigehen soll, um seine Freundin wegen der Fahrt im Jeep zur Rede zu stellen. Aber es ist schon spät; ihre Eltern sind sehr streng und außerdem muss er nach Hause, um nach seiner kranken Mutter zu sehen.
Sein Vater sitzt noch draußen auf der Bank. „Na, Papa, noch nicht müde?“ Er setzt sich neben ihn und versucht, sich seinen Kummer und Frust nicht anmerken zu lassen.
„Ich habe auf dich gewartet, Amadou“, antwortet sein Vater, „deiner Mutter geht es gar nicht gut, kannst du …“
Amadou erhebt sich sofort wieder und lauscht am mit Stoff verhangenen Eingang zur Hütte seiner Mutter. Leise fragt er durch den Vorhang: „Mama, bist du noch wach?“
Jaa, komm’ nur herein“, flüstert sie schwach. Er setzt sich ans Kopfende der Schlafstätte zu ihr auf den Boden.
„Miriam war hier“, fügt sie hinzu und schließt vor Schwäche die Augen.
„Mama, du sollst dich nicht anstrengen“, lenkt Amadou ab, weil er nicht möchte, dass seine Mutter sich aufregt. Er taucht einen Stofffetzen in die neben dem Bett stehende Wasserschüssel, wringt ihn aus und betupft behutsam die heiße Stirn seiner Mutter. „Soll ich den Doktor holen?“, fragt Amadou mit besorgter Miene.
„Nein, nein, so schlimm ist es nicht.“ Sie versucht sich etwas aufzurichten, „aber ich muss mit dir reden.“ Amadou setzt sich zu ihr auf das Bett und hält stützend den rechten Arm um die Schultern seiner Mutter. „Es geht um Miriam“, beginnt sie und macht erschöpft eine Pause, „sie ist solch ein liebes Mädchen.“
„Da bin ich mir nicht mehr so sicher; ich habe sie heute Abend im Jeep von dem Typen gesehen, der in Deutschland lebt und zu Besuch bei seiner Familie ist.“
„Ach Junge, das hat nichts zu sagen; er hat sie nur ein Stück mitgenommen, weil sie so viel zu tragen hatte. Das hat sie uns selbst erzählt.“ Amadou schweigt. „Aber du solltest nicht mehr zu lange mit dem Heiraten warten, sie liebt dich wirklich und hat es nicht verdient, so hingehalten zu werden.“
Amadou antwortet nicht; seine Gedanken driften, wie schon so oft, zurück zu dem Afrikafestival, das vor einigen Jahren live im Fernsehen übertragen worden war. ‚Wo hatte das noch stattgefunden?’, versucht er sich zu erinnern, ‚auf jeden Fall in Europa.’
Der Besitzer vom ‚Paradies’ hatte damals in einem Anfall von Großzügigkeit und der Erwartung eines festtagsähnlichen, hemmungslosen Getränkeumsatzes, seinen Fernseher mit drei gefährlich brüchigen Verlängerungskabeln unter dem Mangobaum aufgestellt. Das ganze Dorf hatte, auf dem nackten Boden hockend, fasziniert die Funken sprühende Show von tanzenden und singenden Afrikanern verfolgt. Begeisterung und Stolz waren auf den Gesichtern des Publikums abzulesen.
Nur einmal wurde diese friedvolle Einträchtigkeit unter den Schaulustigen von etwas wirklich Trivialem empfindlich gestört: von einem dicken Vogelschiss direkt auf den Fernseher. Den Besitzer des Fernsehers traf fast der Schlag. Er sprang vom einzigen Stuhl auf und brüllte in die verunsicherte Menge: „Macht das weg oder ich mach den Kasten aus!“ Ein Tumult entstand; einige waren der Meinung, dass der Besitzer das selber machen sollte, andere waren der Meinung, den Vogelschiss nicht weiter zu beachten, um die Show nicht zu verpassen, andere wiederum konnten sich vor Lachen kaum halten, und noch andere waren wütend, weil die Palavernden den Bildschirm verdeckten. Schließlich wurde der Barkeeper, der nichts Böses ahnend weitere Getränke herausbrachte, dazu verdonnert, die Schweinerei zu beseitigen. Sein angeekeltes Gesicht dabei provozierte die Anwesenden prompt erneut zu einer Vielzahl von Bemerkungen mitfühlender, aufziehender oder höhnischer Art. Amadou schmunzelt bei dem Gedanken an die Szene.
„Amadou, woran denkst du?“ Seine Mutter legt ihre verschwitzte Hand leicht auf den Arm ihres Sohnes. In ihren Augen flackert ein Lächeln.
Erfreut nutzt er die Gelegenheit, um seine Mutter etwas aufzuheitern. „Ach, kannst du dich noch an den Vogelschiss auf dem Fernseher der ‚Paradies‘-Bar erinnern?“ Natürlich kann sie das, und für eine kleine Weile denken beide nicht an Krankheit.
Als Amadous Mutter erschöpft ihre Augen schließt, kehren seine Gedanken wieder zurück zu den afrikanischen Künstlern.
‚Die haben es geschafft’, hatte er damals gedacht, ‚dabei machten sie dort auf der Bühne in Europa nichts anderes als zu Hause. Nur, dass sie dort Geld dafür bekamen. Sie nannten sich ‚Botschafter der afrikanischen Kultur’ und die Weißen fuhren total darauf ab.’
Amadou ist ein Tagträumer.
Seine Gedanken driften in seinen Lieblingstraum ab, wo auch er Botschafter seiner Kultur ist, wo er als Tänzer um die Welt reist und sich auf internationalen Bühnen feiern lässt. Er würde erst dann zurückkommen, wenn er das nötige Geld hätte, um die besten europäischen Ärzte und eine Pflegerin für seine Mutter zu engagieren, und wenn er seinen Eltern ein schönes, kühles Haus bauen könnte.
„Amadou, hörst du mich? Ich rede mit dir.“ Amadou hört sie nicht; sein Körper ist zwar anwesend aber sein Geist hat den afrikanischen Kontinent verlassen. ‚Ja, und er würde auch etwas für sein Dorf tun. Nicht wie die anderen, die nur an sich selbst denken, die gerade mal das Nötigste aus dem reichen Europa schicken. Zugegeben, um es richtig zu machen, müsste er zunächst in der Hauptstadt eine traditionelle Tanzausbildung absolvieren, um sein Talent professionell umzusetzen; tanzen kann ja jeder.’
„Amadou.“
„Ja, Mama“, er wendet ihr schleppend den Kopf zu, die Augen folgen verzögert, als müssten sie sich gewaltsam von seinem schönen Zukunftstraum losreißen. „Tut mir leid; was hast du gesagt?“
Sie seufzt. „Ich wünsche mir so sehr, dass du Miriam heiratest.“
„Mama, ich bin noch zu jung zum Heiraten, und abgesehen davon haben wir kein Geld für eine Hochzeit.“
Das Petroleumlämpchen neben dem Bett seiner Mutter flackert und erlischt dann ganz. Mutter und Sohn lassen die vollkommene Dunkelheit zu. Reglos verharren sie in Schweigen; die unausgesprochenen Worte hängen abwartend in der stickigen Luft. Sie haben keine Eile. Dann entschließt Amadou sich doch, für Licht zu sorgen. Er tastet auf dem Regal neben dem Bett nach Streichhölzern, steht auf, hebt den Vorhang vor dem Eingang zur Seite und befestigt ihn an einem dafür vorgesehenen Nagel. „Ich hole nur Öl für die Lampe, bin gleich wieder da“, sagt er leise in Richtung Bett.
Als er zurückkommt, ist seine Mutter in einen leichten Schlaf gefallen. Er sorgt dafür, dass die Lampe wieder brennt, fächelt mit einem Stück Pappe etwas frische Luft in die Hütte und gesellt sich dann zu seinem Vater draußen auf die Bank. „Schläft sie?“ „Ja.“ Ihre Blicke wandern bedächtig hoch zum Himmel, wo unzählige Sterne nach und nach ihre Position einnehmen.
Ein ganz normaler Tag
Sekou hat bei seinem Onkel geschlafen. Das macht er oft, um dem Stress mit seinem Vater zu entgehen. Es ist noch Nacht, als er sich von seinem Lager erhebt. Er tritt aus dem Haus und geht mit noch vom Schlaf verklebten Augen hinter die Büsche, um sich zu erleichtern. Dabei blickt er in den Himmel und sieht die Sterne in der beginnenden Morgendämmerung verblassen. Zurück im Haus, wirft er sich eine Handvoll Wasser ins Gesicht, spült sich den Mund aus, nimmt ein paar Münzen aus einem Glas und schlüpft so leise wie möglich durch das knarrende Holztor.
Auf der Straße steuert er den Brotstand an, einen kleinen Holzverschlag mit einer Luke zum Herausreichen des Brotes. Hier schmeckt das Brot am besten. Beim Nachbarstand kauft er dann noch vier Eier, zwei Zwiebeln und etwas Erdnuss-Öl in einem kleinen Plastikbeutel. Der Verkäufer legt die Eier vorsichtig in einen zu einer Papiertüte zusammengedrehten Papierfetzen und lächelt Sekou freundlich an. „Vergiss nicht das Salz“, erinnert Sekou ihn mit ruhiger Stimme. Der Verkäufer knebelt einen Teelöffel voll Salz in einen noch kleineren Papierfetzen und packt alles in eine dünne Plastiktüte. „Grüß deinen Onkel von mir.“ Sekou nickt.
Der Verkäufer mag den Jungen, er ist immer hilfsbereit und höflich, und er ist sich für keine Arbeit zu schade. Manchmal, wenn abends noch Brot übrig ist, ruft er den Vorübergehenden zu sich und schenkt ihm ein oder zwei Brote - es wäre doch schade, wenn es altbacken würde - weil er weiß, dass Sekou seinen Stolz hat. ‚Tja, der Junge hat wirklich Pech gehabt’, denkt er und schaut ihm nachdenklich nach. ‚Ohne Mutter aufzuwachsen, ist schon schlimm genug, aber mit dem griesgrämigen Vater unter einem Dach zu leben, der mit dem Leben hadert und dem Sohn für jegliche Misere die Schuld gibt, ist nicht einfach.’
Er reicht der dreijährigen Tochter seiner Nachbarin eine volle Tüte hinunter in die ausgestreckten Ärmchen. „Kannst du das alleine tragen?“ „Ja“, antwortet sie stolz und balanciert auf dünnen Beinchen vorsichtig die Tüte auf dem Kopf.
‚Schließlich’, spinnt er seine Gedanken weiter, trifft den Jungen keine Schuld daran, dass seine Mutter von einem Verwandtenbesuch in Guinea nie mehr zurückkehrte. Er muss damals gerade mal fünf gewesen sein. Der einzige Lichtblick im Leben des Kindes war seither sein Onkel, ein Bruder seiner Mutter. Später hat der dann auch Sekous Begabung für das Kunsthandwerk entdeckt und ihn zu Baba Joel in die Ausbildung zum Instrumentenbauer geschickt. Alles schien sich für den Jungen endlich zum Guten zu wenden. Aber, wie das Leben so spielt.’ Er gibt sich seufzend einen Ruck, um seine trüben Gedanken abzuschütteln; er muss sich jetzt auf die Gegenwart konzentrieren; denn alle Dorfbewohner sind nun auf den Beinen und benötigen noch das eine oder andere zum Frühstück.
Mit dem duftenden Brot unterm Arm, und der Plastiktüte mit den übrigen Einkäufen in der Hand, stößt Sekou mit dem Ellenbogen das Tor zum Hof seines Onkels auf und legt seine Einkäufe in der Kochecke ab.
Bedächtig entfacht er ein kleines Kohlefeuer und setzt einen Topf mit Wasser für den Tee auf. In der Zwischenzeit verquirlt er die Eier in einer alten Tasse mit abgebrochenem Henkel und schneidet eine große Zwiebel in Streifen. Er hängt je einen Teebeutel in die bereitstehenden Becher, und als das Wasser kocht, nimmt er einen alten Lappen, um sich nicht an dem heißen Topf zu verbrennen und gießt es vorsichtig in die Becher. Er hebt den Kopf und lauscht auf die Geräusche aus dem Haus. Das Bett quietscht, eine Schranktür klappt, sein Onkel ist aufgestanden. Sekou setzt die flache Aluminiumpfanne auf das Feuer. Das Öl zischt, als er es in die heiße Pfanne gießt; zügig fügt er die Zwiebelstreifen hinzu, dünstet sie etwas an und schüttet die verrührten Eier darüber. Es duftet appetitlich.
Sein Onkel steht in der Türöffnung und schnuppert, während er sich das frisch gewaschene, geblümte Hemd zuknöpft.
„Gut geschlafen?“, fragt er und klopft Sekou freundlich auf die Schulter.
„Es geht so“, ist die vage Antwort, „und du?“
„Hervorragend.“ Sein Onkel nimmt die vollen Becher, zwei Teller und Gabeln mit an den kleinen Tisch auf der Veranda. „Bringst du das Brot mit?“, ruft er in Richtung Kochecke. „Hm“, kommt die Bestätigung.
Im Osten schiebt der herannahende Tag zartblau die Nacht wie eine Wand vor sich her, der Himmel färbt sich dort bereits leicht rosa, gleich wird die Sonne aufgehen. Die beiden Männer tauchen schweigend ihre Gabeln in die Pfanne und tunken Brotstückchen in die Soße.
„Hast du heute eine Tour über Nacht?“, fragt Sekou den Älteren respektvoll mit gesenktem Kopf und niedergeschlagenen Augen.
„Nein, ein Kollege wollte gerne mit mir tauschen; er hat eine Freundin in der Stadt. Warum fragst du? Du weißt doch, dass du immer hier sein kannst.“ Er schaut seinen Neffen forschend an. „Ich bin schon spät dran, lass uns heute Abend reden, in Ordnung?“
„Klar. Mach’ dir keine Sorgen, es eilt nicht.“
Onkel Louis erhebt sich etwas schwerfällig; sein Rücken ist nicht mehr der Beste. Seit mehr als 20 Jahren schon steuert er den großen Überlandbus durch die Dörfer bis zur Hauptstadt; jetzt nehmen ihm seine Knochen diese einseitige Tätigkeit übel. Aber er beklagt sich nicht, weil er seine Arbeit und die Menschen liebt. Jeder von hier bis zur Küste kennt ihn; er ist überall gern gesehen. Abgesehen davon verdient er genug, um seinem Neffen und seinem Schwager ab und an finanziell unter die Arme zu greifen.
Er holt seine Tasche aus dem Haus, stellt sie kurz ab, um mit einem Stofffetzen sorgfältig imaginäre Staubkörnchen von seinen hochglänzenden Schuhen zu entfernen und wirft das Tuch danach achtlos in die Ecke.
„Also dann …“; sie nicken sich zu. „Und schau nach deinem Vater; du kannst etwas Geld nehmen, um einige Lebensmittel für ihn zu kaufen“, fällt ihm noch ein, dann schlägt das Tor hinter ihm zu.
Zurück bleibt ein nachdenklicher Sekou, der sich mit einem Ruck erhebt und geistesabwesend mit mechanischen Handgriffen die Reste des Frühstücks abräumt. Er fühlt sich wie zerschlagen, denn er hat die halbe Nacht wach gelegen. Die harten Worte seines Freundes haben wie Heuschrecken in seinem Kopf herumgeschwirrt und ein heilloses Durcheinander angerichtet. Und gegen Heuschrecken ist man ja bekanntlich machtlos.
„Warum zerbreche ich mir eigentlich den Kopf?“, sagt er leise zu sich selbst, „es kommt sowieso, wie es kommen muss: Gott stellt uns auf die Probe; wir müssen durchhalten und abwarten, was er mit uns vorhat.“
Damit hat er dem Allmächtigen den Schwarzen Peter zugespielt, obwohl das sonst gar nicht seine Art ist, und ist fürs Erste aus dem Schneider. Erleichtert wäscht er ab und macht Ordnung im Hof. Er tut das gerne, weil er so seinem Onkel etwas von dessen Fürsorge zurückgeben kann; auch wenn Hausarbeiten nicht nur in dieser Region eher den Frauen überlassen werden. Mit einem letzten prüfenden Rundblick über den Hof vergewissert er sich, ob er auch alles erledigt hat, dann schließt er das Holztor von außen mit dem schweren Vorhängeschloss.
Auf der staubigen Straße lenkt er seine Schritte gleich, wie jeden Morgen, zu dem einzigen kleinen Supermarkt im Dorf.
„Wie ist es, habt ihr heute Arbeit für mich?“, fragt Sekou den vor der Tür stehenden Chef.
„Nein, komm morgen wieder; morgen bekomme ich eine größere Lieferung; da kann ich deine Hilfe gut gebrauchen.“ Er klopft dem Jungen wohlwollend auf die Schulter, dreht sich um und geht in den Laden.
Sekou macht sich auf den Weg nach Hause. Ab und zu hält er an, um mit Muße ein paar Früchte auszusuchen, die sein Vater gerne isst. Ja und dann kauft er noch Gemüse, Trockenfisch, einen Maggi-Brühwürfel und ein Beutelchen Reis. ‚Das reicht für heute Mittag und für heute Abend’, denkt er zufrieden, ‚verhungern müssen wir jedenfalls nicht.’
Seine Gedanken machen einen Abstecher zu seinen Freunden. Ibrahim schuftet sicher schon längst auf dem Feld und Amadou lässt sich wahrscheinlich in der Herberge herumkommandieren; so gesehen geht es ihm gar nicht so schlecht, aber er würde auch viel lieber hart arbeiten, um sein eigenes Geld nach Hause zu bringen.
Unterwegs versucht Sekou, sich innerlich gegen die immerwährende schlechte Laune seines Vaters zu wappnen. Eigentlich tut er ihm leid, so ganz alleine und ohne Geld. ‚Wenn er nur nicht immer so ungerecht wäre.’ Sekou kennt seine Pflichten als Sohn und würde sie liebend gerne erfüllen, aber ohne Arbeit … Dafür nimmt er sich heute vor, besonders liebevoll und nachsichtig mit ihm umgehen. So motiviert öffnet er schwungvoll das Tor zu seinem Zuhause und blickt geradewegs in die vorwurfsvoll aufgerissenen Augen seines Vaters.
„Mein Gott, hast du mich erschreckt! Musst du denn direkt hinter der Tür sitzen?“
„Ja, das muss ich wohl“, sagt der Alte mit hoher weinerlicher Stimme, „so kann ich wenigstens mit den Ohren am Leben auf der Straße teilhaben und gleichzeitig sichergehen, dass ich dich nicht verpasse.“ Und in anklagendem Ton fügt er hinzu: „Du gibst hier ja nur noch ein Gastspiel. Wer weiß, vielleicht kommst du auch eines Tages gar nicht wieder, wie deine Mutter.“
Sekou zwängt sich wortlos an ihm vorbei, um die mitgebrachten Lebensmittel in der Kochecke abzuladen. ‚Da hat er doch tatsächlich die schwere Bank bis zum Tor manövriert, nur um mir ein schlechtes Gewissen einzureden’, denkt er. Sein Vater folgt ihm humpelnd dicht auf den Fersen. Mit gestrecktem Hals meckert er vorwurfsvoll:
„Woher hast du das Geld, um all diese Sachen zu kaufen? Bist du jetzt unter die Diebe oder unter die Bettler geraten?“
Sekou dreht sich so abrupt um, dass sein Vater erschrocken fast über ihn fällt. „Warum denkst du immer nur das Grundschlechteste?“, herrscht er ihn dicht vor seinem Gesicht in scharfem Ton an. Für den Bruchteil einer Sekunde registriert er die ungepflegten weißen Bartstoppeln im Gesicht seines Vaters, nimmt dessen alte, grau verschleierte Augen wahr und fügt etwas verständnisvoller hinzu: „Du weißt doch, dass Onkel Louis aushilft, wenn ich keine Arbeit habe. Ich tue mein Bestes, um dir das Leben etwas leichter zu machen, aber du machst es mir wirklich schwer.“
Resolut dreht er sich um und beginnt geschäftig in der Kochecke zu hantieren. Etwas kleinlaut und beschämt setzt sich der Alte an den Tisch.
„Ich weiß, du bist ein guter Junge, du kommst ganz nach mir“, und beschwörend setzt er hinzu: „Du wirst mich nicht in Stich lassen.“
Sekou nickt und denkt dabei an seine Mutter, die er 15 Jahre nicht gesehen hat. Sie hat auch ihm all die Jahre gefehlt.
„Was ist nun, bekomme ich heute noch etwas zu essen?“, unterbricht sein Vater, plötzlich munter geworden, seine Gedankengänge.
„Sofort. Setz dich doch schon mal“; und er serviert ihm ein richtig gutes Frühstück, mit allem was dazugehört.
Derweil schleudert Amadou in der Herberge lustlos den Wischlappen in den Eimer mit Schmutzwasser. Er hat die Duschen und Toiletten gewischt, Papierrollen nachgefüllt - was machen die Touristen bloß mit dem ganzen Toilettenpapier? - alle Zimmer bis auf eins in Ordnung gebracht, und jetzt sind die Flure dran. Alle Türen stehen offen, damit der nasse Fußboden trocknen und Frischluft in die stickigen dunklen Flure strömen kann. Tagsüber gibt es manchmal keinen Strom, so auch jetzt. Nur ein schmaler Streifen diffusen Tageslichts schwächelt durch die vergitterten kleinen Lüftungsfenster in den Duschen und erhellt notdürftig den Flur. Für Amadou ist das kein Problem, er kennt jeden Winkel dieser Herberge; er könnte selbst mit verbundenen Augen noch seine Arbeit erledigen. Dabei nimmt er es auch nicht so genau, weil der allgegenwärtige Staub, kaum dass er den Rücken kehrt, sowieso alles wieder bedeckt. Er arbeitet mit eindrucksvoller Langsamkeit, schließlich muss er seine Kräfte für den ganzen Tag einteilen.
Als die Tür von Zimmer fünf aufgeht, fallen staubschwere Sonnenstrahlen schräg in den Flur. Amadou und der Gast, eine nachts eingetroffene deutsche Touristin, blinzeln sich an. Beide können im ersten Moment kaum etwas sehen.
„Guten Morgen Mademoiselle, haben Sie gut geschlafen?“, fragt er höflich auf Französisch. Lächelnd betrachtet er die junge Frau im Badelaken mit dem Kulturbeutel in der Armbeuge. Sie hat Schweißperlen auf Stirn und Oberlippe.
„Oh, ja, es war nur so heiß im Zimmer.“ Sie hat auf Französisch geantwortet. Verlegen blickt sie ihn aus hellgrauen Augen an. Amadou reckt den Hals, um einen Blick ins Zimmer zu erhaschen.
„Ist der Ventilator kaputt?“
„Nein, nein, ich habe ihn abgestellt, er war so laut und außerdem vertrage ich die Zugluft nicht.“
„Ja, aber dann ist es ja kein Wunder, dass es heiß in Ihrem Zimmer ist.“ Er schnalzt missbilligend mit der Zunge. „Sie haben die Vorhänge nicht zugezogen und die Glaslamellen sind auch geöffnet. So kann die Hitze natürlich eindringen.“
Sie fühlt sich wie ein Kind, dass man bei einer Dummheit ertappt hat, und darüber ärgert sie sich. „Ich bin nicht zum ersten Mal in Afrika“, ist daher auch die etwas patzige Antwort, „ich weiß, was die Afrikaner machen, um die Hitze ertragen zu können.“
Sie will an ihm vorbei, aber er steht wie festgewachsen im Weg. ‚Was bildet der sich ein’, denkt sie, und laut sagt sie zickig: „Ich hatte die Wahl, an Hitzschlag oder an Sauerstoffmangel einzugehen. Sie wissen ja, wofür ich mich entschieden habe. Würden Sie mich nun bitte vorbei lassen, damit ich endlich duschen kann?“
Amadou macht betreten ein paar Schritte zur Seite. Sie rauscht, so zivilisiert es eben geht mit dem alten Duschtuch, den strähnigen, verschwitzten Haaren und den ungeputzten Zähnen, an ihm vorbei. Fast wäre sie auf dem noch feuchten Steinfußboden ausgerutscht, aber Gott sei Dank hat sie sich noch rechtzeitig gefangen. Amadou ist das nicht entgangen. Er grinst und denkt: ‚So ergeht es einem, wenn man hochmütig ist’, und laut ruft er ihr hinterher:
„Wann kann ich Ihr Zimmer machen, Mademoiselle?“
Sie dreht den Kopf zur Seite und antwortet kühl: „Um zwölf bin ich weg.“
Amadou lässt prompt alles stehen und liegen, um bis zwölf Uhr andere Arbeiten zu erledigen. Als er die Tür zum Hof öffnet, schlägt ihm die Gluthitze des Vormittags entgegen. Missmutig macht er sich auf den Weg zur Küche.
„Was ist?“, empfängt ihn sein Kollege frotzelnd, „ist dir ein weißer Geist erschienen oder warum machst du so ein Gesicht?“
Amadou blickt auf den Berg schmutzigen Geschirrs, der auf ihn wartet, und, den kleinen Spaß ignorierend, blafft er seinen Kollegen an: „Wie soll ich denn meine Arbeit schaffen, wenn die Weiße von Zimmer fünf erst mittags aufsteht, und ich dann noch mal anfangen muss zu putzen?“ Sie beide wissen, dass das nicht der einzige Grund für Amadous Frust ist.
Um zwölf Uhr mittags bringt Aissatou Ibrahim das Mittagessen und eine Flasche Wasser zum Feld. Sie trägt alles auf dem Kopf in einer mit einem Tuch und einem Teller abgedeckten Emailschüssel. Ibrahim erwartet sie bereits erschöpft unter dem Baobab, der um diese Jahreszeit zwar kaum Schatten spendet, dafür aber eine bequeme Anlehnmöglichkeit bietet. Aissatou breitet ein Tuch auf dem Boden aus und stellt das Mitgebrachte vor Ibrahim. Als er bedächtig zu essen beginnt, setzt sie sich in ein paar Metern Entfernung ins Gras, um auf die leere Schüssel zu warten. Ibrahim genießt das fruchtige, scharf gewürzte Essen. Es belebt seine müden Lebensgeister.
Als sich Aissatou langsam wieder auf den Heimweg macht, folgen Ibrahims Augen ihr mit abwesendem Blick so lange, bis die kleine, hoch aufgerichtete Gestalt am Horizont verschwunden ist. Er gähnt und streckt sich für einen Moment aus. Bevor er die Augen schließt, nimmt er sich vor, sobald wie möglich mit seinen Freunden ein ernsthaftes Gespräch über ihre missliche Lage zu führen. Wenn nicht heute, dann eben morgen, oder übermorgen.
Sekou ist nachmittags wieder zum Haus seines Onkels gegangen, hat das Abendessen gekocht und einen Teil davon in einem kleinen Emailtopf für seinen Vater beiseite gestellt. Er wird es ihm nachher bringen und hat sich vorgenommen, einmal wieder zu Hause zu schlafen.
Müde wischt er sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Ihm ist gar nicht wohl bei dem Gedanken an das Gespräch, dass er mit seinem Onkel zu führen gedenkt. Das frisch angezogene T-Shirt klebt schon nach fünf Minuten wie eine zweite Haut an seinem Körper. Hunger hat er auch keinen. Wen wundert’s, wenn die Sonne noch nicht aufgibt und wie die Öffnung eines Backofens am Horizont glüht.
Geduldig starrt er auf das Hoftor; vor ihm das Abendessen unter sauberen Tüchern. Als es endlich aufgeht, liegt die frühe Nacht schon grau-lila über den Bodensenken.
Sie essen schweigend. Es gibt für alles eine Zeit und jetzt ist die Zeit des Essens.
Nach einer angemessenen Erholungspause eröffnet der Ältere das Gespräch. „Also, worüber möchtest du mit mir reden?“
„Onkel Louis, du weißt, dass ich dir sehr dankbar bin für die fortwährende finanzielle und moralische Unterstützung. Aber du weißt auch, dass es nichts Schlimmeres für einen Sohn gibt, als dass er nicht für seine Eltern sorgen kann. Vater lässt mich das jeden Tag aufs Neue spüren.“ Sein Onkel lehnt sich vorsichtig auf dem klapperigen Stuhl zurück, verschränkt die Arme vor der Brust und schaut ihn nachdenklich an.
„Worauf willst du hinaus, Junge?“
„Na ja, ich möchte einfach endlich wieder mit meiner Arbeit anfangen.“
„Und wie stellst du dir das vor? Du bist zwar der beste Instrumentenbauer in der Gegend, aber …“
„Ich weiß, ich habe kein Atelier, kein Material und keine Leute mehr.“
Onkel Louis schlägt eine Hand auf den Oberschenkel „Siehst du, also was soll’s?“
Er erhebt sich, um seine Zigaretten aus der Küche zu holen. Sekou schaut ihm ruhig nach und wartet, bis sein Onkel wieder am Tisch sitzt und sich eine angezündet hat.
„Aber genau darum geht’s; ich brauche nicht alles auf einmal zu haben. Für den Anfang würde das Geld für Material reichen.“
So, jetzt war’s raus, und bevor Onkel Louis nur den Mund aufmachen kann, fügt Sekou hastig hinzu: „Arbeiten könnte ich fürs Erste hier oder zu Hause, und verkaufen könnte ich in der Stadt. Es gibt da einen kleinen Laden; ich kenne den Besitzer von früher, als ich noch mein eigenes Atelier im Süden hatte. Er weiß, dass ich durch den Bürgerkrieg alles verloren habe, und will mir helfen. Er hat mir angeboten, alle Instrumente, die ich anfertige, in Kommission zu nehmen, und auch Bestellungen für mich anzunehmen. Die Touristen kommen wieder ins Land und ich habe früher mit meiner Arbeit genug verdient, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten; warum sollte das jetzt nicht wieder möglich sein?“ Sekou lehnt sich zurück, atmet tief ein und langsam wieder aus.
Eine kleine Ewigkeit herrscht tiefes Schweigen. Nebenan wird eine Öllampe angezündet. Trotz der zwei Meter hohen Mauer strahlt ein wenig von ihrem sanften Licht herüber; denn direkt an der Mauer auf der anderen Seite steht ein kleiner Baum, dessen staubig grünes Blätterdach das Licht einfängt und wieder zerstreut. Im Osten geht der Abendstern wie ein kleiner Edelstein auf.
Als Onkel Idrissa seine Haltung verändert, huscht eine Maus erschrocken im Zickzack über den Hof. „Wir sollten jetzt auch die Lampe anzünden“, sagt er lachend.
Sekou erhebt sich schleppend, um die vertraute Blechlampe zu holen. Er kehrt mit dem flackernden Licht zurück, hängt es an den rostigen Haken für die Wäscheleine und versucht dann, wieder eine günstige Sitzposition in dem unbequemen Plastikstuhl zu finden.
„Du willst also, dass ich dir dieses Startkapital leihe. Und an wie viel hattest du dabei gedacht?“
Mutig antwortet Sekou mit fester Stimme: „Nachdem ich alles durchgerechnet habe, denke ich, sollten 500 Euro reichen.“
Sein Onkel schluckt und streicht sich nachdenklich über das Kinn. „Dafür müsste ich einen Kredit aufnehmen, soviel habe ich nicht auf der Bank.“
Hoffnungsvoll beugt Sekou sich vor und sagt beschwörend: „Du weißt, dass du mir vertrauen kannst. Ich habe es genau ausgerechnet: Nach drei Monaten kann ich mit der Rückzahlung beginnen.“ Beherrscht und bis zum Äußersten angespannt lehnt er sich wieder zurück und schaut seinen Onkel erwartungsvoll an.
„Ich glaube dir, aber ich möchte trotzdem wissen, wie deine Rechnung aussieht.“
Während Onkel und Neffe sich ausführlich über das Für und Wider eines Kredits beraten, spannt sich kühl und unbeteiligt das Sternenzelt über den weiten Himmel und Sekous Vater geht hungrig zu Bett.
Dörfliches Wochenendvergnügen
Mannshohe Lautsprecher vor der kleinen Diskothek ködern mit dröhnenden Bässen die Dorfjugend. „Kommt doch mit“, fleht Amadou seine Freunde Sekou und Ibrahim an, „ein bisschen Bewegung tut euch doch auch gut.“
„Ach ich weiß nicht, über Bewegungsmangel können wir nicht gerade klagen.“
„Wir brauchen ja nicht so lange zu bleiben“, lenkt Amadou schmeichelnd ein. Er trägt heute Abend als einziger von den Freunden traditionelle Kleidung. Sein Hosenanzug aus afrikanischem Stoff glüht in allen Braunrot-Tönen der afrikanischen Erde.
An der Kasse winkt Amadous bulliger, gutmütiger Cousin die Freunde durch. Amadou tänzelt gut gelaunt vorneweg; Hände strecken sich den Ankommenden entgegen, Schultern werden geklopft, Handflächen ehrerbietig auf die Brust gelegt. Die Luft steht; feucht und heiß lässt sie die Gesichter der Tanzenden glänzen. Die immer wieder benutzten Taschentücher und kleinen Waschlappen hängen schlapp und zipfelig aus den rückseitigen Hosentaschen.
Der DJ wechselt von Hip-Hop zu traditioneller afrikanischer Musik. Amadou wirft seinen Freunden einen fürsorglichen Blick zu, sie sind in guter Gesellschaft an der Bar, und bahnt sich einen Weg durch das Gedränge bis zur handtellergroßen Tanzfläche, die nur wegen der sich wild Bewegenden als solche erkennbar ist. Bereitwillig machen die Tanzenden etwas Platz für Amadou. Sie alle kennen und mögen ihn; denn er ist der Beste, der Champion! Ein Garant für mitreißendes Tanzen und ausgelassene Stimmung, erst recht ohne weibliche Begleitung.
Amadou badet für einen kurzen Moment in den Strömen der Sympathie, die ihm von allen Seiten entgegen fließen; dann schießt der heiße Rhythmus der Musik seinen biegsamen Körper. ‚Ja, der Tanz ist mein Leben’, wird Amadou wieder einmal klar und er schließt sekundenlang emphatisch die Augen wie zum Gebet. Seine Muskeln agieren wie ferngesteuert, als stünde er unter gleichmäßig abgegebenen Strom. Die aufputschenden Zurufe aus dem Publikum verführen ihn zu immer abenteuerlicheren Verrenkungen. Die Schweißtropfen lösen sich von seiner Stirn und werden von der Fliehkraft der extrem schnellen Bewegungen waagerecht unter die Gäste geschleudert. Die Stimmung ist auf dem Siedepunkt; die Bässe dröhnen aufreizend in den Körpern. Ausgelassen schwingen die jungen Männer ihre Taschentücher, ihre Freundinnen treten verständnisvoll lächelnd zurück und tanzen alleine weiter.
Amadou brennt der Schweiß bereits in den Augen und er nimmt alles nur noch wie durch einen Schleier wahr. Als sein Blick die Umgebung scannt, registriert er am Rande der Tanzfläche eine Weiße, die ihn, wie er meint, anzüglich anlächelt. Er wischt mit dem Handrücken über seine Augen und starrt sie an.
Die Menge tobt. Nutzlos und flügellahm schaukelt der schrottreife Ventilator über der Tanzfläche.
Das traditionelle Musikstück wird von einem Pop-Song abgelöst. Nicht, dass Amadou danach nicht tanzen könnte, er hat nur im Moment keine Lust dazu. Stattdessen kämpft er sich zu seinen Freunden an die Bar durch.
„Habt ihr das gesehen?“, fragt er Sekou und Ibrahim aufgeregt, während sein Blick schon wieder zurückwandert und suchend die Tanzfläche abtastet.
„Was denn? Was sollen wir denn gesehen haben? Beruhig dich erst mal.“
Amadou dreht den Kopf wieder in Richtung Freunde. „Die Weiße. Habt ihr die Frau mit den langen Haaren nicht gesehen?“ Er rollt die Augäpfel verklärt nach oben und seufzt, als jemand ihm von hinten auf die Schulter tippt und freundlich sagt:
„Darf ich mal? Ich möchte gerne etwas bestellen.“
Er dreht sich um und möchte auf der Stelle vor Scham im Erdboden versinken. ‚Sie hat alles gehört.’ Wie ein Kugelblitz rast dieser Gedanke kreuz und quer durch sein Bewusstsein, verzweifelt nach einem Ausweg suchend.
Die Weiße lacht amüsiert über sein verdutztes Gesicht, sie hat natürlich nichts verstanden, und seine Freunde, diese Idioten, stimmen auch noch mit ein. Doch dann registriert Amadou, dass sie ihn nicht auslacht, sondern freundlich anlacht, Grund genug, sich wieder geerdet zu fühlen, sich cool mit dem Rücken an die Bar zu lehnen und erst mal abzuwarten, was passiert.
Sie langt, seitlich stehend, mit ausgestrecktem Arm an ihm vorbei, um nach ihrem georderten Drink zu greifen. Es ist so eng vor der Bar, dass sie ihn dabei zwangsläufig berührt. Amadou weicht nicht einen Zentimeter zur Seite.
„Du warst gut auf der Tanzfläche“, sagt sie im Plauderton zu ihm und nimmt einen kleinen Schluck von ihrer Cola. Sie steht zu den drei Freunden gewandt und signalisiert damit Gesprächsbereitschaft. „Ich hätte dich fast nicht erkannt, … wahrscheinlich wegen der afrikanischen Kleidung. Die steht dir sehr gut“, fügt sie, nun etwas unsicherer geworden, hinzu.
Amadou erinnert sich an das verschlafene, verschwitzte Gesicht von Zimmer fünf und denkt: ‚Diese Frau ist ein Chamäleon. Wie kann sie sich sonst so verändern?’ Und noch ehe er seinen philosophischen Fragen auf den Grund gehen kann, fragt sie ihn, ob er mit ihr tanzen würde.
Ibrahim und Sekou schauen dem zur Tanzfläche strebenden ungleichen Pärchen mit sorgenvoller Miene nach. „Das hat uns gerade noch gefehlt.“
Kontaktaufnahme für alle Fälle
„Ich will nicht unter dem Ventilator tanzen. Der sieht aus, als ob er gleich abstürzen würde“, sagt sie und zieht ihn am Ärmel aus der Mitte.
„Da passiert nichts, der ist schon seit Urzeiten in diesem Zustand“, lacht Amadou sie aus, lässt sich aber bereitwillig fortziehen. Zögernd macht er ein paar gängige Tanzschritte ohne sie anzufassen.
„Wie heißt du eigentlich?“, fragt sie ihn aufmunternd. „Amadou, und du?“
„Sue“. Sie prustet lachend los und Amadou feixt verlegen in die Runde. Was die Anderen wohl denken. Als sie wieder zu Atem kommt, neigt sie ihr Gesicht zu seinem Ohr und flüstert schmeichelnd: „Kannst du nicht so mit mir tanzen, wie du es vorhin mit den Anderen getan hast?“ Amadou klopft das Herz hart unter seinem Brustbein. ‚Was will diese Frau eigentlich von mir?‘
„Ich, ich, äh, eigentlich tanzen nur wir Männer untereinander so; denn ein Mädchen kann, wenn es einen Rock trägt, nicht jede Bewegung mitmachen“.
„Ich kann aber.“ Sie blickt an ihren langen Beinen in weißen Jeans hinunter und dann herausfordernd in sein Gesicht. „Lass’ es uns doch wenigstens versuchen.“
Grob ergreift er ihre Hände und versucht, fast schon aggressiv, sie zu führen. ‚Dir werde ich es zeigen; du denkst wohl, nur weil du weiß bist, kannst du alles.’ Am Anfang klappt es dann auch gar nicht, weil er sich nicht auf sie einstellen will; als er aber merkt, wie sehr sie sich bemüht, ihren Rhythmus seinem anzugleichen, tut sie ihm fast schon leid und er verzeiht ihr, dass sie ihn in der Herberge so arrogant behandelt hat. Er fällt in einen geschmeidigeren Rhythmus, und als er erstaunt feststellt, dass Sue es drauf hat, erhöht er die Geschwindigkeit. Sie strahlt ihn siegessicher an. Behutsam versucht er ihre Schultern zu umschlingen und als Sue es erlaubt, lässt Amadou schmeichelnd seine Hände über ihren ganzen Rücken gleiten. Am Ende des Tanzes hat er sie fest im Griff.
„Du tanzt wie eine Afrikanerin. Wo hast du das gelernt?“, erkundigt sich Amadou mit leuchtenden Augen, als er Sue an die Bar zurückgeleitet.
„In Deutschland, in einer Disco, wo karibische und afrikanische Musik gespielt wird."
„Das bedeutet, dass es viele Afrikaner in deiner Stadt geben muss“, folgert Amadou, und Sue antwortet ihm gelassen:
„Ja, sie gehören inzwischen schon zum Alltagsbild unserer Stadt.“ Amadous Interesse ist geweckt.
Durch den Massenandrang an der Bar werden die beiden vorübergehend auseinandergedrängt. Sofort bemüht Amadou sich intensiv, seinen Platz an ihrer Seite wieder zurückzuerobern. Er hört und sieht nicht mehr, was um ihn herum passiert, nicht einmal die Live-Performance seines Cousins an der Djembe nimmt er wahr.
„Erzähl’ mir mehr von deiner Stadt“, bittet Amadou Sue.
Aber Sue hat gerade der Rhythmus der Trommeln gepackt, und wenn einer das verstehen kann, dann ist das Amadou. Also verfolgt er halbherzig die Show und klatscht eifrig, als sie endlich zu Ende ist.
„Wow, das war echt stark.“ Begeistert schaut Sue die drei Freunde an. „Könnt ihr das auch?“
„Klar, mehr oder weniger“, räumt Sekou ein, „aber der Tänzer unter uns ist Amadou.“
„Ach ja?“
„Also, wie heißt deine Stadt“, versucht Amadou hartnäckig das von der Trommel-Show unterbrochene Gespräch fortzusetzen.
„Sie heißt Bremen und sie liegt im Norden von Deutschland. Aber warum willst du das wissen?“ Sue blickt ihn von der Seite aus forschenden Augen an.
„Vielleicht möchte ich dich einmal besuchen?“
„Hey, das soll wohl ein Witz sein, wir kennen uns doch gar nicht.“ Sie stößt ihm lachend den Ellenbogen in die Rippen, Amadou knickt zum Scherz halb zusammen und weiß, er hat noch eine Chance.
„Lass uns irgendwo hingehen, wo wir in Ruhe reden können“, schlägt er vor.
„Nein, ich möchte gerne noch tanzen; schließlich bin ich deswegen hergekommen; vielleicht später.“
Amadou wird nicht schlau aus Sue; in der Herberge hat sie ihm die kalte Schulter gezeigt, in der Disco macht sie ihn an, obwohl er sie nicht dazu ermuntert hat, schließlich hat er eine Freundin. Und jetzt will sie nicht einmal mit ihm reden. Er dreht ihr den Rücken zu und widmet sich seinen Freunden. Als sie mit seinem Cousin auf die Tanzfläche geht, hat Amadou keine Lust mehr zu bleiben.
„Lasst uns gehen Leute; wir wollten doch sowieso nicht lange bleiben.“
„Was ist los, hat sie dich abgewimmelt?“
„Nein, aber das ist mir alles zu kompliziert. Ich weiß nicht, was diese Frau will.“
„Was willst du denn von ihr?“
„Ich? Na ja, vielleicht ihre Adresse, man kann nie wissen, ob ich nicht eines Tages doch noch nach Europa gehe.“ Ibrahim und Sekou schauen sich mit hochgezogenen Brauen bedeutungsschwer an.
Draußen vor der Tür glättet Nichtraucher Amadou brummig eine alte, zerknitterte Zigarette, die er noch in den Weiten seines Boubous gefunden hat. Unter den missbilligenden Blicken seiner Freunde zündet er sie vorsichtig an, als Sue hinter den Dreien hergelaufen kommt.
„Wartet doch mal!“ Abwartend bleiben sie stehen. „Amadou kann ich kurz mit dir reden?“
„Reden? Mit mir? Später vielleicht“, sagt Amadou betont kühl und schickt sich an, sich umzudrehen und mit seinen Freunden den Heimweg anzutreten. Sue blickt den Freunden enttäuscht nach; eine kleine Romanze hätte ihrem Afrika-Aufenthalt noch den letzten Kick gegeben. Sie ist aber zu stolz, um noch weiter in Amadou zu dringen.
„Okay, dann bis Morgen in der Herberge“, ruft sie ihm kleinlaut hinterher und geht langsam zurück in die Disco.
Amadou hat sein Gesicht gewahrt, aber Sekou und Ibrahim sind nicht zufrieden mit ihm.
„Fang bloß nichts mit der an; das führt zu nichts, außer zu Ärger mit Miriam“, droht Ibrahim fast väterlich.
„Ich habe doch nur mit ihr getanzt“, verteidigt sich Amadou vehement, und aus lauter Trotz fügt er hinzu: „Abgesehen davon kann sie mir vielleicht wirklich helfen, nach Europa zu kommen.“ Das war ihm so rausgerutscht, das wollte er gar nicht sagen. Das hatte er auch gar nicht gemeint, nicht einmal gedacht!
Bitter blickt Ibrahim auf den kleineren Amadou herunter. „So ist das also, du willst tatsächlich deine Eltern und Miriam in Stich lassen?“





























