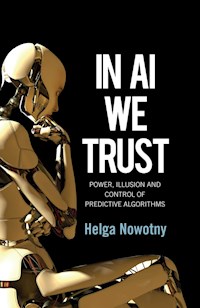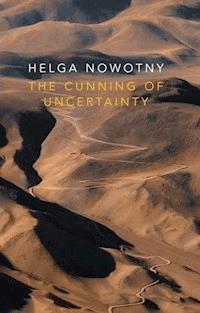Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wissenschaft ist das zutiefst gesellschaftlich geprägte Unterfangen, die Welt nicht einfach hinzunehmen, sondern sich vorzustellen, sie könnte auch anders sein. Wissenschaft ist getragen von der Freude am Spiel mit der Ungewissheit, die dazu verleitet, sich auf noch unbekanntes Terrain zu wagen. Von der Freude, etwas zu entdecken, was man noch nicht weiß. Dabei ist jede wissenschaftliche Entdeckung immer auch eine Entdeckung des eigenen Blicks, wie Helga Nowotny in ihren Erinnerungen mit unerschrockener Offenheit beweist. Von ihren Anfängen in der Wissenschaftsforschung und Technologiewissenschaft, wo sie mit bürokratischen Hürden in einem von Männern dominierten Feld konfrontiert war, bis hin zu ihrer einflussreichen Rolle bei der Gestaltung des Europäischen Forschungsrats – stets stand ihre Arbeit in Wechselwirkung mit ihren persönlichen Erfahrungen und Prägungen, kurz ihrem Leben. Helga Nowotny verleiht in ihrem Wissenschaftsmemoir mit unstillbarer Neugier, Weitsicht und Weisheit ihren Einsichten einen glanzvollen Ausdruck, der Mut macht: Mut, gegen den Strich zu denken, Mut zur kompetenten Rebellion.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2026
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Helga Nowotny
Zukunft braucht Weisheit
Helga Nowotny
ZukunftbrauchtWeisheit
Protokolle einer Grenzwanderung
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Die Erfindung der Zukunft
Als die Zukunft den Göttern gehörte
Der Lärm und die Signale
Nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe
Die KI als Spiegel
Die Vergegenwärtigung der Vergangenheit
Die Ungewissheit der Zukunft
Zwischen den Welten: ein nicht geradliniger Werdegang
Von Wien nach New York
Ein halbes Jahr wildes Denken: King’s College, Cambridge
Multitasking: ein Doppelleben
Institutionelle Einschränkungen und Freiräume
Exkurs 1
Undichte Grenzen
Von den Risiken der Kernenergie zur Nützlichkeit nutzlosen Wissens
Modus 2 der Wissensproduktion
Wie männlich ist die Wissenschaft (noch immer)?
Exkurs 2
Eigenzeit und das Leben in der digitalen Zeitmaschine
Eigenzeit, Pandemie und die digitale Zeit
Die KI sei mit Euch – die KI ist mit uns
Was folgt? Eine Standortbestimmung
Exkurs 3
Sandbänke des Lebens
Navigieren: zwischen Ebbe und Flut
Im Notfall: wissen, was zu tun ist
Vom Zurückbleiben und Zurücklassen
Die Verlockungen der Ferne
Gespräch
Dank
Anmerkungen
Vorwort
Es begann an einem herrlichen Sommernachmittag. Die Sonne stand noch hoch am Himmel, die Hitze war erträglich. Von der Terrasse überblickte man den Strand, der mit der üblichen Mischung von Badenden gefüllt war. Bald würden einige aufbrechen, um den Zug zu erreichen und in ihre städtische Umgebung zurückkehren, während andere sich später mit Freunden zum Aperitivo oder zum Abendessen in ihrem Sommerhaus treffen würden. Jenseits des Strandes lag das Meer umsäumt von einer der unzählig schönen Küsten des Mittelmeers, geformt von den Wellen, die sanft über Steine, Sand und Felsen strichen, so wie sie es seit Tausenden von Jahren getan hatten.
Mein Gast und ich hatten ein späteres Abendessen vereinbart. Davor wollten wir ein seit einiger Zeit geplantes Interview für eine Fachzeitschrift führen. Elena Esposito kannte ich seit langem, aber obwohl ich ihre wissenschaftliche Arbeit stets verfolgt habe, sind wir uns nur selten begegnet. Aus dem Vorhaben, uns am Wissenschaftskolleg zu Berlin zu treffen, dem renommiertesten europäischem Institute for Advanced Study, zu dem ich seit meiner Einladung als ›Ur-Fellow‹ im ersten Jahr seines Bestehens immer wieder zurückkehre, war nichts geworden, pandemiebedingt.
Und so kamen wir nun an diesem idyllischen Ort in Ligurien zusammen, den Elena, wie ich bald erfuhr, schon aus ihren Kindheitstagen gut kannte. In dem
Interview sollte meine Arbeit und mein Leben zur Sprache kommen. Es ging um meine wissenschaftliche Biografie, wie ich zur Forschung gelangt war und meine akademische Laufbahn bestritten hatte. Im Mittelpunkt des Interviews standen viele der Themen, mit denen ich mich in meiner Forschungsarbeit intensiv beschäftig habe: wie Wissenschaft funktioniert und wie Wissenschaftler:innen arbeiten; die Beschleunigung des technologischen Wandels und seine Rolle in der Gesellschaft; die gesellschaftspolitischen Kontroversen, die daraus folgen; die Organisation und Finanzierung der Wissenschaft auf EU-Ebene und die derzeitigen Veränderungen des Forschungssystems. Unweigerlich sprachen wir auch über Frauen in den Wissenschaften und über jenes Thema, in dem sich unsere wissenschaftlichen Interessen wohl am engsten berühren – das Thema ›Zeit‹, insbesondere in Bezug auf die Zukunft und das unermüdliche Bemühen, sie vorherzusagen.
Das Interview mit Elena wurde wenig später in einer englischsprachigen Fachzeitschrift veröffentlicht und gelangte so auch nach Hong Kong. Nach einem Vortrag an der Chinese University Hong Kong wurde ich darauf angesprochen und gefragt, ob ich bereit wäre, das Interview zum Ausgangspunkt eines intellektuellen Memoires über mein Leben und meinen wissenschaftlichen Werdegang zu machen. Mein anfängliches Zögern half wenig und so entstand eine englischsprachige Publikation, auf der auch dieses Buch aufbaut.1 In seiner Chronologie und Struktur gibt es meine wissenschaftliche Laufbahn wieder, doch eingebettet sind die persönlich gefärbten Stränge in zwei Essays zu Themen, die mich aktuell beschäftigen. Eine Reflexion über den eigenen wissenschaftlichen Werdegang und die damit verbundene Grenzwanderung – zwischen Ländern und Kontinenten; zwischen akademischen Disziplinen; zwischen universitären und außeruniversitären Forschungseinrichtungen; zwischen der akademischen Welt und jener der politischadministrativen der Europäischen Union; alle entlang der spannungsgeladenen Grenze zwischen Wissenschaft und Gesellschaft – unterscheidet sich von den Antworten in einem Interview. Im Lauf meines Lebens habe ich viele gute und einige schlechte Interviews erlebt und jedes Mal war ich überrascht, wie sehr das Ergebnis von der persönlichen Interaktion abhing und wie unvorhersehbar diese war. Mit Elena verstand ich mich hervorragend. Sie war eine kongeniale Interviewpartnerin, der es gelang, die für meinen intellektuellen Werdegang wichtigsten Gesprächsstränge freizulegen. Doch wie unterscheidet sich ein Interview vom Schreiben, wie ich es jetzt vorhabe?
Hier sitzt mir keine Kommunikationspartnerin gegenüber. Ich bin darauf angewiesen, mich selbst zu interviewen. Das mag seltsamer klingen, als es ist, doch es bleibt eine eigenartige Situation. Ich behaupte, dass mich niemand besser kennt als ich mich selbst, gleichzeitig gilt es einen kühlen, analytischen Blick zu bewahren. Ich will Persönliches einflechten, doch im Vordergrund steht mein professionelles Leben und meine Arbeit. Ich weiß sehr wohl, wie viel ich den Personen verdanke, denen ich in verschiedenen Zusammenhängen begegnet bin und mit denen ich kooperiert habe, hege aber eine tiefe Abneigung gegen name dropping und bin nicht gut im Erzählen von Anekdoten. Dennoch werde ich versuchen, die Aufmerksamkeit meiner Leser:innen in anderer Weise zu gewinnen.
Mit meinem Vorhaben, in diesem Buch ein Gleichgewicht zwischen meiner Rolle als Interviewerin und als Befragte herzustellen, war es bald vorbei. Kaum hatte ich mit dem Schreiben begonnen, setzte ein Erinnerungsstrom ein und mit ihm eine Kette von Assoziationen, die ein Eigenleben entwickelten. Hatte ich anfangs noch versucht, einen analytischen Blick auf das Geschehene zu bewahren, schmuggelten sich bald schon Reminiszenzen in die Reflexion und ich stellte fest, wie schnell sich eine Beobachtung durch einen Wechsel der Perspektive vom analytischen zum erinnerungsgesättigten Blick wandelt. Also musste ich danach trachten, wieder eine Balance zwischen den Perspektiven herzustellen und zwischen Engagement und Distanz zu vermitteln. Auf der einen Seite waren es meine Erfahrungen, gefiltert durch das Gedächtnis, das immer selektiv arbeitet, und auf der anderen Seite der Blick von außen, die Beobachtung meiner Beobachtung und der Versuch, diese in einen größeren Kontext zu stellen: Beides wollte ich zusammenführen. Zeitweilig musste ich mich bewusst zurücknehmen, um nicht in die Rolle der Universitätsprofessorin zurückzufallen, die versucht, ihren Studierenden die Wissenschaft und ihre Arbeitsweise in der Absicht näherzubringen, die Urteilsfähigkeit zu schärfen und gute Fragen zu stellen.
Was folgt, ist keine Autobiografie. Dafür gibt es weder Anlass noch Motivation. Nicht um mein Leben geht es, sondern um die Erfahrungen, die ich mit den Wissenschaften gemacht habe. Als Wissenschaftsforscherin habe ich das Privileg, meiner Neugier folgen zu können und mich für alles zu interessieren, das durch sie geweckt wird. Wissenschaftsforschung ist ein relativ junges, interdisziplinäres Feld, in dem – mit sozialwissenschaftlichen Ansätzen und theoretischen Sichtweisen – empirische Methoden angewandt werden, um Arbeitsweisen und Auswirkungen der Wissenschaften als System zu erforschen und zu reflektieren. Wissenschaftsforschung befasst sich mit der Entstehung neuer Forschungsagenden, mit unterschiedlichen Forschungsfeldern und den daraus für die Gesellschaft resultierenden Wirkungen, einschließlich der durch sie hervorgerufenen Kontroversen. Der Stellenwert, den die Einwerbung von Projektmitteln erreicht hat, und die Auswirkungen auf wissenschaftliche Kreativität und Produktivität sind ebenso Thema wie die Lebens- und Arbeitsbedingungen an Universitäten und in der Industrie. Wissenschaftsforschung folgt den Wissenschaftler:innen ins Labor und in die Institutionen, in denen Entscheidungen über akademische Karrieren und Finanzierung der Forschung getroffen werden. Sie analysiert die Verläufe bei der Erstellung eines Forschungsantrags, von dessen Finanzierung so viel abhängt, ebenso wie die Strategien wissenschaftlicher Publikationen und analysiert, welche Evaluierungskriterien dabei verwendet werden.
In meinen Vorlesungen zur Einführung in die Wissenschaftsforschung musste ich feststellen, wie schwer es meinen Studierenden fiel, eine Verbindung zu deren Erfahrung herzustellen. Kein Wunder also, dass die Öffentlichkeit nicht genug über die Arbeitsweise von Wissenschaftler:innen weiss. Meine Absicht, etwas von der Faszination der Wissenschaft und dem Hervorbringen von neuem Wissen zu vermitteln, hat das nur weiter angespornt. Wissenschaft ist getrieben von Neugier und ermöglicht etwas zu entdecken, das man noch nicht weiß; sie wird von der Freude am Spiel mit der Ungewissheit getragen, die uns verleitet, sich auf noch unbekanntes Terrain zu wagen und die vielen Menschen leider fremd bleibt. Allerdings ist es wichtig, sich dabei von einer guten Forschungsfrage leiten zu lassen. Gerade jungen Menschen fällt es schwer, eine solche für sich zu definieren, wenn sie nicht von vornherein an Fragen arbeiten, die von ihren Betreuer:innen vorgegeben sind. Viele Forschungsanträge scheitern bereits daran, weshalb es wichtig ist, herauszufinden, was es bereits gibt, was dennoch wichtige Aspekte auslässt und wie man dorthin kommen will, wo neues Wissen entsteht. So einfach – und gleichzeitig so schwer umzusetzen. Für interdisziplinäre Teams besteht das größte Hindernis, trotz aller guten Vorsätze zur Zusammenarbeit über disziplinäre Grenzen hinweg, oft darin, eine Forschungsfrage so zu definieren, dass alle etwas dazu beitragen und sich wissenschaftlich damit identifizieren können. Eine gute Forschungsfrage gleicht einem Trüffelschwein, das einen dorthin führt, wo man das Gesuchte vermutet. Und dennoch ist es wichtig, offen zu bleiben für alles, was es auf dem Weg dorthin zu entdecken gibt. Hier kommt serendity ins Spiel – doch davon später mehr.
In manchem gleicht die Wissenschaftsforschung der Anthropologie und genauso wichtig wie bei der anthropologischen Feldforschung ist es in der Wissenschaftsforschung, ein Vertrauensverhältnis herzustellen, das von gegenseitigem Respekt getragen wird. In vielen Gesprächen, die ich mit Naturwissenschaftler:innen geführt habe, gelang es mir, sie dazu zu bringen, mir als Kollegin aus einer anderen Wissenschaftsdisziplin zu begegnen. Sie schilderten woran sie arbeiteten und wir diskutierten gemeinsam ihre Sichtweise auf Wissenschaft und Gesellschaft und die daraus resultierenden Probleme. Das hat meine Arbeit spannend gemacht und zu neuen Einsichten geführt. Meistens ist es mir gelungen das unabdingbare Vertrauensverhältnis für ein offenes Gespräch über ihre Arbeit und ihre Probleme herzustellen und gerade die Besten, denen ich begegnet bin, waren dafür immer aufgeschlossen.
Eine der Grenzen, entlang derer ich mich bei meinen Wanderungen wiederholt bewegt habe, ist jene zwischen den Sozial- und Naturwissenschaften. Andere Grenzen – viele davon unbewusst – verlaufen zwischen Männern und Frauen in den Wissenschaften. Die größte Kluft besteht aber zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, obwohl Wissenschaft ohne Gesellschaft undenkbar ist und umgekehrt. Nicht zuletzt werde ich aber auch von Grenzen erzählen, die im Kopf bestehen. Natürlich sind weder die Wissenschaften als Institution noch Wissenschaftler:innen frei von Vorurteilen, hier unterscheiden sie sich nicht von anderen Menschen. Wissenschaft ist und bleibt ein zutiefst gesellschaftlich geprägtes Unterfangen, das sich ständig verändert und konkreten gesellschaftlichen, politischen, ökonomischen und kulturellen Einflüssen unterliegt. Sie ist Teil der Gesellschaft und muss dennoch immer wieder um ihren Freiraum und ihre epistemische Unabhängigkeit bangen. In dieser Hinsicht ist es wichtig, ihre Eigenständigkeit zu schützen und Grenzen immer wieder neu zu verhandeln. Wie diese am besten zu bewahren sind, bleibt umstritten. Auch davon möchte ich aus meiner Erfahrung berichten.
Es gibt noch weitere Grenzen, wie jene zwischen Vergangenheit und Gegenwart, die auch eine zwischen den Generationen markiert. Wahrscheinlich hat jede ältere Generation den Wunsch, der jüngeren zu erzählen ›wie es gewesen ist‹, egal ob das Pendel in die Richtung ›es war alles besser‹ oder ›wir hatten es so viel schwerer‹ ausschlägt. Ich hoffe, dass ich nicht nostalgisch werde, sondern meine Erfahrung mit Blick auf die Verhältnisse und Zukunftserwartungen gleichermaßen gelassen wie engagiert darlegen kann. Bisweilen werde ich von jungen Wissenschaftler:innen gefragt, wie ich das erreichen konnte, was ich erreicht habe. Meine erste Reaktion entspringt meistens der Überzeugung, dass es junge Menschen heute viel schwerer haben als meine Generation. Doch dann folgt der eindringliche Appell zu bedenken, dass heute eine Vielzahl von Möglichkeiten existiert, die es früher nicht gab und die es zu nützen gilt, wohl wissend, dass zu viele Optionen auch erdrückend sein können. Ich kann die subjektive Wahrnehmung von Problemen und der institutionellen Bedingungen, die von vielen als äußerst prekär empfunden werden, nachvollziehen. Dennoch will ich alle, die mich fragen, ermutigen, sich nicht einschüchtern zu lassen und sich den scheinbar so undurchdringlichen wie abweisenden Umständen zu stellen. Auch die geltenden Normen sind von Menschen gemacht. Sie ändern sich, manchmal viel schneller als gedacht, und die Regeln, die dazu da sind, das Verhalten in vorbestimmte Bahnen zu lenken, bedürfen der Interpretation. Es gibt also immer Spielräume. Auch deshalb ist die Welt nicht einfach hinzunehmen, wie sie ist oder zu sein scheint, vielmehr lautet eine wesentliche Botschaft, die ich weitergeben möchte: Haltet eure Vorstellungskraft, dass die Welt auch anders sein könnte, offen.
Damit will ich auch den Widerstandsgeist stärken, der jungen Menschen eigen ist, wollen sie ihre Welt doch mitgestalten. Wer, wenn nicht ihr? Wann, wenn nicht jetzt? Zugegeben, die Lage der Welt ist katastrophal, die Klimakrise real, eure Karrierechancen und Arbeitsbedingungen sind prekär und eure Zukunftsaussichten sind dringend verbesserungsbedürftig, und dennoch: Euer Handlungsspielraum ist weit größer, als ihr glauben mögt. Ich möchte dazu beitragen, dass sich viel mehr junge Menschen entschließen, das zu werden, was ich ›kompetente Rebell:innen‹ nenne: Sie stellen das Bestehende in Frage und halten daran fest, dass es immer auch anders sein kann. Dazu bedarf es einer konstruktiven Imagination und des Mutes, an der Umsetzung neuer Ideen zu arbeiten. Doch die andere Voraussetzung ist mindestens ebenso wichtig: Die Bereitschaft, sich die Kompetenz anzueignen, die für die Umsetzung notwendig ist. Das erfordert eine Grenzwanderung zwischen dem Status als insider und als outsider und setzt eine gute Kenntnis der Regeln voraus, die jeweils auf der einen und auf der anderen Seite gelten, sowie die Fähigkeit zu wissen, wann der Augenblick gekommen ist, die Grenze zu überschreiten, ohne in ein Minenfeld zu geraten. Und dennoch zu wissen, wann das notwendig ist.
Rückblickend war mein Werdegang von Grenzwanderungen geprägt, die oft auch Gratwanderungen waren. Das Risiko eines möglichen Absturzes war immer vorhanden und ich war mir dessen meistens bewusst. Grenzen zu überschreiten kann aus schierer Lust an Provokation geschehen oder um aus einer unerträglichen Lage zu flüchten. Sie kann von der Aussicht auf bessere Chancen getragen sein oder der existenziellen Angst um das Überleben. Mir geht es dabei weder um Bravour noch Überleben. Ich hatte immer eine Richtung vor Augen und ließ mich von meinem Orientierungssinn leiten. Freilich war mir immer bewusst, dass es viele unterschiedliche Wege gibt und dass das Leben von Zufällen geprägt ist. Planung erleichtert vieles, doch meistens kommt es anders. Diese Kontingenzen anzuerkennen, im Guten wie im Schlechten, war für mich entscheidend und hat es mir ermöglicht, die Ungewissheit nicht als Bedrohung, sondern als Offenheit der Zukunft zu leben.
Dass Grenzen und die an sie gebundenen Normen von Menschen gemacht und deshalb veränderlich sind, bedeutet zu erkennen, dass sie einen historischen Ursprung haben. Auch dafür schärft die Wissenschaftsforschung den Blick. Ein Beispiel von vielen sind die wissenschaftlichen Disziplinen, die mit der Institutionalisierung der Wissenschaften an den Universitäten des 19. Jahrhunderts entstanden und ständig neu gezogen werden. Grenzen zwischen den Disziplinen, welche Inhalte und Methoden sie einschließen und welche ausgeschlossen werden, verlaufen je nach geografischem Standort und Geschichte anders. Heute erfahren das alle Studierenden unmittelbar, wenn sie an europäischen Austauschprogrammen teilnehmen. Ein und dieselbe Physik gilt in Boston und Beijing, in Berlin und Innsbruck, und doch wird sie anders unterrichtet und andere Forschungsfragen stehen im Vordergrund.
Mein Rückblick in eine vergangene Zeit richtet sich als Wissenschaftsforscherin zwangsläufig auch darauf, wie sehr sich Institutionen und Organisationsformen des wissenschaftlichen Arbeitens verändert haben und weiter verändern. Die Anzahl von Wissenschaftler:innen, obwohl gemessen am Anteil an der Bevölkerung noch immer gering, ist weltweit stark angestiegen, ebenso wie die Anzahl der wissenschaftlichen Publikationen. Konkurrenz erwächst den Ländern, die in der Vergangenheit stark mit wissenschaftlichen Leistungen hervorgetreten sind, vor allem durch China, während ein Nord-Süd-Gefälle nach wie vor besteht. Die Internationalität der Wissenschaft ist Teil ihres Selbstverständnisses, wenngleich es in der Praxis bei zunehmenden politischen Spannungen erneut zu Einschränkungen kommt. Als Antwort auf die globalen Herausforderungen ist allen Beteiligten bewusst, dass vermehrt gemeinsame Anstrengungen notwendig sind. Meine Teilnahme an internationalen Konferenzen hat mir gezeigt, wie sehr sich politische Überlegungen mit dem vermischen, was wissenschaftlich erstrebenswert und möglich erscheint und wie subtil das fragile Gewebe einer science diplomacy darauf reagieren muss. In der gegenwärtigen Situation zunehmender geopolitischer Spannungen und dem erstarkenden Konkurrenzverhalten zwischen den Staaten, steigt die politische Einflussnahme auf die Wissenschaft wieder an. Selbst innerhalb eines Staates ist die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr – und das nicht nur in den USA, wo Forschungseinrichtungen geschlossen, jahrzehntelange Datenerhebungen abrupt gestoppt, Wissenschaftler:innen und ganze Forschungsrichtungen diskreditiert und den Universitäten Finanzierung und Zugang zu internationalen Studierenden unterbunden wird. Auch in Europa ist Wachsamkeit überall dort angesagt, wo die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr gerät.
Die autonomen Räume, die sowohl Wissenschaft wie Kunst benötigen, bleiben fragil und umstritten. Sie müssen geschützt werden, denn es gilt ihre Kreativität zu erhalten. Die Forschungsfragen, die mich bewegten und sich durch meine Arbeit ziehen, sind nicht als Antwort auf Ausschreibungen von Forschungsförderinstitutionen entstanden, obwohl solche durchaus ihre Berechtigung haben und ich ihnen einen Teil meiner Tätigkeit gewidmet habe, ohne dies als Belastung zu empfinden. Es war mein Beitrag zum Dienst an der Allgemeinheit, also eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Dennoch war es mir immer wichtig, mir jenen Freiraum zu schaffen, ja zu erkämpfen, der es mir erlaubte, mich den Themen zu widmen, die mich faszinierten und die ich erforschen wollte. Ich war nie versucht, dies als Antwort auf die dringlichsten ›Fragen der Zeit‹ anzusehen, doch auch nie verlegen, öffentlich Stellung zu beziehen, wenn es erforderlich war. Ich versuchte, mich nie darüber zu täuschen, was ich mache und warum ich mich für das einsetze, was mir wichtig ist, ohne dabei den Boden wissenschaftlicher Methoden und Arbeitens zu verlassen. Wahrscheinlich ist es das, was ich meine, wenn ich von kompetenten Rebell:innen spreche. Unter politischem Druck führt Rebellion ohne wissenschaftliche Kompetenz nicht weit, während wissenschaftliche Kompetenz allein leicht zum nützlichem Idiotentum verkommen kann oder in der Irrelevanz landet.
Die Grenze zwischen Wissenschaft und politischem Aktivismus ist immer schwer zu ziehen, und bleibt voll von Widersprüchen. Doch es gibt sie und sie verändert sich je nach Kontext. Einerseits ist die Wissenschaft gefordert ihren Anspruch auf Annäherung an die Wahrheit mutig zu verteidigen und gegenüber einer Politik dezidiert Stellung zu beziehen, die mit allen Mitteln versucht, wissenschaftliches Wissen und Expertise, die sich nicht in ihr ideologisches Korsett pressen oder kaufen lässt, zu disqualifizieren. Andererseits gibt es Situationen, in denen die Emotionen hoch gehen und viel auf dem Spiel steht. Man fühlt sich gefordert, etwas dafür oder dagegen zu tun und die Autorität der Wissenschaft als Waffe entsprechend einzusetzen. Für die junge Generation von Wissenschaftler:innen erwachsen daraus neue Dilemmata. Wenn, wie es jetzt in den USA geschieht, die Internationalisierung der Wissenschaft auf dem Spiel steht und einer engstirnigen Re-Nationalisierung weicht; wenn gerade erst begonnene, vielversprechende wissenschaftliche Karrieren willkürlich beendet werden, weil es das Visum oder die Finanzierung der Stelle plötzlich nicht mehr gibt oder ganze Forschungsgebiete geschlossen werden – dann gerät auch die wissenschaftliche Welt, so wie sie bisher war oder imaginiert wurde, aus den Fugen. Die Angst wächst auch unter den (noch) nicht unmittelbar Betroffenen und Mutlosigkeit greift um sich. Dennoch bin ich überzeugt, dass kompetentes wissenschaftliches Rebellentum seinen Weg finden wird, selbst wenn dieser mit persönlichen Kosten und Irrwegen verbunden ist.
Die Wissenschaft braucht Freiraum für die Fragen, die sich die Grundlagenforschung stellt, bevor das so entstandene Wissen in erweiterten Kontexten der Anwendung oft unerwartete Lösungen liefert. Zwar ist unumstritten, dass Wissen aus der Grundlagenforschung, das zunächst ohne greifbares oder verwertbares Ergebnis produziert wird, unverzichtbar ist, doch die Grundlagenforschung muss sich immer wieder rechtfertigen. Vor allem die Politik erwartet ›im Namen der Steuerzahler‹ ökonomisch rasch umsetzbare Ergebnisse. Sie drängt, wie wir während der Pandemie gesehen haben, auf eindeutige Antworten, wo jede Wissenschaftler:in ehrlicherweise nur zugeben kann, dass es in der Wissenschaft dazu noch keine gesicherten Erkenntnisse gibt oder nur mit einem ›ja, unter folgenden Bedingungen …‹ oder ›nein, unter folgenden Bedingungen …‹ antworten kann. Es ist die dem Forschungsprozess inhärente Ungewissheit, die erst den Möglichkeitsraum für neue Erkenntnisse und Methoden eröffnet und das Erkunden des noch unbekannten Terrains einleitet. Deshalb braucht die Grundlagenforschung eine langfristige Förderung und sie braucht ebenso Räume, die sie vor dem Druck abschirmen, von außen vorgegebene Ziele kurzfristig zu erreichen. Rückblickend wird mir klar, dass das institution building, das einen Teil meines Werdegangs ausmacht, wohl auch dazu diente, mir die Freiräume zu schaffen, die ich benötigte.
Kontingenzen sind ein wesentlicher Bestandteil meiner wissenschaftlichen Laufbahn und ich bin damit sicher nicht allein. Ich bin überzeugt davon, dass wir die Unwägbarkeiten schätzen und die Ungewissheit umarmen sollten. Statt uns an überholten Dichotomien und Kategorien festzuhalten, die von der Moderne erfunden wurden, um die Angst vor sozialer, politischer und kultureller Unordnung abzuwehren, sollten wir die Grenzen dessen, was planbar ist, anerkennen. Wir sind mit einer neuen Unordnung der Welt konfrontiert und es fällt schwer, sich von der relativen Stabilität einer Nachkriegsordnung zu verabschieden, ohne in eine unangebrachte Nostalgie zu verfallen. Im offiziellen Diskurs ist viel die Rede von der Wende- und der Übergangszeit. Transformation und Transition sind angesagt, und sie sollen grün, digital und sozial sein. Viele Menschen sind durch die technologische Beschleunigung verunsichert und die junge Generation fürchtet zu Recht, dass die Versäumnisse früherer Generationen sie überproportional treffen werden, angefangen vom menschengemachtem Klimawandel bis zur Unhaltbarkeit des Pensionssystems. Und dennoch – es wird anders kommen, als wir es uns jetzt vorstellen.
Über Grenzwanderungen nachzudenken und ihre Protokolle auszuwerten legt es nahe, eine neue Form zu finden. Dieses Buch ist ein Hybrid. Es ist entschieden keine Autobiografie, dennoch spreche ich über mein Leben, meine Arbeit und meinen intellektuellen Werdegang. Dieser folgt einem chronologischen Faden, trotzdem wechsle ich immer wieder zwischen den Zeiten und den üblichen Genres, bringe persönliche Überlegungen ein und verknüpfe sie mit meinem Wissen über den Aufbau von Institutionen und den Kenntnissen der europäischen Forschungspolitik. Es gibt kurze Exkurse, die für das stehen, was sie sind: Abweichungen vom Kurs. Ich habe aber sogar einige frühere und ein neues Gedicht eingefügt. Zum Abschluss adjustierte ich meinen Kompass erneut – denn der Wandel geht weiter. Deshalb schließt das Buch mit einem Gespräch, das ich mit meiner Enkeltochter Isabel Frey geführt habe, über die Grenzen der Generationen hinweg.
Die Erfindung der Zukunft
Als die Zukunft den Göttern gehörte
Wenn ich längere Zeit zu sehr auf etwas fokussiert bin, suche ich Abwechslung, um mich mit anderen Themen und in einem variierten Denkmodus zu beschäftigen und so einen mentalen Ausgleich herzustellen. So erging es mir auch in einer intensiven Schreibphase meines Buches über prädiktive Algorithmen, woraufhin mir eine kurze Besprechung der eben erschienenen neuen Übersetzung von Gilgamesch unterkam. Ich wurde neugierig. Wie die meisten hatte ich das babylonische Epos vor Jahren gelesen und der Name Gilgamesch, der wiederholt in der Popkultur und in Filmen auftauchte, ist gegenwärtig geblieben. Doch es gab keinen aktuellen Anlass, mich dafür zu interessieren, noch kannte ich Sophus Helle, den dänischen Übersetzer, Assyriologen und Autor der erläuternden Essays, die auf den Primärtext folgen.2 Warum wollte ich jetzt also plötzlich mehr über Gilgamesch erfahren? War es einer der vielen Zufälle, die als serendipity auftauchen und dazu verlocken, unserer Intuition zu folgen, ohne zu wissen, wohin sie uns führt?
Ich bestellte das Buch und wie in meinen Jugendtagen las ich das hervorragend ins Englische übersetzte Epos in einem Zug3. Die Sprache übte eine seltene Faszination auf mich aus. Kein Wunder, hatte doch Sophus Helle zusammen mit seinem Vater, einem bekannten dänischen Dichter, jahrelang an der Übersetzung ins Dänische gearbeitet. Diese Erfahrung und sein akademischer Hintergrund als Assyriologe ermutigten ihn, die Neuübersetzung ins Englische zu wagen. Die wissenschaftliche Exzellenz und die Freude an gut geleisteter Arbeit, die von jeder Zeile des Textes ausstrahlt, begeisterten mich. Hier war jemand am Werk, der versuchte, einen alten Text über Jahrtausende hinweg für uns Heutige zum Sprechen zu bringen, der mit kühnen Wortspielen operierte und zugleich in zurückhaltender, doch bestimmter Weise darlegte, dass die präsentierten Ergebnisse auf Jahren intensiver Beschäftigung mit dem beruhten, was andere Fachleute und der Autor auf dem Gebiet der Assyriologie gefunden, verglichen, kontrovers diskutiert und weiterentwickelt haben.
Fernab der Assyriologie kann man nur ahnen, wie viel Wissen und Kenntnisse notwendig sind, um die Bruchstücke der Tafeln, die aus einem ebenso brüchigen Material bestehen und erst gefunden und ausgegraben werden müssen, in neuen Kombinationen von Worten und deren Bedeutung zusammenzufügen – unter Beachtung der kleinsten Details. Das ist nur ein Teil des Puzzlespiels, um das bestehende Wissen zu korrigieren und zu erweitern und so ein sinnvolles Ganzes zu rekonstruieren. Da ständig an neuen Fundorten Ausgrabungen stattfinden, wächst die Fülle des vorhandenen Materials, um den Text verständlicher zu machen. Dieser besteht aus einer Keilschrift, die in einer ausgestorbenen Sprache, dem Akkadischen, verfasst wurde, bevor sie ins Sumerische übersetzt und letztlich in eine standardisierte babylonische Fassung gebracht wurde. Die Bedeutung der Worte ist je nach Betonung und Aussprache völlig unterschiedlich, da es keine Zwischenräume oder Satzzeichen gibt. In der englischen Übersetzung des Epos gibt es Leerstellen, die durch untereinander gereihte Zeichen markiert sind. Die Fachleute sind sich über die Länge und Platzierung der Leerstellen weitgehend einig und gespannt darauf, was inhaltlich noch alles zu Tage kommen wird. In Helles Übersetzung werden die Leser:innen auf ebenso raffinierte Weise in den Forschungsprozess einbezogen. Sie beginnen ungewollt mitzudenken, mit welchen Worten und Sätzen die Lücken wohl gefüllt werden könnten.
Mich inspirierte der Text und die von Sophus Helle angefügten Erklärungen zu Überlegungen und einer Grenzwanderung besonderer Art. Sie führten mich in eine uns Heutigen fremde Welt, und ich begann zu verstehen, was mich an Gilgamesch so faszinierte. Es war die Macht der Sprache, die uns über Jahrtausende hinweg erreicht. Ich begann diese Welt, in der sich alles um Sterblichkeit und Unsterblichkeit drehte und in der die Idee der Zukunft weder Platz hatte noch nötig schien, mit der heutigen Welt in Bezug zu setzen. Jede Zeitreise, wenn sie nicht nur der Ablenkung, Spannung oder Unterhaltung dient, führt in die Gegenwart zurück und hier begann ich zu meiner eigenen Überraschung Gemeinsamkeiten zu entdecken.
Gilgamesch besteht aus zwölf Tafeln, wovon die letzte ein Appendix ist, der eine direkte Übersetzung einer alten sumerischen Erzählung wiedergibt.4 Diese erzählt eine eigene Geschichte über die Personen des Epos und lässt sie hinsichtlich des zentralen Themas Tod und Unsterblichkeit in einem anderen Licht erscheinen. Das Gilgamesch-Epos ist alt, wird aber durch die unterschiedlichen Lesarten in späteren Zeiten immer wieder aktualisiert. Das Alte besteht in den zahlreichen Verwandlungen, Variationen und Adaptationen, die sich von seinen ungeklärten Anfängen bis in die Gegenwart im Detail verfolgen lassen. Die Forschung weiß, welche Textstellen zum Kopieren in kuneiformer Schrift von welchen Schreibern getätigt wurden und welche Stellen einer Elite vorbehalten waren. Die Variationen überlappen sich, weichen aber auch voneinander ab und führen zu unterschiedlichen Deutungen. Trotz der Widersprüche und Ungereimtheiten entsteht das Bild einer uns fremden, doch auch vertrauten Welt. Schnell erkennen wir Herrschaftsverhältnisse wieder, die damals wie heute ungerecht und brutal waren. Wir können uns zumindest teilweise mit den handelnden Personen identifizieren, sie abstoßend oder sympathisch finden, doch wohin immer uns ihre Taten führen, es bleibt eine Art unsichtbare Wand, die uns vom Geschehen trennt. Dennoch gibt diese Wand bisweilen den Blick frei und wir können uns selbst in einem anderen Licht sehen.
Die Wand, die zwischen damals und heute steht, ist die Allgegenwart der Götter. Sie sind mächtige und handelnde Personen, die in der kosmischen Hierarchie über den Menschen stehen. Unter den Göttern gibt es nicht nur Machtverhältnisse, Rivalitäten und Streit, vielmehr mischen sie sich in die Angelegenheiten der Menschen ein und tragen ihre Konflikte nicht selten auf deren Rücken aus. Den Menschen bleibt nur übrig, Schutz und Beistand bei jenen Göttern zu suchen, denen sie sich besonders verbunden fühlen. Sie tun gut daran, wachsam zu bleiben, da die menschliche Existenz unvorhersehbar und von den Entscheidungen der Götter abhängig ist. Daher die große Bedeutung, die den Omen, den allgegenwärtigen Zeichen, zukommt, die es zu erkennen und zu deuten gilt. In der babylonischen Kultur ist die menschliche Intelligenz nicht im Kopf oder im Herzen zu finden, sondern im Ohr, das als eine Art Antenne für die Außenwelt dient. Daher ist es wichtig, zuhören zu können, Signale und Zeichen rechtzeitig aufzunehmen und richtig zu deuten. Die Welt ist voller geheimer Botschaften, die von Mehrdeutigkeiten durchwoben sind, doch durch gutes Zuhören und Intelligenz entschlüsselt werden können.
Einer, der gut zuhören konnte, ist Uta-napišti (›der das Leben fand‹), der einzige Überlebende der Flut. Das ist der große Erzählstrang im Epos, das ›Geheimnis der Götter‹. Uta-napišti hat als einziger das doppeldeutige Flüstern des Gottes der Weisheit, Ea, gehört und war dessen Befehl gefolgt, alles hinter sich zu lassen, ein Schiff zu bauen, die Samen allen Lebens an Bord zu bringen und das Schiff von außen versiegeln zu lassen. Wir kennen eine ähnliche, spätere Erzählung aus der Bibel, doch selbst das Gilgamesch-Epos ist nicht das erste Zeugnis, das vom Ereignis einer Flutkatastrophe berichtet. Dieses findet sich in einem noch älteren Epos, dem Atra-hasis. Für die Babylonier war die Flut der Wendepunkt, der die Existenz ihrer Welt, Ende und Anfang zugleich, markierte. Ihre Zeitrechnung teilte sich in die Zeit vor und nach der Flutkatastrophe, die zu einer totalen Zerstörung alles Lebens und jeglicher Erinnerungen führte. Der Verlust der Erinnerungen rührte aus dem Verlust der materiellen Basis ihrer Kultur, denn alles, was über die Vergangenheit auf Tontafeln aufgezeichnet worden war, hatte die Flut zu einem formlosen Klumpen nassen Lehms verwandelt. Das gesamte Wissen der Menschheit versank in derselben Materie, die einst dazu gedient hatte, es zu formen, lesbar und mitteilbar zu machen. Damit läutete die Flut das Ende der Geschichte ein.
Nach der Katastrophe – das Epos bezeichnet sie als den größten Fehler, den die Götter in ihrem unsterblichen Leben machten – gewähren die Götter als den einzigen Menschen Uta-napišti und seiner Frau Unsterblichkeit, allerdings unter sehr eingeschränkten Bedingungen. Im schwer zu erreichenden Niemandsland, auf der fernen Insel der Unsterblichkeit, besteht Uta-napištis Leben ausschließlich in der Wiedererzählung und dem Wiedererleben seiner Geschichte. Seine Unsterblichkeit verdammt ihn, gefangen in seinem alten Leben, zu einer Art ständiger Wiederkehr, wobei er es allerdings zu einer wahren Meisterschaft im Erzählen bringt, das von Ironie und Wortspielen sprüht. Als ein völlig verwahrloster und entkräfteter Gilgamesch auf seiner obsessiv-krankhaften Suche nach Unsterblichkeit auf der Insel eintrifft, führen Uta-napišti und seine Frau Gilgamesch vor Augen, dass er sein Ziel nie erreichen kann. Doch Uta-napišti vermittelt ihm auch, dass die Grenze zwischen Sterblichkeit und Unsterblichkeit sich durch das Erzählen von Geschichten und dem Erinnern durchqueren lasse. Die Vergangenheit, so die Botschaft, lasse sich als erzählte Geschichte aufbewahren.
Wir beginnen zu begreifen, wer es ist, der erzählt, denn das Epos ist eine Autobiografie, die in der dritten Person von den tragischen Erlebnissen, den Unwegsamkeiten des Lebens sowie von der Heimkehr und Läuterung des Autors, Gilgamesch, erzählt.
Sterblichkeit ist ein menschliches Problem. Dass Menschen sterben müssen, ist eine Entscheidung der Götter, doch der Zeitpunkt bleibt offen und daraus resultiert eine lebenslange Gratwanderung zwischen der Gewissheit des Todes und der Ungewissheit seines Eintritts. Vor dem Tod gibt es kein Entkommen, auch nicht für Gilgamesch, der zu zwei Dritteln göttlich und zu einem Drittel menschlich ist, was ein Hinweis auf die Unausgewogenheit seines Charakters ist. Er ist ein klassischer Held, ein durch und durch Getriebener, der aggressiv und selbstzerstörerisch auftritt, die Göttin beleidigt und seine Verpflichtungen als Herrscher vernachlässigt. Sogar über die Beschlüsse der Ratsversammlung, die ihn zu beschwichtigen versucht, setzt er sich hinweg. Es fällt schwer, Sympathie für ihn zu empfinden.
Allerdings erzählt das Epos gleichzeitig die Geschichte von der Freundschaft und Liebe Gilgameschs zu Enkidu, seinem Gefährten, den die Götter Gilgamesch als Gleichgesinnten und Freund an die Seite stellen. Enkidu kommt aus der Wildnis. Er war ein Tier und wird erst zum Menschen und Mann, nachdem ihn die Priesterin Šamḫats verführt. In ihrem Übermut töten und zerstückeln die Freunde den Stier des Himmels, und Enkidu schleudert dessen Penis der Göttin Ištar entgegen. Darauf beschließen die Götter Enkidus Tod, der Gilgamesch in tiefe Trauer stürzt. Am Ende steht der Prozess der Selbstfindung, die Introspektion: Gilgamesch scheitert zwar in seinem Verlangen nach Unsterblichkeit, doch was er nach seinen Heldentaten und Irrfahrten nach Uruk zurückbringt, ist die Erzählung von der Flutkatastrophe und der Geschichte der Welt vor der Flut. Sie hilft ihm, seine Sterblichkeit zu akzeptieren – ›he saw the deep‹, heißt es an dieser Stelle. Auch wenn jeder Mensch sterben muss: Im Geschichtenerzählen, Erinnern und über die Vergangenheit als Geschichte kann die Menschheit eine Form der Unsterblichkeit gewinnen.
Der Lärm und die Signale
Gilgamesch spricht aus einer tiefen Vergangenheit zu uns. Durch unser Zuhören entsteht der Text immer wieder aufs Neue. Es ist, als wäre ihm eine Wandlungsfähigkeit eingeschrieben, eine Plastizität, sich mühelos in jede Gegenwart einzufügen. Ein Gedicht für alle Zeitalter, so ließe sich auch sagen. Da ist die Mauer, die Uruk umgibt und die das Reich Gilgameschs von der Welt draußen, der Natur und Wildnis, abgrenzt. Dennoch lädt sie dazu ein, die Grenzmauer zu umschreiten und der anfänglichen Aufforderung zu folgen: ›walk the length‹, schreite die Länge ab. Der Weg führt an den Ausgangspunkt zurück, doch die Reise verändert jeden. Unterwegs werden viele Fragen gestellt, von denen die meisten unbeantwortet bleiben. Vielleicht ist es gerade diese Offenheit und Mehrdeutigkeit, die zum Denken und Vergleichen anregt und dazu verleitet, die Struktur der Erzählung entdecken zu wollen, als läge ihr eine mathematische Konstruktion zugrunde, die sich entschlüsseln lässt. Der Keilschrift fehlt die Eindeutigkeit, da die Bedeutung aus der Betonung und dem Kontext erwächst. Dadurch bewegen wir uns in einem enormen Möglichkeitsraum von Bedeutungen, die sich, von den unsichtbaren und wechselnden Beziehungen zwischen den Worten angetrieben, erst im Prozess der Deutung ergeben. Heute nennen wir ein solches Phänomen die Emergenz in komplexen Systemen.
Die Rezeptionsgeschichte von Gilgamesch ist ebenso vielfältig wie wandlungsfähig. Die Wiederentdeckung im viktorianischen Zeitalter fügte sich nahtlos in dessen imperiale Großmachtphantasien ein, zwang aber die Zeitgenossen, sich den Widersprüchen in ihrer Einstellung zur geologischen Zeitrechnung und der Auslegung der Bibel zu stellen. Die im Epos enthaltene Schilderung der Flut war eindeutig älter als die Bibel und ihr Zeitrahmen jünger, als es die geologische Zeitrechnung damals vorsah. Daraus erwuchs eine tiefe theologische Verunsicherung, die zu zahlreichen Kontroversen führte, was dem Epos Ruhm und Bedeutung verschaffte und zu seiner späteren Popularität beitrug. Letztlich führte sie jedoch zur Erkenntnis, dass Gilgamesch nicht nur als ein Werk parallel zur Bibel anzusehen ist, sondern neben ihr und Homer seinen Platz als eigenständiges literarisches Oeuvre im westlichen Kanon verdiente.
Heute liegt das Wissen über diesen Ausschnitt unserer Vergangenheit vor uns, ist jedoch noch lange nicht abgeschlossen. Weitere archäologische Ausgrabungen bringen neue Tonscherben ans Tageslicht und die Künstliche Intelligenz, die längst in dieses Forschungsfeld eingezogen ist, ermöglicht durch maschinelles Lernen neue Vergleiche der Textstücke, ihre genauere Datierung und eine präzisere Einordnung. Die Welt von damals, in der unvorhersehbare Kräfte am Werk waren, die die Menschen antrieben, die von ihnen ausgesandten Signale und Zeichen zu hören und zu deuten, ist inzwischen einer Welt gewichen, in der die Wissenschaft die Gesetze, denen die Naturkräfte folgen, weitgehend kennt. Wir können in die fernen Ursprünge von Galaxien zurückblicken und die chemische Zusammensetzung der Oberfläche unserer Nachbarplaneten bestimmen. Wir können dem Gesang der Wale in den Ozeanen zuhören, auch wenn sie zunehmend von den Geräuschen der Schifffahrt bedroht sind, und mittels KI ihre Beziehung zueinander bestimmen. Wir wissen über fast alle Sprachen Bescheid, die je gesprochen wurden, aber auch, dass ihre Zahl immer geringer wird.
Die Information überflutet uns, doch das Problem, die Signale vom Lärm zu unterscheiden, ist geblieben. Künstliche Intelligenz hat die Welt vorhersehbarer und zugleich unvorhersehbar gemacht. Das Paradox prädiktiver Algorithmen besteht darin, dass wir sie benützen, um mehr Gewissheit und Kontrolle über die Zukunft zu erlangen. Gleichzeitig verringert jedoch die Performanz der KI, die Macht, die sie ausübt, uns so zu verhalten, wie sie vorhersagt, unsere Handlungsfähigkeit über die Zukunft.5 Die algorithmischen Operationen laufen über black boxes, deren Output wir vertrauen, obwohl wir wissen, dass sie falsch sein können. Es ist, als ob sich die Doppel- und Mehrdeutigkeit der kuneiformen Wörter und ihre Stellung im Satz auf die digitalen Maschinen übertragen hätten. Fast so, als handle es sich um das versteckte Erbe der babylonischen Mathematik. Prädiktive Algorithmen erfordern klare, binäre Angaben bei der Eingabe, doch was dabei herauskommt, bleibt mehrdeutig. Je direkter die Botschaft eines prädiktiven Algorithmus sich an uns als Individuum richtet, je mehr sie auf persönliche Vorlieben, Charaktereigenschaften und Lebensgeschichten zugeschnitten ist, desto eher sind wir geneigt, an ihre Richtigkeit zu glauben und sie als ein für uns bestimmtes, persönliches Omen zu deuten.
Dabei haben wir allen Grund, unsere ›natürliche‹ Intelligenz zu schärfen, um die falschen Signale zu entdecken, die von der ›künstlichen‹ Intelligenz ausgesendet werden. Wir sind bemüht die Deepfakes herauszufiltern, auch wenn das in einem Wettlauf mit all jenen geschieht, die mehr davon auf kriminelle Weise gezielt in Umlauf setzen. Unsere Kultur räumt die Priorität nicht mehr dem Ohr, sondern dem Auge ein. Satellitenaufnahmen aus der Ferne und Überwachungskameras aus der Nähe registrieren, was sich im öffentlichen wie im privaten Raum abspielt. Wir sind besessen davon, uns in jeder Pose und bei jeder Gelegenheit aufzunehmen, ob Selfies oder Videos, und die Bilder zu teilen. Alles, was im Netz zirkuliert und sich in den sozialen Medien verbreitet, wird gesehen und gelesen, bevor es weiter zum Ansehen und Lesen versandt wird. ChatGPT stellt den gewünschten Inhalt in Bild, Ton und Text in Sekundenschnelle her. Doch was ist echt, was ist Täuschung? Es sind nicht mehr die Götter, die uns verwirren oder bewusst in die Irre leiten, sondern Menschen, die es darauf anlegen, uns durch Maschinen zu täuschen und die enorme Konzentration von ökonomischer Macht in den Händen von Konzernen und von Staaten, die mit lancierter Desinformation über automatisierte Bots darauf aus sind, Zwiespalt und Hass zu säen.
Und wie steht es mit der von Gilgamesch und seinem Gefährten Enkidu so offen ausgelebten Aggressivität, die keine Grenzen anerkennt? Die beiden Helden sind jederzeit zum Kämpfen bereit. Wem immer sie begegnen, sie erkennen in ihm sofort einen Gegner. Durch ihre Taten hinterlassen sie eine breite Spur der Verwüstung. Obwohl von jedem Herrscher erwartet wird, militärische Feldzüge zu unternehmen, um die benötigten Rohstoffe in Form von natürlichen Ressourcen und menschlichen Zwangsarbeitern aufzustocken, ist das beim Feldzug gegen Humbaba, einem Monster, das den Zedernwald hütet, weder das Motiv noch das erklärte Ziel. Vielmehr ist es purer Übermut, der Gilgamesch entgegen dem Rat der Götter und seiner Ratsversammlung in den Kampf ziehen lässt. Und obwohl Humbaba bereit ist, seine Niederlage anzuerkennen, wird er getötet. Der Zedernwald wird völlig zerstört, eine der ersten von Menschen verursachten Naturkatastrophen, denn Gilgamesch hätte Humbabas Leben schonen können. Als Sieger hätte er ihn zum Naturschützer ernennen und von ihm Tribut einfordern können, doch diese Alternative zieht er nicht in Erwägung.
Parallelen zu heutigen Zeitgenossen drängen sich auf. Hat die Menschheit nichts dazugelernt? Bleibt sie für immer im Freund-Feind-Schema gefangen, sind Kriege und brutale Überfälle auch im 21. Jahrhundert ein konstitutioneller Bestandteil unseres Menschseins, Kriege, die sich mit noch tödlicheren Waffensystemen scheinbar unvermeidbar fortsetzen? Der israelische Historiker Yuval Harari, um ein Beispiel zu nennen, sieht die Tragödie des Israel-Gaza-Konflikts darin, dass sie nicht aus einer Paranoia erwächst, sondern auf einer rationalen Analyse der Situation beruht, in der jede Seite die eigenen Absichten und Fantasien bestens kennt. Die dunklen Wünsche, den anderen zu vernichten, die auf beiden Seiten existieren, führen zum Schluss, dass der andere dieselben Ängste hegt und denselben Hass schürt. Das Ergebnis dieser teuflischen Logik ist: Wenn wir den anderen nicht vernichten, wird er uns vernichten.6
Hararis düstere psychoanalytische Diagnose verweist auf einen größeren Kontext, in dem die Gewaltspirale, einmal in Gang gesetzt, nur zu mehr Gewalt führt, die Zerstörung, unsägliches Leid und Traumata mit sich bringt und an die kommenden Generationen weitergegeben wird. Gewalt kann niemals gegen Gewalt aufgerechnet oder einfach mit ihr gleichgesetzt werden. Es gilt, die Voraussetzungen, rechtlichen Rahmenbedingungen und legitimen Rechtfertigungsgründe zu berücksichtigen, ohne die es weder ein gesellschaftliches Zusammenleben noch eine internationale Ordnung geben kann. Nach dem mörderischen Anschlag der Hamas am 7. Oktober 2023 geht der von Israel darauf erklärte Krieg mit unverminderter Heftigkeit weiter. Ein Teil der Weltöffentlichkeit verfolgt die sich in Gaza ausbreitende Verwüstung und humanitäre Katastrophe mit hilflosem Entsetzen angesichts einer internationalen Realpolitik, die allen zivilgesellschaftlichen Versuchen trotzt, das Grauen zu beenden und eine politische Lösung des jahrzehntelangen Konflikts anzustreben.
Auswege aus einer selbstzerstörerischen Logik zu finden, bleibt schwierig. Das Gilgamesch-Epos ist voll von Anspielungen und abschreckenden Beispielen, wohin die Ausübung von Macht, ob die des Herrschers oder jene der Götter, führt, wenn sie nicht durch Weisheit und gute Ratschläge im Zaum gehalten wird. Dazu gehören Diskussion und Deliberation, um den Impuls zur Rache und zur schnellen, unüberlegten Handlung zu hemmen. Die wohl folgenschwerste Entscheidung wird von den Göttern getroffen, als sie die Flut über die Menschen kommen lässt. Enil, der König der Götter, hasste die Menschen und beschloss, die Flut auszulösen, »ohne sich zu beraten«, wie es im Epos heißt. Die Folgen hätten noch katastrophaler ausfallen können, hätte Ea, der Ratgeber der Götter, Uta-napišti nicht gewarnt. Ea wusste von Enils Entscheidung, doch da er unter Schweigepflicht stand, konnte er keine offene Warnung aussprechen. So sandte er verschlüsselte und mehrdeutige Botschaften an Uta-napišti. Dieser befolgte die Aufforderung, ohne den Grund zu kennen, und baute das rettende Schiff. Zusammen mit seiner Frau wurden sie so zu den einzigen Überlebenden. Die Götter schenkten den beiden Unsterblichkeit, die freilich auf das bisherige Leben der Sterblichen beschränkt war. Den Menschen blieb die Zukunft verwehrt, lag doch alles, was ihnen widerfahren würde, in der Macht der Götter. Die Zukunft gehörte den Göttern – und ihnen allein.
Nach der Katastrophe ist vor der Katastrophe
Das Gilgamesch-Epos ist Fiktion, ein literarisches Werk, das nicht mit der historischen Wirklichkeit und dem Wenigen, was wir darüber wissen, verwechselt werden darf. Dennoch gibt es Überschneidungen, wie das mit dem historischen Ereignis der Flut offensichtlich der Fall ist. Auch wenn sie im Gedächtnis der Menschen und in ihren Erzählungen als Ende ihrer Welt erlebt und interpretiert wurde, handelte es sich – aus heutiger wissenschaftlicher Sicht gesehen – um ein regionales Ereignis, dessen geografische Umrisse und Folgen einigermaßen bekannt und weiterhin Gegenstand der Forschung sind. Angesichts der aktuellen Bedrohung durch den Klimawandel, dem Anwachsen der Weltbevölkerung auf bald neun Milliarden Menschen und den engmaschigen ökonomischen, ökologischen und politischen Verschränkungen einer sich weiterhin globalisierenden Welt, sind einige der sich aufdrängenden Parallelen dennoch zulässig. Das Gefühl einer globalen Bedrohung und der weltweit katastrophalen möglichen Folgen ist real. Gilgamesch wieder zu lesen, vermittelt einen Eindruck, wie schwerwiegend die Erfahrung des Verlusts für die Menschen, die nachher kamen, gewesen sein musste.
Der Topos ›nach der Katastrophe‹, einer Welt des Wiederaufbaus nach der Zerstörung, ist uralt und taucht in vielerlei Varianten sowohl bei indigenen Bevölkerungsgruppen wie in der Science-Fiction auf. Das ›Danach‹ markiert den Bruch, einen tiefen Einschnitt in der Zeitrechnung, der das Vorher abtrennt und das Nachher in den Projektionsraum einer imaginierten Zukunft verlegt. Eine SciFi-Variante dieses Motivs lief jüngst in der erfolgreichen Neuverfilmung von DUNE 2 durch Denis Villeneuve in den Kinos. Sie beruht auf dem 1965 erschienenen Roman von Frank Herbert. Die Geschehnisse ereignen sich nach einer von den Menschen vor tausend Jahren durchgeführten ›Großen Revolte‹, dem ›Butlerian Jihad‹, in dem alle Roboter und Computer zerstört wurden. Auf geschickte Weise will sich der Autor des obligatorischen technologischen Instrumentariums der Roboter und Androiden entledigen, um sich auf die von Menschen ausgehenden zerstörerischen Gefahren zu konzentrieren. Diese verdichten sich im Syndrom des Superhelden und thematisieren die Mechanismen, die von der Faszination ausgehen, einem Anführer bedingungslos die Macht zu übertragen.