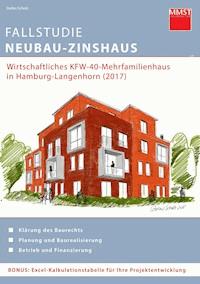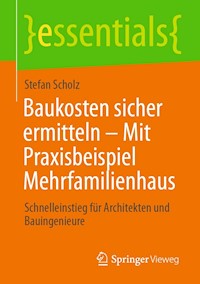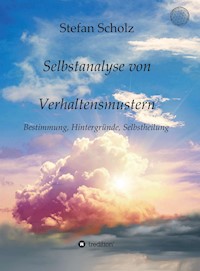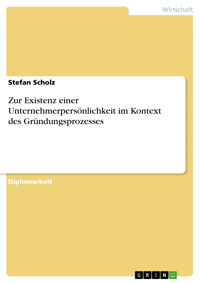
Zur Existenz einer Unternehmerpersönlichkeit im Kontext des Gründungsprozesses E-Book
Stefan Scholz
36,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: GRIN Verlag
- Sprache: Deutsch
Diplomarbeit aus dem Jahr 2002 im Fachbereich BWL - Unternehmensführung, Management, Organisation, Note: 1,3, Humboldt-Universität zu Berlin (Institut für Entrepreneurship und Innovationsmanagement), Veranstaltung: Entrepreneurship und Innovationsmanagement, Sprache: Deutsch, Abstract: Kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) kommt bei Wirtschaftswachstum und der Schaffung neuer Arbeitsplätze eine besondere Bedeutung zu (Frese/Chell/Klandt, 2000, S. 3). Dies gilt insbesondere für Unternehmen innovativer Hochleistungstechnologien (Audretsch, 2002, S. 1221; Licht/Nerlinger, 1997, S. 203). Insgesamt 99 % aller deutschen Unternehmen zählen zum Kreis des Mittelstandes, fast 70 % der verfügbaren Arbeitsplätze können diese Unternehmen auf sich vereinigen (BMWi, 1997, S. 16). Shane (1996, S. 747) zeigt, dass 80 % aller neu geschaffenen Stellen auf Neugründungen zurückzuführen sind. Eine direkte Korrelation zwischen Arbeitslosenquote und unternehmerischer Aktivität wurde zudem in einer multinationalen Studie direkt nachgewiesen (Bögenhold/Staber, 1990). Unternehmertum kann somit als eines der zentralen Aspekte zur Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen angesehen werden (Stewart, 1996, S. 3). Doch wie entsteht Unternehmertum? Welche Voraussetzungen stimulieren Erfolg versprechende Gründungsaktivitäten? Die Forschung der letzten vierzig Jahre hat gezeigt, dass ein Zusammenspiel psychologischer, soziologischer, demographischer und wirtschaftlicher Aspekte bei der Beantwortung beider Fragen zu berücksichtigen ist (u. a. Hisrich, 2000, S. 93; Stewart, 1996, S. 6; Cunningham/Lischeron, 1991, S. 46; Sexton/Bowman, 1985, S. 138). Die Gründung eines Unternehmens ist zudem mit hohen finanziellen, gesellschaftlichen und beruflichen Risiken verbunden (Brockhaus, 1982, S. 46). Zentrales Element innerhalb dieses Prozesses ist und bleibt deshalb der Unternehmer selbst (vgl. Cromie/O‘Donaghue,1992, S. 66). Dies wirft die Frage auf, wie der potentielle Unternehmer agiert, wie er denkt, letztlich, welche spezifische Persönlichkeitsstruktur er aufweist, und ob diese in allgemeiner Form überhaupt existiert. Ist es zudem sinnvoll und notwendig, den Unternehmer zu begreifen, um den Unternehmensgründungsprozess zu verstehen und zu beeinflussen? [...] 1 Audretsch (2002, S. 111) ermittelt in eigenen Studien, dass kleine- und mittelständische Hochtechnologiefirmen die treibende Kraft bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze sind.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2003
Ähnliche
Page 1
Page 2
Page 3
Danksagung
Mein Dank gilt vor allem Prof. Dr. Christian Schade für die Unterstützung bei der Ausgestaltung des behandelten Themas sowie für das entgegengebrachte Vertrauen. Die vielfältigen Hinweise und die kritische Begleitung waren bei der Erstellung der Arbeit von großer Hilfe. Seinem wissenschaftlichen Mitarbeiter Dipl.-Kfm. Tobias Krebs danke ich insbesondere für die unzähligen praktischen Ratschläge.
Diese Arbeit wäre jedoch nicht ohne die wunderbare Unterstützung meiner lieben Freunde möglich geworden. Zahlreiche kritische Bemerkungen, aber auch die oft vernommenen Worte der Aufmunterung, inspirierten mich immer wieder neu. Ich danke Kathrin Reinhold, Manuela Dreyer, Mascha Pachomow, Mahjar Roshanai und René Schörnick für die zeitintensive Durchsicht und Fehlerkorrektur. Ein besonderer Dank geht an Jan Steinhagen, der mir bei der optischen Gestaltung der Arbeit zur Seite stand. Ignacio Hermo danke ich herzlich für die hilfreiche Unterstützung bei der oft nicht einfachen Literaturbeschaffung.
Stefan Scholz
Page 6
Abbildungsverzeichnis Abbildung 1: Creation Value Performance Modell...........................................39 Abbildung 2: Modell des unternehmerischen Potentials...................................45 Abbildung 3: Modell der unternehmerischen Disposition.................................58 - VI -Page 1
„Entrepreneurship is the ability to create something from practically nothing. It is initiating, doing, achieving, and building an enterprise rather than just watching, analysing or describing one. It is the knack of sensing op-portunities where others see chaos, contradiction and confusion. It is the ability to build a ‘founding team’ to complement your own skills and talents. It is the knowledge to find, marshal and control resources [ ... ] Finally it is the willingness to take calculated risks [ ... ] - and then do everything possi-
1.Einleitung
1.1 Motivation
Kleinen und mittelständischen Unternehmen (KMU) kommt bei Wirtschaftswachstum und der Schaffung neuer Arbeitsplätze eine besondere Bedeutung zu (Frese/Chell/Klandt, 2000, S. 3). Dies gilt insbesondere für Unternehmen innovativer Hochleistungstechnologien (Audretsch, 2002, S. 1221; Licht/Nerlinger, 1997, S. 203). Insgesamt 99 % aller deutschen Unternehmen zählen zum Kreis des Mit-telstandes, fast 70 % der verfügbaren Arbeitsplätze können diese Unternehmen auf sich vereinigen (BMWi, 1997, S. 16).
Shane (1996, S. 747) zeigt, dass 80 % aller neu geschaffenen Stellen auf Neugründungen zurückzuführen sind. Eine direkte Korrelation zwischen Arbeitslosenquote und unternehmerischer Aktivität wurde zudem in einer multinationalen Studie direkt nachgewiesen (Bögenhold/Staber, 1990).
Unternehmertum kann somit als eines der zentralen Aspekte zur Lösung der wirtschaftlichen und sozialen Herausforderungen angesehen werden (Stewart, 1996, S. 3). Doch wie entsteht Unternehmertum? Welche Voraussetzungen stimulieren Erfolg versprechende Gründungsaktivitäten?
1Audretsch (2002, S. 111) ermittelt in eigenen Studien, dass kleine- und mittelständische Hochtechnologiefirmen die
treibende Kraft bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze sind.
Page 2
Die Forschung der letzten vierzig Jahre hat gezeigt, dass ein Zusammenspiel psychologischer, soziologischer, demographischer und wirtschaftlicher Aspekte bei der Beantwortung beider Fragen zu berücksichtigen ist (u. a. Hisrich, 2000, S. 93; Stewart, 1996, S. 6; Cunningham/Lischeron, 1991, S. 46; Sexton/Bowman, 1985, S. 138). Die Gründung eines Unternehmens ist zudem mit hohen finanziellen, gesellschaftlichen und beruflichen Risiken verbunden (Brockhaus, 1982, S. 46). Zentrales Element innerhalb dieses Prozesses ist und bleibt deshalb der Unternehmer selbst (vgl. Cromie/O‘Donaghue,1992, S. 66).
Dies wirft die Frage auf, wie der potentielle Unternehmer agiert, wie er denkt, letztlich, welche spezifische Persönlichkeitsstruktur er aufweist, und ob diese in allgemeiner Form überhaupt existiert. Ist es zudem sinnvoll und notwendig, den Unternehmer zu begreifen, um den Unternehmensgründungsprozess zu verstehen und zu beeinflussen?
Ein Diskurs zwischen William B. Gartner (1988) und Carland, Hoy und Carland (1988) soll darauf eine Antwort geben. Gartner (1988, S. 11) kritisiert, dass die Frage nach dem „Wie“ (entsteht Unternehmertum) mit „Wer“ (ist der Unternehmer) beantwortet wird und eine separate Betrachtung von Unternehmer und Unternehmertum nicht möglich ist: „How can we know the dancer from the dance?“ Doch wenn wir den Tänzer nicht aus dem Tanz heraus erkennen können, dann bedeutet dies, dass beide untrennbar miteinander verbunden sind. Es ist also nicht möglich, das eine ohne das andere Konzept zu begreifen. Das Verständnis unternehmerischer Aktivität setzt fundiertes Wissen über diejenigen voraus, die in entscheidendem Maße diese Aktivität bestimmen und verantworten. Den Unternehmer in seiner Persönlichkeit zu definieren, ist demzufolge ein wesentlicher Schritt, um die Frage nach dem „Wie” zu beantworten (Carland et al., 1988, S. 34-35). Die psychologische Literatur lässt keinen Zweifel daran erkennen, dass die Persönlichkeit einen entscheidenden Einfluss auf Ausbildung und Berufswahl ausübt (Carland et al., 1988, S. 37). Persönlichkeitsmerkmale sind, der breiten Auffassung der Entrepreneurship-Forschung folgend, zudem für das Gesamtverständnis des Gründungsprozesses von wesentlicher Bedeutung (Cromie, 2000, S. 9;
Page 3
Rauch/Frese, 2000, S. 102; Carland/Carland/Stewart, 1996, S. 10; Stewart, 1996, S. 6; Greenberger/Sexton, 1988, S. 7).
1.2 Vorgehensweise
Die vorliegende Arbeit ist in vier weitere Abschnitte gegliedert. Zuerst wird über eine historische Analyse eine Arbeitsdefinition des Unternehmers entwickelt. Der darauffolgende Abschnitt befasst sich detailliert mit der zur Unternehmerpersönlichkeit vorliegenden Literatur und diskutierten Theorieansätzen. Im Anschluss wird ein Modell entwickelt, dass die Stellung der Unternehmerpersönlichkeit im und seine Bedeutung für den unternehmerischen Prozess herausstellt. Die Arbeit schließt mit einer Schlussbetrachtung.
Neben der grundsätzlichen Problematik der allgemeinen Unternehmerpersönlichkeit soll gleichzeitig untersucht werden, welche Persönlichkeitsstruktur und Umgebungsvariablen erfolgreiche Unternehmer kennzeichnen. Diese Differenzierung erscheint in folgender Hinsicht sinnvoll: Die Antwort auf die erste Fragestellung ermöglicht es, potentielle Unternehmer generell zu bestimmen. Die Untersuchung des zweiten Aspekts führt zu einem besseren Verständnis möglicher Einflussfak-toren in Bezug auf eine positive Entwicklung des Gründungsunterfangens. Die Existenz einer unternehmerischen Persönlichkeitsstruktur ist nicht zwingend mit der Tatsache verbunden, erfolgreich zu sein (Utsch et al., 1999, S. 32; vgl. Begley/Boyd, 1987, S. 89-90).
Page 4
2. Unternehmerdefinition - eine Abgrenzung
Grundlage einer erfolgreichen wissenschaftlichen Studie ist die exakte Definition des Untersuchungsobjektes. Die prinzipielle Schwierigkeit einer Persönlichkeitsanalyse des Unternehmers liegt jedoch bereits in der Festlegung des Unternehmerbegriffs selbst (Chell/Harworth/Brearley, 1991, S. 1). Weder in der deutschen Literatur, noch im englischen Sprachraum konnte bisher eine befriedigende, allgemein gültige Definition gefunden werden (Stewart, 1996, S. 4; Cunningham/Lischeron, 1991, S. 45; Shaver/Scott, 1991, S. 23-24; Carland et al., 1988, S. 33; Gartner, 1988, S. 12). Erschwerend kommt hinzu, dass der deutsche Unternehmerbegriff semantisch keine vollständige Deckungsgleichheit mit dem aus dem angloamerikanischen Sprachraum stammenden Entrepreneur besitzt (Zumholz, 2001, S. 12).
Gartner (1988, S. 12 und S. 21) bemerkt in Hinblick auf die vorliegenden Forschungsergebnisse:
„(1) that many (and often vague) definitions of the entrepreneur have been used (in many of the studies the entrepreneur is never defined); (2) there are few studies that employ the same definition; (3) that lack of basic agreement as to ‘who the entrepreneur is’ has led to the selection of samples of ‘Entrepreneurs’ that are hardly homogeneous. This lack of homogeneity occurs not only among the various listed, but actuallywithinsingle samples [ … ]”
Der einheitlichen Definition des Unternehmerterminus kommt deshalb entscheidende Bedeutung zu, da die Begriffsbestimmung zum einen der Festlegung der
Page 5
empirischen Grundgesamtheit jeder Studie dient, und damit auf die jeweiligen Forschungsergebnisse erheblichen Einfluss ausübt, zum anderen die grundsätzliche Frage behandelt, wem sich die Gründungsforschung im Allgemeinen widmen sollte, und damit, wessen psychologisches Potential es zu analysieren gilt. Eine allgemein anerkannte Definition würde letztendlich die Entwicklung eines übergreifenden konzeptuellen Rahmens für alle Teilbereiche der Entrepreneurship-Forschung erleichtern (Stewart, 1996, S. 5).
Einen ersten Anhaltspunkt geben die etymologischen Wurzeln. Das Wort Entrepreneur ist demnach vom Französischen „entreprendre“ abgeleitet, was sinngemäß etwas unternehmen, versuchen, wagen bedeutet (Carland et al., 1988, S. 33). Gablers Wirtschaftslexikon (1997, S. 3949) sieht im Unternehmer eine „Persönlichkeit, die eine Unternehmung plant, mit Erfolg gründet und/oder selbständig und verantwortlich mit Initiative leitet, wobei sie persönliches Risiko oder Kapitalrisiko übernimmt“. Merriam-Webster‘s Collegiate Dictionary Online (2002) findet für den Entrepreneur eine ähnliche Erläuterung: „one who organizes, manages, and assumes the risk of a business enterprise“. Beide Definitionen basieren auf einer historischen Auseinandersetzung, die im Wesentlichen auf Richard Cantillon (1680-1734) zurückzuführen ist. Der irische Bankier und Ökonom erwähnte erstmals 1725 den „Entrepreneur“ und beschrieb ihn als einen rationalen Entscheider, der das Risiko und die Führung seiner Unternehmung übernimmt (Kuratko/Hodgetts, 1992, S. 5; Carland et al., 1988, S. 33). Eine zweigeteilte Systematisierung existierender Definitionsansätze nimmt Zumholz (2000, S. 12-13) vor. Zum einen stehen dort die anfunktionalenKriterien orientierten Begriffsauffassungen, wie sie hauptsächlich in der Volkswirtschaftslehre Verwendung finden. Unternehmertum ist dabei eng mit der Vorstellung ver-bunden, die allgemeine Wohlfahrt zu mehren (Kuratko/Hodgetts, 1992, S. 5). Dies gelingt dem Unternehmer durch die explizite Schaffung (Schumpeter, 1952) oder die Ausnutzung (Kirzner, 1973) von Marktungleichgewichten. Der Unternehmer agiert als Koordinator (Say, 1841) und trägt das Risiko seiner Unternehmung (Knight, 1921). Diese Sichtweise assoziiert Unternehmertum mit dem Gedanken, dass neue Kombinationen am Markt durchgesetzt werden können (Schumpeter, 1952), d. h.neue, innovativeLeistungen entstehen (Cromie, 2000,