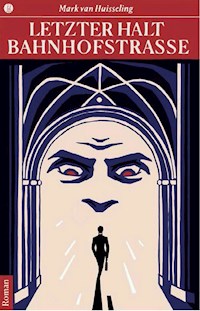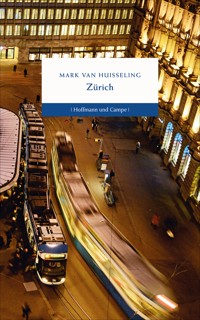
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: HOFFMANN UND CAMPE VERLAG GmbH
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Über seine Stadt schreibt man mit so viel Leidenschaft wie über die Frau, die man liebt, sagt der Kolumnist der Weltwoche und erzählt über Geld, Zicken, den »richtigen« Stadtkreis, das Zürich der Zürcher und das der anderen. Bestreitbar wie die Qualität des Schnitzels in der Kronenhalle, erfrischend wie ein Bad im See!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 122
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Mark van Huisseling
Zürich
Hoffmann und Campe Verlag
Für Elena aus dem Emmental
Go (North-)East, Young Man
Zürich war immer gut zu mir. Das ist ein Satz, den man nicht oft hört in Zürich und in der Schweiz. Weil es genügend Gründe gibt, über die größte Stadt jedes Landes zu klagen. Oder weil er einem nicht in den Sinn kommt. Die, die klagen, sind in den meisten Fällen Menschen, die nicht in Zürich leben, sondern sonst wo in der Schweiz. Und die, denen es nicht in den Sinn kommt, darüber nachzudenken, ob eine Stadt gut oder schlecht ist zu ihnen, sind Menschen, die in der Stadt geboren wurden, wie selbstverständlich dort leben. Bleiben die, die nicht aus Zürich sind, die aus eigenem Antrieb in Zürich leben – die Zuwanderer. Einer wie ich also.
Ich komme aus Bern. Das habe ich mit Absicht so geschrieben und nicht, »ich bin Berner«. Bin ich zwar, wollte ich aber nicht sein, so lange ich zurückdenken kann. Schon als kleines Kind haben mich große Städte mehr angezogen und interessiert. Wenn ich mit meinen Eltern im Wagen in die Ferien reiste, viele Male nach Kärnten, Österreich, wo meine Mutter herkommt und wo es keine großen Städte gibt, fuhren wir ein kleines Stück durch Zürich. Damals gab es noch keine Umfahrung, die man nehmen konnte. Wenn man aus dem Westen der Schweiz oder aus dem Mittelland in das Graubünden im Osten oder eben nach Österreich wollte, hörte die Autobahn plötzlich auf – und man war in Zürich. Genauer, man war am Stadtrand, wo es Industriegebiete gibt zuerst, und danach befand man sich auf der Weststraße, die durch das Viertel führte, in dem die meisten Juden der Schweiz leben. Anschließend war man wieder auf der Autobahn. Und meinem Vater, der aus den Niederlanden in die Schweiz eingewandert war, ging es wieder besser. Weil Zürich hinter ihm lag und er sich nicht verfahren hatte. »Wenn du hier falsch abbiegst, bist du verkauft«, sagte er immer. Und im Grunde hoffte ich jedes Mal, dass er falsch abbiegen würde. Weil ich herausfinden wollte, was es bedeutete, verkauft zu sein. Und weil ich gern mehr gesehen hätte von Zürich. Die Ecken, durch die man fuhr, wenn man den Schildern, auf denen Transit stand, folgte, waren sozusagen die Achselhöhlen der Stadt. Das wusste ich zwar nicht, doch man merkte es, sogar als Neunjähriger. Wenigstens rochen die Achselhöhlen irgendwie gut, immerhin waren es die Achselhöhlen einer großen Stadt.
Jahre später, als ich ein junger Erwachsener war, musste ich Computerkurse besuchen für die Versicherungsgesellschaft, für die ich damals arbeitete. Die Computerkurse interessierten mich wenig, was keine gute Voraussetzung ist, wenn man eine Ausbildung zum Software-Entwickler macht. Dafür interessierte mich der Austragungsort: Die Kurse fanden in Zürich statt. Und der Abteilungsleiter der Versicherungsgesellschaft überließ es seinen Mitarbeitern, ob sie während der etwa zehn Wochen, die die Kurse zusammengenommen dauerten, im Hotel in Zürich wohnen oder abends retour nach Bern fahren wollten. Ich nahm ein Zimmer im Hotel in Zürich, klar. Und konnte jeden Tag nach Ende des Kurses die Stadt anschauen.
Was ich sah, gefiel mir. Gefiel mir so gut, dass ich entschied, in Zürich leben zu wollen, irgendwann einmal. Einen Eintrag im Kalender, an einem bestimmten Tag, an dem ich herziehen würde, konnte ich noch nicht vornehmen. Mir fehlte ein Grund dazu. Die Stadt war zwar größer als Bern, das war ein Grund. Doch nicht Grund genug, denn ich hatte in den zehn Wochen auch gesehen, dass ich zwar Zürich wollte, aber Zürich mich nicht unbedingt. Einmal, zum Beispiel, fragte ich in der Mittagspause den Kursteilnehmer mit der größten street credibility, der zudem in Zürich lebte, welches im Augenblick das Restaurant sei, in das man gehe. Das heißt, ich fragte ihn jeden Tag, bis er es mir, nach einer Woche oder so, sagte. Das Tres Kilos war es, weil es »grölig« sei, ein Ausdruck für unterhaltsam, den man damals verwendete in Zürich, nehme ich an. Ich rief dort an, um einen Tisch für eine Person reservieren zu lassen, am Abend des folgenden Tages. Doch die Mitarbeiterin sagte, das Lokal sei dann schon voll. Und kommende Woche ebenfalls. Die danach auch, und drei Wochen im Voraus nehme man keine Reservierungen entgegen.
Das war meine erste Erfahrung mit der Haltung, die es in jeder großen Stadt gibt, in dem Restaurant, in das man geht, und die man so beschreiben kann: »Wir suchen keine Gäste, die uns zum ersten Mal besuchen.« Und wenn ich den Gedanken weiterdachte, kam ich zum Schluss, dass Zürich als Ganzes es ähnlich machen könnte mit mir wie das Mädchen am Tres-Kilos-Telefon.
Diese Haltung, das will ich kurz sagen, ist kein Widerspruch zu dem ersten Satz dieses Buches: Zürich war immer gut zu mir. Ich hätte schreiben können: Zürich war immer gut zu mir, seit ich dort hingezogen war. Wer liebt schon eine Stadt, die zu leicht zu erobern ist?
Ich lernte, zurück am Arbeitsplatz bei der Versicherung, dass man in Bern zwei verschiedene Rückmeldungen empfangen konnte, wenn man erzählte, man möge Zürich: Es gab die, die erwiderten, sie sähen es genauso und seien im Augenblick auch gerade dabei, den Umzug dorthin zu planen. Und es gab die, die erwiderten, ich solle doch hinziehen, wenn dort alles besser sei, was ich im Grunde so nicht gesagt hatte; doch dieser Verdacht ist es vermutlich, der Bewohner einer kleineren Stadt verunsichert, wenn ihnen einer, der ebenfalls dort lebt, Gutes erzählt über eine größere Stadt.
Wenn es um die Schweiz geht, sind solche Empfindlichkeiten möglicherweise besonders groß. Im Grunde passen die Worte »groß« und »Schweiz« nicht gut in einen Satz. Jedenfalls in den Köpfen einer Mehrheit der Bewohner des Landes nicht. Außer es geht um Schweizer Berge (doch dann wäre »hoch« das treffende Wort). Oder um Banken oder Unternehmen der pharmazeutischen beziehungsweise Nahrungsmittelindustrie, und dann befinden wir uns in den internationalen Wirtschaftsnachrichten. In anderem Zusammenhang mögen die meisten Schweizer es lieber kleiner. So klein, dass die Schweizerische Eidgenossenschaft keine »Hauptstadt« hat, sondern nur eine »Bundesstadt «. Den Verantwortlichen der Kantone, die diese zu einem Bundesstaat zusammenschlossen im Jahr 1848, war es vermutlich unwohl bei dem Gedanken, festschreiben zu müssen, welche Stadt die wichtigste sei. Vielleicht konnten sie sich auch nicht einigen. Darum entschieden sie, Bern, das in weiter zurückliegender Vergangenheit einmal wichtig gewesen war, zu dem Sitz der Regierung zu machen. So hatten die drei größten Städte, die mitmachten bei der Staatsgründung, alle eine Art USP. Basel hatte, damals, wichtige Banken plus eine Bürgeroberschicht, deren Mitglieder sich für die Gebildetsten und Belesensten hielten. Zürich hatte am meisten Unternehmen und Einwohner sowie, wahrscheinlich, die höchste Dichte von Einwohnern mit großen Köpfen. Und Bern war, irgendwie, auch wichtig mit dem zu bauenden Bundeshaus, in dem das Parlament zusammenkommen würde, sowie den Beamten, die man bekommt, wenn man die Regierung eines Landes aufnimmt.
Zirka hundertvierzig Jahre später – und das ist eine große Fallhöhe, was die Wichtigkeit angeht – schloss ich meine Software-Entwickler-Ausbildung ab und war dabei, einzusehen, dass ich nicht bloß uninteressiert war, Computer zu programmieren, sondern auch ungeeignet dazu.
Im Sommer 1990 bekam ich eine Volontärsstelle beim Sonntagsblick. Das war gut. Noch besser: Arbeitsort Zürich. Ich war ein wenig enttäuscht, an meinem ersten Tag als »Stift« (eigentlich Mundart für Lehrling, passt aber hier auch) bei der damals größten Zeitung der Schweiz, dass die Redaktion nicht an der Bahnhofstraße, der bekanntesten Adresse der Stadt, lag und auch nicht am Paradeplatz, der in der Schweizer Ausgabe von Monopoly das teuerste Grundstück des Spielfelds ist, sondern in einer (für mich) unbekannten Wohngegend mit Namen Seefeld, wohin man vom Hauptbahnhof nicht zu Fuß gehen konnte, sondern mit der Straßenbahn, die hier Tram heißt und komischerweise männlich ist auf Zürichdeutsch (»der Vierer«), fahren musste. Doch alles in allem war ich zufrieden, stolz eigentlich, einen Grund gefunden zu haben, nach Zürich zu ziehen.
Fehlte nur noch – eine Wohnung. Mit meinem damals niedrigen Gehalt und in einer Stadt, in der der sogenannte Leerwohnungsbestand zwei oder drei Prozent betrug, war einen Mietvertrag zu bekommen ungefähr so einfach wie einen Tisch für acht Personen am Samstagabend im Tres Kilos. Heute wäre es leicht, wenigstens den Tisch zu bekommen – weil man ins Tres Kilos nicht mehr geht, was normal ist nach so vielen Jahren. Das Lokal gibt es aber noch immer, was nicht normal ist für einen Mexikaner, doch recht normal für Zürich, da hier ausreichend viele Menschen einem Restaurant, das sie einmal mochten, treu bleiben, auch wenn es over ist. Was das Finden von Mietwohnungen angeht, hat sich die Lage nicht geändert seither, das heißt, es ist wahrscheinlich noch schwieriger geworden.
Doch, wie geschrieben, Zürich war immer gut zu mir, beziehungsweise in diesem Fall die Kollegin, neben deren Schreibtisch in der Sonntagsblick-Redaktion meiner stand. Ich hatte zuvor noch nie etwas gehört von Zollikon, einem Vorort am rechten Ufer des Zürichsees. Dieses Ufer nennt man immerhin »Goldküste «, weil viele reiche Leute dort leben, in großen Häusern in Parkanlagen. Ich hatte ja zuvor auch noch nie etwas gehört von dem Seefeld, wo sich mein Arbeitsplatz befand, und das in der Zwischenzeit auch ich als eines der besseren Viertel, oder einer der besseren Stadtkreise, wie man in Zürich sagt, einschätzen kann. Und dass sich die Wohnung, die meine Kollegin verließ und mir zur Miete anbot, eher am low end von Zollikon und der Goldküste befand, damit konnte ich leben und musste es auch nicht jedem mitteilen.
Doch dass ich schon bald in der großen Stadt wohnen würde, musste ich fast jedem erzählen in Bern. Vor allem denen, die früher, wenn ich erzählte, ich plane, nach Zürich zu ziehen, sagten, sie seien auch dabei, abzuhauen. Die übliche Rückmeldung auf meine Nachricht war, man habe sich das alles noch einmal überlegt – und Zürich sei, irgendwie, doch nicht richtig gut. Und darum wahrscheinlich nicht das richtige Ziel. Wenn schon abhauen, dann richtig – nach New York vielleicht zum Beispiel, das sei der neue Plan auf alle Fälle.
Zicke trifft Banker
Was sagt ein Zürcher, wenn er zum ersten Mal das Meer sieht?« – »Ich habe es mir größer vorgestellt.« Diesen alten Witz findet man recht lustig in der Schweiz. Und zwar überall in der Schweiz. Lustigerweise auch in Zürich. Das ist im Grunde unüblich – man macht sich lustig über jemanden, und der kann darüber lachen. Dafür gibt es zwei mögliche Erklärungen: Der, den es angeht, nimmt sich selbst nicht so ernst. Oder, zweitens und in diesem Fall zutreffender, der, den es angeht, empfängt den Witz anders, als der, der ihn erzählt, senden wollte. Der Sender sagt, nicht in diesen Worten, doch zusammengefasst, Zürcher seien ziemlich grandios im Auftritt. Und der Empfänger hört, es sei nicht leicht, einen aus Zürich zu beeindrucken, weil der viel fordert, was logisch ist, wenn man überlegt, wo er herkommt beziehungsweise lebt. So kann man das auch sehen.
Vor einigen Jahren gab es Reklameplakate des Kleidergeschäfts Modissa aus Zürich, die überall in der Stadt hingen und eine junge Frau zeigten, die, so die Botschaft, Zürcherin war, mit der Headline: Typisch Zürcherin, zu spät bei der Gala-Veranstaltung eintreffen, dafür als Erste ein Glas Champagner bekommen und das kürzeste Kleid anhaben (oder so ähnlich). Im Grunde also dieselbe, nicht besonders zu Herzen gehende Charakterbeschreibung: Ein Alpha-Weibchen (oder -Männchen ), das anderen Menschen auf die Nerven fällt, sich dabei aber gut fühlt und dafür irgendwie, wenn schon nicht gemocht, wenigstens geschätzt oder sogar ein wenig bewundert wird.
Einverstanden, einen Teil dieses Bildes kann man wahrscheinlich von den Bewohnern jeder größten und wichtigsten Stadt eines Landes zeichnen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen Männern und Frauen aus Zürich und Bewohnern von, sagen wir, London, New York oder Berlin: Die Londoner, New Yorker oder Berliner leben in einer richtig großen Stadt. Sie haben es also nicht (oder weniger) nötig, ihre Landsleute und andere, die das wahrscheinlich auch nicht interessiert, daran zu erinnern, dass sie es mit Männern und Frauen von Welt zu tun haben. Ich habe vier Jahre lang in London gelebt und kann mir nicht vorstellen, dass ein Londoner den Witz, er habe sich das Meer größer vorgestellt, lustig fände oder eine Londonerin den Slogan, dass sie zu spät irgendwo eintrifft, dafür als Erste Champagner bekommt und dabei sexy ist, verstehen würde. Auch weil Londoner oder Londonerinnen es nicht so wichtig finden, was Nichtlondoner über sie denken. London ist ihr Planet – gibt es Leben anderswo da draußen?
Die Stadt Zürich besteht aus zwölf sogenannten Stadtkreisen. Darin leben ungefähr 390000 Menschen. Zählt man die Bewohner der umliegenden Orte dazu, wie das in den meisten Ländern gemacht wird, hätte greater Zurich ungefähr 1,1 Millionen Einwohner oder, falls man die Städte Winterthur, Schaffhausen sowie Orte an beiden Uferseiten des Sees auch nimmt, 1,9 Millionen. Das ist nicht besonders viel, verglichen mit anderen Städten Europas, aber auch nicht besonders wenig, und, natürlich, sehr wenig, verglichen mit Städten in Asien, aber mit den Asiaten können wir uns wirklich nicht messen. Man darf den Witz jedenfalls als Kompliment auffassen: Falls man sich das Meer größer vorgestellt hat, ist die Ausstrahlung der Stadt offenbar größer als die Ausstrahlung vieler anderer Städte mit ungefähr gleich vielen Einwohnern. Das Angebot des kulturellen, wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Lebens zum Beispiel ist in Zürich reich wie sonst nur in Welthauptstädten: hochrangige Kunstwerke in mehr als zehn teils sehr namhaften Museen, steht im Baedeker; weltbeste Musiker im Opernhaus und in Konzertlokalen, zahlreiche Weltfirmen mit Hauptsitz in der Stadt; Universitäten (Universität Zürich, 25000 Studenten) und Hochschulen (Eidgenössische Technische Hochschule ETH, 15000 Studenten), die auf verschiedenen Gebieten zu den besten des Fachs und stärksten der Forschung zählen … Da kommen ähnlich große und ein wenig bekannte Städte wie beispielsweise Bologna oder Stuttgart immer nur in einzelnen Punkten hinterher.