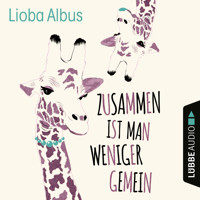11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Manchmal wird es auch in der größten Wohnung ganz schön eng ...
Die Zeiten sind hart, die Konten leer, und obwohl sie einander kaum kennen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als vorübergehend zusammenzuziehen: die Komikerin Daniela Dies, ihr Techniker Franz und die Kostüm- und Modedesignerin Pia. Vierte im Bunde ist die eitle Filmdiva Etta Glück, die ihre riesige Wohnung zur Verfügung stellt. Als Wohnungsbesitzerin beharrt sie allerdings darauf, die Regeln des Zusammenlebens zu bestimmen. Ihr oberstes Gesetz: keine Nacktheit und kein Sex in ihren heiligen Hallen. Kann das auf Dauer gut gehen? Wer bricht zuerst die Regeln, und wer trickst am geschicktesten? Raufen die vier sich zusammen, oder scheitert ihre Zweck-WG an den Schrulligkeiten eines jeden Einzelnen?
Vier erwachsene Menschen, vier Individualisten in einer Zweck-WG. Kann das gut gehen? Humorvoll und mit einem Augenzwinkern lässt die beliebte Kabarettistin Lioba Albus ihre Held:innen aufeinander los. Für sie steht fest: Zusammen ist man weniger gemein!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 449
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Inhalt
Über das Buch
Die Zeiten sind hart, die Konten leer, und obwohl sie einander kaum kennen, bleibt ihnen nichts anderes übrig, als vorübergehend zusammenzuziehen: die Komikerin Daniela Dies, ihr Techniker Franz und die Kostüm- und Modedesignerin Pia. Vierte im Bunde ist die eitle Filmdiva Etta Glück, die ihre riesige überteuerte Wohnung für die ungewöhnliche WG zur Verfügung stellt. Als Wohnungsbesitzerin beharrt sie allerdings darauf, die Regeln des Zusammenlebens zu bestimmen. Ihr oberstes Gesetz: keine Nacktheit und kein Sex in ihren heiligen Hallen. Kann das auf Dauer gut gehen? Raufen die vier sich zusammen, oder scheitert ihre Zweck-WG an den Schrulligkeiten eines jeden Einzelnen?
Über die Autorin
Lioba Albus wurde 1958 in Attendorn im Sauerland geboren, lebt in Dortmund und ist Mutter von drei erwachsenen Töchtern. Als gelernte Schauspielerin zog es sie vor dreißig Jahren auf Deutschlands Kabarettbühnen. Außerdem ist sie häufig zu Gast in diversen Radio- und Fernsehshows wie z.B. der Ladies Night (ARD). Freunde, die es gut mit ihr meinen, finden, sie spricht ein bisschen zu viel. Darum schreibt sie jetzt. Wer will, kann das lesen. Hoffentlich wollen viele – sonst fängt sie wieder an zu sprechen.
Vollständige eBook-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Titel auch als Hörbuch erhältlich
Originalausgabe
Copyright © 2022 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Dr. Stefanie Heinen
Umschlaggestaltung: ZERO Werbeagentur, München
Einband-/Umschlagmotiv: © shutterstock.com: Nik Merkulov | Olga_Angelloz | VectorShow | Master_shifu
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-2823-2
www.luebbe.de
www.lesejury.de
Willst du schnell gehen, geh allein.
Willst du weit gehen, geh mit anderen.
Afrikanisches Sprichwort
Für meinen Tourbegleiter Raimund, der mich seit Jahrzehnten mit fürsorglicher Solidarität durch Nacht und Wind von Auftritt zu Auftritt kutschiert und der nichts, aber wirklich gar nichts mit dem Franz dieses Romans gemeinsam hat.
GLÜCKS VERLUST
Etta Glück zog die Schultern hoch. Dortmund empfing sie heute mit Nieselregen. Sieben elfenbeinfarbene Taxen parkten in Reih und Glied auf dem Bahnhofsvorplatz und warteten auf Fahrgäste. Sie sahen aus wie satte, schläfrige Hausgänse. Selbst im Schlaf immer in Alarmbereitschaft, dachte Etta und blieb stehen.
Rechts und links von sich setzte sie ihre zwei Koffer ab, so riesig, dass sie notfalls auch ein paar Tage darin wohnen könnte. Vorsichtig legte Etta sich die weite Kapuze ihres edlen grauen Wollmantels über die Frisur. Sie wartete, doch keiner der Taxifahrer stieg aus, um ihr entgegenzukommen.
Das kann doch nicht wahr sein! Indigniert winkte und gestikulierte sie in Richtung der Taxis. Keine Reaktion. Typisch Dortmund. Im gleichen Augenblick wusste sie, wie ungerecht dieser Gedanke war. Die Berliner Taxifahrer beispielsweise waren für ihre Unfreundlichkeit ja regelrecht berühmt.
Seufzend rollte sie ihre beiden Koffer in Richtung des ersten Taxis. Als sie sich gerade herunterbeugen wollte, um an die Scheibe zu klopfen, setzte der Fahrer den Blinker, scherte nach links aus und fuhr davon.
Der Taxifahrer dahinter hatte diese Szene beobachtet. Er stieg aus. »Brauchen Sie ein Taxi?«
»Nein, ich hatte vor, auf meinen Koffern nach Hause zu fliegen«, sagte sie gereizt.
Der Fahrer blieb ungerührt. Er sah schon so aus wie einer, den so leicht nichts aufregt: etwas dicklich, klein, mit wachen dunklen Augen und einer Lederjacke, die schon bessere Zeiten erlebt hatte.
Ohne Anstalten zu machen, ihr Gepäck in den Kofferraum zu hieven, strich er sich über einen ungepflegten Oberlippenbart, der aussah wie eine Wurzelbürste. Etta wurde ungeduldig. »Worauf warten wir?«, fragte sie. »Natürlich brauche ich ein Taxi, wonach sieht es denn sonst bitte aus?«
Auch jetzt reagierte der Fahrer nicht auf ihren ruppigen Ton, sondern fragte nur: »Kann ich Ihnen mit dem Gepäck behilflich sein?«
Herr im Himmel’ wie begriffsstutzig kann man sein? Sie ließ die beiden Koffergriffe los und bedeutete dem Taxifahrer mit einer unmissverständlichen Geste, er möge die Koffer im Wagen verstauen.
Der Taxifahrer hob den ersten ächzend an und verfrachtete ihn in den Kofferraum. Damit war dieser voll. »Den zweiten auf den Rücksitz?«, fragte er in Ettas Richtung.
»Auf den Schoß wollte ich ihn nicht nehmen«, sagte Etta und setzte sich auf den Beifahrersitz.
Der Taxifahrer stieg ein. »Wo soll es denn hingehen?«
Etta nannte ihm die Straße, er stellte das Taxameter ein, und sie fuhren los. Endlich!
»Ganz schön schwer, Ihre Koffer«, sagte der Taxifahrer, der offenbar Konversation betreiben wollte. »Haben Sie Steine da drin?«
»Nein«, antwortete Etta, »dann hätten Sie die ja wohl kaum hochbekommen. Sie haben ja eh schon reichlich gestöhnt. In den Koffern sind lediglich meine Kleider.«
Konnte es tatsächlich sein, dass dieser unsensible Tölpel sie nicht erkannte? Nicht, dass sie unbedingt erkannt werden wollte, nein, ganz bestimmt nicht – aber sie war es einfach nicht gewohnt, so ignoriert zu werden. Und das, obwohl sie noch gestern Abend im Fernsehen zu sehen gewesen war! In einer sehr schönen Rolle. Im Tatort.
Jawohl! Etta hob das Kinn ein wenig höher. Sie hatte die leicht schizoide Gattin des Hauptverdächtigen gespielt, der dann nicht der Mörder gewesen war. Eine gute Folge, wie sie fand. Und sie war mit ihrer Arbeit sehr zufrieden. Vielleicht guckt dieser armselige Tropf von einem Taxifahrer einfach keinenTatort, versuchte sie, sich zu trösten.
Trotzdem war es ihr irgendwie unheimlich, dass er sie offenbar so gar nicht erkannte. Er schien auch nicht großartig an ihr interessiert zu sein. Im Gegenteil. Er starrte auf die regennasse Fahrbahn, zupfte an ein paar schwarzen Haaren, die unappetitlicherweise aus seiner Nase wucherten, und summte unmelodisch vor sich hin.
Vielleicht muss ich meine Kapuze abnehmen. Sie nahm ihre Kapuze herunter und drehte ihr Gesicht ein wenig in seine Richtung.
Keine Reaktion.
Mein Gott, ist das ein Bauerntrampel! Aber gut. Ich wollte ja ohnehin ein paar ruhige Wochen im Ruhrgebiet verbringen.
Etta ließ sich zurück in ihren Sitz sinken und schaute betont gleichgültig aus dem Fenster. Als sie endlich am Ziel angekommen waren, öffnete sie ihre Handtasche dennoch so, dass einige ihrer Autogrammkarten aus der Tasche rutschten.
Der Fahrer hob die Karten auf. »Ah, Se sind Autogrammsammlerin. Schönes Hobby, doch, doch! Ich selbst sammle ja eigentlich keine Autogramme. Aber eins habe ich mal ungefragt gekriegt, und jetzt raten Se mal, von wem?«
»Was weiß denn ich«, antwortete Etta.
»Da wären Se auch nie drauf gekommen.« Er öffnete die Klappe seines Handschuhfachs, stieß dabei an ihre Knie, ohne sich zu entschuldigen, und zog eine Autogrammkarte heraus. »Ja, da sind Se platt«, sagte er, und hielt ihr eine Postkarte mit einer sichtlich bearbeiteten Fotografie des Mändlers unter die Nase.
Etta hätte fast einen Ganzkörperherpes bekommen. Ausgerechnet der Mändler, dieser selbstverliebte Berufsjugendliche, der so stark geliftet war, dass er wahrscheinlich beim Lachen das Knie heben musste!
»Jetzt gucken Se aber mal, was da draufsteht.« Stolz hielt der Taxifahrer ihr die Karte entgegen. »Da steht: ›Für den lieben Heribert nach einer angenehmen Fahrt durch Dortmund von dem Maxi.‹ Ja, jetzt staunen Se aber. Und das Verrückte war, ich hatte den gar nicht um das Autogramm gebeten. Meine Musik ist dem sein Geträller eigentlich nicht, ich höre lieber Andrea Berg. Die hat ja die wirklich niveauvollen Texte. Der Mändler ist da ja insgesamt eher flach. Aber das konnte er ja nicht wissen, und dann hat er mir die Autogrammkarte einfach so gegeben. Weil der mich so gut leiden mochte. Ich hab den zur Westfalenhalle gefahren, zu ’ner Kinderbenefizgala. Ist doch ’n schöner Zug von ihm, hab ich gedacht, dass er bei so was mitmacht, hab ich gedacht. Dass er so ein großes Herz für Kinder hat. Muss man aber auch verstehen, wo er doch selbst mit ’nem halben Kind zusammen ist. Hahaha, haha, nein, nicht böse sein. War ’n Scherz. Ich gönn dem doch seine Kleine. Aber das Autogramm halte ich in Ehren. Ist vielleicht mal was wert, wenn der so richtig berühmt wird.« Damit reichte er ihr ihre eigenen Autogrammkarten. »Und von wem sammeln Sie Autogramme? Egal? Einfach so blind drauflos? Oder nur von dieser hübschen Dame da? Wer ist das denn eigentlich? Müsste man die kennen?«
Etta spürte, wie ihr heiß wurde. So gelangweilt, wie sie nur eben konnte, antwortete sie: »Ich sammle keine Autogramme. Ich gebe Autogramme. Die Frau auf dem Foto bin ich. Ich bin Schauspielerin, und wenn Sie gestern Abend Tatort geschaut haben, dann haben Sie mich dort gesehen.«
»Ach was«, antwortete Heribert, der fast beste Freund vom Mändler. »Da sind Se ’ne waschechte Schauspielerin. Und beim Tatort arbeiten Se, sagen Se? Dann muss ich Ihnen aber mal was sagen. Wenn Se den nächsten Tatort in Dortmund drehen, dann richten Se Ihren Chefs mal einen schönen Gruß aus, und sagen Se denen mal, dass wir in Dortmund alles andere als begeistert von diesem Scheiß sind, den die sich da immer so zusammendrehen. Als wenn Dortmund nichts weiter wäre als ein dreckiges, drogenverseuchtes Loch mit lauter kriminellen Ausländern und Nazis. Das passt uns hier nicht! Das können Se Ihren feinen Chefs gerne mal von mir ausrichten. Sagen Se denen ruhig ’nen schönen Gruß von Heribert Machowski, das bin ich, und das hier ist mein eigenes Taxi.«
Damit drehte er sich herausfordernd ganz zu Etta. »Und? Ist das sauber, dieses Taxi? Haben Se was auszusetzen an dem Wagen? Oder an mir? Bin ich mit Drogen vollgepumpt, oder spreche ich gebrochen Deutsch, oder bin ich Ihnen an die Wäsche gegangen? Nein, das bin ich nicht. Weil wir Dortmunder anders sind. So, das können Se beim nächstens Tatort mal schön den Herren Chefs ausrichten. Nicht, dass Se mich falsch verstehen. Ich meine, Sie machen ja auch nur Ihre Arbeit. 17,80 macht das. Brauchen Se ’ne Quittung?«
»Ja, bitte.« Mehr fiel Etta dazu nicht ein. Hätte sie sich doch die Aktion mit den Autogrammkarten gespart! Blöde Eitelkeit. »Hier sind zwanzig Euro. Wenn ich noch zehn drauflege: Wären Sie dann so gut, mir die Koffer in die Wohnung zu tragen? Ist auch nur der erste Stock. Danke.«
Ehe Heribert, der fast beste Freund des Mändler, es sich anders überlegen konnte, drückte sie ihm dreißig Euro in die Hand und ging voran Richtung Haustür.
Er wuchtete nacheinander die beiden schweren Koffer die Treppe zu ihrer Wohnung hoch und wischte sich anschließend mit dem Ärmel seiner speckigen Jacke den Schweiß von der Stirn.
»Na denn!«, verabschiedete er sich pathetisch schnaufend. Auf halber Treppe drehte er sich noch einmal herum: »Und nicht vergessen: Beim nächsten Tatort in Dortmund gucken Se den Jungs mal ’n bisschen auf die Finger, damit da nicht wieder so ’n schmuddeliger Mist bei rauskommt. Und wenn Se ein paar schöne Ecken hier in Dortmund zum Drehen suchen, dann sollen Se sich ruhig an mich wenden. Heribert Machowski. Ich fahre euch an Plätze, da werden euch aber de Augen aus dem Kopp fallen, so schön, wie das da ist! Tschüss, die Dame.«
Etta ließ erleichtert die Wohnungstür zufallen. Uff, zu Hause! Zumindest in ihrer zweiten Heimat. Als ihr eigentliches Zuhause betrachtete sie Berlin, wo sie sich in Wedding eine Wohnung mit ihrem Freund Poldi teilte. Dort aber hatte sie sich aus dem Staub machen müssen. Poldi hatte im Herbst geheiratet und sie gefragt, ob sein Mann bei ihnen miteinziehen könne. Ja, was sagt man da als gute Freundin? Natürlich sagt man da Ja. Aber innerlich war sie in sich zusammengesunken. Sie hatte so gar keine Lust, einem Paar – egal, ob schwul oder heterosexuell – bei der Beziehungsführung zu applaudieren. Oder es zu trösten. Je nachdem, wie die Wetterlage in der Beziehung gerade so war.
Etta selbst hatte schon lange keine feste Beziehung mehr gehabt. Eine lockere auch nicht, wenn sie ehrlich war. Nicht, dass sie keine Angebote mehr bekam, aber sie wurden seltener. Und waren in der Regel, das musste Etta sich eingestehen, auch eher scherzhaft.
Natürlich flirteten immer wieder Männer mit ihr. So machte man das in ihrer Branche. Aber die ernst gemeinten Möglichkeiten hatten seit ihrem sechzigsten Geburtstag abgenommen, und der war inzwischen sechs Jahre her.
Etta betrachtete sich im Flurspiegel. Sie sah nicht aus wie Mitte sechzig, und in der Öffentlichkeit wusste niemand über ihr wahres Alter Bescheid. Das hatte sie immer verschwiegen. Zum Glück, denn für Frauen ist es in der Filmbranche ab einem gewissen Alter schwierig. Je älter du wirst, desto unappetitlicher werden die Rollen. Wenn überhaupt noch Angebote kommen. Etta seufzte. Wie oft sie in den letzten Jahren demente, verblühte oder krebskranke Frauen hatte spielen müssen, die tapfer vor sich hin kämpften!
Bei Männern war das anders. Die konnten sich in Falten legen wie ein Plisseerock, die konnten dick werden und bei jeder Bewegung schnaufen, und trotzdem bekamen sie interessante Rollen. Wie oft sich ein seniler Kollege im Film ein attraktives, mittelaltes oder sogar junges Frauchen an Land ziehen konnte! Er durfte in fremden Ländern als Journalist um Gerechtigkeit kämpfen oder ein knarziger Kommissar mit Ecken und Kanten sein. Frauen blieb all dies verwehrt. Dabei hatte sich Etta wirklich gut in Schuss gehalten. Sie war schlank und beweglich – wofür sie ihrer Personal Trainerin Bente sehr dankbar war –, hatte, obwohl sie mit unverschämt dünnem, flusigem Haar geschlagen war, die Haare stets gut frisiert und gefärbt. Und auch für die Bekämpfung von Falten und schlaffer Haut gab sie einiges aus. Mit Erfolg, wie sie selbst fand.
Sie stemmte ihre Hände in die Hüften und drehte sich vor dem Spiegel hin und her. Ihr größtes Kapital waren ihre großen grünen Augen, die einen schönen Kontrast zu ihrem rotbraun gefärbten Haar bildeten. Wenn sie lächelte, hatte sie in der linken Wange ein Grübchen, was ihr etwas Neckisches verlieh. Da sie eher klein geraten war, trug sie stets Schuhe oder Stiefel mit hohen Absätzen, egal, wie sehr ihr Rücken von Zeit zu Zeit dagegen protestierte. Ihre Haut hatte immer noch einen rosigen Schimmer, und wenn sie sich günstig schminkte, fielen ihre Falten kaum auf.
Na gut, heute sah sie etwas benutzt aus, das musste sie zugeben. Das hatte man davon, wenn man quasi im Morgengrauen in den Zug stieg. Etta war keine Frühaufsteherin. Trotzdem hatte sie sich aufgerafft und den Sechs-Uhr-Zug nach Dortmund genommen. So hatte sie dramatischen Abschiedsszenen entgehen können. Dafür sah sie jetzt nicht nur müde, sondern auch ziemlich derangiert aus.
Nun denn … Etta wandte sich ab. Aber dass dieser dämliche Taxi-Heribert mich auf meinem eigenen Foto nicht erkannt hat, bleibt eine Frechheit!
Entschlossen rollte sie ihre Koffer ins Schlafzimmer. Zufrieden stellte sie fest, dass es überall in der Wohnung blitzsauber war und angenehm frisch duftete. Da hatte ihre liebe Frau Pohlmann ganze Arbeit geleistet. Frau Pohlmann kümmerte sich, auch in Zeiten ihrer Abwesenheit, um die Wohnung. Sie machte sauber, versorgte die Blumen, nahm Post aus dem Briefkasten, und wenn sie erfuhr, dass Etta plante zu kommen, kaufte sie auch für sie ein.
Ein Blick in ihren Kühlschrank zeigte Etta, dass ihre Haushaltsfee auch dieses Mal nichts vergessen hatte. Sie nahm sich ein wenig Obst und Gemüse aus dem Long-fresh-Fach und beschloss, sich einen Smoothie zu machen. Sie hatte noch nicht gefrühstückt, und nun, am frühen Vormittag, meldete sich ihr Magen. Um den Smoothie in Ruhe zu trinken, setzte sie sich in ihren Entspannungssessel in ihrem Erker und legte die Beine hoch. Sie liebte diesen Platz. Auch wenn ihr Blick von hier aus nur in den Hinterhof ihres Wohnblocks ging, gab es dort immerhin einen uralten Ahornbaum. Außerdem konnte sie, wenn sie ihrer Neugierde nachgab, auch ziemlich direkt in die Wohnung ihrer Nachbarin sehen, die im rechten Winkel ums Eck wohnte.
Viel wusste Etta nicht über ihre Nachbarn, und eigentlich liebte sie die Anonymität. Ihr Beruf war mit viel Trubel und Aufregung und ständig wechselnden Sozialkontakten verbunden. In Berlin ging sie gern und oft in einschlägige Restaurants, Bars und Künstler-Cafés, wo sie sich sicher sein konnte, den ein oder anderen Kollegen zu treffen oder wenigstens zu sehen. Sehen und gesehen werden – das war das Spiel, und meistens spielte sie es bereitwillig mit.
Aber Dortmund war anders. Um in Dortmund auf offener Straße erkannt zu werden, musstest du schon ein Fußballstar sein oder der Mändler, wie sie seit heute wusste. Sie wäre nie darauf gekommen, sich ausgerechnet hier eine zweite Wohnung einzurichten, wenn sie nicht vor mehr als siebzehn Jahren eine ebenso heiße wie heimliche Affäre mit einem ehemaligen Fußballstar gehabt hätte, der damals eine wichtige Funktion im Vorstand des BVB hatte. Der Mann bestand darauf, dass ihre Affäre unentdeckt blieb, weil er verheiratet war. Ihr war das mehr als recht. Sie wollte nicht mit einem deutlich jüngeren Sportpromi in die Klatschblätter geraten.
Damit sie sich heimlich und unerkannt treffen konnten und nicht auf Hotels angewiesen waren, hatte er die riesige Altbauwohnung in einem der begehrten In-Viertel Dortmunds auf ihren Namen gekauft. Die Beziehung mit diesem Mann war absolut entzückend gewesen, und als sie sich aus Gründen, die sie längst vergessen hatte, im Guten trennten, hatte er gefragt, ob sie die Wohnung nicht ganz übernehmen wollte. Damals verdiente sie noch so gut, dass sie sich die hohen monatlichen Abtragungen durchaus leisten konnte. Außerdem hatte sie zu dem Zeitpunkt bereits gelernt, dass das Leben in einer eher provinziellen Ruhrgebietsstadt mit uneingeschränktem Fußballfimmel für sie viele Vorteile barg. Sie konnte sich vom ewig aufgedrehten Öffentlichkeitshype erholen, war innerhalb kürzester Zeit in Köln, und – das war das Wichtigste – sie hatte inzwischen in der Nähe für ihre zunehmend dement werdende Mutter eine wunderschöne Altersresidenz gefunden.
Etta nippte an ihrem Smoothie und schloss die Augen. Nun rächte sich ihr früher Aufbruch aus Berlin. Sie war gerädert und merkte, dass ihr Schlaf fehlte. Der Nieselregen hatte sich mittlerweile in einen ausgewachsenen Schneeregen verwandelt, doch ihre Wohnung war warm, und als sie den Smoothie ausgetrunken hatte, döste sie ein wenig vor sich hin.
Von draußen hörte sie ein regelmäßiges Tropfen. Vielleicht war die Dachrinne nicht ganz dicht. Während sie in einen leichten Schlaf glitt, sah sie vor ihrem inneren Auge noch einmal das schwarze Haar, das aus dem Nasenloch des Taxifahrers gequollen war wie die zerfaserten Reste eines Topfschwamms.
Sie schreckte hoch, als es an ihrer Tür klingelte. Da sie niemanden erwartete, beschloss sie kurzerhand, nicht zu öffnen. Aber das Klingeln wurde penetranter.
Seufzend erhob sie sich nun doch aus ihrem Sessel und drückte den Türöffner. Eilige Schritte auf der Treppe waren zu hören. Sie sah durch den Spion an ihrer Wohnungstür und traute ihren Augen nicht. Das war doch wieder dieser stumpfe, nasenhaarige Taxifahrer. Dieser Heribert! Was wollte der denn bei ihr?
Da sie die Wohnungstür nicht sofort öffnete, klopfte er energisch und rief: »Hallo? Hallo! Gute Frau, machen Sie auf, ich hab was für Sie.«
Oh Gott, will er mir vielleicht sein scheußliches Mändler-Autogramm schenken?, dachte sie und öffnete die Tür einen winzigen Spalt.
»Keine Angst, ich bin es nur. Der Heri, Ihr Taxifahrer. Ich glaube, Se haben Ihr Smartphone im Sitz liegen lassen. Gucken Se doch mal, ob das Ihres ist.« Damit hielt er ihr ein Handy durch den Türschlitz.
Etta öffnete die Tür nun ganz. Tatsächlich, das war ihr Telefon. Wie hatte sie das nur verlieren können? Und vor allem: Wie hatte sie das noch nicht mal bemerken können? Dankbar nahm sie es entgegen.
»Das ist aber furchtbar nett von Ihnen, Herr Heribert«, sagte sie und steckte ihr Smartphone erleichtert in ihre Rocktasche.
»Das ist doch ’ne Selbstverständlichkeit, gute Frau«, antwortete Heribert. »Wir sind eben ein durch und durch ehrliches Völkchen, hier in Dortmund. Nichts für ungut, aber das können Se ja den Herren Chefs vom Tatort vielleicht auch noch erzählen. Wie vertrauenswürdig hier bei uns auch die Taxifahrer sind. Ich bin jetzt schon gespannt, ob’s was bringt, wenn Se den Herren mal Bescheid stoßen. Den nächsten Tatort aus Dortmund, den gucke ich ganz bestimmt. Se können mir ja mal zuzwinkern. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.« Er tippte sich an die Stirn und schickte sich an, die Treppe hinunterzulaufen.
»Halt!«, sagte Etta. »Nicht so eilig. Lassen Sie mich Ihnen wenigstens einen kleinen Finderlohn geben.«
Sie wollte sich umdrehen, um nach ihrer Handtasche zu suchen, aber Heribert unterbrach sie: »Nicht nötig, gute Frau. Machen Se einfach, dass der Dortmunder Tatort besser wird, das wäre mir mehr wert. Und jetzt muss ich machen …« Eilig lief er die Treppe hinunter.
Ach, du guter Gott! Jetzt guckt der arme Kerl den nächsten Dortmund–Tatort und denkt ernsthaft, ausgerechnet ich hätte Einfluss auf die Handlung und das Setting. Etta runzelte die Stirn. Hoffentlich steige ich nie wieder versehentlich ausgerechnet in Heriberts Taxi, sonst macht der mich total zur Schnecke.
Aber dass sie ihr Handy wiederhatte, war fantastisch. Nur, dass sie es überhaupt hatte liegen lassen, machte ihr zu schaffen.
Hoffentlich werde ich nicht langsam tüdelig, so hat es damals bei Mama auch angefangen, dachte sie und versuchte, sich zu beruhigen. Jeder ließ ja wohl mal etwas liegen. Und letztlich war es doch eigentlich auch nur ein positives Zeichen, wie wenig abhängig sie sich von ihrem Handy fühlte.
Sie schaltete ihr Telefon ein und ging in die Küche, um sich einen Kaffee aus ihrer teuren Maschine zu ziehen. Während die Maschine aufheizte, kontrollierte sie ihre Mailbox.
Siebzehn Anrufe in Abwesenheit. Na, das war ja toll. Ausgerechnet heute war sie offensichtlich höchst gefragt.
Während der Kaffee in ihre Tasse plätscherte, schaute sie nach, wer angerufen hatte.
Zweimal Poldi. Gut, der wollte wissen, ob sie gut angekommen war. Dann stutzte sie. Vierzehn Anrufe aus Eikes Büro!
Eike war ihr Agent, ein guter Freund und, ja, das auch: ein früherer Liebhaber. Aber das war lang her. Sehr lang. Davon waren nur ihre Freundschaft und die außergewöhnlich enge Zusammenarbeit übrig geblieben. Bestimmt wollte er mit ihr über das Drehbuch sprechen, das er ihr vor etlichen Tagen gemailt hatte. Sie hatte es mit wenig Begeisterung gelesen. Wieder die Rolle einer alten kranken Frau, die ihrem großartigen umtriebigen Ehemann hinterherjammert, der sie für eine Jüngere verlassen hat! Originell wie eine Packung Knäckebrot.
Etta hatte extrem wenig Lust auf diese Rolle – aber sie musste schließlich Geld verdienen. Und wenn Eike schon so oft versucht hatte, sie zu erreichen, schien es dringend zu sein.
Sie schnappte sich die Kaffeetasse und ging mit Kaffee und Handy bewaffnet wieder zu ihrem Relaxsessel im Erker. Sie ließ sich nieder, nippte an dem herrlich heißen und starken Kaffee und drückte die Rückruftaste.
Während sie dem Freizeichen lauschte, sah sie aus dem Augenwinkel, wie ihre langjährige Nachbarin in der Wohnung gegenüber ebenfalls telefonierend auf und ab ging.
* * *
Dani Dies bemerkte nicht, dass sie beobachtet wurde. Es wäre ihr auch gleichgültig gewesen. Jedenfalls in diesem Moment. Normalerweise genoss sie die seltsame anonyme Freundschaft, die sie mit ihrer Nachbarin verband.
Schon seit mehr als fünfzehn Jahren hatten sie ihre Wohnungen über Eck. Beide waren sie Nachteulen, und sie hatten einander oft bei einem letzten Absacker durch die Scheiben mit Rotwein zugeprostet. Dani war sich ziemlich sicher zu wissen, wer ihre Nachbarin war. Auch wenn der Name Iravani an der Klingel stand.
Ja, auch wenn es albern war, hatte Dani irgendwann einmal das Klingelschild ihrer Nachbarin inspiziert. Der Name darauf passte nicht, aber davon abgesehen war sie sich so gut wie sicher, dass es sich bei der Frau um Etta Glück handelte, die Schauspielerin. Auch das Verhalten passte zu einer etwas exzentrischen Künstlerin. Manchmal hatte Dani nachts gesehen, wie ihre Nachbarin ganz allein durch die riesige Wohnung tanzte.
Danis Wohnung war deutlich kleiner. Aber das störte sie nicht. Sie liebte ihre kleine sonnendurchflutete Wohnung. Es war nicht leicht gewesen, hier überhaupt eine bezahlbare Wohnung zu ergattern, da der Stadtteil so beliebt war. Hier lebten Lehrer, Architekten, Ärzte, Freaks, Musiker, Künstler und Lebenskünstler bunt durcheinander. Früher waren viele der wunderschönen Altbauten heruntergekommen gewesen. Doch nach und nach war die ehemalige Polit- und Besetzerszene zu Geld gekommen und in gut bezahlten Berufen gelandet. Investoren hatten ganze Häuserzeilen gekauft und edel saniert, und auch viele der ehemaligen Besetzer und Freaks hatten sich ihre eigene Wohnung oder sogar ein ganzes Haus gekauft. Dafür musste man allerdings gute und zuverlässige Kohle verdienen.
Dani verdiente seit zwanzig Jahren als freiberufliche Solo-Komikerin nicht schlecht. Zum Kauf einer Immobilie hatte es zwar nicht gereicht. Es hatte ihr aber auch nie gefehlt. Sie war glücklich, dass sie sich ihre wunderschöne Wohnung und ein freies und sorgenfreies Leben leisten und sich ein kleines finanzielles Polster zulegen konnte, um mögliche Krisen im Job oder etwaige Erkrankungen überbrücken zu können. Bis gestern hätte sie ihr Leben deshalb als nahezu perfekt bezeichnet.
Heute aber, an diesem verregneten, graukalten 10. März, konnte davon keine Rede mehr sein.
Das Unglück hatte gestern Abend seinen Lauf genommen. Zusammen mit Franz war sie in der Nähe von Frankfurt gewesen, wo sie einen Auftritt mit ihrem neuen Chanson-Programm hatte. Franz war ihr langjähriger Tourtechniker und inzwischen so etwas wie ein guter Freund. Er war still, kompetent, zuverlässig – und stand bedingungslos auf ihrer Seite. Liefen Auftritte einmal nicht so, wie sie sollten, wusste Franz sie zu trösten. Dann lästerten sie auf der nächtlichen Rückfahrt im Auto gern ein bisschen über das lahme Publikum oder den doofen Veranstalter, und danach war wieder alles gut.
Gestern aber hatte es weder an einem sperrigen Publikum noch am Veranstalter gelegen, dass der Auftritt kein Erfolg war. Das neue Programm, das Dani nun seit drei Wochen spielte, war alles andere als beliebt. Auch gestern hatte der Kartenvorverkauf sehr zu wünschen übriggelassen, und an der Abendkasse hatte sich nicht mehr viel getan. Das war für die erfolgsverwöhnte Dani der erste Schock.
Möglicherweise hatten sich ihre Fans von den verheerenden Kritiken abschrecken lassen, oder es war genau das eingetreten, was ihre Agentin Paula schon seit Monaten hatte kommen sehen. Immer und immer wieder hatte sie Dani bekniet, sich von der Idee eines Chanson-Programms zu verabschieden. »Die Leute wollen lachen und dich nicht singen hören, Mädel! Was soll dieser Blödsinn? Never change a winning team. Das ist das eiserne Gesetz. Mach ein schönes, lustiges Wortprogramm, und leb deine verflixte, verspätete Midlifecrisis gefälligst privat aus.«
Wie es schien, hatte Paula recht behalten. Doch das half Dani jetzt nicht. Sie war schon immer ein Dickschädel gewesen, und sie war den Zwang, lustig sein zu müssen, einfach leid. Sie liebte es zu singen und hatte ein heimliches Faible für alte Schlager und Chansons. Also hatte sie sich zu ihrem sechzigsten Geburtstag eine kleine Extratour gegönnt, sich eine Pianistin gesucht, Lieder zusammengestellt, die mit ihrem begrenzten Stimmumfang machbar waren, und hatte sich mit Feuereifer in ihr neues Projekt gestürzt. Die Premiere im Februar war noch gut besucht gewesen. Aber dann kamen erst die schlechten Kritiken und danach die Einbrüche beim Kartenverkauf.
Der gestrige Auftritt in der schlecht geheizten Mehrzweckhalle eines hessischen Kaffs war der traurigste gewesen. Die wenigen Zuschauer hatten nur verhalten applaudiert, und eine Zugabe hatten sie auch nicht gefordert. Beklommen und schweigend hatten Franz und Dani danach ihre sieben Sachen zusammengesucht, während sich ihre Pianistin mit einem Schulterzucken verabschiedet hatte, um ins Hotel zu gehen.
Franz und Dani hatte ein Blickwechsel gereicht, um zu entscheiden, dass sie noch nach Hause fahren würden. Es gibt nach einem unerfreulichen Abend nun einmal nichts Besseres, als sich ins eigene Bett zu kuscheln und dort die Wunden zu lecken.
Sie hatten gerade das Auto fertig beladen, als der Veranstalter sie noch zu sich bat. »Ich will Sie ja nicht verletzen, aber das war leider so gar nicht das, was ich erwartet habe«, kam er direkt zur Sache. »Das Publikum sieht das offenbar ähnlich. Was ist denn in Sie gefahren, dass Sie so sehr von Ihrer gewohnten Linie abweichen?« Er räusperte sich und sah Dani kurz so an wie früher ihr Lateinlehrer, wenn sie einen Vokabeltest verhauen hatte. »Frau Dies, ich meine es wirklich gut mit Ihnen.«
Vor lauter Eifer war sein seltsames Toupet leicht verrutscht, und weiße Speichelreste hatten sich in seinem Mundwinkel gesammelt. Er beugte sich vor und tätschelte Danis Knie. »Frau Dies, haben Sie vielleicht eine Lebenskrise? Sie waren doch immer so eine lustige und – wenn ich das als Mann sagen darf – attraktive, fröhliche Frau. Dieses unfröhliche Gezwitscher passt doch gar nicht zu Ihnen.«
Seine Hände waren weich, matschig und feucht. Sein Atem roch nach Mottenkugeln. Dani wurde es regelrecht übel. Gerade wollte sie ansetzen, diese unattraktive Kulturkröte in die Schranken zu weisen, als Franz ihr resolut zu Hilfe kam.
Er klapperte mit dem Autoschlüssel, räusperte sich und fragte: »Können wir dann mal? Dani, du bist müde, das sehe ich. Den Rest könnt ihr morgen telefonisch mit der Agentin besprechen.«
Dani atmete auf. In solchen Dingen war Franz klasse. Wurde ein Veranstalter oder ein Pressefritze übergriffig, konnte er für seine Verhältnisse sehr deutlich werden. Manche hielten Franz deshalb für Danis Lebensgefährten, und sie klärten den Irrtum nie auf – obwohl Franz seit mehr als zwanzig Jahren in festen Händen und Dani an ihm als Mann nie interessiert gewesen war.
Der Veranstalter runzelte verärgert die Brauen. »Eine Sache muss ich aber noch ansprechen.« Er nahm seine dicke Patschhand von Danis Knie und lehnte sich zurück. »Mit Ihrer Gage, Frau Dies, werden Sie mir dieses Mal entgegenkommen müssen. Ich habe nicht einmal die Hälfte davon eingenommen. Da müssen wir einen Kompromiss finden, sonst fahre ich Verluste ein, und das kann ich mir nicht leisten. Sie wollen bestimmt auch nicht, dass meine Kleinkunstreihe scheitert und ich Sie demnächst, wenn Sie endlich wieder etwas Fröhliches zu bieten haben, nicht mehr buchen kann.«
Dani war perplex. Da versuchte diese widerliche, schmierige Ratte doch tatsächlich, sie mit der Gage zu drücken! Und das, obwohl sie ihm nun schon seit fünfzehn Jahren regelmäßig den Saal knallvoll machte und er dicke Gewinne eingestrichen hatte.
Bevor sie irgendetwas sagen konnte, zog Franz sie von ihrem Stuhl. »Wir fahren jetzt. Auch Gagenverhandlungen sind ausschließlich Angelegenheit der Agentur. Gute Nacht.«
Sie hätte vor Dankbarkeit heulen können.
Als sie wenig später im dunklen, kalten Auto saßen, sagte keiner ein Wort. Dani saß am Steuer. Sie fuhr gerne nachts, während Franz zumeist auf der Hinfahrt das Steuer übernahm und anders als sie um diese Uhrzeit müde war.
Die Stille zwischen ihnen hatte etwas Bedrückendes. Der Scheibenwischer surrte rhythmisch, und die emotionslose Stimme des Navis gab die Richtung vor. Sie waren bereits auf der Höhe von Siegen, und Dani dachte schon, Franz sei eingeschlafen, als er auf einmal sagte: »Was ein Arsch!«
Dani schwieg zunächst, wechselte auf die rechte Spur und sagte dann leise: »Ganz unrecht hat er allerdings nicht. Alle buchen mich, weil sie davon ausgehen, dass mein neues Programm genauso unterhaltsam ist wie die davor. Stattdessen bekommen sie eine Mogelpackung. Die Veranstalter wären mit Sicherheit begeistert, wenn Publikum und Presse es auch wären. Aber die sind es nicht … Ich hätte auf Paula hören sollen.«
Auch darauf sagte Franz nichts.
Dani schaute auf den Tacho. Sie wusste, dass man in solchen Situationen zu Raserei und aggressiver Fahrweise neigte, und fuhr deshalb bewusst langsam. Auf der linken Spur sausten die anderen Autos an ihr vorbei, und die Reifen machten auf der nassen Fahrbahn ein schmatzendes Geräusch.
Schließlich seufzte Franz. »Solche Phasen, Dani, muss man einfach aussitzen. Was glaubst du, wie oft ich in meinem Leben schon in Situationen gesteckt habe, wo ich gedacht habe, da komme ich nicht wieder raus. Häufig lösen sich die Probleme mit der Zeit von ganz allein. Jedenfalls die meisten.«
Dani wusste genau, worauf seine letzte Bemerkung abzielte. Franz war ein wunderbarer Mensch, feinfühlig, loyal und ein hervorragender Techniker. Und seit Jahren in einer komplizierten Beziehung mit Eleni gefangen.
Eleni war Griechin und besaß einen Imbiss, den sie von ihren Eltern geerbt hatte. Sie arbeitete viel und wusste genau, was sie wollte. Das Problem war ihr überbordendes Temperament. Sie war, schlicht gesagt, ein furchtbares Donnerwetter. Immer wieder hatte Dani mitbekommen, wie sie Franz am Telefon oder auch von Angesicht zu Angesicht angeschrien hatte. Manchmal beschimpfte sie ihn als Techniknerd und Langweiler; sie hatte ihm auch schon vorgeworfen, sich einen feuchten Kehricht um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Franz blieb dabei meist ruhig. Aber ganz prallten Elenis Attacken nicht an ihm ab, und er hatte schon etliche Male versucht, sich von Eleni zu trennen. Er war jedoch immer wieder zu ihr zurückgekehrt.
Dani seufzte nun ebenfalls. In der Dynamik von Beziehungen gab es einfach Geheimnisse, die man von außen nicht entschlüsseln konnte. Vielleicht war der Sex mit Eleni so traumhaft, dass er Franz für den restlichen Stress entschädigte.
Leise sagte sie in die Dunkelheit: »Ich bin anders als du, Franz. Ich halte nichts einfach so lange aus, bis es wieder besser ist. Ich glaube auch nicht daran, dass irgendetwas von allein besser wird. Ich muss mir was einfallen lassen. Sonst stecken wir beide mächtig in der Klemme. Vielleicht modle ich mein neues Programm ein bisschen um. Was weiß ich … ein paar alte, lustige Nummern zwischen die Lieder schieben oder so. Vielleicht merkt das Publikum dann nicht so, dass es anders ist. Wie bisher geht es jedenfalls nicht weiter. Stell dir vor, ich fahr die Geschäfte mit meinem Dickschädel so vor die Wand, dass wir beide kein Geld mehr verdienen. Dann müsstest du am Ende doch bei Eleni im Grill mitarbeiten, und das willst du bestimmt nicht.«
Franz zog scharf die Luft ein.
Dani wusste, dass es für ihn eine Horrorvorstellung war, im Imbiss zu arbeiten. Obwohl Eleni ihm damit schon seit Jahren in den Ohren lag, weil ihre Hüftprobleme immer schlimmer wurden und die Arbeit für sie allein zu anstrengend, hatte Franz sich stets herausgewunden. Er ekelte sich vor dem Geruch des Frittenfetts – und liebte und brauchte seine Ruhe. Die aber hatte er nur, wenn er mit Dani auf Tour war.
Plötzlich drehte sich Franz in Danis Richtung. Sie konnte im Dunkeln spüren, dass er sich einen Ruck gab, bevor er anfing zu sprechen. »Dani, ich weiß, dass der Zeitpunkt nicht schlechter sein könnte, aber ich muss dir was sagen.«
Dani spürte einen spitzen Schmerz im Brustraum und bekam sofort feuchte Hände. Nein, bitte nicht! Bitte, lass ihn jetzt nicht kündigen! Bitte, er darf mich nicht ausgerechnet jetzt im Stich lassen!
»Ich … also … Es ist so …«
Franz stammelte normalerweise nicht. Nie! Dani machte sich auf das Schlimmste gefasst.
»Also, ich wollte dich eigentlich fragen, Dani, ob ich für eine Weile bei dir wohnen kann.« Franz stieß einen lauten Seufzer aus. Bestimmt hatte es ihn Überwindung gekostet, um diesen Gefallen zu bitten. »Es ist so, dass es zwischen Eleni und mir in der letzten Zeit immer wieder zum Äußersten gekommen ist, und ich kann einfach nicht anders … Ich muss jetzt einen Schlussstrich ziehen. Sonst eskaliert das Ganze und wird gefährlich.«
»Oh Gott! Das tut mir leid!« Dani war voller Mitgefühl. »Du hast Eleni nicht geschlagen, oder?«
»Nein, im Gegenteil«, sagte Franz, und an seinem Ton konnte sie merken, wie unangenehm es ihm war.
Dennoch war sie entsetzt. »Was willst du damit sagen? Umgekehrt? Wie meinst du das? Du willst mir doch nicht etwa sagen, dass Eleni dich … Das glaube ich jetzt nicht! Eleni schlägt dich? Ehrlich? Aber da kann sich ein Mann doch wehren. Das kann doch nicht –«
»Natürlich könnte ich mich wehren«, fiel Franz ihr ins Wort. »Aber genau das will ich um jeden Preis vermeiden. Bisher habe ich es geschafft, sie nur festzuhalten, wenn ihr die Sicherungen durchgebrannt sind. Aber sie schaukelt sich immer weiter hoch und wirft mit Sachen nach mir. Gestern hat sie einen großen Topf nach mir geworfen und mich nur knapp verfehlt. Das geht nicht mehr lange gut. Sie müsste in Therapie, aber wenn ich ihr das sage, rastet sie komplett aus. Ich muss da weg. Und wir müssen unbedingt vor ihr geheim halten, wohin ich mich geflüchtet habe. Sonst hast auch du noch Stress mit ihr. Ich suche mir auch ganz schnell was Eigenes, versprochen. Aber für die erste Zeit –«
»Natürlich kannst du bei mir bleiben.« Dani war erleichtert und alarmiert zugleich: erleichtert, weil Franz nicht kündigte, und alarmiert, weil er in der letzten Zeit offensichtlich schlimme Dinge ausgehalten hatte, ohne sie ins Vertrauen zu ziehen.
»Franz, ich unterstütze dich, wo ich nur kann«, sagte sie und wagte einen kurzen Blick auf ihn. »Versprochen. Eleni wird sich zwar bestimmt denken, dass du bei mir bist, aber mach dir darum keinen Kopf. Wenn sie mir deshalb die Hölle heiß macht, dann komme ich damit zurecht. Das Wichtigste ist jetzt erst einmal, dass du aus diesem Wahnsinn rauskommst. Meine Couch ist bequem und steht dir zur Verfügung. Und morgen rufe ich Paula an und sage ihr, dass ich mein Programm ändere. Dann wird alles gut. Bestimmt.«
»Danke«, sagte Franz leise. Seine Stimme war belegt, und Dani fragte sich, ob er im Schutz des dunklen Autos heimlich weinte.
* * *
Franz erwachte mit starken Rückenschmerzen. Ohne die Augen zu öffnen, hörte er, dass es draußen regnete. Er drehte sich auf den Rücken und lauschte, ob Dani schon aufgestanden war. Ja, sie sprach leise im Nebenraum, telefonierte wahrscheinlich. Normalerweise, das wusste er, ging sie jeden Morgen eine halbe Stunde joggen, bevor sie duschte und sich den ersten Kaffee kochte. Er hatte aber nichts gehört. Entweder war er gegen Morgen doch noch fest eingeschlafen, oder Dani war so mit ihrer vertrackten Lage beschäftigt, dass sie sich zum Joggen nicht hatte aufraffen können.
Durch die zugezogenen Vorhänge kam nur wenig Licht, und Franz ließ seinen Blick langsam durch das dämmrige Zimmer schweifen. Es war vollgestopft, ein wenig chaotisch und roch nach Danis Parfüm. Franz liebte Ordnung und zurückhaltende Farben, doch Dani war anders. Ihre bunte, fast schrille Einrichtung wirkte im Hellen auf ihn nicht sehr ästhetisch, war jetzt im Halbdunkel aber einigermaßen erträglich.
Franz’ Blick blieb an der offenen Tür eines Kleiderschranks hängen. Er hatte noch nie bei Dani übernachtet, denn Eleni neigte zu furchtbarer Eifersucht. Es hatte ihr schon immer mächtig gestunken, wenn er und Dani mehrere Tage, manchmal sogar Wochen am Stück auf Tour waren. Zwar buchte Dani stets Einzelzimmer, aber Eleni hatte ihm dennoch immer wieder eine Affäre mit Dani unterstellt.
Völlig abwegig war die Idee nicht, denn Dani war nett, lustig, lebensfroh und auf ihre Art durchaus attraktiv. Hochgewachsen und knochig, wie sie war, wirkte sie mit ihren kurz geschnittenen roten Haaren, dem breiten Mund, den blitzenden blauen Augen und dem ganzen Gesicht voller Sommersprossen wie eine erwachsene Pipi Langstrumpf. Ähnlich selbstbewusst war sie auch. Doch genau das war der Grund, warum er sich für sie als Frau nie interessiert hatte. Von selbstbewussten Frauen fühlte er sich immer schnell an die Wand gedrängt.
Auch Eleni war ihm eher passiert, so wie eigentlich alle Frauen in seinem Leben. Er fühlte sich selbst nicht begehrenswert und hätte sich nie getraut, aktiv um eine Frau zu werben. Ob ihm die selbstbewusste Eleni damals gefallen hatte, konnte er nicht genau sagen. Als sie sich kennenlernten und näherkamen, befand er sich gerade in einer sehr seltsamen Lebensphase: Seit dem Tod seiner Mutter lebte er allein im Haus seiner Eltern. Mehr aus Pflichtgefühl denn aus Begeisterung betrieb er den Laden für Radio- und Fernsehgeräte, den sein Vater seinerzeit aufgebaut und den er auf Wunsch seiner Mutter nach dessen Tod weitergeführt hatte.
Seine Mutter war lange depressiv gewesen, und obwohl ihn alles in die Ferne zog, hatte er sich nicht getraut, sie alleinzulassen. Die Geschäfte liefen schlecht. Franz war kein Geschäftsmann, und die Radio- und Fernsehbranche befand sich in einem großen Umbruch. Da hätte jemand mit Elan und Begeisterung den Laden umkrempeln müssen.
Als seine Mutter starb, war er insgeheim erleichtert, dass das quälende Zusammenleben mit ihr ein Ende gefunden hatte, und schämte sich zugleich für dieses Gefühl. Auch fehlte ihm jede Idee, was er mit seiner neuen Freiheit anfangen sollte. Natürlich war er auch traurig, das war ja klar. Dazu quälten ihn Schuldgefühle. Hätte er seiner Mutter helfen können, wenn er mit mehr Nachdruck auf einen anderen Arzt oder Psychologen bestanden hätte? Hatte sie die vielen Tabletten am Tag ihres Todes absichtlich genommen oder aus Versehen? An welchem Punkt ihres Lebens hätte er noch eine Chance gehabt, ihr aus ihrer Depression herauszuhelfen?
Damals war er fast jeden Tag zum Essen in den griechischen Grill nebenan gegangen. Eigentlich mochte er weder Gyros noch Tsatsiki, und schon gar keine Pommes frites. Aber so antriebsarm und kraftlos, wie er war, erschien ihm der kürzeste Weg als der einzig machbare. Weil er fast täglich im Akropolis aß, blieb es ihm nicht verborgen, dass es zwischen Alexandros und Eleni – dem Besitzerehepaar – häufig zu heftigem Streit kam. Worüber sie sich lautstark auf Griechisch stritten, verstand er zum Glück nicht. Sein eigenes Leben war zu dieser Zeit kompliziert genug. Da wollte er sich in das Leben anderer nicht unbedingt einmischen.
Eines Abends aber hatte er beim Betreten einen verwaisten Imbiss vorgefunden. Er wollte gerade wieder gehen, als er hinter dem Verkaufstresen ein erbärmliches Wimmern und Schluchzen hörte. »Hallo?«, hatte er vorsichtig gefragt. Und noch einmal: »Hallo?«
Schließlich hatte Eleni sich erhoben. Sie hatte furchtbar ausgesehen: verquollen, verheult und verzweifelt. »Heute kannst du hier nicht essen, Franz«, hatte sie gejammert. »Ich bin fertig. Ganz und gar fertig. Ich habe mein Leben vor die Wand gefahren, verstehst du?«
Wenn Franz irgendetwas zutiefst verstand, dann das Gefühl, sein Leben vor die Wand gefahren zu haben. Außerdem hatte er ein mitleidiges Herz, und mit weinenden Frauen kannte er sich auch aus. Darum sagte er selbstbewusster, als es sonst seine Art war: »Komm, schließ die Tür ab, und dann setz dich hin. Was du brauchst, ist ein Ouzo. Und dann erzählst du mir, was los ist.«
Welch schicksalhafte Entscheidung! Er hätte gehen sollen, einfach murmeln: »Ich komme ein andres Mal wieder«, aber so war Franz nicht.
Also hatte Eleni geredet, und sie hatten Ouzo getrunken. Eher eine Flasche als ein Glas. Eleni hatte erzählt, dass Alexandros sie verlassen und ihre gemeinsamen Söhne mitgenommen hatte. »Nach Griechenland, zu seiner Familie. Ende. Aus.«
Franz hatte versucht, sie zu trösten, und sie hatte weiter geheult und getrunken, und er hatte weiter getröstet und mitgetrunken – und als er am nächsten Mittag mit einem ausgewachsenen Kater in ihrem Bett aufwachte, war ihm sofort klar, dass er eventuell einen Fehler gemacht hatte. Wieder einmal.
All dies ging ihm nun, in Danis überfülltem Zimmer durch den Kopf. Und noch eine andere Geschichte kam ihm in den Sinn:
Vor vielen Jahren hatte er mit Eleni auf Antiparos Urlaub gemacht. Es war Herbst gewesen, und der größte Touristenansturm war längst vorbei. Eine Cousine von Eleni betrieb auf der Insel eine kleine Pension, wo sie unterkamen. Franz erinnerte sich nicht genau, nahm aber an, dass Eleni und er damals wieder einmal versucht hatten, Ordnung und Ruhe in ihre Beziehung zu bringen. Er hatte die Insel gemocht, aber der Beziehung hatte der Urlaub nicht geholfen. Eleni war aufgeblüht und hatte es sichtlich genossen, sich endlich einmal wieder ins griechische Leben zu stürzen. Sie hatte mit ihrer Cousine in der Sprache ihrer Heimat gesprochen, und er, der außer den üblichen Touristenfloskeln kein Griechisch konnte, hatte sich ausgeschlossen gefühlt. Abends war er zumeist die einzige Hauptstraße der Insel hinuntergeschlendert und auf der Platia gelandet. Dort gab es einen großen alten Baum, in dem Hunderte von Spatzen saßen und wild und fröhlich lärmten. Im Schatten dieses Baums hatte er mit einigen Inselbewohnern Wein getrunken und Tavli, ein Brettspiel, gespielt. Sie hatten schweigend getrunken und gespielt und sich ab und zu anerkennend auf die Schulter geklopft. Dafür war nicht viel Griechisch erforderlich.
Am Rande des Platzes hatten einige Jungs jeden Abend Fußball gespielt. Immer wenn ihr Ball versehentlich in den Spatzenbaum gekracht war, waren Hunderte von Vögeln aufgeregt schimpfend aufgeflogen.
Genauso wild und ungeordnet kam Franz das Durcheinander in seinem Kopf vor. Er schaute auf sein Handy. Kurz vor elf. Eleni hatte mit Sicherheit noch keinen Verdacht geschöpft. Eigentlich hätte er die letzte Nacht im Taunus verbracht und wäre heute von dort mit Dani direkt nach Siegburg weitergefahren, wo der nächste Auftritt gebucht war. Eleni würde ihn also frühestens heute Nacht erwarten.
Trotzdem wusste er, dass er vorher mit ihr sprechen sollte. Einfach nicht nach Hause zu kommen war gemein. Sie würde sich Sorgen machen, und das wollte er nicht. Sowieso wäre es ihm am liebsten, wenn die Trennung möglichst friedlich verlief. Er wollte endlich seine Ruhe haben und nicht mehr Elenis unberechenbaren Attacken und dem ständigen Streit ausgeliefert sein.
Er seufzte. Der Wunsch nach einer friedlichen Trennung gehörte ins Land der Illusionen. Eleni würde toben, ihn suchen, zu verhandeln versuchen, ihm schmeicheln – und Druck machen. Er kannte das schon. Schließlich war es nicht sein erster Versuch, sich aus ihrem Leben davonzustehlen.
Diesmal ist es endgültig, schwor er sich. Trotzdem war es strategisch vielleicht günstig, ihr im Laufe des Tages schon einmal zu schreiben. Dann konnte sie toben, wie sie wollte, während er mit Dani nach Siegburg fuhr. Und wenn Eleni morgen hier aufkreuzen sollte, um ihn zurückzuholen, würde er sich weigern, mit ihr zu reden. Oder er würde ihr sagen, er sei nur bereit, mit ihr zu sprechen, wenn sie ruhig und sachlich … Wobei das lächerlich war. Eleni konnte einfach nicht ruhig und sachlich bleiben.
Vielleicht wäre es doch besser, seinen Freund Udo zu fragen, ob er vorübergehend bei ihm unterkommen könnte. Aber Udo war mit Evi zusammen, die Franz nicht ausstehen konnte. Und dann würde er wieder unter der Fuchtel einer schlecht gelaunten Frau leben müssen …
Franz schüttelte sich. Der Sturm in seinem Kopf kam einfach nicht zur Ruhe.
Dani hatte bestimmt nichts dagegen, wenn er jetzt aufstand und für sie und sich einen Kaffee kochte. So gut kannte er sich in ihrer Küche aus. Und wenn Dani noch joggen wollte, dann konnte sie das ja auch nach ihrem Kaffee noch tun.
Franz stand auf, zog sich seinen Hoody über und ging leise Richtung Bad, wo er sich im Badezimmerspiegel musterte. Seine grauen Locken, die langsam dünner wurden, standen wild vom Kopf ab. Er war schon immer blass, aber heute sah er aus wie ein Gespenst, und die Ränder unter seinen Augen zeugten von seiner fast schlaflosen Nacht. Eilig spritzte er sich ein paar Spritzer kaltes Wasser ins Gesicht, trocknete sich mit dem Handtuch ab, das Dani ihm letzte Nacht gegeben hatte, und schlich in die Küche.
Dort prallte er regelrecht zurück. Dani saß am Küchentisch, den Kopf in die Hände gestützt. Vor ihr stand eine Tasse mit irgendeinem Gebräu, das ekelhaft nach gesund oder doch eher nach krank roch.
Als sie ihn sah, hob sie den Kopf und lächelte kläglich. »Sorry, wollte dich nicht wecken.«
»Um Gottes willen, was ist denn mit deiner Stimme passiert?« Franz war schlagartig klar, dass Dani so heute auf keiner Bühne stehen konnte.
»Selbstboykott, Akt zwei«, krächzte sie. »Halsentzündung. Da ist nichts mit Programm ändern und Schaden begrenzen.« Sie versuchte, sich zu räuspern. Das Sprechen fiel ihr ganz offensichtlich schwer. »Da werden wir erst mal alles absagen müssen. Was für eine Scheiße! Paula bringt mich um.«
»Jetzt mach mal halblang«, versuchte Franz, sie zu trösten. »Du kannst doch nichts dafür, dass du ’ne Erkältung hast. Hast du Paula schon benachrichtigt? Die heutige Vorstellungen zumindest muss ja so schnell wie möglich abgesagt werden.«
»Ich hab mich noch nicht getraut. Ich hab gehofft, durch dieses ekelhafte Gesöff könnte ich meinen Hals vielleicht versöhnen.« Sie zeigte auf die Teetasse.
Franz grinste schief. Er kannte Dani gut genug, um zu wissen, dass ihre berüchtigten Halsentzündungen immer etwas Längerfristiges waren.
»Ich koche uns mal lieber einen Kaffee. Ist ja keinem geholfen, wenn du auch noch kotzen musst«, sagte er, nahm ihr die Tasse weg und kippte den Inhalt ins Waschbecken. Während er sich an der Kaffeemaschine zu schaffen machte, sagte er über die Schulter: »Wenn du willst, rufe ich Paula an. Schließlich hast du keine Stimme.«
Sie wussten beide, dass Dani sich darauf nicht einlassen würde. Immerhin ging es bei dem anstehenden Telefonat keineswegs nur um die Halsentzündung und die deshalb nötigen Terminverschiebungen.
Also seufzte Dani, zog ihre nackten Füße auf den Stuhl und flüsterte: »Erst Kaffee, dann Paula. Ich bin krank, aber nicht blöd!«
* * *
In der Wohnung gegenüber wartete Etta in ihrem Relaxsessel darauf, dass in Eikes Büro jemand ans Telefon ging. Es war inzwischen fast elf Uhr, da musste Rosi längst am Schreibtisch sein.
Rosi arbeitete schon seit der Steinzeit für Eike. Sie war schon seine Sekretärin gewesen, als Etta vor vielen, vielen Jahren in Eikes Leben und in seine Schauspielagentur gekommen war. Tipptopp gepflegt und mit völlig undurchschaubarer Miene saß sie an ihrem Platz, wann immer Etta die Agentur besuchte. Sie ordnete, organisierte, sie telefonierte, sie zog im Vordergrund und im Hintergrund die Strippen und wirkte so, als habe sie kein eigenes Leben. Auch ihr Alter war schwer einzuschätzen. Manchmal hatte Etta sich gefragt, ob Rosi wohl irgendwann einmal heimlich in Eike verliebt gewesen war. Oder ob sie vielleicht gar nicht auf Männer stand und stattdessen mit einer Frau zusammenlebte.
Wenn Eike, der eigentlich mit Vornamen Adolf hieß und aus naheliegenden Gründen auf keinen Fall so genannt werden wollte, auf Rosi angesprochen wurde, sagte er immer: »Manche wollen regieren, und andere wollen dienen. Rosi will Letzteres, mehr muss man über sie nicht wissen.« Das war typisch Eike. Und so hatte Etta all die Jahre nichts über Rosi erfahren. Sie war ein Mysterium. Ein verlässliches und unerschütterliches Mysterium.
Umso mehr erschreckte es Etta, als am anderen Ende der Leitung eine fremde Frau abhob. Jedenfalls glaubte sie das, denn die Stimme kam ihr gänzlich unbekannt vor, auch wenn sie sich wie sonst Rosie meldete: »Agentur Eikelbaum, was kann ich für Sie tun?«
Als Etta nach Eike fragte, war es eine Weile still am anderen Ende der Leitung. Etta wollte schon ansetzen zu erklären, wer sie war. Vielleicht wurde gerade eine neue Bürokraft eingearbeitet, die noch nicht alle Schauspieler der Agentur kannte.
Doch in dem Moment fragte die fremde Stimme: »Etta, bist du das? Etta! Endlich! Ich habe schon zigmal versucht, dich anzurufen«, und dann brach die Frau am anderen Ende der Leitung in hemmungsloses Schluchzen aus.
Das war merkwürdig.
»Hallo? Wer ist denn da?«, fragte Etta leicht besorgt.
»Ich bin’s doch, Etta: Rosi. Dass du mich nicht erkannt hast! Etta …« Es folgte wieder ein grauenhaftes Schluchzen.
Allmählich wurde Etta das Ganze unheimlich. Vielleicht war Eike gestorben. Bei seiner ausufernden Lebensweise musste man immer mit dem Schlimmsten rechnen.
»Etta, weißt du, wo Eike ist? Hast du irgendeine Ahnung, wo er sich versteckt haben könnte?« Rosis Stimme war wirklich kaum wiederzuerkennen. Sie schien schon eine ganze Weile geweint zu haben.
Etta schüttelte den Kopf. Warum sollte Eike sich verstecken? Vielleicht war Rosi verrückt geworden.
Wie lange klammert man sich an abstruse Hoffnungen? Wie lange braucht man, um zu erkennen, dass das vermeintlich Verrückte manchmal einfach die Realität ist? Es dauerte jedenfalls, bis Etta ein Licht aufging, dass nicht Rosi verrückt war, sondern die Situation, in der Eike Rosi, die Agentur und ihre Künstler zurückgelassen hatte.
Immer wieder von heftigen Weinkrämpfen unterbrochen, erzählte ihr Rosi, dass Eike sich mit ziemlicher Sicherheit aus dem Staub gemacht hatte. »Seit sechs Tagen war er nicht mehr im Büro«, klagte sie. »Du weißt, er ist auch sonst häufig auf Reisen. Aber normalerweise meldet er sich zwischendurch. Oder ist zumindest erreichbar.«
Jetzt aber war er nicht an sein Handy gegangen. Gleichzeitig hatte sein Steuerberater immer und immer wieder angerufen. Es schien dringend zu sein, doch Rosi hatte keine Ahnung, worum es gehen konnte, denn schon seit einigen Jahren bereitete nicht mehr sie die Steuererklärungen für das Büro vor, sondern Eike selbst. »Und nun sind auch noch die Geschäftskonten gesperrt«, schluchzte Rosi.
Obwohl er zur Verschwiegenheit verpflichtet war, hatte der Steuerberater ihr auf ihr Drängen hin verraten, dass Eike mit Steuernachzahlungen in immenser Höhe in Verzug war. Das Finanzamt hatte seine Konten gepfändet, und auch der Steuerberater hatte Eike seitdem nicht erreicht.
»Erst da ist uns der Verdacht gekommen, Eike könnte möglicherweise Dummheiten gemacht haben. Vielleicht hat er sich sogar ins Ausland abgesetzt«, schloss Rosi ihren Bericht. »Etta, kannst du bei dir mal nachschauen, ob alles in Ordnung ist? Du hast doch auch noch ein Konto mit ihm, oder?«
Etta nickte beklommen. Eike und sie hatten tatsächlich ein gemeinsames Konto. Das stammte noch aus der Zeit, als sie ein Paar gewesen waren und Eike ihre Finanzen geregelt hatte. Er hatte Teile von Ettas Gagen in Immobilien auf Mallorca investiert, um für ihr Alter oder Zeiten vorzusorgen, in denen sie nicht mehr so viel verdiente. Die Einnahmen aus der Vermietung flossen zurück auf das gemeinsame Konto.
Einen Teil des Geldes hatte er verwendet, um Kredite zu tilgen; einen weiteren Teil hatte er schließlich an sich selbst und Etta ausbezahlt. Für Etta war das wunderbar gewesen: Es ermöglichte ihr ein sorgenfreies Leben, ohne dass sie sich selbst um die leidigen Geldangelegenheiten kümmern musste. Eike war ihr engster Vertrauter und war es auch geblieben, nachdem sie kein Liebespaar mehr waren.
Ihre Gagen waren auch danach noch auf das gemeinsame Konto gegangen, und Eike hatte sich selbst nur ausgezahlt, was ihm als ihr Agent an Provision zustand. Daran und an seiner bedingungslosen Loyalität und Ehrlichkeit hatte sie nie gezweifelt. Nun aber breitete sich ein leichter Nebel des Zweifels in Ettas Hirn aus.
Nach dem Telefonat mit Rosi ging es in Ettas Kopf zu wie in einem überfüllten Hotelfoyer. Gedanken flogen wild durcheinander: War Eike zu solch einer Dummheit fähig? War ihm ihre Freundschaft in der Not nichts mehr wert? Hatte er sich am Ende aus Verzweiflung gar etwas angetan?
Sie seufzte. Sie würde nicht darum herumkommen, sich Klarheit zu verschaffen. Nachdem sie Eike erfolglos wieder und wieder versucht hatte zu erreichen, beschloss sie, sich mit ihren Bankberatern in Verbindung zu setzen.
Die Ernüchterung folgte rasch.
GLÜCK IM UNGLÜCK
Alles weg. Diese Erkenntnis lief wie eine Schallplatte, die einen Sprung hatte, in Dauerschleife durch Ettas Kopf. Weg, weg, weg.
Keinen Cent hatte er übrig gelassen. Schlimmer noch: Schon vor Wochen hatte Eike hinter ihrem Rücken sämtliche Immobilien verkauft. Ob er dafür ihre Unterschrift gefälscht oder ob sie sogar versehentlich selbst unterschrieben hatte, konnte Etta nicht mit Sicherheit sagen. Fest stand: Sie war pleite. Ruiniert. Aus und vorbei. Vielleicht sollte sie ihren Künstlernamen »Glück« ab sofort in »Unglück« ändern. Etta Unglück, die selten dämliche Pute, die aus Faulheit, falscher Vertrauensseligkeit und Naivität alles verloren hatte. Ich doofe, doofe Kuh, dachte sie. Und: Dieser miese, ekelhafte, verschlagene Scharlatan!