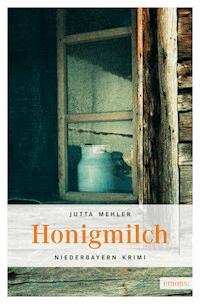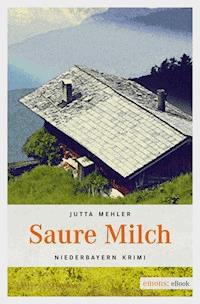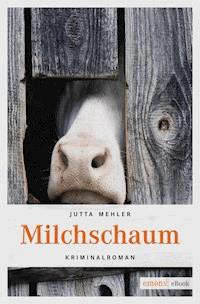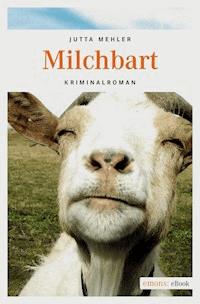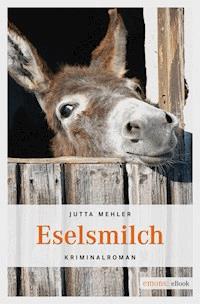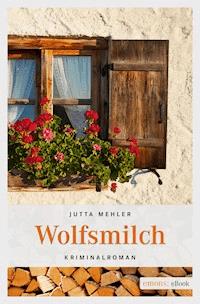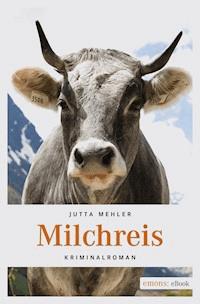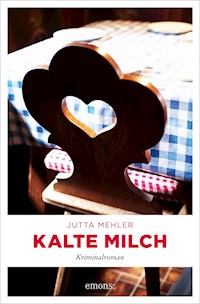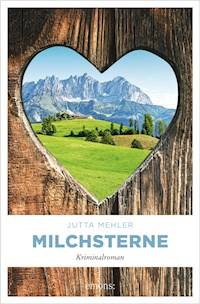Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Eva Brunriedel
- Sprache: Deutsch
Eine tragisch-witzige Geschichte, wie sie aktueller kaum sein könnte. Eigentlich hat Eva Brunriedl genug von ihrer Arbeit als "Good Mama" für die Flüchtlinge in ihrem ehemaligen Dorfgasthaus. Doch als einer ihrer Schützlinge ermordet wird und die Polizei nur tatenlos zusieht, ergreift sie resolut die Initiative. Bald muss sie feststellen, dass ihr niederbayerisches Heimatdorf längst nicht so beschaulich ist wie gedacht. Als schließlich auch noch ihre Nichte Felizitas in Gefahr gerät, wird es zunehmend ungemütlicher im Schatten des Brotjacklriegels ...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Jutta Mehler, Jahrgang 1949, hängte frühzeitig das Jurastudium an den Nagel und zog wieder aufs Land, nach Niederbayern, wo sie während ihrer Kindheit gelebt hatte. Seit die beiden Töchter und der Sohn erwachsen sind, schreibt Jutta Mehler Romane und Erzählungen, die vorwiegend auf authentischen Lebensgeschichten basieren, sowie Kriminalromane.
Dieses Buch ist ein Roman. Handlungen und Personen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.
© 2018 Emons Verlag GmbH
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Udo Siebig
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
eBook-Erstellung: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-96041-319-6
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmäßig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Aulo-Literaturagentur.
Wir müssen lernen, entweder als Brüder miteinanderzu leben oder als Narren unterzugehen.
Martin Luther King
Prolog
»Inno! Innocent! Wieso liegst du denn da mitten auf dem Tanzboden? Ist dir schlecht? Oder bist ausgrutscht und hast dir den Fuß verknackst?« Eva Brunriedl ließ den Henkelkorb fallen und hastete quer durch den ehemaligen Festsaal. »Innocent? Jetzt sag halt was.«
Weil der junge Nigerianer ihr nach wie vor den Rücken zukehrte und keine Anstalten machte, sich zu bewegen, ging sie um ihn herum und bückte sich, um ihm ins Gesicht schauen zu können.
Innocent lag auf der Seite, hatte die Beine angezogen und den linken Arm mit gestreckten Fingern wie einen Zeigestock hinter dem Körper abgelegt. Der rechte Arm ruhte angewinkelt unter dem Brustkorb. Von seinem Gesicht waren nur das linke Ohr und ein Teil der Wange zu sehen. Der Rest wurde von seiner Mütze verdeckt, die ihm über Stirn und Augen geglitten war.
Eva kniete sich hin, griff nach der Mütze, zog sie weg und begann im nächsten Moment zu keuchen.
Innocents Stirn war blutverschmiert, sein linkes Auge starrte ihr blicklos entgegen.
»In – no.« Es klang wie zerhackter Seufzer.
Nachdem Eva es geschafft hatte, ihren Atem halbwegs unter Kontrolle zu bringen, legte sie die Hand auf Innocents linke Brustseite, schloss die Augen, horchte, fühlte und merkte, wie sich Panik in ihr ausbreitete.
Dann ging ein Ruck durch ihren Körper. Energisch zog sie ihr Mobiltelefon aus der Gesäßtasche ihrer Hose und tippte 112 ein.
In den darauffolgenden Stunden und Tagen gaben sich bei Eva Brunriedl Polizisten, Leute von der Spurensicherung, Kripobeamte und Zeitungsreporter die Klinke in die Hand. In Zirnding und Umgebung sprach man von nichts anderem als von dem toten Asylbewerber auf Evas Tanzboden. In den Nachrichten wurde darüber berichtet und natürlich im Tagblatt.
Sämtliche Hausbewohner wurden verhört – allen voran Eva –, etliche Zimmer wurden durchsucht, Fragen wurden aufgeworfen und meist unbeantwortet wieder fallen gelassen.
Und irgendwann schien die Sache damit erledigt zu sein.
Nach einer guten Woche schlief die Berichterstattung ein. Die Kripoleute machten sich rar. Die Zirndinger wandten sich anderen Themen zu. Der Mord an Innocent begann zu verblassen.
EINS
Eva Brunriedl warf den Stift auf die Tischplatte, hob den Kopf und sah ihre Nichte mit schmalen Augen an.
»Was is fest ausgmacht?«
Felizitas nickte, wohl um auszudrücken, dass sie recht gut wusste, was ausgemacht war.
Eva wollte sich gerade mit einem »Also dann« wieder ihrem Schreibkram zuwenden, da fiel ihr das vorgereckte Kinn ihrer Nichte ins Auge, der feste Blick, die straffe Haltung.
Statt des »Also dann« stieß sie einen Seufzer aus. »Gilt auf einmal nicht mehr?«
Felizitas demonstrierte Entschlossenheit. Kein Blinzeln, kein Gewicht-aufs-andere-Bein-Verlagern, kein trockenes Schlucken. »Innocent ist vor zwölf Tagen erschlagen worden.« Ihre Stimme klang fast automatenhaft, so sehr bemühte sie sich, nicht das kleinste bisschen Schwäche heraushören zu lassen. »Und die Polizei hat noch nix rausgefunden. Nix über den Täter, nix übers Motiv.«
»Weil sich die Scheißpolizei einen Scheißdreck drum schert, wenn ein Scheißasylant hopsgeht«, sagte Eva und nahm den Stift wieder auf. »Denen ist das doch scheißegal.« Sie sah Felizitas kurz die Augen schließen und tief Luft holen. Eva biss sich auf die Lippen. Zugegeben, in letzter Zeit übertrieb sie es mit dem Scheiß-dies und Scheiß-das. Aber es gab ja kaum noch etwas, das die Bezeichnung nicht verdiente.
Andererseits schien sie damit allmählich Anstoß zu erregen.
Vor einiger Zeit hatte sie Chantal zu ihrer Nichte sagen hören: »Deine Tante Brunriedl hat ja schon immer einen Hau gehabt, aber seit sie die Asylantenmama spielt, ist sie voll abartig drauf.«
Ausgerechnet Chantal musste sich vor Felizitas über sie mokieren. Chantal Mösenbichler, das Flitscherl aus dem Friseursalon.
»Aber willst du nicht auch wissen, wer den Inno auf dem Gewissen hat?«, fragte Felizitas.
Eva warf den Stift quer durch den Raum. Er flog in hohem Bogen ans Fenster, prallte ab und blieb mit der Spitze in einem Blumentopf stecken.
Warum konnte ihre Nichte nicht endlich akzeptieren, dass der Scheißmörder ungestraft davonkommen würde? Nicht einmal die Polizei wollte sich in den Fall reinhängen. »Die ganze Rumfragerei ist für die Katz«, hatte Sepp Maxenberger nach den ersten Verhören gesagt. »Die mauern, die können auf einmal kein Wort Deutsch mehr, die halten so was von dicht.«
Maxenberger war ein Vollpfosten, keine Frage, aber in diesem Fall schätzte er die Lage richtig ein. Evas afrikanische Hausgäste hüteten sich davor, Informationen über sich und ihre Mitbewohner preiszugeben.
Sofern sie überhaupt Informationen besaßen.
Felizitas war ans Fenster getreten und pickte den Stift aus dem Blumentopf. Trockene Blätter raschelten, als sie die Hand zurückzog.
Die Pflanze war also inzwischen verdurstet. Sollte sie doch. Was hier in der alten Gaststube geschah, interessierte Eva nicht mehr. Vor ein paar Wochen hatte sie mit einem lautstarken »Ihr könnt mich alle mal« Türen zugeknallt und damit quasi gekündigt.
Mit »alle« waren speziell fünf junge Männer gemeint gewesen. Fünf Afrikaner, deren genaue Herkunft sie nicht kannte.
Dass Evas Abdankung Kollateralschäden verursachen würde, war abzusehen gewesen. Dass auch die arme Birkenfeige leiden musste, zeigte, wie wütend Eva gewesen war und wie wenig ihre Wut sich seither gelegt hatte.
Felizitas hielt ihr den Stift hin, doch sie griff nicht danach, fixierte ihre Nichte mit Basiliskenblick. »Man hat uns gewarnt.«
Ein kompletter Satz ohne das Wort »Scheiße«. Ein Zeichen, wie ernst Eva es meinte. Bitterernst. Sie musste Felizitas zum Einlenken bringen.
Die presste ihre Kiefer so fest aufeinander, dass man es knacken hörte.
»Die Lage ist brenzlig, das weißt du doch.« Eva schnappte sich den Stift und hämmerte damit auf die Tischplatte, sodass darin kleine Löcher entstanden. Im Takt dazu sagte sie: »Es hat ja immer mal wieder ein bisschen gekriselt. Geht gar nicht anders, wenn man einen Haufen junger Kerle zusammensperrt, dazu müssten die nicht mal aus allen möglichen Ecken von Schwarzafrika kommen.« Sie zeigte mit dem Stift auf den Durchgang zur Großküche, von wo Geschirrklappern zu hören war und ein sagenhaft köstlicher Duft hereinwehte. »Aber seit der Sabo da ist, haben wir Krieg.«
Sabo, so nannte Eva einen der Asylbewerber seit dem Tag des Türknallens. Sie hatte Innocent nach einem afrikanischen Ausdruck für »Verräter« gefragt. Er hatte das Wort auf eine alte Zeitung gekritzelt.
Innocent war seit zwölf Tagen tot. Erschlagen. Von Sabo?
Von ihm oder einem seiner Anhänger, dachte Eva. Von wem genau, interessierte im Dorf nicht wirklich. Niemanden interessierte das. Nur Felizitas.
»Einen beschissenen Scheißkrieg«, fuhr sie mit erhobener Stimme fort. »Wegen Allah oder irgendeinem andern Gott, wegen dem Koran oder der Bibel, wegen irgendeiner Scheißstammeszugehörigkeit oder Scheißbruderschaft, was weiß ich. Der Krieg wird heimlich geführt, aber glaub mir, da gärt es ganz gewaltig. Sabo und seine Kumpane sind hinterfotzig. Das haben sie ja gründlich bewiesen.« Sie wies mit der Spitze des Stifts auf ein gerahmtes Foto, das über dem Schanktisch hing. Ein Bild aus den glücklicheren Tagen, bevor dieser Sabo eingetroffen war und eine Gruppe Umstürzler um sich versammelt hatte. Es zeigte Innocent, Kobe und Tayo aus Nigeria, Bouba, Sidy, Oumar aus dem Senegal in orangefarbenen Anzügen vom Bauhof mit Schaufeln in den Händen. »Wer im Krieg zwischen die Fronten gerät, Felizitas, der wird eingestampft.«
Ihre Nichte musste endlich begreifen, dass Rückzug angesagt war.
Felizitas sah allerdings nicht so aus, als wollte sie die Richtung ändern. Eva ließ den Stift auf das halb ausgefüllte Formular fallen und machte sich auf Widerspruch gefasst.
»Innocent ist mein Freund gewesen«, sagte Felizitas bereits. »Ich muss wissen, wer ihn erschlagen hat.«
Eva warf ihr einen Blick zu, der als Antwort genügen sollte.
So war es auch, denn Felizitas erklärte geradezu trotzig: »Dass es Sabo und seine Leute waren, ist überhaupt nicht gesagt, auch wenn sie Streithammel sind.«
Natürlich hatte ihre Nichte recht. Was allerdings nichts daran änderte, dass sie die Finger von der Sache lassen musste.
Aber zum ersten Mal, seit Felizitas bei ihr wohnte, biss Eva auf Granit. Noch nie zuvor hatte sich ihre Nichte so störrisch gezeigt.
Felizitas war sechs Jahre alt gewesen, als das Auto ihrer Eltern auf der Landstraße zwischen Aicha vorm Wald und Neukirchen vorm Wald von einem Lastwagen erfasst wurde. Der Unfall machte das Kind zur Waise. Eva und ihr Mann Alfred hatten sich sofort bereiterklärt, die Pflegschaft zu übernehmen, denn als Alternative wäre das Kind ihrer jüngeren Schwester im Heim gelandet.
Die ersten Monate als Neuling im Wirtshausbetrieb der Brunriedls mussten für Felizitas schrecklich gewesen sein. Doch wie Eva gehofft hatte, gewöhnte sie sich recht bald an ihr neues Zuhause, an Eva und Alfred und an die Pensionsgäste.
»So eine Wirtschaft hat ja viel Gutes«, hatte sie Jahre später einmal zu ihrer Tante gesagt. »Langweilig wird dir da nie, weil ständig Leute aus und ein gehen. Und jeder, der hereinkommt, bringt den neuesten Klatsch mit. Du musst bloß hinhören, dann weißt du immer ganz genau, was abgeht im Dorf.«
Eva hatte geschmunzelt. Genau deswegen war der Bürgermeister jeden Abend auf eine Halbe Coronator vorbeigekommen und der Pfarrer auf einen Schoppen Veltliner – der hatte es ja nicht weit, musste bloß über die Straße gehen. Der Chef vom Bauhof hatte regelmäßig auf drei Kurze hereingeschaut und der Vorstand vom SC auf eine Apfelschorle.
Damals setzten Eva und Alfred Brunriedl in ihrem Gasthaus hübsch was um. Gute Zeiten waren das, und Eva war in ihrem Element gewesen. Sie hatte gekocht und gebacken, die Gäste bedient und die Zimmer gemacht. Ihr Mann stand den ganzen Tag und die halbe Nacht hinter dem Ausschank, zapfte das Bier und füllte die Gläser. Und da, hinter dem Zapfhahn, war er am Allerheiligentag vor vier Jahren zusammengebrochen und wenig später gestorben.
Eva wäre es lieber gewesen, ihre Pflegetochter hätte nichts von dem Getuschel mitbekommen, das sich kurz darauf erhob, hatte jedoch schnell einsehen müssen, dass sich die Zirndinger das Schlechtreden einfach nicht verkneifen konnten – nicht einmal vor Zitas Ohren.
»Jede zweite Halbe hat er für sich selbst gezapft«, hieß es. Das sagten die Leute eigentlich immer, wenn ein Schankwirt ins Gras biss. Oft traf es sogar zu.
Was Alfred betraf, wusste Eva es besser. Und, wie sie bald erfahren sollte, war auch Felizitas nicht unwissend gewesen. »Onkel Brunriedl hat sein Schnapsglasl jedes Mal untern Wasserhahn gehalten, wenn einer eine Runde ausgegeben hat, und sein Bierglas, das hat er nur mit Schaum vollgemacht. Ich hab ihm oft genug dabei zugeschaut. Onkel Brunriedl hat sich ganz bestimmt nicht totgesoffen«, hatte ihre Nichte kundgetan.
Und sie hatte recht damit gehabt. Aber Alfred war halt erst dreiundsechzig Jahre alt gewesen, als er den Löffel abgeben musste, und das hatte zu denken gegeben. Die Zirndinger machten kein Geheimnis daraus, was sie sich dachten.
»Der Doktor hat mir erklärt, dass Onkel Alfred an einem Gehirnschlag gestorben ist und dass so einen jeder kriegen kann, ob alt oder jung, ob Wirt oder Mesner«, hatte Felizitas hinzugefügt und dann mehr zu sich selbst gesagt: »So ist das, interessiert bloß keine Sau.«
Ja, dachte Eva deprimiert. Alfred ist schon mit dreiundsechzig gestorben. Felizitas war da gerade mal zwölf.
Sie selbst hatte ein paar Monate zuvor ihren Sechzigsten gefeiert. Oben im Festsaal, mit halb Zirnding zu Gast. Alfred hatte einen Walzer mit ihr getanzt und ihr eine Urlaubsreise versprochen. Im November hatten sie das Wirtshaus für eine Woche schließen und nach Gran Canaria fliegen wollen. Aber daraus war nichts geworden.
Weil ich Ende Oktober schon keinen Ehemann mehr gehabt habe, dachte Eva, nur noch ein Wirtshaus an der Backe. Und Felizitas.
Aber ihre Nichte war keine Belastung gewesen, ganz im Gegenteil, von Tag zu Tag war sie Eva unentbehrlicher geworden. Da sie und Felizitas von irgendwas leben mussten, entschied Eva, die Gastwirtschaft weiterzuführen. Beherzt nahm sie den Schlegel und zapfte ein frisches Fass Bier an. Aber ohne Alfred hinterm Schanktisch war das Dorfwirtshaus nicht mehr dasselbe. Monat für Monat erschienen weniger Gäste.
Als sie an Alfreds zweitem Todestag vom Friedhof nach Hause gekommen waren, den Marmorkuchen angeschnitten hatten und zusammen am Tisch saßen, sagte Eva zu Felizitas: »Zita, das Geschäft rechnet sich nicht mehr. Ich mach zu, bevor die Sache kritisch wird.«
Felizitas schien kein bisschen überrascht. Offenbar hatte sie sich so etwas bereits gedacht. Sie nickte. Zu diskutieren gab es nichts, denn sobald ihre Tante einmal einen Entschluss gefasst hatte, führte sie ihn auch aus.
Nach einer Weile war Eva aufgefallen, wie bedrückt ihre Nichte wirkte. Sie hatte ihr Kakao nachgeschenkt, den Felizitas schweigend trank. »Was ist?«
Zita hatte herumgedruckst, dann rückte sie heraus damit. »Ein bisschen mulmig wird mir schon, wenn ich es mir vorstelle: wir zwei mutterseelenallein in einem dichtgemachten Wirtshaus, wo mit der Zeit massig Spinnen, Mäuse und wer weiß was für Viecher in die leeren Zimmer einziehen.«
So war es dann ganz und gar nicht gekommen, was dem Zirndinger Bürgermeister zu verdanken gewesen war.
Der hielt wenig davon, mitten im Ort ein erledigtes Wirtshaus stehen zu haben, und suchte nach Alternativen. Eines Tages kreuzte er bei Eva auf und machte ihr einen Vorschlag, der ihr – was enorm selten vorkam – eine Zeit lang die Sprache verschlug.
Der Bürgermeister nutzte ihr Schweigen und erklärte ihr seinen Plan ausführlich.
»Du musst nicht mal umbauen. Im Großen und Ganzen kann alles bleiben, wie es ist. Nur die Kühlkammer musst dichtmachen und einen Aufenthaltsraum musst einrichten. Aber da ist ja nicht viel dabei. Die Wirtshausküche und die Pensionszimmer kannst du so lassen, wie sie sind. Du stellst das Geschirr, die Bettwäsche und die Handtücher – ist ja alles da – zur Verfügung, kümmerst dich ein bisserl um die Asylanten und kriegst sechzehn Euro pro Tag für jeden. Da muss man doch nicht lang überlegen, wenn einem so ein Angebot gemacht wird. Wenn du die Bude leer stehen lässt, frisst sie dir die Haare vom Kopf, das kannst mir glauben.«
Der Bürgermeister kam derart in Fahrt, dass er überhaupt nicht merkte, wie schnell Evas Überraschung in Erleichterung umgeschlagen war. Dass das Haus – so gut wie unbewohnt – zu einer Ruine verkommen würde, wusste sie besser als er.
Ende November, pünktlich mit dem ersten Schnee, trafen sechs Nigerianer am Passauer Bahnhof ein. Eva lieh sich einen Ford S-Max mit sieben Sitzen aus und holte sie persönlich ab.
Sechs junge Kerle, schwarz wie der Eyeliner von Chantal Mösenbichler. Keiner konnte ein Wort Deutsch. Sie sprachen Englisch mit Eva, deren Wortschatz in dieser Sprache sich bisher auf »Okay« und »Coffee to go« beschränkt hatte. Auf dem Weg nach Zirnding lernte sie mindestens zehn neue Wörter dazu. In ihrem Haus nahm sie die Burschen auf, so wie sie acht Jahre zuvor Felizitas aufgenommen hatte. Die redeten sie allerdings nicht mit »Tante« an, sondern sagten »Mama« zu ihr.
Eva war eine strenge Mutter, ließ ihnen nichts durchgehen. Kein Schulschwänzen, kein Sich-vor-der-Arbeit-Drücken, keine Schlamperei und kein Aufmucken.
Auf Widerrede hatte sie stets die gleiche Antwort: »In deinem Country ist das anders? Da bist aber nimmer.«
Kurz vor Weihnachten kamen noch fünf junge Kerle, damit war die Mannschaft komplett.
Eine Zeit lang jedenfalls.
Die Namen der elf Asylbewerber, die damals in ihr Haus eingezogen waren, hätte sich Eva beim besten Willen nicht mehr ins Gedächtnis rufen können, denn bereits im Frühjahr begann das, was sie »Bäumchen wechsel dich« nannte: Ihre Schützlinge wurden ausgetauscht, nach und nach an andere Unterkünfte weitergereicht. Dafür kamen neue Burschen von irgendwoher.
Eva begriff nicht, warum man sie nicht dort beließ, wo sie sich halbwegs eingewöhnt hatten, und sie litt darunter.
Besonders weh tat ihr, wenn einer abkommandiert wurde, mit dem sie sich gut verstand. Am schlimmsten war, als Bafu gehen musste. Bafu hatte sie mehr als jeden andern ins Herz geschlossen, und er sie. »My good Mama« hatte er sie genannt.
Als Eva erfuhr, dass Bafus Tage in ihrem Haus gezählt waren, hätte sie der Asylbeauftragten am liebsten den Hals umgedreht.
»Die blöde Tussi verpflanzt unsern Bafu an den Arsch der Welt«, hatte sie gewettert, was von der inzwischen fünfzehnjährigen Felizitas trocken kommentiert worden war: »Als ob Zirnding nicht sowieso der Arsch der Welt wär.«
Evas Beurteilung sollte allerdings nach Bafus Umzug von ihm bestätigt werden.
»Zirnding ist Scheiße«, sagte Bafu, als er einmal zu Besuch kam. »Aber Loderhof ist Großscheiße.«
Scheiße war so ziemlich das erste Wort, das Eva Brunriedl ihren Schützlingen beibrachte. Sie benutzten es fleißig, wogegen sie bei ihnen nichts einzuwenden hatte. Bei Felizitas schon.
»Will ich nicht hören von dir«, pflegte sie ihre Nichte zu rüffeln. »Du nimmst das Wort nicht in den Mund, capito?«
»Hallo?«, hatte Zita ein- oder zweimal aufbegehrt. »Warum du, die Afrikaner, sogar der Karl, bloß ich nicht?«
»Weil ich nicht will, dass du in der Fäkalsprache daheim bist. Ende Gelände.«
»Zita?« Eva sah ihre Nichte scharf an. »Da ist nix zu machen. Also vergiss die ganze Gschicht.« Mit einem äußerst misstrauischen Blick setzte sie hinzu: »Haben wir uns verstanden?«
Felizitas schluckte. »Ich hab dich sehr gut verstanden.«
Eva konnte es kaum fassen. Auf Granit gebissen.
Sie stand auf, packte Felizitas bei den Schultern und begann sie zu schütteln. »Zünd ein paar Kerzen für den Inno an, spiel seinen Lieblingssong, stell dir sein Foto aufs Nachtkastl. Aber denk nicht mehr darüber nach, wer ihn auf dem Gewissen haben könnt. Und vor allem: Frag die Afrikaner nicht mehr über die Sach aus.« Daraufhin ließ sie ihre Nichte so plötzlich los, dass die zur Seite torkelte und sich am Schanktisch festhalten musste.
Als Felizitas das Gleichgewicht wiedererlangt hatte, schob Eva ihr Gesicht ganz nah an das ihrer Nichte: »Selbst wenn – was ein Mirakel wär – wir zwei Hübschen herausfinden könnten, wer den Innocent umgebracht hat, tät ihn das wieder lebendig machen?«
Zitas »Nein« kam kaum vernehmbar, aber es kam.
»Eben. Aber für dich – für uns alle zwei – könnt es gefährlich werden. Versprich mir …«
Eva spürte, wie sich ihre Nichte straffte.
Sie würde das Versprechen, das Eva haben wollte, nicht geben.
Das war gar nicht gut.
Andererseits war es besser, als hintergangen zu werden.
»Wär das nicht superverdächtig«, fragte Felizitas, »wenn ich mich überhaupt nicht dafür interessieren tät, wer’s gewesen ist?«
Der Einwand war schlau, aber Eva hatte nicht vor, ihn gelten zu lassen. »Du hast dich in den letzten Tagen schon genug dafür interessiert. Schluss damit. Du stellst keine Fragen mehr, stocherst nirgends mehr rum.« Irgendwann würde ihre Nichte schon nachgeben.
Irgendwann vielleicht, aber nicht jetzt. »Meinst du wirklich, Tante, dass derjenige, der Innocent erschlagen hat, dich und mich auch umbringt, wenn er fürchten muss, dass wir ihm auf die Spur kommen könnten?« Bevor Eva eine Antwort parat hatte, fuhr Felizitas fort: »Das fürchtet der aber nicht. Garantiert nicht. Falls es Sabo oder einer von seinen Leuten gewesen ist, dann schon gar nicht. Die nehmen uns doch überhaupt nicht zur Kenntnis. Mit dir haben sie am Anfang nur deswegen geredet, weil es einfach nicht anders ging. Und dann haben sie so schnell wie möglich dafür gesorgt, dass du nichts mehr zu sagen hattest.«
Abermals schlau gedacht, musste Eva zugeben. Für ihr Alter – Zitas sechzehnter Geburtstag lag noch nicht lang zurück – war sie ganz schön gewieft.
Trotzdem. Oder gerade deshalb musste ihre Nichte es aufgeben, Innocents Mörder überführen zu wollen.
»Versprich mir –«, machte Eva einen neuen Vorstoß, durfte jedoch nicht ausreden.
»Ich kann nicht.« Felizitas’ Miene wurde weicher. »Tante, ich bin’s dem Innocent schuldig.«
»Einen Scheißdreck bist ihm schuldig«, regte Eva sich auf.
»Er ist doch mein Freund gewesen«, hielt Felizitas dagegen.
Eva stieß zischend die Luft aus. »Freund! Was ist denn das für eine Freundschaft, wenn man sich kaum miteinander unterhalten kann? Und außerdem wär der Inno in drei, vier Wochen sowieso abgeschoben worden. Ende Gelände.« Sie beugte sich hastig über ihre Formulare, weil sie nicht sehen wollte, wie ihrer Nichte die Tränen in die Augen stiegen.
Doch den Blick abzuwenden nützte nichts, denn Felizitas sagte mit erstickter Stimme: »Tante, ich scheuer den Holzboden oben im Saal, ich wasch dein Auto und topf den Gummibaum um. Alles, was du willst. Aber ich kann das, was mit dem Inno passiert ist, nicht einfach von mir wegschieben und so tun, als wär nix. Weißt, das geht einfach nicht. Nicht mal, wenn ich es wollt.«
Eva hob den Kopf und starrte aus dem Fenster irgendwohin in die Ferne.
Vielleicht tat sie Sabo und seinen Leuten ja Unrecht. Vielleicht hatte sie die Burschen nur deshalb so auf dem Kieker, weil sie ihr bei Weitem nicht den Respekt und die Herzlichkeit entgegenbrachten, die sie von den anderen Asylbewerbern gewohnt war und auch von ihnen erwartete. Vielleicht waren sie grundanständig und harmlos. Vielleicht aber auch nicht. Wer wusste schon, weshalb sie aus ihrem Heimatland geflohen waren. Vielleicht waren sie Kriminelle, die sich zu viel aufs Kerbholz geladen hatten, um sich, wo auch immer sie herkamen, noch halbwegs sicher fühlen zu können. Vielleicht waren sie schlicht und einfach Banditen. Vielleicht machten sie kurzen Prozess mit Leuten, die ihnen ins Gehege kamen. Vielleicht waren sie aber auch bloß misstrauisch, wachsam und vorsichtig.
Es gab entschieden zu viele Vielleichts.
Tatsache war, dass man Innocent ermordet hatte, und zwar hier im Haus. Und deshalb hatte Eva Angst, speziell um Felizitas.
Ihre Stimme klang ein wenig heiser. »Vergiss den Kerl, Zita. Bitte.«
Dieses »Bitte«, das in Evas Wortschatz eigentlich nicht existierte, schien mehr zu bewirken als Argumente und Verbote.
Felizitas knickte sichtlich ein.
Gerade als Eva ihre Chance nutzen und doch noch ein Versprechen aus ihrer Nichte herausholen wollte, war aus dem Treppenhaus ein Krachen zu hören. Sie sprang auf, um nachzusehen, was draußen los war, kam aber nicht weit.
Die Tür flog bereits auf. »Wer von denen hat denn einen alten Kühlschrank neben die Stiege gestellt? Was wollen die denn mit so einem Teil, das schon auseinanderfällt, wenn man bloß scharf hinschaut?«, rief Chantal erbost und stürmte in den Schankraum.
ZWEI
Eva stand, die Hände in die Hüften gestützt, im Treppenhaus vor einem etwas ramponierten Klein-Kühlschrank. »Wer hat denn das Scheißding da angeschleppt?«
Bouba, an den sie die Worte richtete, zuckte auf eine Weise die Schultern, die ihr sagte, dass er es gewesen sein musste.
Eva deutete anklagend auf das Gerät. »Du weißt ganz genau, dass ihr nichts mitnehmen dürft aus dem Wertstoffhof. Das Scheißteil kommt wieder weg, und zwar pronto.« Sie warf einen zweiten Blick darauf und fügte hinzu: »Der funktioniert doch eh nicht mehr.«
Bouba nickte wie ein folgsames Kind und bückte sich, um das Kühlschränkchen in Richtung Ausgang zu schieben. Dabei stieß er mit dem Fuß gegen dessen Tür, die nur noch lose in den Angeln hing. Prompt fiel sie heraus, klapperte auf den Steinboden.
Eva setzte zu einer Verwünschung an, hielt jedoch inne, denn Bouba hatte sich aufgerichtet und sah sie mit einem seltsamen Ausdruck in den Augen an.
Was zum Henker …
Täuschte sie sich, oder flackerte sein Blick zu dem Schrottkühlschrank, der nun sein schäbiges Innenleben darbot?
Eva schaute es sich genauer an.
Die Klappe des winzigen Gefrierfaches rechts oben war verbeult und klaffte ein Stück weit auf. Die Glasfläche darunter wies einen Sprung auf, der mit Paketband geflickt worden war. Statt einer Lade für Obst und Gemüse gab es ein Wellengitter für Flaschen. Darüber befand sich ein Einlegeboden aus Plastik, und darauf lag ein Werkzeug. Es war knapp vierzig Zentimeter lang, sehr schmal und besaß an jedem Ende eine flache ringförmige Verdickung mit scharfen Ober- und Unterkanten. Eine dieser Verdickungen war auf der Oberseite bräunlich verfärbt.
Evas Blick blieb daran kleben. Ihre Gedanken rekapitulierten, wie der Gegenstand, mit dem Innocent erschlagen worden war und den man bisher nicht gefunden hatte, in der Zeitung beschrieben gewesen war.
Schwer und kantig und aus Metall.
Evas Piercing fing an zu zittern, als sich ihre Nasenflügel blähten. Ihre rechte Hand hob sich, wollte sich auf den Mund pressen, entschied sich jedoch anders, hob sich weiter, griff in ihre Kurzhaarfrisur und bekam die lila Strähne zu fassen, die sich strohiger anfühlte als der restliche Pelz.
Eva zog daran, bis es wehtat. Sie musste heftig nach Luft schnappen, versuchte jedoch, sich selbst zu beschwichtigen.
Bloß ein Scheiß-Ratschenschlüssel mit einem Rostfleck.
Aber der Argwohn, die Tatwaffe vor sich zu haben, die der Täter womöglich in dem Schrottkühlschrank entsorgt hatte, ließ sich nicht verscheuchen.
Ihr Blick schoss zu Bouba hinüber, bat um ein beruhigendes Grinsen. Seine Miene war ausdruckslos, und das sprach Bände.
Auch Bouba hegte also den Gedanken, dieses Ding im Kühlschrank könne die Tatwaffe sein, nach der man tagelang vergeblich gesucht hatte.
Ein Ratschenschlüssel.
Schwer und kantig und aus Metall.
Die obere oder untere Kante einer der ringförmigen Verdickungen konnte Innocents tödliche Kopfverletzung durchaus herbeigeführt haben.
Mit einem Schauder erinnerte Eva sich an die tiefe Einkerbung oberhalb von Innocents Schläfe, die sie wahrgenommen hatte, und an all das Blut, das an manchen Stellen einen Farbton angenommen hatte wie der Fleck auf dem Ratschenschlüssel.
Und nun fand sich ein Ding, das möglicherweise, nein höchstwahrscheinlich die Tatwaffe war, in diesem ausgedienten Kühlschrank. Hatte Bouba ihn tatsächlich vom Wertstoffhof? Hatte er gewusst, was sich darin befand? Hatte er einen Verdacht, wie die Ratsche hineingekommen war? In Evas Kopf begannen tausend Fragen durcheinanderzuwirbeln.
Warum nur fühlte sie sich außerstande, wenigstens eine davon stellen?
Sie sah Bouba verstört an.
Er war ein stämmiger Kerl mit einem breiten Gesicht, platter Nase und gutmütigen Augen, die sich zu Schlitzen verengten, wenn er lachte. Im Moment blickten sie starr geradeaus, schienen irgendetwas zu fixieren, das nur er sehen konnte.
Eva stieß einen tiefen Seufzer aus. Sie hatte schon oft genug erlebt, wie einer ihrer Schützlinge einfach dichtmachte, wenn er sich überfordert, bedrängt oder sonst wie unter Druck gesetzt fühlte. Bouba würde nicht eine einzige Frage beantworten.
Eva ließ ihre lila Haarsträhne los und streckte die Hand langsam nach dem Ratschenschlüssel aus. Sie konnte nicht so tun, als gäbe es ihn nicht, und ebenso wenig konnte sie in ihrem Kopf die Überzeugung ausmerzen, dass die Tatwaffe vor ihren Augen lag.
Eva griff danach, aber Bouba kam ihr zuvor.
Erst jetzt bemerkte sie, dass er Handschuhe trug. Alte Arbeitshandschuhe mit Löchern an den Fingerkuppen.
Boubas behandschuhte Hand ergriff den Ratschenschlüssel und deponierte ihn mit einer achtlos wirkenden Bewegung auf dem Vilshofener Anzeiger vom Vortag, der auf der untersten Treppenstufe für die Papiertonne bereitlag.
Kaum hatte er das Ding weggelegt, schien er es auch schon vergessen zu haben. Er wandte sich dem Schrottkühlschrank zu, setzte die Tür ein und begann, ihn weiter Richtung Ausgang zu bugsieren.
Als er dabei eine kleine Drehung machte, um die Richtung zu korrigieren, traf Eva ein tiefgründiger Blick aus seinen weit geöffneten Augen.
Was wollte er ihr damit zu verstehen geben? Dass es ihm leidtat, den Kühlschrank angeschleppt und ihr damit – bewusst oder unbewusst – die Tatwaffe aufgehalst zu haben? Dass er hoffte, sie würde tun, was zu tun war, und ihn dabei aus dem Spiel lassen?
Den Gefallen konnte sie ihm tun. Vorerst jedenfalls. Später würde sie ihn sich vornehmen, privat und unter vier Augen. In ihrer Küche, wo es keine Treppenabsätze und keine Flure gab, auf denen man herumlümmeln und belauschen konnte, was im Eingangsbereich gesprochen wurde.
Anklagend deutete sie auf den Kühlschrank. »Zisch bloß ab mit dem Mistding. Und lass dir nicht einfallen, noch mal was abzustauben am Wertstoffhof. Keine Kabel, keine Stecker, keine Rohrmuffen. Ist das angekommen?«
Ein kurzes Aufblitzen in Boubas Augen zeigte ihr, dass er zufriedengestellt war. Die Haustür schlug hinter ihm und dem Kühlschrank zu.
Eva starrte den Ratschenschlüssel an, der gleichmütig unter der Schlagzeile »Freie Bahn für offenes Internet« lag, und seufzte ein weiteres Mal.
Sie hätte eine Menge Fragen gehabt. Die dringlichste lautete: Wo kommt das Trumm her? Die zweitdringlichste: Was weiß Bouba darüber? Falls ihn ähnliche Ängste plagten wie sie selbst, würde es ziemlich schwierig werden, einschlägige Informationen aus ihm herauszuholen. Womöglich zeigten dann nicht einmal Marmorkuchen, Filterkaffee und leise Schlagermusik Wirkung.
Vielleicht aber doch.
Bouba musste schließlich wissen, dass er ihr vertrauen konnte, denn in den paar Monaten, die er nun hier wohnte, hatten sie eine geradezu enge Beziehung aufgebaut. Für Bouba war Eva tatsächlich »Good Mama« geworden. Er beherzigte ihre Ratschläge, ihre Kritik, steckte ihre Rüffel ein.
Eva gab es ja nicht gern zu, aber sie war zu Tränen gerührt gewesen, als er eines Abends mit einem Zwinkern zu ihr gesagt hatte: »I mog di.«
Was also könnte ihn daran hindern, ihr zu gestehen, was er wusste, vermutete oder sonst wie im Sinn hatte?
Die Antwort darauf lautete: der Zwiespalt, in den er sie bringen würde.
Mal angenommen, überlegte Eva, Bouba könnte mir Hinweise auf den Täter geben. Was mache ich dann? Ihn zu einer offiziellen Aussage zwingen? Ihn vor die Behörden schleppen, vor denen er mehr Angst hat, als ihm Innocents Mörder je einjagen könnte?
Andererseits sollte der Täter nicht davonkommen dürfen. Das wollte Bouba sicherlich nicht, Eva genauso wenig und Felizitas am allerwenigsten.
Nur die Polizei schien kein Problem damit zu haben, denn es sah ganz danach aus, als würde der Fall des toten Nigerianers Innocent Kuti demnächst ungelöst zu den Akten gelegt werden, weil die Ermittler bisher nicht die geringste Spur zum Täter gefunden hatten.
Inwieweit sich Unfähigkeit und Desinteresse dabei paarten, musste dahingestellt bleiben.
Eva bückte sich, schlug den Vilshofener Anzeiger vorsichtig um den Ratschenschlüssel, knickte die Enden um und rollte das Papier so zusammen, dass es aussah, als wäre eine Salami darin eingewickelt. Dann hob sie das Paket auf, klemmte es sich unter den Arm und fragte sich, was sie nun damit machen sollte.
Fraglos galt es als ihre Bürgerpflicht, es schleunigst bei der Polizei abzuliefern. War es nicht sogar strafbar, Beweismittel zu unterschlagen? Unbedingt.
Die Polizei würde den Ratschenschlüssel auf Fingerabdrücke und Blutspuren untersuchen und vom Gerichtsmediziner feststellen lassen, ob Innocents Kopfwunde davon herrührte. Doch was auch immer sich bei diesen Untersuchungen ergab, man würde in jedem Fall wissen wollen, wo das Ding auf einmal herkam. Damit wäre Boubas Aussage fällig.
Eva befingerte das Paket unter ihrem Arm, das ihr mit jeder Minute schwerer zu wiegen schien. Eine Last war ihr aufgebürdet worden, die sie nicht tragen wollte.
Müde lehnte sie sich ans schmiedeeiserne Treppengeländer, schloss die Augen und dachte an den frostigen Wintertag im vergangenen Januar, an dem sie Innocent, Kobe und Tayo vom Bahnhof in Passau abgeholt hatte. Drei lange, schlanke Kerle, von irgendwo aus Nigeria, mit dunklen Gesichtern und schneeweißen Zähnen, die zitternd in der Kälte standen. Sie kamen aus unterschiedlichen Gebieten, glaubten an unterschiedliche Gottheiten und hatten denselben Traum: Bleiberecht in Deutschland, Arbeitserlaubnis, Geld verdienen.
Kobe und Tayo sahen phantastisch aus. Markante Gesichter, geschmeidige Körper. Neben ihnen wirkte Innocent wie das sprichwörtliche hässliche Entchen. Er war nicht nur schlank, sondern dürr, elendslang und kantig wie ein Holzscheit. Alles war kantig an ihm: der Kopf, das Gesicht, die Gliedmaßen, die Bewegungen. Doch im Gegensatz zu Kobe und Tayo war Innocent inwendig ganz weich und rund. Er war – nomen est omen – ein Unschuldslamm. Niemand brauchte länger als ein paar Minuten, um ihn entsprechend einzuschätzen. Kobe und Tayo sollten sich als härter und zielstrebiger erweisen. Sie wussten, was sie wollten, und versuchten, es zu bekommen: das Fahrrad, den Markenblazer, den Trolley. Selbst wenn Eva das eine oder andere noch gute Stück, von dem sich ein Zirndinger zugunsten der Asylbewerber trennte, für ihn aufsparte, winkte Innocent oft lächelnd ab. »Passen für Kobe oder Tayo. Oder vielleicht Bouba?«
Bouba. Der Senegalese und der Nigerianer schienen sich zu mögen. Man sah sie zusammen die Dorfstraße hinuntergehen, zusammen in den Bus steigen und auf der Bank neben der Haustür sogar zusammen deutsche Grammatik pauken. Dabei hätten sie unterschiedlicher nicht sein können. Äußerlich sowieso. Der eine lang, dürr und linkisch, der andere kurz und platt, aber flink. Der eine, Innocent, schien ein trauriges Herz zu haben, der andere, Bouba, dagegen ein fröhliches. Quasi als Ausgleich dafür besaß Innocent einen scharfen Verstand.
Gemeinsam war den beiden eine unerschütterliche Rechtschaffenheit.
Waren Innocent und Bouba echte Freunde gewesen? Eva hätte das nicht mit Sicherheit beantworten können. Denn ihre Schützlinge waren ihr bei aller Zuneigung im Grunde fremd geblieben. Manche schotteten sich komplett ab, manche – wie Bouba – machten hin und wieder ein Fensterchen auf.
Felizitas hatte bei Innocent eine ganze Scheibe eingedrückt.
Eva stieß sich vom Geländer ab und fuhr sich mit der freien Hand über die Augen. Hätte sie den Treffen der beiden einen Riegel vorschieben müssen? Aber weshalb hätte sie das tun sollen?
Alles war ja ganz unschuldig – innocent – gewesen. Zwei, die immer ein wenig abseits standen, sich in Cliquen und Klüngeln nicht wohlfühlten, hatten sich zusammengetan und versucht, sich gegenseitig ein bisschen zu stützen.
Hätte sie ahnen müssen, dass die Sache nicht gut ausgehen würde? Könnte Innocent noch leben, wenn er Zita nicht in sein trauriges Herz gelassen hätte, das durch sie womöglich ein wenig froher gestimmt worden war? War er wegen seiner Schwäche für sie ermordet worden?
Wohl kaum. Denn als Motiv käme ja nur Eifersucht in Frage, und wer sollte auf die harmlose Annäherung zwischen Innocent und Zita eifersüchtig gewesen sein?
Das Motiv musste woanders stecken, und nur der Täter konnte wissen, wo. Hielt sie gerade das Instrument in der Hand, das ihn überführen würde?
Eva zuckte zusammen. Nun hatte sie doch tatsächlich geglaubt, Zitas Stimme zu hören. Aber das Mädel war ja noch mit Chantal im Schankraum. Was hatten die zwei eigentlich so lang zu bequatschen? Und seit wann gab Chantal sich mit Felizitas ab? Hatte sie normalerweise nicht »null Bock« auf die Gesellschaft von »unangesagten« Leuten?
Als unangesagt galt Zita wohl vor allem deshalb, weil sie sich nicht so aufbrezelte wie Chantal und die anderen Mädchen, die zur Miedinger-Clique gehörten.
Obwohl Eva es ihrer Nichte nicht abgeschlagen hätte (sie trug ja selbst eines), hatte Felizitas nie nach einem Piercing oder einem Tattoo, ja nicht einmal nach einer pinkfarbenen Haarsträhne verlangt.
Sie hatte es vorgezogen, mit Innocent in gotterbärmlichem Kauderwelsch ernste Gespräche zu führen.
Worüber hatten sich die beiden eigentlich unterhalten? Eva musste sich eingestehen, dass sie nicht die geringste Ahnung hatte. Sie biss sich auf die Unterlippe. Konnte es sein, dass Felizitas in Gefahr schwebte, weil ihr Innocent Geheimnisse verraten hatte, die sie nicht wissen durfte? Es reichte ja vielleicht sogar schon, wenn Innocents Mörder bloß glaubte, Felizitas wüsste etwas, das nicht für ihre Ohren bestimmt war.
Vorausgesetzt, es verhielt sich so, was würde der Kerl tun?
Auf jeden Fall würde er Felizitas mit Argusaugen beobachten, jeden ihrer Schritte kontrollieren und rigoros eingreifen, wenn sie ihm zu nahe zu kommen drohte.
Das Gleiche galt für Bouba. Auch ihm konnte Innocent Dinge anvertraut haben, die der Täter unter dem Deckel halten wollte.
Evas Unterlippe begann zu bluten, aber sie kümmerte sich nicht darum. Wie konnte sie die beiden, vor allem natürlich Felizitas, am besten schützen?
Ganz einfach: indem sie herausfand, weshalb Innocent hatte sterben müssen.
Eva horchte auf, als sie jemanden die Treppe herunterkommen hörte, und entschloss sich, eiligst in ihrer Wohnung zu verschwinden. Neugierige Blicke oder gar Fragen konnte sie jetzt überhaupt nicht gebrauchen. Sie klemmte ihr Paket fester unter den Arm und setzte sich hastig in Bewegung. Dummerweise nahm sie in ihrem Eifer die Kurve zu eng und blieb mit dem Jackenärmel am Schubladengriff des Flurschränkchens hängen. Bevor sie sich losmachen konnte, erschien Sabo in ihrem Sichtfeld.
Sie richtete sich auf und blickte ihm entgegen.
DREI
Ausgerechnet Sabo war aufgekreuzt, den sie nicht ausstehen konnte.
Von Anfang an hatte er sich nicht anpassen und nicht auf sie hören wollen. Hatte eine Eigensinnigkeit an den Tag gelegt, die sie bisher nur von sich selbst kannte, weshalb sie bei jemand anderem nicht damit umzugehen wusste. Sabo, der sie bloß unverwandt anstarrte, wenn sie ihn zur Rede stellte, weil er wieder einmal die Schule geschwänzt hatte oder über Nacht weggeblieben war, ohne sich abzumelden. Sabo, der im Laufe weniger Wochen fast die Hälfte ihrer Schützlinge mit Widerspenstigkeit infiziert hatte.
Dabei meinte sie es doch nur gut mit den Burschen. »Integration« hieß nämlich das Zauberwort, das ihnen in dem Land, in das sie geflüchtet waren, ein Auskommen bescheren würde. Aber wie sollte ihnen auch nur ein Hauch von Integration gelingen, wenn sie sich nicht einmal an ein paar einfache Regeln halten wollten, die Eva in aller Mütterlichkeit aufgestellt hatte.
Eine Zeit lang hatte sie sich wirklich Mühe gegeben, die Kerle zu erziehen, musste aber einsehen, dass bei Sabo absolut nichts fruchtete. Da streckte sie eines Tages die Waffen, machte eine Kehrtwende und begann, ihn zu verabscheuen.
Daraufhin bildeten sich zwei Lager. Innocent, Kobe und Tayo, die drei Nigerianer, die schon etliche Monate bei ihr wohnten, aber auch Bouba, Sidy und Unmar aus dem Senegal hielten sich weiterhin an Eva. Der Rest hielt sich an Sabo, kochte unter seiner Ägide sein eigenes Süppchen und steigerte damit fortlaufend Evas Erbitterung.
Zwischen den beiden Lagern herrschte nicht wirklich Krieg, aber auch kein Frieden. Es gab finstere Blicke und manchmal auch Wortgefechte, die Eva zwar meist mitbekam, aber selten ausdeutschen konnte.
Der Konflikt gipfelte schließlich darin, dass Sabo und seine Truppe eines Morgens mit dem Acht-Uhr-Bus in die Kreisstadt fuhren und im Landratsamt allerlei Beschwerden vorbrachten.
Daraufhin wurde Eva vor die Asylbeauftragte zitiert.
»Sie haben die Asylsuchenden zu beherbergen und sich ansonsten nicht einzumischen«, belehrte die sie.
»Wollt ihr mir einen Maulkorb verpassen?«, hatte Eva erbost gefragt.
»Nun seien Sie nicht so aufsässig«, war die Antwort gewesen.
So ging es noch eine Weile hin und her, dann dankte Eva ab. Für die Asylbewerberunterkunft in Zirnding wurde ein staatlicher Administrator eingesetzt, der sich allerdings nur selten blicken ließ und an den dort Untergebrachten oder deren Problemen verschwindend geringes Interesse zeigte, sodass letztlich alles beim Alten blieb. Die Sabo-Leute verschanzten sich auf der einen Seite einer unsichtbaren Trennwand, »Good Mama« und ihre Schützlinge auf der anderen.
Die sichtbarste Konsequenz ihrer Entscheidung zeigte sich darin, dass Eva ihre bisherigen Privatzimmer im ersten Stock räumte und das ehemalige Lager im Westflügel zu einer Wohnung für sich und Zita umbauen ließ. Das hatte zur Folge, dass drei weitere Quartiere für Asylbewerber frei wurden, die mal belegt waren, mal nicht.
Die am wenigsten sichtbare Konsequenz war Evas vervielfältigte Abneigung gegen Sabo. Der Kerl, fand sie, war abgefeimt. Alles war dem zuzutrauen. Alles bis hin zu Mord und Totschlag.
Und nun stand er ihr gegenüber. Musterte sie. Bohrte den Blick in das Paket, das unter ihrem Arm klemmte.
Eva schluckte.
Wie viel von dem, was sich vorhin abgespielt hatte, hatte er mitbekommen? Wie lange hatte er oben an der Treppe gestanden, hatte den Hals gereckt und die Ohren gespitzt? Lungerte auch seine Gefolgschaft dort oben herum? Würden sie nun über sie herfallen, ihr die soeben sichergestellte Tatwaffe entreißen und ihr damit den Schädel einschlagen, wie sie es bei Innocent getan hatten?
Sie zuckte zusammen, als Sabo plötzlich auf dem Absatz herumfuhr und den Zeigefinger in einen Aushang an der Pinnwand stach. »Erlaubt?«
Redete der Kerl mit ihr? Offenbar. Es war ja sonst niemand hier.
Langsam ging Eva auf, was Sabo wissen wollte. Es musste mit dem Aushang zu tun haben. Sie kniff die Augen zusammen, um erkennen zu können, um welchen es sich handelte. »Heilige Messe für unseren Mitbruder Innocent, der … von uns …« Das Todesdatum und was da sonst noch stand, schenkte sie sich, sie hätte es ohnehin auswendig hersagen können. Verwundert suchte sie Sabos Blick, der ihr wieder einmal unverwandt begegnete.
Bitte, blöd glotzen konnte sie auch. Sie starrte zurück.
Schließlich deutete Sabo zuerst auf sich, dann wieder auf den Aushang. »Erlaubt kommen zu Messe für Innocent?«
Was sollte das? Wollte Sabo auf einmal so tun, als wäre er gut Freund mit Inno gewesen? Wollte er mit seiner Teilnahme an der Gedenkfeier einen Beweis dafür liefern? Wollte er Trauer und Schmerz um den Ermordeten zeigen und damit allen zu verstehen geben, dass er Innocent Kuti niemals ein Härchen gekrümmt haben würde?
Oder war Sabo der Täter, und das schlechte Gewissen trieb ihn dazu, den Gedenkgottesdienst zu besuchen?
Sabo wartete noch immer auf eine Antwort.
Eva räusperte sich. »Jeder kann in die Kirche gehen. Wann er will und so oft er will. Aus einer Kirche wird niemand vertrieben – außer er hält sich nicht an die geltenden Regeln. Regeln muss man nämlich immer und überall einhalten.«
Unvermittelt wandte Sabo den Blick von ihr ab und begann sich im Eingangsbereich umzuschauen, als hätte er das Haus in diesem Augenblick zum ersten Mal betreten.
Eva konnte nicht anders, als seinem Blick zu folgen.
Betrat man dieser Tage das frühere Dorfwirtshaus von der Straße aus, die quer durch Zirnding von Saldenburg über Thurmansbang nach Schöllnach führte, dann gelangte man wie eh und je in ein weitläufiges Treppenhaus. Von dort aus ging es rechts in den ehemaligen Schankraum, der jedoch – laut Verordnung für das Gaststättengewerbe – nicht mehr als solcher benutzt werden durfte. Den Asylbewerbern war der Zutritt sogar strikt verboten. Hinter dem Schankraum lag die ehemalige Wirtshausküche, die den Burschen zum Kochen zur Verfügung stand. Sie war vom ersten Stock aus, wo die Zimmer und der Aufenthaltsraum lagen, über eine schmale Stiege zugänglich. Der ehemalige Kühlraum daneben war versperrt.
Wandte man sich im Treppenhaus nach links, dann gelangte man in einen kleinen Flur und durch ihn zu Evas Wohnung. Auch in diesem Flur gab es eine schmale Stiege. Sie führte zu einem Appartement, das für den vorgeschriebenen Hausmeister hergerichtet worden war, nachdem die ersten Asylbewerber eingetroffen waren und Karl Rucknagel den Job übernommen hatte.
Gegenüber der Haustür befand sich die Haupttreppe, die in den ersten Stock zu den früheren Pensionszimmern führte. Deren Fenster lagen teils zur Straße hin, teils zu dem riesigen, längst verwilderten Garten hinterm Haus, der sich bis an die Grenze einer Moorlandschaft hinunterzog.
Eva hatte es längst aufgegeben, dort nach dem Rechten zu sehen. Karl kümmerte sich darum, dass die Wege zwischen Büschen und Bäumen begehbar blieben. Manchmal sah sie einen der Afrikaner im Gesträuch verschwinden, dann wünschte sie ihm, er würde dort – wenigstens in seiner Phantasie – auf all jene Tiere treffen, die er aus seiner Heimat kannte.
Sabo hatte seinen Rundblick beendet. Er wandte sich wieder dem Aushang zu und begann, ihn zu studieren. Nach einer Weile tippte er auf das Datum und spreizte zwei Finger der rechten Hand ab.
Eva rechnete nach. »Ja, in zwei Tagen.«
Daraufhin nickte er kurz, spannte die Muskeln an und sprintete die Treppe hinauf.
Mit einem Schnauben wandte Eva sich ab, trat in den kleinen Flur, der ans Treppenhaus grenzte, ging an der Stiege vorbei, die zu Karl Rucknagels Appartement hinaufführte, öffnete ihre Wohnungstür und machte in der Diele dahinter halt.
Wohin mit dem Trumm?, fragte sie sich, zog es unter dem Arm hervor und wog es in der Hand.
»Was hast denn da für ein Packel? Ist da der Fisch vom Ottmar sein Weiher drin, den er uns versprochen hat?«
Eva fuhr herum. »Scheiße, Mann. Musst du mich so erschrecken?«
Karl Rucknagel schloss die Tür hinter sich und schaute sie empört an. »Man wird ja noch was fragen dürfen.«
Eva bemühte sich hastig um einen konzilianten Gesichtsausdruck. Sie wollte Karl nicht komplett vergraulen. Seit er da oben eingezogen war, hatte sie ihm ohnehin eine Illusion nach der andern geraubt.
Karl war ein tüchtiger Handwerker, keine Frage. Gründlich – manches Mal allzu gründlich –, verlässlich, besonnen. Ohne ihn zurechtkommen zu müssen war für Eva kaum vorstellbar.
Aber ihn heiraten? Ganz gewiss nicht.
Nein, eine Liebesbeziehung kam ebenso wenig in Frage.
Und nein, auch keine geschäftliche Partnerschaft.
Wirtshaus und Pension waren ja längst passé, und die Herrschaft über das daraus entstandene Asylbewerberheim wollte Eva sowieso nicht mehr zurückhaben. Die Abmachung mit Karl hatte von Anfang an gelautet: freie Wohnung gegen Hausmeisterservice. Eva hatte nicht vor, das Geringste daran zu ändern. Weder in der einen noch in der anderen Richtung.
Doch so wenig sie Karl privat und persönlich näherkommen wollte, so gern sah sie ihn als Mann im Haus. Er besaß eine tiefe, dröhnende Stimme, die auf die jungen Afrikaner nachhaltig Eindruck machte. Sein kräftiger Körperbau und die buschigen Brauen über tiefliegenden Augen, die ihm ein beinahe despotisches Aussehen gaben, taten ein Übriges, ihm einen Respekt zu verschaffen, den die Bewohner Eva bei aller Liebe niemals entgegenbringen würden.
Karl griff nach dem Paket. »Gib her, ich filetier dir den Fisch. Dann kannst nachher einfrieren, was du nicht gleich verwenden willst.« Er brachte das Paket an sich und wog es in der Hand. »Ganz schön schwer.«
Eva entriss es ihm wieder. »Der Fisch liegt schon im Waschbecken in der Küche.«
»Und was ist dann da drin?«, fragte Karl.
»Nix, was dich was angeht.« Mist, warum war ihr Mundwerk immer schneller als ihr Hirn? So würde Karl sich gewiss nicht abspeisen lassen. Er arbeitete nicht nur gründlich, er ging allem penibel auf den Grund. Würde er noch mal fragen oder einfach nachsehen?