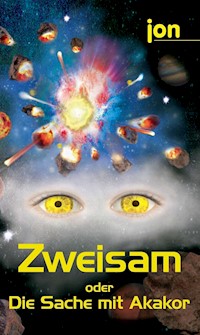
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
„Zweisam“ oder "Die Sache mit Akakor"- Sience-Fiction-Roman Raumflüge können echt langweilig sein, vor allem, wenn sie im äußeren Sol-Arm der Milchstraße, einem sternenarmen Gebiet also, stattfinden. Trotzdem hätte Captain Michaela Brauer gern darauf verzichtet, von einem Geistwesen belästigt zu werden, aus dem Orbit eines explodierenden Planeten flüchten zu müssen und diverse Besatzungsmitglieder zu verlieren. Aber das Leben ist nun mal kein Wunschkonzert – auch nicht im 24. Jahrhundert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 328
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Zweisam oder Die Sache mit Akakor
© 2014 Ulrike Jonack / jon
Umschlaggestaltung: Berthold Sachsenmaier
Verlag: tredition GmbH, Hamburg (2014)
ISBN:
978-3-8495-8422-1 (Paperback)
978-3-8495-8423-8 (Hardcover)
978-3-8495-8424-5 (e-Book)
Printed in Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
jon
Zweisam
oder
Die Sache mit Akakor
KAPITEL 1
Es war heiß. Blut tropfte in den Sand. Schwarzrot und schwer. Es sammelte sich zu einer Kuppel, die wuchs und wuchs und wuchs. Lebendiger Granat – Michaela konnte den Blick nicht davon abwenden. Dabei fühlte sie sich schuldig. Der Tod sollte sie nicht so faszinieren, doch sie war unfähig, sich ihm zu entziehen.
Der Wüstenwind strich ihr über die Stirn, über die Arme. Er strich über ihren Leib und rieb ihr den Geruch erhitzter Körper auf die Haut. Sie wandte sich um und sah eine Gestalt sich über das sterbende Raubtier beugen. Das Fell des Vacha schimmerte samten, forderte Berührung.
Michaela ließ sich nieder, streckte die Hand aus. Jemand griff nach ihr, hinderte sie. Sie schaute auf in das Gesicht des Mannes. Es war fast vollständig verhüllt. Mandelförmige Augen wiesen den Mann als Kara aus.
Michaelas Handgelenk begann zu schmerzen, sie versuchte, sich dem Griff zu entwinden. Vergeblich.
„Sieh!“, sagte der Kara mit der rauen Stimme der Wüstenbewohner. „Sieh her!“
Und Michaela sah: Der Vacha erhob sich und lächelte. Der goldene Samt glitt von ihm ab und entblößte bronzen schimmernde Haut, die sich makellos über festes Fleisch spannte. Muskeln spielten erwartungsvoll. Hitze sammelte sich in Michaelas Leib, sie spürte eine Hand sich darauf senken. Eine große heiße Hand. Die sie kaum berührte. Unerträglich nah. Glühend. Schmerz versprechend. Versprechend. Ver…
Michaela Brauer fuhr auf. Ihr Atem ging schwer und viel zu laut in der Dunkelheit ihrer Kabine. Sie fühlte die Hitze aus ihrem Körper rinnen und sich im Schwarz der Nacht verlieren. Sie versuchte, dieses Gefühl noch einen Moment länger zu halten, wissend, dass es nicht gelingen würde. Dann erst griff sie hinüber zum Nachtschränkchen und machte Licht.
Sie sah zur Uhr. Es war kurz vor sechs. Zu zeitig zum Aufstehen, zu spät, um noch mal einzuschlafen. Unschlüssig darüber, was sie tun sollte, blieb Brauer auf der Bettkante sitzen und dachte über den Traum nach. Sie konnte sich nicht erklären, wie sie gerade auf eine Vacha-Jagd kam. Sie hatte bei ihren Besuchen auf Warén nur einmal eines dieser Raubtiere gesehen. Der Anblick war erschreckend genug gewesen, sie hatte dankend abgelehnt, als Imnoi ihr anbot, an einer Vacha-Jagd teilzunehmen.
Das war nun auch schon wieder über drei Jahre her. Damals dachte Brauer noch, sie würde mit ihrem eben erworbenen Kommandobrief bestenfalls vom Copiloten zu Piloten aufsteigen. Kaum auf der Erde zurück, hatte man ihr jedoch den Captainsposten auf dem neuesten Galaxy-Ship angetragen. Sie hatte sofort zugesagt und es bis heute nicht bereut. Die GS5 Explorer war ein gutes Schiff.
Zur Zeit war es nur ein bisschen langweilig auf diesem Schiff. Hier draußen, im äußeren Bereich des Sol-Armes, war einfach nichts los. Die meisten Erfolge konnten die Astronomen melden: Sie hatten ein paar neue Sterne entdeckt. Weit, weit entfernt. So weit, dass nicht einmal die Astronomen selbst darüber begeistert waren – sie konnten kaum mehr als die bloße Existenz der Sterne feststellen. Und gestern hatte die Explorer einen Gasnebel durchquert, der so dünn war, dass sich Chefastronom Luang, ein kleiner, quirliger Koreaner, und Isaac Sauders nicht einig werden konnten, ob es überhaupt ein Nebel war.
Brauer lächelte, als sie sich an die Szene erinnerte: Luang hatte mit Händen und Füßen argumentiert, der große, beinahe bullige Sauders hatte sich das von oben herab angesehen und dann gesagt: „Es taugt nicht als Navigationsmarke, also ist es für mich kein Nebel.“ Gegen dieses Argument des Piloten konnte Luang nichts setzen. Was ihn nicht daran hinderte, es dennoch zu versuchen. Alle hatten sich prächtig über den Anblick der ungleichen Duellanten amüsiert. Außer den Warénern natürlich.
Die Waréner. Der einzige Punkt auf dieser Reise, der Brauer von Anfang an nicht behagte. Immer, wenn sie an die beiden Kara dachte, fühlte sie sich missgestimmt. Sie hatte keine Ahnung, woran das lag. Fremdheit konnte es nicht sein: Imnoi kannte sie von ihren Besuchen auf Warén und weder er noch Mit’Xitlan fielen in der bunt gemischten Besatzung besonders auf. Wenn sie nicht gerade ihre typischen blauen Roben trugen, hätte man sie für klassische Südamerikaner halten können. Auf den ersten Blick zumindest. Spätestens wenn man ein Gespräch mit ihnen beginnen wollte, merkte man allerdings den Unterschied: Die beiden waren kühl, wortkarg und humorlos. Und man hatte ständig das Gefühl, von ihnen beobachtet zu werden. Brauer zumindest ging es so.
Sie lehnte sich in ihrem Sessel zurück und sah aus dem Fenster. Ganz am Rand kroch ein Stern aus dem Sichtfeld, mehr verriet nicht, dass sich das Schiff bewegte. Dieses Gefühl, nicht vorwärts zu kommen, machte Brauer nervös. Es war, als wüchse etwas in ihr, etwas, das sie sprengen würde. Jetzt gleich oder morgen. Irgendwann. Vor allem aber ohne Gewissheit, ob sie dabei nur eine alte Hülle abstreifen oder sterben würde. Es war das gleiche Gefühl wie von den Warénern beobachtet zu werden. Was suchten sie in ihr?
Ein unbestimmter Druck breitete sich hinter Brauers Stirn aus und wuchs sich allmählich zu einem leichten aber lästigen Schmerz aus. Sie rieb sich die Schläfen. Es war eher ein Instinkt, als dass es wirklich Linderung gebracht hätte. Sie tat es trotzdem, hörte auch nicht auf, als ihr bewusst wurde, dass es schon gestern nicht geholfen hatte. Der Schmerz hatte sie den ganzen Nachmittag lang unkonzentriert sein lassen. Nicht, dass irgendetwas ihre volle Aufmerksamkeit erfordert hatte, aber es gab kein gutes Bild ab, wenn der Captain geistesabwesend wirkte. Vielleicht, so überlegte Brauer und stand auf, sollte sie ihre Prinzipien Prinzipien sein lassen und den Schmerz nicht einfach hinnehmen, sondern sich etwas dagegen geben lassen.
Jetzt, da sie endlich einen Entschluss gefasst hatte, fühlte sie sich etwas besser. Auf dem Weg zur Krankenstation atmete sie ein paarmal tief durch und auch wenn der Druck hinter der Stirn davon nicht verschwand, erschien er ihr nun doch erträglicher. Vielleicht, dachte Brauer, lag das aber auch nur an der Aussicht, gleich Leo zu treffen.
Leonard Cohen war Arzt und galt als Kara-Experte. Er selbst mochte das Wort nicht, seiner Meinung nach konnte bestenfalls ein Kara das subtile Zusammenspiel verstehen, das zwischen der karanischen Physis und der durch den jahrhundertelang praktizierten Kontakt zu den Wahren Herrschern geprägten Psyche der Kara existierte. Mehr noch: Genau genommen verdienten nur die Wahren Herrscher den Titel Kara-Experte, schließlich waren es diese nichtstofflichen Wesen, die seit Generationen für die Gesundheit der Kara sorgten. Nicht ganz uneigennützig, denn sie konnten zwar den Nanokosmos manipulieren, die Hallen jedoch, die sie zum Schutz brauchten, mussten Kara mittels ganz profaner körperlicher Arbeit errichten und instand halten.
Cohen wurde nicht müde, auf diese Tatsachen hinzuweisen, und zu erklären, dass er bei seinen Studien auf Warén nicht mit den wirklichen Experten, eben jenen Wahren Herrschern, hatte kommunizieren können. Er war, wie die meisten Menschen, psi-blind. Er erinnerte immer wieder daran, dass er sich alles nur angelesen hatte, die Sache mit dem Mentalschild und dem Gefühle- und Gedankenspüren nicht wirklich begriff und dass das alles überhaupt schrecklich diffizil sei und er nur Arzt war, kein Wunderdoktor. All das hatte ihn allerdings nicht davon abgehalten, auf die Explorer zu kommen – und zwar in eben jener Funktion als Experte, falls Imnoi und Mit’Xitlan medizinische Hilfe brauchen sollten.
‚Wenigstens etwas, wozu die Waréner gut sind‘, dachte Brauer und fühlte, wie sich ihre Stimmung wieder verdüsterte. Die Erkenntnis, dass sie den beiden Kara mit dieser Aussage unrecht tat, machte sie noch ärgerlicher. Bevor die Waréner an Bord gekommen waren, hatte sie nie mit solchen dummen Sprüchen hantiert! Es war zum …!
Brauer unterbrach sich, sie hatte die Krankenstation erreicht. Bevor sie die Tür öffnete, holte sie noch einmal tief Luft. Weder Cohen und erst recht nicht der Chefarzt, Dr. Yongbo Tian, sollten etwas von ihrer Verstimmung bemerken.
Ihre Sorge war unbegründet, es war niemand da. Einen Augenblick lang blieb Brauer mitten im Sprechzimmer stehen und fragte sich erfolglos, was sie nun tun sollte. Wieder gehen und den Kopfschmerz einen weiteren Tag lang ertragen oder warten? Oder Cohen über Bordfon rufen? Vielleicht schlief er ja noch. Brauer stellte fest, dass sie nicht wusste, was für eine Schicht Cohen heute hatte. Und wann für die Ärzte die reguläre Frühschicht überhaupt anfing. Natürlich hatte immer einer der beiden Bereitschaft, eigentlich hatten beide immer Bereitschaft, es gab ja nur zwei Ärzte an Bord. Es gab natürlich noch hochqualifizierte Schwestern, aber … Als Captain musste sie das alles eigentlich wissen. Und eigentlich wusste sie es ja auch. Nur jetzt nicht. Oder vielleicht dachte sie nur, dass sie es wusste. Oder dass sie es jetzt nicht wusste. Vielleicht … Brauer verlor den Faden. Sie fühlte sich, als würde ihr gleich schwindelig werden, und setzte sich vorsichtshalber auf den Stuhl am Schreibtisch.
‚Also doch warten‘, dachte sie und rückte sich bequemer auf dem harten Stuhl zurecht.
Da trat Cohen ein. Er sah sie überrascht an, das wasserhelle Blau seiner Augen betonte diesen Eindruck noch. „Micha?“
„Gut erkannt.“ Sie stand auf. „Ich wollte mal testen, ob du pünktlich bist.“
Er reichte ihr die Hand. „Und hab ich bestanden? Guten Morgen erstmal.“
„Morgen. Ja, hast du.“ Sie folgte Cohen, der ins Behandlungszimmer ging und dort einige Geräte anschaltete. „Bist du allein heute Vormittag?“
„Schwester Kristine kommt um neun.“ Er wandte sich Brauer zu. „Warum?“
„Nur so. Ehm … Weshalb ich hier bin: Hast du ein Kopfschmerzmittel oder so für mich?“
„Klar. Setz dich!“ Er wies auf einen Stuhl.
Brauer nahm Platz.
Cohen kramte in einem der Wandschränke.
„Was Leichtes reicht.“
Er kam zu Brauer und hielt ihr ein Messgerät an die Stirn.
„Ich brauche nur was gegen Kopfschmerzen, Leo“, sagte Brauer und versuchte aufzustehen.
Cohen drückte sie auf den Sitz zurück. „Ich bin hier der Arzt. Also bitte, Micha!“ Er fuhr damit fort, ihr Temperatur und Puls zu messen.
„Ich muss zum Dienst“, wandte sie ein. Es war eine rhetorische Bemerkung, sie wusste, dass sie Cohen damit nicht beeindrucken konnte.
„Ja sicher.“ Er wechselte die Gerätschaft und piekste Brauer ins Ohrläppchen.
„Au! Musste das sein?!“
Er nickte, ganz in seine Arbeit vertieft.
Brauer versuchte es anders: „Macht es Spaß, den Chefarzt zu spielen? Du bist doch bloß froh, dass Tian heute erst zur Spätschicht hier auftaucht!“
Wieder nickte er.
„Halloo?! Hast du gehört, was ich gerade gesagt habe?“
Jetzt erst sah Cohen auf. „Ich bin ja nicht taub.“
Brauer lächelte ihn demonstrativ an.
Cohen ging nicht darauf ein. „Du hast dir ’ne Marsgrippe eingefangen. Leg dich hier hin.“ Er wies auf die Pritsche unter der Diagnosetafel.
„Das ist nicht dein Ernst!“
„Doch.“
„Warum bist du heute so zickig?“
„Ich bin nicht zickig, ich bin Arzt. Dein Arzt, um genau zu sein. Also bitte!“
„Eine Volldiagnose. Wegen einer Marsgrippe.“
„Wegen einer Marsgrippe“, bestätigte Cohen. Er stemmte sich mit beiden Händen auf den Armlehnen an Brauers Stuhl ab, so dass sie etwas zurückweichen musste. „Micha, du schleppst die Grippe schon ein paar Tage mit dir herum. Ich bin nicht blind. Du bist müde und abgespannt und mürrisch. Ja“, wischte er ihren Einwand fort, „mürrisch. Es gibt Schlimmeres als einen mürrischen Captain und zwar einen müden unkonzentrierten Captain.“
„Das liegt nicht an der Grippe …“
„Woran auch immer: Ich bin an Bord der Arzt des Captains und ich verordne dem Captain eine Ruhepause. Geh ins Bett, kurier dich aus, mach mal Pause!“
„Pause. Wovon denn, Leo?! Hier ist doch nichts los.“
„Dann mach Pause von Nichtsmachen! Und jetzt leg dich da hin und lass mich nachsehen, wieso diese Grippe dich schon so lange plagt!“
Sie gab auf und legte sich unter die Diagnosetafel. Während Cohen an allen möglichen Rädchen drehte, sich irgendwelche Daten notierte und mit anderen verglich, die er von der Tafel ablas, glitten Michaelas Gedanken ab.
Vielleicht hatte Leo recht, sie musste mal ausspannen. In ihr war immer noch dieser Groll, der, wenn sie ehrlich war, schon im Urlaub vor dieser Reise begonnen hatte. Das heißt, ein richtiger Urlaub war es ja nicht gewesen. Die Zivile Globalkontrolle hatte sie und alle anderen, die jemals auf Warén gewesen waren, nach Kabul beordert. Dort hatte sich Brauer fast sofort zwischen den Fronten der Integrationsbefürworter und der Integrationsgegner wiedergefunden. Sie hielt die Diskussionen für Zeitverschwendung. Es war – gelinde gesagt – albern: Dreizehn Monate nach der Gründung des Terranischen Bundes stritt man noch immer, ob Warén vollwertiges Mitglied sein sollte. Natürlich hatte man es auf Erde, Mars und Wöltu mit Menschen, auf Warén dagegen mit Kara und Wahren Herrschern zu tun. Aber bitte! Entweder es war ein Bund mit der Erde als Hauptsitz, dann konnte Warén doch vollwertiges Mitglied sein, oder nur eine Sammlung von menschlichen Kolonien! Und was um alles in der Welt war denn so verwerflich daran, dass sich zwanzig Kara – Mitglieder im Bund oder nicht – aufgemacht hatten, eine für sie neue Welt, die Erde nämlich, kennenzulernen? Als Captain Hewlett diese zwanzig Forscher an Bord nahm, tat er das doch nicht, um sich in die Belange Waréns einzumischen! Und ausgerechnet einer dieser Kara – Imnoi – stellte sich vor den Ausschuss und sagte, das Weggehen der zwanzig sei vom Hohen Rat Waréns mit … wie hatte er es ausgedrückt? … „nicht mit Wohlwollen bedacht worden“. So ein …!
„Reg dich ab, Micha! Mein Gott, dein Puls rast, als würdest du in den Kampf ziehen wollen.“
„Entschuldige. Ich war mit den Gedanken grade woanders.“
„Das war nicht zu übersehen. Worum ging es denn?“
Brauer winkte ab. „Nicht so wichtig. Und?“, wechselte sie das Thema. „Wann muss ich sterben?“
Cohen schwenkte die Diagnosetafel zur Seite. „Es scheint alles in Ordnung zu sein. Zumindest, was die organische Seite angeht.“
Brauer richtete sich auf. „Aber?“
„Du stehst unter Stress, dein Körper konzentriert sich nicht darauf, die Grippe auszuheilen.“
„Na, so ein böser!“ Sie stand auf. „Was machen wir denn da?“
„Du machst mal Pause und ich mache mir Gedanken, was diesen Stress ausgelöst haben könnte.“
Brauer verdrehte die Augen.
„Micha, du bist nicht der Typ, der bei Langeweile Stress kriegt. Vielleicht ist irgendwas im Psi-Raum …“
„Och bitte! Leo! Ich bin ein Mensch, kein Kara. Mir ist der Psi-Raum, wie du das nennst, ziemlich egal.“
„Du bist sensibel dafür, Micha, ob du es willst oder nicht.“
„Ja“, räumte sie ein und trat vor den Spiegel über dem Waschbecken, um sich die Haare zu ordnen. „Aber deshalb mach ich nicht krank. – Seit wann ist der Spiegel golden?“
„Golden? Der Spiegel?“
„Meine Haare sehen aus wie aus Messing.“
„Die sehen immer … Du lenkst ab!“
Sie drehte sich um und grinste.
„Im Ernst, Micha, du bist krank. Du hast eine verschleppte Marsgrippe. Und deshalb legst du dich ins Bett.“
„Tu ich das.“
Er nickte.
„Ich bin der Captain dieses Schiffes und … “
„… und dieses Schiff kommt auch mal drei Tage ohne dich aus.“
„Aber ich nicht ohne die Arbeit.“
„Eben sagtest du noch, es sei nichts zu tun.“
„Seit wann nimmst du mich beim Wort? Bitte, Leo, ich kann nicht einfach so nichts machen.“
„Mach doch was von dem, von dem du mir sonst immer vorjammerst, dass du nicht dazu kommst: Bücher, Bilder, Fachartikel … Dein Tagebuch, in das du schon ewig nichts eingetragen hast. Oder dein Bruder, der bis heute nicht weiß, wie du sein vorvorletztes Konzert gefunden hast.“
„Ja, ja!“, winkte Brauer resignierend ab. „Aber wenn ich vor Langeweile durchdrehe …“
„… bin ich als dein Arzt sofort zur Stelle. Ab jetzt in dein Quartier!“
„Okay. Ich gehe nur schnell in der Zentrale vorbei und sage Boor Bescheid, dass ich …“
„Nichts da! Ich werde den Ersten Offizier informieren. Du gehst in dein Quartier und machst dir einen faulen Vormittag. Ich komme dann halb zwölf und hole dich zum Mittagessen ab.“
Brauer gab die Gegenwehr auf. „Na gut.“ Der Gedanke, mal für drei Tage nicht Captain zu sein, gefiel ihr plötzlich. Sie fühlte sich leicht.
In dieser Stimmung erreichte sie ihr Quartier. Sie beschloss, sich Tee zu kochen. Im Vorbeigehen tippte sie das Radio an. Die Einrichtung eines ständigen Musik- und Informationskanals in den Kommunikationsleitungen des Schiffes ging auf Cohen zurück. „Das ist gut für die psychische Gesundheit“, hatte er seine Idee dem Ersten Offizier gegenüber verteidigt. Jason Boor hatte kein Gegenargument gewusst und dem Antrag mit gemischten Gefühlen stattgegeben. Inzwischen stellte das Radioteam drei komplette Programme zusammen, die nahezu rund um die Uhr „gesendet“ wurden.
Brauer landete mitten in einem Hörspiel. Sie erkannte Jake Kennys Stimme und regelte die Lautstärke nach, um auch in der Kochnische zuhören zu können. Sie brühte sich Earl Grey auf, genau ein großes Glas voll und nach einem strengen Ritus. Die Teestunde war ihr heilig. Fast heilig. Wichtig genug, um einen gewissen Aufwand dabei zu treiben. Natürlich nicht wichtiger als ihre Arbeit. Und auch nicht so wichtig, dass sie Freunde deshalb vor der Tür stehen lassen würde. Also eigentlich war der gelegentliche Earl Grey nicht mehr als ihre Standard-Prozedur zum Entspannen. Und es funktionierte immer wieder.
Brauer nippte am heißen Tee und stellte fest, dass sie noch immer auf Jake Kennys Stimme lauschte, ohne zu begreifen, was der Mann eigentlich sagte. Sie bemühte sich, besser aufzupassen, und war Sekunden später in ihrem Sessel eingeschlafen.
Es fiel Imnoi schwer, sich zu konzentrieren. Er hatte nicht gut geschlafen und es war schwieriger als sonst, all die Geräusche zu ignorieren, die durch die dünnen Schiffswände hindurch von überall her in sein Bewusstsein drängten. Mit’Xitlan war es wohl ähnlich ergangen, er hatte die morgendliche Meditation schon nach wenigen Sekunden abgebrochen und hantierte nun in der Kochecke. Imnoi versuchte, auch das zu ignorieren. Er schloss das letzte Band an seiner Robe, drapierte seinen Zopf formgerecht über Schulter und Brust und betrat die Altarnische.
Dort entzündete Imnoi das Öllicht. Der flackernde Schein brach sich im Kristall auf dem Altar und warf einen unruhig tanzenden Fleck auf die kleine weiße Stele, die das Zentrum des Arrangements bildete. Ein schwerer Duft entströmte der Flamme. Imnoi zog sich das hellblaue Kissen heran, ließ sich auf die Knie nieder, legte seine Hand um die Stele und senkte den Kopf.
Stille stieg auf. Sie schuf einen Raum zwischen den Realitäten, zwischen den Sphären der stofflichen und nichtstofflichen Welt. Jenen Raum, den ein Kara betrat, wenn er mit den Wahren Herrschern Kontakt aufnehmen wollte, um sich Rat oder Beistand zu holen. Beistand konnten die beiden Kara brauchen, seit sie gemeinsam mit den anderen Warén verlassen hatten, denn die Welt der Menschen war verwirrend laut und bunt. Kaum jemand auf Terra oder dem Mars machte sich die Mühe, seine Gedanken und Gefühle abzuschirmen, von den unabgeschirmten Energien der terranischen Technik ganz zu schweigen. Selbst hier, so weit entfernt vom Sol-System, schienen die Echos in der Zwischensphäre nachzuhallen und die Präsenz der Wahren Herrscher zu übertönen.
So war es natürlich nicht. Imnoi wusste durchaus, dass das, was er hier als glühende Bänder und Flüsse wahrnahm, was er hier als undeutliches aber unüberhörbares Gemurmel empfand, allein von diesem Schiff und den Menschen darauf stammte: gesprochene Worte und gedachte, Gedankenfetzen und Emotionswellen und immer wieder die glühenden Stränge der Energieleitungen und die bunten Funken der Schiffselektronik. Selbst wenn ein Wahrer Herrscher hier gewesen wäre, fern der schützenden Hallen auf Warén, er hätte in diesem Durcheinander der Auren alle seine Kraft zum Überleben gebraucht, wäre nicht in der Lage gewesen, die Zwischensphäre aufzusuchen, geschweige denn, mit den Kara zu kommunizieren.
Dennoch genoss Imnoi die morgendliche Meditation. Sie vermittelte ihm trotz allem ein Gefühl von Vertrautheit. Manchmal formten sich in der Zwischensphäre sogar Muster, Bilder, etwas, was einem Kontakt nicht unähnlich war. Vielleicht berührte er in diesen Sekunden das Unterbewusstsein eines Besatzungsmitgliedes, vielleicht wurde dieser Eindruck auch durch das Zusammenspiel verschiedener zufälliger Effekte erzeugt. Wie auch immer – es wirkte real und in der Regel ließ sich Imnoi darauf ein.
So wie jetzt …
… da ihn arhythmisch wabernde Lichter umfingen. Ein Geruch nach schwelendem Kunststoff lag schwer im Raum und im Hintergrund war ein Atmen, tief und fordernd. Imnoi drehte sich danach um. Er nahm einen Blick wahr, der ihn durch das unruhige Glühen der Energien hindurch traf. Noch ehe Imnoi sie sehen konnte, wusste er, dass es karanische Augen waren, die ihn beobachteten. Dann fiel er in das Schwarz dieser Augen. Ein wohlig vertrautes Gefühl umfloss ihn, streichelte ihn. Duftete nach Wind und Hitze und nach seidigem Frauenhaar. Es hüllte sie ein – ihn und Tnom. Draußen schrie ein Vacha. Imnoi spürte Jagdfieber in Tnom zucken und umschlang sie. Wissend, dass er sie nicht halten konnte. Sie war längst fort. Gestorben. Vor langer, langer Zeit. Er spürte wieder die Tränen, die er nie vergossen hatte, und dass jemand seinen Kopf in die Hände nahm. Ihn zwang, aufzuschauen. In ein menschliches Gesicht, flach und farblos und stupsnasig. Mit grauen Augen, wie aus Samt und Glas. Er spiegelte sich darin. Sah, dass hinter ihm etwas war. Doch er konnte sich nicht umwenden. Er hatte nichts als den grauen Samt als Spiegel, in dem er den Reflex von etwas Grüngelbem gewahrte. Grüngelbe Lichter, ein Paar. Tunnel, die ihn aufsaugen wollten und aus denen ihm jemand entgegenkam. Eine Frage, die ihn nicht ganz erreichte und die doch an ihm zog und zerrte …
Dann schlug Imnoi irgendwo hart auf.
Als er wieder zu sich kam, hatte Mit’Xitlan den Deckenstrahler eingeschaltet. Die Helle machte den Altartisch klobig und den Kristall stumpf. Das Öllicht blakte.
Mit’Xitlan beugte sich über Imnoi, er blickte besorgt.
Imnoi versuchte, nicht verwirrt zu sein, und richtete sich auf. Er löschte das Öllicht und schlug alle Altargegenstände in das Zeremonientuch ein. Mit’Xitlan ließ ihm die Zeit.
Erst als Imnoi alles verstaut, das Kissen formgerecht an den Altarsockel gelehnt und die Tür zur Nische geschlossen hatte, fragte Mit’Xitlan: „Was ist geschehen?“
Imnoi zögerte. Auf Warén war es nicht üblich, sich über Erlebnisse in der Zwischensphäre auszutauschen, bestenfalls enge Vertraute taten dies gelegentlich. Dies hier war allerdings nicht Warén und jemand Vertrauteren als Mit’Xitlan hatte er auf der Explorer nicht.
Mit’Xitlan wandte sich ab, dem Frühstück zu, das er ihnen bereitet hatte. Er brachte das Tablett zum Tisch, legte die Gedecke auf. Er wirkte ganz darin vertieft, doch Imnoi konnte die Anspannung spüren. Er setzte sich und sagte: „Ich bin nicht sicher, was geschah. Ich scheine so etwas Ähnliches wie eine Begegnung erlebt zu haben.“
Mit’Xitlan sah ihn überrascht an. „Hier?“
„Wie ich bereits sagte: Ich bin nicht sicher. Das meiste, das, was ich klar zuordnen konnte, war die Projektion von Erinnerungen.“ Er goss ihnen Tee ein.
Mit’Xitlan machte sich nicht die Mühe, sein Nichtverstehen zu verbergen. „In der Zwischensphäre? Ich habe nie davon gehört, dass sich dort Erinnerungen manifestieren.“
„Ich habe davon ebenfalls nie reden hören. Doch ich begegne Tnom dort. Der Logik nach fußt dies auf meiner Erinnerung. Es sei denn, die Menschen, die an ein Weiterleben der Seele nach dem körperlichen Tod glauben, hätten recht. Wofür ich keinen Beweis sehe. Was den anderen Teil meines Erlebens angeht, den Teil, den man als Begegnung interpretieren könnte …“
„Interpretieren?“ Mit’Xitlans Verwirrung stieg spürbar.
„Es war eher das Gefühl der Präsenz einer Frage“, versuchte Imnoi zu erklären, „weit entfernt vom Wahrnehmen eines tatsächlichen Bewusstseins.“
Mit’Xitlan runzelte die Stirn.
Imnoi fiel die Geste auf, denn sie war für einen Kara ungewöhnlich. Andererseits hatten sie schon so viel von den menschlichen Angewohnheiten übernommen, warum also nicht auch das. Er merkte, dass seine Aufmerksamkeit sich in diese Richtung bewegen wollte, und konzentrierte sich. „Die Zwischensphäre, die wir von hier aus betreten können, ist voller Echos aus dem All und dem Schiff. Wir waren die ruhigen Sphären Waréns gewohnt, was wir dort wahrnehmen, haben wir zu erkennen gelernt. Vielleicht sind wir den Menschen auch in psychischer Hinsicht ähnlich, ähnlicher als wir dachten zumindest, und neigen, ohne dass wir es bisher wahrhaben wollten, dazu, Unbekanntes in vertraute Formen umzudenken. Vielleicht ist das, was ich als Frage empfand, nichts als eine bisher noch nie gespürte Ausstrahlung eines technischen Details des Schiffes. Oder das Echo aus einem menschlichen Bewusstsein. Oder die Widerspiegelung eines kosmischen Phänomens.“
„Das ist logisch“, räumte Mit’Xitlan ein und wandte sich seinem Frühstück zu. Er trank von seinem Tee und nahm sich ein Croissant. Anders als sonst bestrich er es nicht mit Marmelade, sondern biss einfach so hinein.
„Du bist besorgt“, stellte Imnoi fest.
Mit’Xitlan blickte ihn wie ertappt an.
„Es ist offensichtlich und zwar nicht erst seit heute. Du meditierst kaum noch und wenn, dann verlässt du die Zwischensphäre beinahe fluchtartig. Ich kann deine nächtlichen Albträume spüren und selbst tagsüber forschen deine Gedanken immer wieder, ob Gefahr droht. Was, mein Freund, fürchtest du?“
„Ich weiß es nicht“, antwortete Mit’Xitlan. „Ich spüre diese …“, er legte das Croissant auf den Teller, „… Sorge in mir, aber ich weiß nicht, worum ich mich sorge. Wenn ich versuche, mich darauf zu konzentrieren, erfassen mich Strudel von Irritation und Fremdheitsgefühlen. Sie zerren mich fort. Anfangs, als ich mich noch darauf einließ, konnte ich nur unter großen Mühen die Zwischensphäre wieder verlassen, und fühlte mich danach völlig erschöpft.“
„Das habe ich bemerkt. Ich nahm jedoch an, es hätte mit der Grippe zu tun.“
„Ich war nicht erkrankt. Du warst anwesend, als Dr. Cohen uns die Testergebnisse mitteilte.“
„Ja.“ Er musterte Mit’Xitlan. Auch so eine menschliche Angewohnheit, die auf Warén als unpassend empfunden worden wäre. Wahrscheinlich sogar mehr als das. Ein so offenkundiges Mühen, in den anderen hineinzusehen, galt als außerordentlich unhöflich oder gar feindselig.
„Meinst du, ich sollte Dr. Cohen konsultieren?“
Imnoi schreckte auf. „Dr. Cohen? Nein. Nein, ich denke, er kennt sich zu wenig aus in diesen Dingen. Er weiß mehr darüber als die anderen Menschen an Bord, den Captain einmal ausgenommen, aber … Nein. Nein, du solltest einfach vorerst die Zwischensphäre meiden. Dich erholen.“ Etwas am Klang seiner eigenen Worte irritierte Imnoi, aber der Eindruck verflog rasch wieder. „Versuche einfach, nicht nach der Gefahr zu forschen. Vielleicht ist es ja nur die Angst, vor der du dich fürchtest. Konzentrieren wir uns auf unsere Ausbildung. Wir sollten noch einmal die Funktionen der Sensorüberwachung repetieren, bevor unser Dienst in der Zentrale beginnt.“
Ja“, bestätigte Mit’Xitlan und straffte sich. „Du hast recht. Konzentrieren wir uns darauf.“
In der Zentrale der Explorer herrschte morgendliche Stille. Jason Boor saß im Captainssessel und leistete es sich, Erinnerungen nachzuhängen. Er dachte an Sylvia, seine Ehefrau. Sie hätte heute Geburtstag gehabt. Das Paar hatte diesen Tag immer mit einem kleinen Ritual gefeiert: Boor hatte eine rote Blüte besorgt, neben eine himmelblaue Kerze gelegt und Marswein serviert. Dann hatten sie sich aneinandergekuschelt und Bachs Brandenburgische Konzerte gehört. Meist beschlossen sie nach zehn oder fünfzehn Minuten, den grässlichen Wein wegzuschütten und sich doch etwas Gutes zu gönnen. Manchmal aber tranken sie die ganze Flasche leer, so wie bei ihrem ersten gemeinsamen Abend, als die Qualität des Weines unwichtig für sie gewesen war.
Sie waren glücklich gewesen. Boor hätte nicht mehr sagen können, was er damit meinte, aber er wusste, dass es so gewesen war. Selbst als Sylvia ihm zu liebe auf dem Galaxy Ship 1, der Hope, angeheuert hatte und alle prophezeiten, sie würden sich bald auf die Nerven gehen, waren sie glücklich gewesen. Boor lauschte in sich hinein, suchte nach der Erinnerung, wie es sich angefühlt hatte. Wollte es noch einmal auskosten, heute, an Sylvias Geburtstag. Doch ein anderer Tag drängte sich ihm auf, eine andere Stunde. Zu der die Menschen von der Existenz der Föderation und der Nugroma erfuhren. Als die Hope ohne Vorwarnung von beiden beschossen wurde, weil jeder in ihr den Feind vermutete. Boor war leicht verletzt worden. Sylvia starb. Sie war nicht das einzige Opfer gewesen, aber das machte es nicht leichter …
Ein sanftes „Pling“ fiel in die Stille der Zentrale und schreckte Boor im Captainssessel auf.
Roxana Collet drehte sich von ihrem Kommunikationspult herum und sagte: „Es ist die Krankenstation, Sir.“ Ein roter Reflex, vermutlich von einer der Anzeigen, huschte über ihre schokofarbenen Haut. Er blieb genau auf der Nasenspitze hängen, was Boor als sehr irritierend empfand. Um den Blickwinkel zu ändern, hob er seine ein Meter neunzig aus dem Sessel und ging zu Collet hinüber. Er beugte sich über die Konsole, drückte die Empfangstaste. „Zentrale, Erster Offizier.“
Leonard Cohens Gesicht erschien auf dem Konsolen-Monitor.
„Doktor! Ist was mit den Kara?“
Cohen war sichtlich erstaunt. „Nein. Wieso? Warum denkt nur jeder gleich an die Waréner, wenn er mich sieht?“
„Entschuldigen Sie, das war natürlich voreilig. Also was gibt es?“
„Ich wollte Sie nur darüber informieren, dass ich eben den Captain für drei Tage krank geschrieben habe.“
„Krank?“
„Nur eine leichte Marsgrippe“, beruhigte ihn der Arzt. „Aber der Captain ist etwas überarbeitet. Es wäre furchtbar nett von Ihnen, wenn Sie Michaela die Ruhepause gönnen würden.“
„Ich verstehe. Und was, wenn der Captain sich erkundigen will, was in der Zentrale so los ist?“
„Sagen Sie so viel, dass Michaela nicht misstrauisch wird, und so wenig, dass sie nicht das Gefühl bekommt, irgendwas würde ihre Anwesenheit erfordern.“
„Ich versuche es, Doktor“, versprach Boor lächelnd. „Noch etwas?“
„Das wird schon schwierig genug für Sie“, erwiderte der Arzt und beendete das Gespräch.
Boor nickte zu Collet herunter, die daraufhin die Verbindung unterbrach, und ging an seinen Platz zurück. Dabei strich er sich mit der rechten Hand über den kahlen Schädel. Isaac Sauders, Boors Freund seit den Tagen der Pilotenausbildung, hatte dessen ovalen, bis auf die buschigen Brauen völlig haarlosen Kopf einmal als „poliertes Denk-Ei“ bezeichnet. Boor hatte sich revanchiert und den Iren daran erinnert, dass sein feines, sehr kurz geschnittenes, rotblondes Haar auch nicht gerade eine Löwenmähne darstellte. Seitdem trug Sauders einen Zopf, der ihm bei jeder heftigen Bewegung um die Ohren flog.
Zum Beispiel jetzt, als er sich vom Steuerpult zu Boor umdrehte, um zu sagen: „Wenn Cohen Brauer überzeugen konnte, nicht zum Dienst zu kommen, muss es ihr ziemlich schlecht gehen.“
Boor schüttelte den Kopf. „Nicht unbedingt. Der Captain war in letzter Zeit tatsächlich etwas überarbeitet, und Brauer ist die letzte, die so was nicht zugeben würde. Sie macht einfach mal Urlaub, denke ich.“
„Aber keine drei Tage“, widersprach Sauders skeptisch.
„Das glaube ich auch nicht.“ Er grinste. „Wahrscheinlich taucht sie spätestens morgen Mittag hier auf, um nach dem Rechten zu sehen.“
Von der Navigationsstation aus mischte sich Lorena Solana in das Gespräch. „Sir“, fragte sie vorsichtig, „sollte die Dienstunfähigkeit des Captains nicht eigentlich vom Chefarzt bescheinigt werden?“
„Ach kommen Sie!“, antwortete Sauders. „Seit Cohen an Bord ist, ist er Brauers Hausarzt. Sowas hat was mit Vertrauensverhältnissen zu tun. Kein normaler Mensch würde das nackten Dienstvorschriften unterordnen!“
„Vertrauensverhältnisse können leicht missbraucht werden!“, konterte Solana eingeschnappt. Eine Strähne ihres langen goldblonden Haares fiel ihr angriffslustig ins Gesicht.
Sauders funkelte sie an. „Wenn Sie das denken, dann fordern Sie doch eine Dienstuntersuchung!“
„Leute!“, versuchte Boor zu beschwichtigen. „Keiner von uns glaubt doch ernsthaft, der Captain würde sich vor dem Dienst drükken wollen! Oder?“, fragte er zur Pilotin hin.
Solana schüttelte verlegen den Kopf und strich sich die Haarsträhne hinters Ohr. Boor war sofort bereit, ihr den absurden Verdacht zu vergeben.
Sauders war es nicht. „Dienstvorschriften“, brummte er, sich wieder dem Steuerpult zuwendend. „Unglaublich. Als ob Tian scharf auf sowas wäre.“
„Er ist aber der Chefarzt“, zischte Solana zu ihm hinüber.
Im hinteren Teil der Steuerzentrale hüstelte jemand. Boor drehte sich um. Wil Richards, der immer etwas bleich wirkende junge Mann an den Sensorpulten, zog von dem Blick eingeschüchtert den Kopf zwischen die Schultern.
Boor versuchte, ihn durch ein Lächeln zu beruhigen. „Was ist denn, Mister Richards?“
Richards räusperte sich. „Eh, Sir, ich … eh … Wir … Wir haben da einen Ortungsreflex, Sir. Bei etwa fünfzehn Grad voraus. Es könnte ein Asteroid sein, Sir.“
Boor nickte. „Danke. Geben Sie mir die Daten rüber!“ Er schwenkte das Captainspult heran, um sich in die Anzeigen zu vertiefen.
In diesem Moment ging die Zentralentür auf und die beiden Waréner traten ein. Boor schaute auf.
„Mit’Xitlan und Imnoi melden sich zur Einweisung in die Sensorstation, Sir“, sagte Imnoi so zackig, dass Boor beinahe das Hakkenklappen vermisste.
„Schön“, erwiderte er betont sanft. „Sie kommen gerade richtig.“ Er stand auf.
„Genau genommen sind wir eins Komma drei Minuten zu früh“, erwiderte Mit’Xitlan.
Boor sah ihn irritiert an. „Was?“
„Wir sind eins Komma drei Minuten vor der vereinbarten Zeit erschienen“, wiederholte der Kara.
Boor hob die Hände. „Ich meinte damit, Sie kommen zu einem günstigen Zeitpunkt. Mister Richards hat soeben einen Asteroiden geortet. Sie beide können also miterleben, wie so eine Fernerkundung abläuft. – Zac?“, sagte er über die Schulter zu Sauders. „Kursänderung um 14.3 Grad. Wir sehen uns den Burschen mal an!“ Boor winkte den Kara, näher an das Sensorpult zu kommen. „Dies hier“, begann er zu erklären, „ist der Radarschirm. Wie Sie sehen, werden die Reflexe in verschiedenen Farbstufen angezeigt.“
„… die einen ersten Eindruck von der Beschaffenheit des angezeigten Körpers ermöglichen“, vollendete Imnoi. „Sir, wenn Sie gestatten zu erwähnen: Mit’Xitlan und ich haben uns eingehend mit der Funktionsweise der einzelnen Sensoren und den Prinzipien der Anzeigen beschäftigt.“
„Prima!“, sagte Boor, ohne es so überschwänglich zu meinen. „Dann machen wir einfach Folgendes: Sie versuchen, die über den Asteroiden eingehenden Daten zu interpretieren. Einverstanden?“
Imnoi nickte knapp. „Der Körper“, begann er abzulesen, „wird bei den Koordinaten Sol 152.83 118.55 1103.55 angezeigt. Eine spezifische Eigenbewegung lässt sich nicht feststellen. Die Masse ist zur Zeit bestimmbar mit 0,98 der Erdmasse plus minus 0,15. Der Durchmesser …“, Imnoi orientierte sich auf dem Pult, „… dürfte bei 8,5 bis 9 Tausend Kilometern liegen, und der Körper scheint in erster Näherung kugelförmig, Sir.“
Boor nickte sprachlos. Auch die anderen Menschen in der Zentrale staunten schweigend.
Imnoi hob ob der Stille die Brauen. „Habe ich etwas übersehen, was bei dem gegenwärtigen Abstand schon feststellbar sein sollte, Sir?“
„Nein!“, beeilte sich Boor zu versichern. „Nichts, was mir auf die Schnelle einfallen würde.“
Collet hob vorsichtig die Hand. „Die Zusammensetzung des Körpers?“
Boor beobachtete Imnoi, Imnoi sah zu Mit’Xitlan und der wandte sich an die Frau. „Man kann natürlich eine erste Vermutung über die Beschaffenheit des Körpers wagen. Doch viel mehr, als dass er aus verhältnismäßig kompaktem silikatischen Material besteht, lässt sich vor den Spektral- und Echoausbreitungstests nicht sagen. Allerdings lässt die Masse des Körpers und die Tatsache, dass eine – wenn auch geringe – Wärmestrahlung zu verzeichnen ist, eine Atmosphäre erwarten. Die Daten hierfür sollten bei Beibehaltung unserer derzeitigen Annäherungsgeschwindigkeit und unter Berücksichtigung der Sensoreffektivitäten in etwa 16 Minuten verfügbar sein.“
„Aaah ja“, sagte Sauders gedehnt. „Und das haben Sie alles eben erst herausbekommen?“
„Natürlich“, erwiderte Mit’Xitlan verwundert. „Woher hätten uns diese Angaben eher zugänglich sein sollen?“
Sauders grinste. „Dann sind Sie ja ’n echt fixes Kerlchen.“
„Schnelles Erfassen und Verarbeiten von Informationen gehören zur Grundausbildung auf Warén“, antwortete Imnoi.
„Zu unserem Glück“, kam Boor einer weiteren Bemerkung des Iren zuvor. „Wie ich sehe“, sagte er zu den Kara, „ist Ihre Anwesenheit auf dem Schiff ein Gewinn für uns.“
Imnoi nickte. Man konnte es als Dank interpretieren oder für eine Bestätigung von Boors Worten halten. Jason Boor entschloss sich zu Ersterem und lächelte.
Michaela Brauer erwachte davon, dass sie eine irreguläre Bewegung des Schiffes zu spüren glaubte. Benommen erhob sie sich aus dem Sessel und rollte die verspannten Schultern. Sie tappte zum Zimmerterminal und rief die Zentrale.
Collet meldete sich. Ihr besorgter Blick erinnerte Brauer daran, dass sie sicher ziemlich zerknittert von der letzten Stunde im Sessel aussah, und sie versuchte ein halbwegs munteres Lächeln. Sie hatte das Gefühl, dass es nicht recht gelang.
„Möchten Sie den Ersten Offizier sprechen, Captain?“, fragte Collet behutsam.
Brauer schüttelte rasch den Kopf. „Lassen Sie nur, ich will ihn nicht stören. Mir war nur so, als hätten wir den Kurs geändert.“
„Das ist richtig“, bestätigte die gebürtige Kenianerin. „Wir haben einen Asteroiden entdeckt und steuern jetzt darauf zu. Möchten Sie über die Erkundungsergebnisse unterrichtet werden?“
„Möchten schon“, grinste Brauer. „Aber ich darf nicht. Ärztliche Anordnung! – Nein“, fügte sie ernst hinzu, „wenn nichts Außergewöhnliches passiert, reicht es, wenn ich mir die Daten zu Gemüte führe, sobald ich wieder im Dienst bin.“
„Aye, Sir.“
„Nur eine Frage: Welchen Kurs fliegen wir jetzt?“
Collet schmunzelte. „Ich gebe Ihnen die Position des Asteroiden auf das Terminal in Ihrem Quartier.“
Brauer bedankte sich, ebenso verschmitzt lächelnd. Das Bild des Komm-Offiziers schmolz zum Symbol der Galaxy-Flotte, der stilisierten Milchstraße.
Brauer rief die versprochenen Daten ab und gähnte. Der Asteroid schwebte recht einsam im All herum, ihn anzusteuern brachte sicher keine großen Überraschungen mit sich. Sie konnte also in aller Gemütlichkeit … Ja, was? Lesen? Seit Wochen schon lag ein Buch mit dem Titel „Die Chronik von Akakor“ auf ihrem Nachtschränkchen. Eine uralte Schwarte, Nachdruck eines noch älteren Buches, das irgendwann im 20. Jahrhundert geschrieben worden war. Brauer hatte es in einem Antiquariat entdeckt und von dort gerettet. Niemand hatte es haben wollen – wen interessierten schon Verschwörungstheorien aus längst vergangenen Epochen? – und der Händler hatte es in die Zum-Mitnehmen-Kiste gelegt.
Sie holte sich das Buch und schlug es an der Stelle mit dem Lesezeichen auf. Ziemlich weit vorn also. Ein Mann, der sich selbst als Häuptling bezeichnete, sprach darüber, was er über die Geschichte seines Stammes wusste. Es war die übliche mittelamerikanische Legende von Göttern, die aus Tieren Menschen machten und sie zivilisierten. Niemand bestritt mehr, dass es so etwas – hochentwickelte Wesen, die einst die Erde aufsuchten – mit einiger Sicherheit gegeben hatte, aber über das Wann und Wo kursierten selbst Jahrhunderte nach Erich von Däniken immer noch die verschiedensten Theorien.
Seltsamerweise hatte Brauer von dieser hier, von der Legende um Akakor, vor diesem Buch noch nie gehört. Entsprechend neugierig war sie gewesen, war sie eigentlich noch immer. Aber jedes Mal, wenn sie anfing, in dem Buch zu lesen, stellte sie fest, dass sie zu wenig über die offizielle Geschichtsschreibung jener Region und Epoche wusste, um den Text wirklich spannend zu finden. Sie begann dann immer, nach den Abbildungen zu blättern. Als ob die mehr verraten hätten. Brauer betrachtete das Foto des Indianers. Des angeblichen Indianers, korrigierte sie sich, denn so sehr sie sich auch mühte: An diesem Tatunca Nara, so nannte sich der Häuptling, war bis auf die abenteuerliche Kleidung nichts Indianisches zu finden. Da sah ja selbst Imnoi in seiner nachtblauen Robe indianischer aus!
Brauer klappte das Buch zu. An der Heftigkeit der Bewegung merkte sie, dass sie verärgert war. Es fühlte sich seltsam an, fast so, als sei es nicht ihr eigener Ärger. Sie mühte sich, diese unangenehme Empfindung abzuschütteln, indem sie an etwas anderes dachte.
Wann, so grübelte Brauer, hatte sie eigentlich das letzte Mal Farben und Pinsel ausgepackt? Nicht auf dieser Reise jedenfalls. Sie musste einen Moment überlegen, wo sie das Malzeug beim letzten Umräumen hingepackt hatte. In den schmalen Schrank, wo es vorher stand, hatte sie Bretter einziehen lassen, um noch ein paar Bücher verstauen zu können. Leonard hatte ihr vorgerechnet, wie viele Buch-Kristalle sie auf dem gleichen Raum unterbringen könnte, und ihr dann doch beipflichten müssen, dass Papierbücher noch immer am besten verkörperten, dass Literatur mehr war als eine Aneinanderreihung von Worten.
In dem Spind standen jetzt also alte Science-Fiction-Romane, einige Klassik-Bände und Mutters Werke. Die Farben – Michaela schlug sich vor die Stirn – waren im Vorraum gelandet! Sie holte sie und baute die Staffelei auf. Aus dem Schreibtisch schaffte sie noch ihre Skizzen herbei und breitete sie zum Auswählen auf dem Boden aus.
Dann sah sie auf das Chaos herab.





























