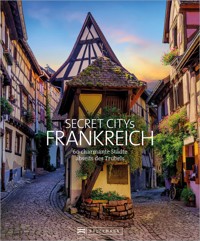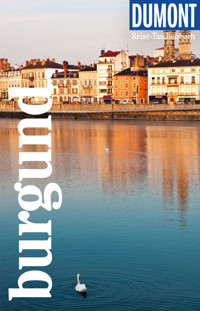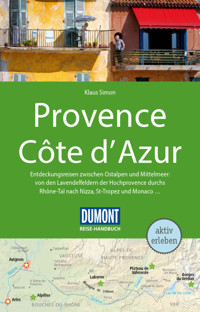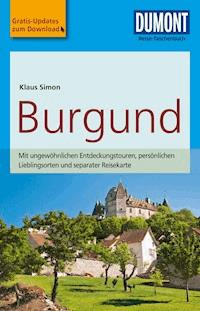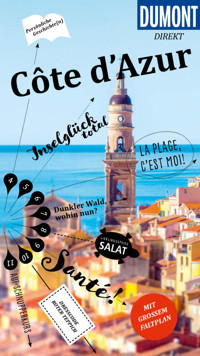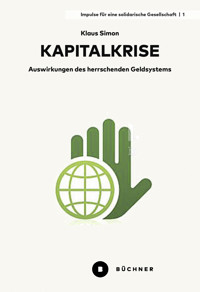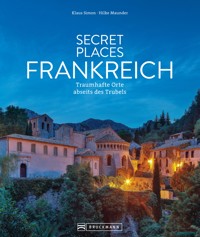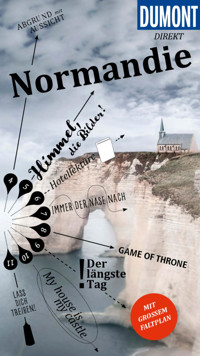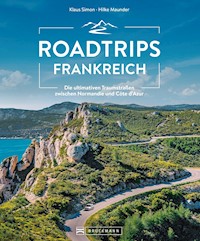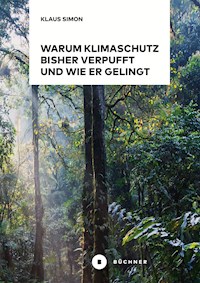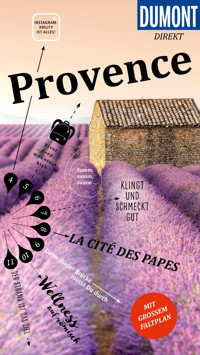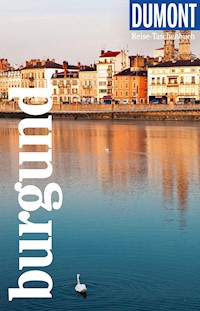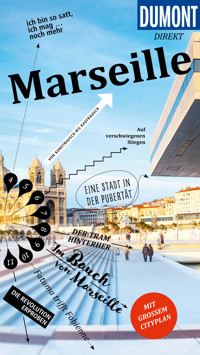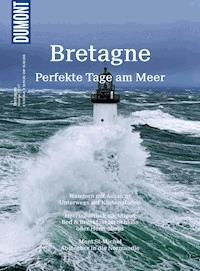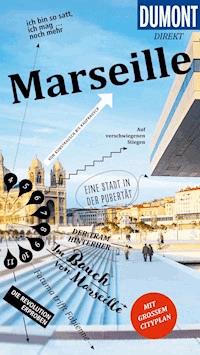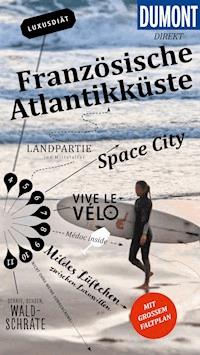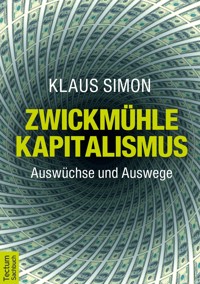
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Tectum
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Es muss sich was ändern! Spätestens seit der aktuellen Finanzkrise spüren wir es alle: Mit diesem System stimmt etwas nicht. Anhand klarer Zahlen und verblüffender Fakten gibt Klaus Simon einen sehr verständlichen Überblick, wie der globale Finanzmarkt-Kapitalismus abläuft - und warum er auf Dauer nicht funktioniert. Es besteht dringend Handlungsbedarf, doch Sozial- und Finanzmarkt-Reformen laufen unter den Bedingungen der Globalisierung ins Leere. Schlimmer noch: Auch ökologische Reformen scheitern am Wachstumszwang im kapitalistischen System. Das Fazit liegt auf der Hand: Der Kapitalismus ist den anstehenden Herausforderungen nicht gewachsen. Doch Simon kritisiert nicht nur: Er zeigt, wie eine nachhaltige, zukunftsfähige Ökonomie aussehen kann, ohne gewaltsame Umsturzversuche oder Diktaturen. Damit gibt er der sympathischen Utopie einer Neuordnung "von unten" Raum.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Akademie Solidarische Ökonomie, Hrsg.Klaus Simon
Zwickmühle Kapitalismus
Auswüchse und Auswege
Akademie Solidarische Ökonomie, Hrsg.
Klaus Simon
Zwickmühle Kapitalismus. Auswüchse und Auswege
© Tectum Verlag Marburg, 2014
ISBN 978-3-8288-5695-0
(Dieser Titel ist zugleich als gedrucktes Buch unter der ISBN 978-3-8288-3257-2 im Tectum Verlag erschienen.)
Umschlagabbildung: © artshock | shutterstock.com
Umschlaggestaltung: vogelsangdesign.de
Satz und Layout: Heike Amthor | Tectum Verlag
Besuchen Sie uns im Internet
www.tectum-verlag.de
www.facebook.com/tectum.verlag
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Angaben sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar.
EIN KURZES GELEITWORT
Hätte man Mephisto vor die Aufgabe gestellt, eine möglichst destruktive Wirtschaftsordnung zu entwickeln, wäre ihm wohl nicht viel anderes als die real existierende kapitalistische Marktwirtschaft eingefallen. Die Zwickmühle Kapitalismus von Klaus Simon stellt eine vorzügliche Analyse der Grundpfeiler dieses Systems dar – gut recherchiert und dennoch für den Laien leicht lesbar.
Gleichzeitig ist das Buch ein Kompendium an alternativen Denkrichtungen zur kapitalistischen Marktwirtschaft. Diese setzen vor allem an der Eigentums- und Geldordnung, aber auch dem Finanz- und Steuerwesen an. Der Verfasser zeigt, dass die gegenwärtige Form des Wirtschaftens nicht „enkeltauglich“ ist. Unserer Einstellung zum Wirtschaftswachstum kommt dabei eine Schlüsselrolle zu. Doch es geht nicht nur um institutionelle Reformen; auch ein kultureller Wandel ist notwendig, um den Planeten nicht zu Lasten kommender Generationen zu plündern. Simon illustriert, wie sich die verschiedenen Denkrichtungen nicht ausschließen, sondern ergänzen können, um dieses Ziel zu erreichen.
Betrachtet man den täglichen Tanz ums Goldene Kalb und verfolgt man die Aneinanderreihung von Desastern und Katastrophen in den Nachrichten, mag man in Resignation und Depression verfallen. Doch gerade hier setzt das Buch ein Zeichen und verweist auf die Silberstreifen am Horizont. Und wann, wenn nicht heute, ist die Zeit gekommen, sich mit den dargestellten „konkreten Utopien“ (Ernst Bloch) ernsthaft auseinanderzusetzen? Und so bleibt Simon nicht bei Analysen stehen: Zwar gibt es, wie er Friedericke Habermann zitiert, keine „Inseln im Falschen“ – wohl aber Halbinseln, „also Räume, in denen Menschen sich ein Stück weit eine andere Wirklichkeit erschaffen und ausprobieren, wohin es gehen könnte.“ Insofern ist das Buch auch eine Aufforderung zum Handeln.
Die Zwickmühle Kapitalismus füllt eine Lücke im Bücherregal des kritischen Bürgers; eine weite Verbreitung ist dem Buch zu wünschen.
Prof. Dr. Dirk Löhr
INHALT
Ein kurzes Geleitwort
Vorwort
1 – Das kapitalistische System verstehen
1.1 – Ein paar Grundbegriffe
Kapitalismus
Marktwirtschaft
Eigentumsordnung
1.2 – Geldsystem
Geld
Geldarten und Geldschöpfung
Die volkswirtschaftliche Geldmenge
Geldumlauf
Geldpolitik
1.3 – Was wächst wie?
Lineares und exponentielles Wachstum
Wirtschaftswachstum
Wachstumszwang
Wachstum der Einkommen
Wachstum der Vermögen
Internationale Entwicklung
1.4 – Globaler Finanzmarktkapitalismus
Finanzindustrie
Schattenbanken
Interbankengeld
Globalisierung
Zunehmende Machtkonzentration
1.5 – Woher kommen Finanzindustriegewinne?
Aktien
Derivate, Zertifikate
Hedgefonds und Private-Equity-Unternehmen
Bankerbezüge und der Zwang zur Kapitalverwertung
1.6 – Das generelle Schuldenproblem
2 – Konkrete Auswirkungen des Systems
2.1 – Monetäre Konsequenzen
Inflation
Privatisierung
Unser täglich Zinstransfer
Steuerflucht
Deutsche Staatsverschuldung und „Bankenrettung“ national
Eurokrise und „Bankenrettung“ international
Finanzkrise 2008/09
2.2 – Der soziale Konflikt
Arbeitslosigkeit, prekäre Beschäftigung, Überforderung
Zunehmend ungleiche Einkommensentwicklung
Zunehmend ungleiche Steuerlast
Zunehmend ungleiche Vermögensentwicklung
Globaler Reichtum schafft globale Armut
2.3 – Der ökologische Konflikt des Systems
Gestörte Ökosystemdienstleistungen
Fußabdrücke und Rucksäcke
Eine Bilanz von 1995 bis 2005
Entkopplungshoffnung und Rebound-Effekt
Energieerzeugung
2.4 – Die militärische Gefahr
Krieg, Rüstung und Volkswirtschaft
Mit doppelter Zunge
Das Wettrüsten ist zurück
Overkill
2.5 – Fazit: Druck von allen Seiten
3 – Reformen im Kapitalismus
3.1 – Soziale Reformen
Der amerikanische New Deal
Die deutsche Soziale Marktwirtschaft
Ende einer Ära
3.2 – Banken- und Finanzmarktreformen
Amerika gestern und heute
Hase und Igel
3.3 – Ökologische Reformen
FCKW-Ausstieg
Klimagerechtigkeit
Green New Deal
Energiewende verkehrt
Das generelle Wachstumsproblem
In der Zwickmühle
3.4 – Fazit: Kapitalismuskritik
Grundsätzliche Kritik
Kritik des globalen Finanzmarktkapitalismus
4 – Unterwegs in die Zukunft
4.1 – Zwei Wege zum Ziel
4.2 – Wandel der gesellschaftlichen Bedingungen
Ein anderes Geldsystem
Eine andere Eigentumsordnung
Eine andere Marktwirtschaft
Eine andere Arbeits- und Sozialordnung
Eine andere Kultur
Ein anderer Systemwechsel
4.3 – Wandel in der Praxis
Soziales Unternehmertum
Gemeinwohl-Ökonomie
Solidarische Ökonomie
Commons
4.4 – Wandel des Individuums
Kann sich der Mensch überhaupt wandeln?
Jetzt anfangen mit Aufhören
Dank
Quellenverzeichnis
Literaturauswahl
Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen
Abkürzungsverzeichnis
Sachwortverzeichnis
VORWORT
Am Anfang allen Nachdenkens stehen Zweifel und Verunsicherung. Es beginnt oft mit ganz einfachen Fragen. Zum Beispiel, warum sich der Erfolg eines Unternehmens an seiner Finanzbilanz misst und nicht an der gesellschaftlichen Bedarfsdeckung. Verwechseln wir da nicht das Mittel mit dem Ziel? Auch die Nationen messen ihre Wohlfahrt am Umsatz von Gütern und Dienstleistungen. Nehmen wir das bekannte Beispiel vom abgeholzten Wald: Statt seiner wächst nun das Bruttoinlandsprodukt. Geht es uns davon wirklich besser? Im weltweiten Durchschnitt beanspruchen wir das Ökosystem bereits 1,5-mal so stark wie es seine Regenerationsfähigkeit erlauben würde. Wieso reden wir immer weiter von Wirtschaftswachstum? Und das Land, in dem wir leben, hat astronomische Schulden. Kann das auf Dauer gut gehen?
Wenn wir nun solchermaßen irritiert Rückbindung an unseren Verfassungsgrundsätzen suchen, so mehren sich die Zweifel noch. Wiederum Beispiele: Das deutsche Grundgesetz verpflichtet privates Eigentum dem Wohle der Allgemeinheit und sieht – wo dies nicht gewährleistet ist – dessen Vergesellschaftung vor (Artikel 14 und 15 GG). Gemäß Bayerischer Verfassung stehen Steigerungen des Bodenwertes nicht dem Eigentümer, sondern der Allgemeinheit zu (Artikel 161 BV). Die gesamte wirtschaftliche Tätigkeit muss der Erhöhung der Lebenshaltung aller Volksschichten dienen (Artikel 151 BV). Die Ansammlung von Riesenvermögen in den Händen Einzelner sowie die Zusammenballung wirtschaftlicher Macht ist zu verhindern (Artikel 123, 156 BV). Auch nach Hessischer Verfassung darf wirtschaftliche Freiheit nicht zu monopolistischer Machtzusammenballung führen (Artikel 39 HV). Und Artikel 41 (1946 in Hessen per Volksentscheid beschlossen!) sieht für die Schlüsselindustrien eine generelle und sofortige Überführung in Gemeineigentum vor; ebenso sind Großbanken und Versicherungen unter staatliche Verwaltung zu stellen. – Das alles glaubt man ja beinahe kaum: Läuft denn die gesellschaftliche Praxis im Lande so, wie sie ursprünglich gedacht war?
Was wir täglich als „ganz normal“ vorfinden, steht nicht nur in bizarrem Kontrast zu unseren Verfassungszielen. Es hat auch vor den Grundwerten freiheitlich demokratischer Ordnung schwerlich Bestand. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit: Das sind die Ideale, zu denen wir uns bekennen. Aber wie frei sind die Millionen von prekär Beschäftigten und Arbeitslosen bei der Verwirklichung ihrer Lebensziele? Wie gleich sind wir in Wahrheit, wenn allein das oberste Hundertstel der Deutschen über ein Nettoprivatvermögen von unglaublichen dreitausendfünfhundert Milliarden Euro verfügt, während sich das Vermögen der Hälfte des Volkes zu null saldiert? Ist der Manager mit dem tausendfachen Einkommen des Gärtners wirklich noch dessen Bruder? Und wenn wir den Blick über Deutschland hinaus wenden: Wie gleich, frei und brüderlich sind unsere Beziehungen zu anderen Nationen?
Auch christliche Grundwerte lassen sich bei alledem nicht ausmachen, und so kritisiert Papst Franziskus das System des Kapitalismus in aller Deutlichkeit. Große Massen der Bevölkerung sehen sich ausgeschlossen, ohne Arbeit, ohne Aussichten, ohne Ausweg. Und durch diese Ausschließung befindet man sich nicht in der Unterschicht, am Rande oder gehört zu den Machtlosen, sondern man steht draußen. Sein Fazit: Die Probleme der Welt werden sich nicht lösen lassen, ohne die Ursachen der Ungleichverteilung der Einkünfte in den Blick zu nehmen – und das schließt ein, die strukturellen Ursachen der Fehlfunktionen der Weltwirtschaft zu beseitigen.
Die Befürworter des herrschenden Systems hingegen verweisen auf dessen immense Produktivität, welche Fortschritt und soziale Sicherheit ja erst ermöglicht – wie man an den entwickelten Industrienationen sieht. Folglich könne nur das freie Agieren der Märkte sowie weiteres Wirtschaftswachstum für die weltweite Verbreitung von Wohlstand sorgen. Aber stimmt denn das? Von 1960 bis 1995 hat sich das Bruttoweltprodukt verfünffacht und die Märkte wurden liberalisiert. Doch zur gleichen Zeit stieg das Pro-Kopf-Einkommen des reichsten Fünftels der Weltbevölkerung vom 30-Fachen auf das 82-Fache des ärmsten Fünftels! Und dieser Prozess zunehmender Ungleichverteilung schreitet fort: Nach Credit-Suisse-Daten hat sich mittlerweile ein Zwölftel der Menschheit 82 Prozent des weltweiten Gesamtvermögens angeeignet, während auf zwei Drittel der Weltbevölkerung knappe drei Prozent aller Reichtümer entfallen! Sieht so Wohlstand für alle aus?
Nicht nur extreme Ungleichheit ist der Preis des Systems, sondern eine ausgeplünderte und geschundene Ökosphäre ebenso. Jedes Jahr gehen uns Waldflächen so groß wie Portugal sowie Ackerland so groß wie die Schweiz verloren, und längst verbrauchen wir mehr Grundwasser als sich nachbildet. Im Gegenzug kommen jährlich 1,3 Milliarden Tonnen Müll hinzu (Tendenz steigend). Geschätzte 100 Millionen Tonnen Plastikabfall schwimmen im Meer. 2012 wurden 1,6 Milliarden Handys verkauft und 40 Millionen Tonnen Elektronikschrott weggeworfen. Der Cadmium-Gehalt der Schokolade steigt, auch der Quecksilber-Gehalt von Fischen – usw. War es das wert? Und das Immer-Mehr der Güter und Dienstleistungen multipliziert sich noch zusätzlich mit dem Immer-Mehr der Menschen; bereits in zehn Jahren werden wir 8 Milliarden sein! Neben religiöser Fehlorientierung verhindern mangelnder Wohlstand und Bildung in den Entwicklungsländern den dringend nötigen Geburtenrückgang. Und hier nun beißt sich die Katze in den Schwanz, denn die Ungleichverteilung grenzt gerade diese Menschen zunehmend aus anstatt sie einzubeziehen. Kann denn das richtig sein?
Zweifel und Verunsicherung – irgendwie stimmt etwas nicht. Wir geraten immer weiter in soziale Schieflage und ökologische Bedrängnisse. Viele von uns sind deshalb lange schon nachdenklich geworden. Doch Zweifel und Verunsicherung sind nur ein Anfang. Jeder Versuch, sich partielle Änderungen am System vorzustellen, endet alsbald in einem Wirrwarr von Folgeproblemen und scheinbarer Unlösbarkeit. Wenn aus bloßer Nachdenklichkeit wirkliches Nachdenken erwachsen soll, ist Faktenwissen sowie das Durchschauen des Zusammenhangs nötig, in den sich all die Fakten einordnen. Dann lässt sich das herrschende System plötzlich von Grund auf verstehen. Warum sich die Krisen zuspitzen. Was es mit den Finanzmärkten auf sich hat. Wie die Folgen aussehen, die uns ganz direkt betreffen (und in einem Ausmaß, das man niemals erwarten würde!). Genau diese Fakten und ihren grundlegenden Zusammenhang möchten die ersten beiden Kapitel des Buches vermitteln.
Was am System müsste sich demnach ändern? Dieser Frage geht das dritte Kapitel nach. Dabei werden konkrete Reformen untersucht – von der deutschen Sozialen Marktwirtschaft bis hin zu aktuellen Bemühungen um Finanzmarktreformen. Auch ökologisch orientierte Reformansätze kommen in den Blick. Es stellt sich heraus, dass (wie auch immer geartete) Reformen den steten Zwang zu Wirtschaftswachstum im kapitalistischen System nicht überwinden können. Und dieser Zwang zu immer weiterem Wirtschaftswachstum lässt sich – gegen alle Effizienzhoffnung – nicht von immer weiterer Umweltbelastung entkoppeln. Es kann demnach im Kapitalismus keine Lösung der Ökokrise geben: Dies ist das ernüchternde Ergebnis des dritten Kapitels. Das kapitalistische System ist den vor uns stehenden Herausforderungen nicht gewachsen, wir werden uns umorientieren müssen.
Erst auf Grundlage dieses so unbehaglichen wie unausweichlichen Befundes skizziert das vierte Kapitel vorsichtig und beispielhaft die Umrisse einer zukunftsfähigen Ökonomie – allen Behauptungen der Alternativlosigkeit zum Trotz. Das geschieht unter strikter Abgrenzung von der Idee gewaltsamer Umsturzversuche oder der Diktatur politischer Apparate. Es geht vielmehr um eine Einladung, das angeblich Undenkbare einfach einmal zu denken und der Utopie gesellschaftlicher Neuorientierung „von unten“ Raum zu geben. Ach, bloß eine Utopie? Ja, eine Utopie! Man kann gesellschaftlichen Prozessen wohl kaum die Fähigkeit zur Entwicklung absprechen, und dabei aber war bisher jede neue Entwicklungsstufe bis zum Vorabend ihres Aufkommens nichts als eben Utopie. Ohne Utopie hat die Gesellschaft keine Orientierung, die über das Bestehende hinauszuführen vermag.
Doch nun der Reihe nach. Wagen wir gemeinsam einen analytischen Blick auf die aktuelle Situation. In dem Maße, wie wir die Gegenwart deutlicher sehen, wird die Zukunft Konturen annehmen.
1 – DAS KAPITALISTISCHE SYSTEM VERSTEHEN
Der Kapitalismus seit Henry Ford hat „den Fabrikmädchen die Seidenstrümpfe der Königinnen gebracht“. Das ist bekannt und unbestritten. Weniger bekannt und oft bestritten sind die Risiken und Nebenwirkungen des Systems. Am Beispiel deutscher und internationaler Daten lässt sich aufzeigen, was wie wächst – und zu welchen Auswüchsen das führt.
1.1 – Ein paar Grundbegriffe
Kapitalismus
Kapitalismus ist eine Wirtschaftsordnung. Der Name ist selbsterklärend: Kapital is Muss. Was aber ist Kapital? Kapital (lat. capitalis: „hauptsächlich“) bezeichnet nicht einfach Sach- oder Geldwerte. Aus Sachwerten wird Sachkapital (z. B. Maschinen und Anlagen) und aus Geldwerten wird Geldkapital (z. B. Anleihen), wenn sie langfristig zum Zwecke der Gewinnerzielung eingesetzt werden. Kapital wird investiert, um vergrößert zurückzukehren. Und wenn der Kapitalist das nunmehr vergrößerte Kapital nicht verknuspert, sondern erneut einsetzt, kann er im zweiten Schritt mit noch mehr Kapital noch mehr Gewinn erzielen – usw. Damit ist das Wesen der kapitalistischen Wirtschaftsweise umschrieben. Grundmerkmale sind die Privatverfügung über Kapital (z. B. auch in Form der Produktionsmittel) und die private Aneignung des entstehenden Mehrwerts.
Sachkapital und Geldkapital sind durch Verkauf ineinander überführbar. So kann das Kapital einen Verwandlungsprozess durchlaufen: Geldkapital wird in Warenkapital investiert (Ausgangsstoffe), welches durch Wertschöpfung in höheres Warenkapital überführt wird (Endprodukte). Der Verkauf führt nach Abzug aller Kosten zu höherem Geldkapital. Die angestrebte Differenz von eingesetztem und schließlich erlöstem Geldkapital heißt Mehrwert.
Der privat angeeignete Mehrwert ist der Profit (lat. profectus: „Fortgang, Zunahme, Vorteil“). Profit ist also der Gewinn, den der Kapitaleigner erzielt. Das lässt sich auch ohne Produktion erreichen, z. B. wenn bei Finanzgeschäften der Einsatz von Geld am Ende noch mehr Geld einbringt. Während Marx die „Besitzer der Ware Arbeitskraft“ und „Geldbesitzer“ noch als ebenbürtig ansah und seine Kritik vor allem auf Erstere abzielte, ist mittlerweile die Rolle der Geldeigentümer als dominant erkennbar. Heutige Firmen finanzieren sich überwiegend über Fremdkapital. Die durchschnittliche Eigenmittelquote deutscher Unternehmen liegt bei 27,5 Prozent (Stand 2010).1 Der gepriesene freie Unternehmer befindet sich in Wahrheit in einer ziemlich unfreien Abhängigkeit von externen Geldgebern: Geldkapital dominiert Sachkapital, das werden wir im Folgenden noch genauer sehen.
Marktwirtschaft
Der Begriff Marktwirtschaft bezeichnet ein System wirtschaftlicher Prozesse, die nicht durch zentrale Planung, sondern über den Markt koordiniert werden: durch Angebot, Nachfrage und Preis. Marktwirtschaft arrangiert die Bedingungen, unter denen sich die wirtschaftlichen Abläufe vollziehen. Dazu gehört insbesondere auch eine regulierende Rechtsordnung sowie die Bereitstellung öffentlicher Güter (z. B. Infrastruktur, Bildung usw.).
Marktwirtschaft ist normalerweise gekennzeichnet durch die liberalen Grundsätze der Chancengleichheit, der freien Information und des freien Wettbewerbs. Im kapitalistischen System sollen die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen zugleich das Agieren des Kapitals effektiv unterstützen. Dabei kann der Staat mit sozial- und konjunkturpolitischen Maßnahmen aktiv in das Wirtschaftsgeschehen eingreifen (soziale Marktwirtschaft) oder sich eher passiv verhalten (freie Marktwirtschaft). Doch auch die freieste Marktwirtschaft kommt in der Praxis nicht ohne öffentliche Güter und eine regulierende Rechtsordnung aus – und insofern nicht ohne Staat.
Marktwirtschaft und Kapitalismus gelten oft als zwei Seiten einer Medaille. Diese Allianz ist zwar heute überwiegend Realität, jedoch keineswegs zwingend. Es ist auch eine nicht-kapitalistische Marktwirtschaft denkbar (bspw. Sach- und Geldkapital auf genossenschaftlicher Basis). Und umgekehrt hat es auch schon nicht-marktwirtschaftlichen Kapitalismus gegeben, z. B. die staatliche Kommandowirtschaft in Nazi-Deutschland.
Eigentumsordnung
Eigentum bezeichnet das umfassendste Herrschaftsrecht an einer Sache: die rechtliche Verfügung (z. B. über eine Mietwohnung). Eigentum ist zu unterscheiden von Besitz als körperliche Verfügung über eine Sache (z. B. das Bewohnen einer Mietwohnung). Eigentum und Besitz können zusammenfallen (z. B. das Bewohnen einer Eigentumswohnung).
Die Geschichte kennt Gemeineigentum (Allmende, gemeinsam geschaffene Dorfanlagen usw.) ebenso wie Privateigentum im Verfügungsrecht einzelner. Dabei ist Privateigentum eine grundlegende Voraussetzung für das kapitalistische System, welches zu seinem Funktionieren die private Verfügungsmacht über das Kapital ebenso braucht wie den Schutz des privaten Kapitals.
Das Wort privat lässt keinen Zweifel am Wesen des Privateigentums aufkommen (lat. privare: „berauben“). Es ist im Grunde verblüffend, dass der Privateigentumsbegriff gleichermaßen durch Leistung gerechtfertigtes Eigentum (z. B. die Arbeitsergebnisse eines Handwerkers) wie auch nicht durch Leistung gerechtfertigtes Eigentum umfasst (z. B. die „durch Eigentumsrechte legalisierte Usurpation öffentlicher Güter“2, etwa die Förderrechte an einer Ölquelle).
In Deutschland ist Privateigentum und dessen Vererbung durch das Grundgesetz garantiert – ohne mengenmäßige oder zeitliche Obergrenzen. Privateigentum ist in den Hauptvermögensarten Grund und Boden (mit Immobilien), Realvermögen (Unternehmensanteile, Aktien) sowie Geldvermögen in jeder Hinsicht unbeschränkt. So sind die Weichen gestellt für die Anhäufung immer größerer Eigentumsanteile in den Händen weniger Menschen.3 Dieser Konzentrationsprozess schädigt zwingend die Wohlfahrt der sozialen Gemeinschaft. Es ist wie beim Monopoly: Die an der Schlossallee bekommen immer mehr.
Neben der Verteilungsungerechtigkeit hat die Dominanz privaten Eigentums auch noch eine fatale ökologische Wirkung. Denn auf Gemeingüter (z. B. Klimasystem, Wasserreinheit) oder privat vereinnahmte Güter (z. B. Bodenschätze) kann zumeist ungeniert zugegriffen werden. „Substanzverzehr gilt als Marktleistung. Das geltende Wettbewerbsrecht schützt Wettbewerber auch dann, wenn sie ihre Produkte durch Externalisierung ‚billiger‘ oder ‚besser‘ anbieten“,4 d. h. wenn sie zum Nachteil der Gemeingüter wirtschaften und die Folgekosten auf die Gemeinschaft abwälzen. Artikel 14 des Grundgesetzes hingegen garantiert nicht nur privates Eigentum, sondern präzisiert in Absatz 2: „Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen.“ Insofern ist jedes Wirtschaften zum Nachteil der Gemeingüter grundgesetzwidrig (die Praxis sieht allerdings anders aus).
Mit Marktwirtschaft und Eigentumsordnung zusammen wird aus der kapitalistischen Wirtschaftsordnung eine Gesellschaftsformation, in der die Gesamtheit aller sozialen und ökonomischen Aspekte an der Logik der Kapitalvermehrung ausgerichtet ist.
Kapitalismus benötigt zu seinem Funktionieren aber noch eine weitere und zentrale Voraussetzung, die auf den ersten Blick etwas kompliziert erscheint: das Geldsystem.
1.2 – Geldsystem
Geld
Geld ist eine wesentliche Voraussetzung für Arbeitsteilung und wirtschaftlichen Austausch. Geld dient heute vor allem als:
•Zahlungs- und Tauschmittel,
•allgemeiner Wertmaßstab für Güter- und Vermögenswerte,
•Mittel zur Wertaufbewahrung,
•Geldkapital, dessen zeitweiliges Überlassen Kapitalzins erbringt.
Mit Geld wird der übertragbare Anspruch ermöglicht, für Leistung eine Gegenleistung zu erhalten. Ein bekanntes Beispiel bringt das Problem auf den Punkt: „Frierender Bäcker sucht hungernden Schneider.“ Genau dieses direkte Zusammentreffen ist mit Geld nicht mehr nötig, Bäcker und Schneider können ihre Leistungen mittels Geld anonym am Markt austauschen. Von zentraler Bedeutung ist dabei die Äquivalenzrelation zwischen Leistung und Geld. Geld kann nur im Vertrauen darauf, dass die Äquivalenzrelation zwischen Leistung und Geld auch morgen noch in gleicher Weise gelten wird, seine Aufgabe erfüllen: „Das Vertrauen in die Wertbeständigkeit des Geldes bildet die Grundlage des Geldwesens.“5
Manche Autoren verstehen unter Geld ausschließlich gesetzliche Zahlungsmittel (z. B. Bargeld). Andere dagegen sehen in Geld einen Oberbegriff, der die Geldarten Bargeld und Giralgeld (z. B. Bankeinlagen) umfasst. Welche der beiden Übereinkünfte man wählt ist eine Frage der Gesichtspunkte. Nachfolgend wird im Verständnis der Bundesbank das Wort Geld als Oberbegriff aufgefasst.6
Geldarten und Geldschöpfung
Zentralbankgeld
Zentralbankgeld besteht konkret aus Geschäftsbankenguthaben bei der Zentralbank und aus Bargeld (das gesetzliche Zahlungsmittel). Zentralbankgeld wird auf Beschluss gesetzgebender Organe geschöpft, man nennt es deshalb auch Fiat-Geld (lat. fiat: „es werde bereitet“). Die Schöpfung erfolgt aus dem Nichts („Geld drucken“). Wenn die Zentralbank Kredite an Geschäftsbanken vergibt oder Wertpapiere o. Ä. ankauft, nimmt das Zentralbankgeld zu. Vermindert die Zentralbank eine dieser Positionen, nimmt es ab.
Giralgeld
Giralgeld (auch Buch- oder Geschäftsbankengeld genannt) besteht konkret aus Kundenguthaben bei den Geschäftsbanken. Es verbürgt einen Anspruch auf Bargeld und wird deshalb wie ein gesetzliches Zahlungsmittel akzeptiert (z. B. Überweisungen). Giralgeld wird durch Geschäftsbanken geschaffen, indem Wertpapiere o. Ä. angekauft oder Kredite an Kunden ausgereicht werden. Dabei nimmt das Giralgeld zu, bei Wertpapierverkauf oder Kredittilgung nimmt es wieder ab. Beim Giralgeldschaffen durch Kreditvergabe werden dem Kreditnehmer je ein Forderungs- und ein Guthabenbetrag zugebucht, die es vorher noch nicht gab. Deshalb wird die Kreditvergabe oft wie beim Zentralbankgeld auch als Geldschöpfung bezeichnet. Doch das ist im Grunde wenig zutreffend. Denn anders als die Zentralbank sind Geschäftsbanken keine Schöpfer im Sinne eines Erstverursachers, sondern sie sind an Liquiditätsvoraussetzungen gebunden.
Die volkswirtschaftliche Geldmenge
Mit Geldmenge ist immer der Geldbestand außerhalb des Bankensektors gemeint. Man kann die Geldmenge zählen: wie viel „Äpfel“ (Bargeld) und wie viel „Birnen“ (Giralgeld) im Land sind. Man kann auch beides zusammenzählen (ja, man kann Äpfel und Birnen zusammenzählen!), dann kennt man die Menge „Obst“. Das geschieht in den sog. Geldmengenaggregaten M1 bis M3:
•M1 umfasst den Bargeldumlauf und täglich fällige Einlagen (z. B. Girokonten)
•M2 umfasst M1 plus kurzfristige Termin- und Spareinlagen mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren oder einer Kündigungsfrist bis zu drei Monaten (z. B. Sparbücher)
•M3 ergänzt M2 noch um den Bestand sog. marktfähiger Instrumente: Repogeschäfte, Geldmarktfondszertifikate, Geldmarktpapiere sowie Schuldverschreibungen mit einer Laufzeit bis zu zwei Jahren.7
Bar- und Giralgeld, Deutschland 1980–2011
Quelle: Deutsche Bundesbank (Zeitreihen TXI300, TXI303, TXI307, TXI308, TXI367 und TXI387, ab 2002 EWU/deutscher Beitrag), eigene Berechnungen
Klaus Simon 2013
Abb. 1: Bar- und Giralgeld
M3 summiert also den Bargeldumlauf und alle Giralgeldguthaben bis zu zwei Jahren Laufzeit und enthält somit nicht den vollen Umfang aller Guthaben, sondern nur die im Nahzeitraum nachfragewirksame Geldmenge. Oberhalb M3 wird im Euroraum keine Geldmenge errechnet, welche langfristige Guthaben mit einbeziehen würde. Gleichwohl weist die Bundesbank neben M3 die einzelnen Giralgeldpositionen auch ohne zeitliche Einschränkung aus.8 Auf der Basis der sog. konsolidierten Bilanz werden in Abbildung 1 die Positionen Einlagen, Schuldverschreibungen, Repogeschäft und Geldmarktfonds zur Menge Giralgeld gesamt summiert. Diese Menge war 2011 mit 3,83 Billionen Euro knapp doppelt so groß wie M3 und 18-mal so groß wie der Bargeldumlauf.
Die jährliche Momentaufnahme in Abbildung 1 sollte uns nicht darüber hinwegtäuschen, dass in Wahrheit ein waberndes Geschehen zugrunde liegt, bei dem immerzu Giralgeld geschaffen (z. B. Kreditvergabe) und wieder vernichtet wird (z. B. Kredittilgung). Und offensichtlich wird dabei stetig mehr Giralgeld geschaffen als vernichtet: Die Grafik zeigt ein fortdauerndes Wachstum.
Geldumlauf
Das derzeitige Bankensystem funktioniert in zwei Kreisläufen: Im ersten Kreislauf verkehren die Geschäftsbanken mit der Zentralbank und erhalten Zentralbankkredite. Im zweiten Kreislauf reichen Geschäftsbanken die erhaltenen Zentralbankkredite an die Volkswirtschaft aus: So kommt das geschöpfte Zentralbankgeld in Umlauf.
Wenn die Geschäftsbanken Kredite ausreichen, müssen sie mit einem Verlust an Zentralbankgeld rechnen (z. B. Barauszahlung des Kreditbetrags). Deshalb werben Geschäftsbanken mit Sparzinsen um Kundeneinlagen, aus denen sie eine Überschussreserve bilden. Aus dieser refinanzieren sie die abfließenden Kreditbeträge. Indem die Geschäftsbanken Vermögenswerte verkaufen oder selbst Kredite aufnehmen, können sie die Reserven erhöhen. Man spricht in diesem Fall von den sog. freien Liquiditätsreserven: „Vom Ausmaß der freien Liquiditätsreserven hängt die Fähigkeit der Banken ab, die durch eine Geschäftsausweitung [z. B. Kreditvergabe] entstehenden Verluste an Zentralbankgeld ausgleichen zu können.“9
Betrachtet man den gesamten Bankensektor, so besteht ein klarer Zusammenhang zwischen ausgereichten Krediten und freien Liquiditätsreserven. Bis auf geringe Bar-10und Mindestreserven11bringen die Geschäftsbanken die Guthaben ihrer Kunden als Kredit in den Umlauf zurück. Das ist für die Volkswirtschaft nützlich, sie ist auf den Geldumlauf angewiesen. Und für die Banken ist es einträglich: Vom einkommenden Kreditzins begleichen sie den Sparzins ihrer Anleger, der Rest fließt als Zinsüberschuss in die Bankengewinne.
Guthaben und Schulden, Deutschland 1980–2011
Quelle: Deutsche Bundesbank (Zeitreihen TXI300, TXI303, TXI307, TXI308, TXI356, TXI367 und TXI387, ab 2002 EWU / deutscher Beitrag)
Klaus Simon 2013
Abb. 2: Guthaben und Schulden
Geld ist kein privates, sondern ein öffentliches Gut. Bankguthaben liegen nicht in Tresoren herum, sondern sie werden als Kredit wieder ausgereicht. Das aber hat Konsequenzen: Die Gesamt-Guthabenmenge entspricht nahezu der Gesamtmenge ausgereichter Kredite (= Schulden)! Das heißt, Giralgeld ist Schuldgeld: Zur Guthabenmenge besteht systemnotwendig immer eine (nahezu) gleiche Menge an Kreditschuld. Abbildung 2 zeigt diesen Zusammenhang wieder anhand der konsolidierten Bilanz. Als Guthaben ist die Menge Giralgeld gesamt aus Abbildung 1 zugrunde gelegt. Dieser Menge stehen die ausgereichten Nichtbankenkredite gegenüber. Beide entwickeln sich nahezu symmetrisch, lediglich in den 1990er-Jahren lagen die Kredite etwas über den Guthaben (erhöhte Kreditnachfrage ‚Aufbau Ost‘). Diese Abweichung ist durch Erhöhung der freien Liquiditätsreserven erklärbar.
Wir sehen ein fortdauerndes Anwachsen der Guthaben und ebenso des Kreditvolumens. Der Wert des neu geschaffenen Giralgeldes beruht auf der Schuldigkeit der Kreditnehmer, „den Gegenwert in der Zukunft abzuleisten.“12
Geldpolitik
Heutiges Geld verfügt weder über Eigenwert (z. B. Edelmetallwert einer Münze) noch über sonstige Garantien (z. B. ein zugesicherter Umtauschkurs in Gold). Nur Knappheit kann die Grundlage für den Wert heutigen Geldes sein. Man kann also nicht nach Gutdünken „Geld drucken“, es muss vielmehr eine angemessen knappe und dennoch mit der Wirtschaftsleistung wachsende Geldmenge zur Verfügung gestellt werden. Dies ist Aufgabe der Geldpolitik der Zentralbank (früher Bundesbank, heute Europäische Zentralbank, EZB).
In der Realität hat sich die Menge Giralgeld gesamt in Deutschland zwischen 1980 und 2011 verfünffacht: von 769 auf 3.832 Milliarden Euro (Abbildung 1 und 2). Ist dieses enorme Wachstum das Ergebnis von geordneter Geldpolitik oder schaffen die Geschäftsbanken aus Eigennutz (Kreditzins!) einfach zu viel Giralgeld?
Als Grundlage ihrer Geldpolitik nutzt die EZB die sog. Zwei-Säulen-Strategie.13 Dabei werden sowohl wirtschaftliche als auch monetäre Indikatoren (eben zwei Säulen) zur Inflationsprognose verwendet. Vereinfacht gesagt: Dem angestrebten Wachstum der Geldmenge liegen Erwartungswerte von Wirtschaftswachstum und Geldumlaufgeschwindigkeit zugrunde, wobei (bisher) eine Preissteigerungsrate von 2 Prozent nicht überschritten werden soll. Auf dieser Grundlage gibt der EZB-Rat seit 1998 für das Wachstum der Menge M3 jährlich 4,5 Prozent als Orientierung vor. Die 4,5-Prozent-Orientierung gilt heute nach wie vor.14
Das tatsächliche Geldmengenwachstum muss also bei gleicher Geldumlaufgeschwindigkeit der Entwicklung des realen Wirtschaftswachstums und der Inflation folgen. Beide Größen zusammen lassen sich mit dem nominalen Wirtschaftswachstum wiedergeben. Zusätzlich zum nominalen Wirtschaftswachstum besteht in der Praxis noch eine weitere Ursache für den Geldmengenanstieg, nämlich die Zentralbankaktivitäten. Wenn die Zentralbank Devisen o. Ä. ankauft, wird die Geldmenge ebenfalls anwachsen. Das geschieht insbesondere auch beim Ausgleich von Exportüberschüssen: „Ein Zahlungsbilanzüberschuß bedeutet, daß die Devisenreserven der Zentralbank zunehmen. Hierdurch steigt die inländische Geldmenge […].“15 Zusammengefasst:
Nominales Wirtschaftswachstum und Zentralbankaktivitäten bestimmen das Geldmengenwachstum. Unter derzeitigen Verhältnissen gibt die EZB für dieses Wachstum jährlich 4,5 Prozent als Orientierung vor.
Betrachtet man nun das reale Wachstum der Menge M3 innerhalb der Jahre 2001 bis 2011, so wurde das 4,5-Prozent-Ziel der EZB zwar nicht genau erreicht, aber auch nicht gravierend verfehlt (Abbildung 3). Zur Orientierung zeigt die Grafik ferner das Wachstum der Menge Giralgeld gesamt. Auch deren Anstieg ist in diesem Zeitraum nicht steiler als der von M3. Zusätzlich ist das nominale Wirtschaftswachstum dargestellt; dessen Anstieg ist etwas flacher. Rechnet man vom tatsächlichen M3-Wachstum das nominale Wirtschaftswachstum und die Zentralbankaktivitäten ab, so bleibt nur wenig Spielraum für die Annahme einer willkürlichen Giralgeldausweitung durch die Geschäftsbanken. Vielmehr wächst die Geldmenge proportional zu Wirtschaftswachstum und Zentralbankaktivitäten.
M3-Wachstum, Deutschland 2001–2011
Quelle: Deutsche Bundesbank, Zeitreihen TXI300, TXI303, TXI307, TXI308, TXI367 und TXI387, Stat. Bundesamt Fachserie 18 Reihe 1.5, eigene Berechnungen
Klaus Simon 2013
Abb. 3: M3-Wachstum
Der tatsächliche Anstieg der Geldmenge orientiert sich offensichtlich an der Entwicklung volkswirtschaftlicher Größen. Aber woher kommt diese Entwicklung volkswirtschaftlicher Größen überhaupt?
1.3 – Was wächst wie?
Lineares und exponentielles Wachstum
Wächst ein Ausgangswert in gleichen Zeitschritten um den immer gleichen Betrag, nennt man das lineares Wachstum. Die grafische Darstellung ergibt eine Gerade. Wächst ein Ausgangswert dagegen in gleichen Zeitschritten um den immer gleichen Faktor, so heißt dies exponentielles Wachstum. Die grafische Darstellung ergibt eine Exponentialkurve. Abbildung 4 zeigt eine Prinzipskizze beider Wachstumsarten:
Abb. 4: Lineares und exponentielles Wachstum
Beispiel 1 (lineares Wachstum): Ein 1 m hoher Baum wächst jedes Jahr 10 cm: 1,10 m, 1,20 m, 1,30 m, 1,40 m, 1,50 m, … Das ergibt nach 10 Jahren 2 m Höhe.
Beispiel 2 (exponentielles Wachstum): Ein 1 m hoher Baum wächst jedes Jahr um 10 Prozent: 1,10 m, 1,21 m, 1,33 m, 1,46 m, 1,61 m, … Das ergibt nach 10 Jahren 2,59 m Höhe.
Im Beispiel 1 fällt die Wachstumsrate im Laufe der Zeit kleiner aus, denn der stets gleiche Wachstumsbetrag entspricht mit wachsender Menge einem immer geringeren Mengenanteil. Der Baum wächst im ersten Jahr 10 Prozent, im fünften Jahr aber nur noch 7,1 Prozent seiner Höhe. Im Beispiel 2 dagegen bleibt die Wachstumsrate gleich. Dadurch fällt im Laufe der Zeit der Wachstumsbetrag immer größer aus, denn die stets gleiche Wachstumsrate entspricht mit wachsender Menge einem immer größeren Mengenanteil. Der Baum wächst im ersten Jahr 10 Zentimeter, im fünften Jahr aber bereits 15 Zentimeter.
In der Natur kommt exponentielles Wachstum nur vorübergehend vor (ein Baum wächst zunächst immer mehr, dann immer weniger und schließlich gar nicht mehr). Dementsprechend sind wir durch die Evolution nicht auf die Wucht fortdauernd exponentieller Vorgänge vorbereitet, uns fehlt dafür jedes Gefühl. Dazu folgendes Beispiel:16
Welches der Jobangebote soll man annehmen? A verspricht ein halbes Jahr lang 1.000 € pro Woche gleichbleibend, B verspricht lediglich 1 Cent bei wöchentlicher Verdopplung. Die Wahl scheint klar – doch weit gefehlt, denn es ergeben sich folgende Summen:
nach 4 Wochen: A: 4.000 €
B: 0,15 €
nach 12 Wochen: A: 12.000 €
B: 41 €
nach 26 Wochen: A: 26.000 €
B: 671.000 €
nach einem Jahr: A: 52.000 €
B: 45.000.000.000.000 €
Wirtschaftswachstum
Wenn die Summe bezahlter Güter und Dienstleistungen innerhalb eines Jahres zunimmt, nennt man dies Wirtschaftswachstum. Basis der Bemessung ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP): Es weist die Wirtschaftsleistung durch Warenproduktion und Dienstleistungen aus – nach Abzug von Vorleistungen und Importen. Gemessen wird in Geldwerten, entweder nominal (in jeweiligen Preisen) oder real (inflationsbereinigt: in Preisen eines Basisjahrs).
Wachstum des realen BIP, Deutschland 1950–2007in Preisen von 1995 (Mrd. Euro)
Quelle: Institut für Wachstumsstudien (Grafikauszug)
Abb. 5: Wirtschaftswachstum in Mrd.
Seit Gründung der Bundesrepublik wächst die deutsche Wirtschaftsleistung ungeachtet vorübergehender Schwankungen linear, in jedem Jahrzehnt um etwa 300 Milliarden Euro. Abbildung 5 zeigt das reale BIP-Wachstum 1950 bis 2007 in Preisen von 1995.17 Nach dem Sprung durch die Wiedervereinigung blieb der lineare Trend bestehen (Erklärung der rot gestrichelten Linie im Folgenden).
Abbildung 5a ergänzt die obige Grafik um die Folgejahre bis 2012. Auch nach dem schweren Einbruch durch die Finanzkrise hat sich der lineare Trend erneut eingestellt:
Wachstum des realen BIP, Deutschland 2006–2012
Quelle: Bundeswirtschaftsministerium, Jahreswirtschaftsbericht der Bundesregierung 2012 vom 17.1.2013
Klaus Simon 2013
Abb. 5a: Ergänzung Folgejahre
Relatives Wirtschaftswachstum, Deutschland 1951–2002 (Wachstumsrate in Prozent)
Quelle: Institut für Wachstumsstudien (Grafikauszug)
Abb. 6: Wirtschaftswachstum in Prozent
Abbildung 6 zeigt ebenfalls das deutsche Wirtschaftswachstum, diesmal aber nicht den Zuwachs in Milliarden Euro oder Indexwerten, sondern die Wachstumsrate in Prozent.18 Wegen des immer gleichen Wachstumsbetrags muss die Wachstumsrate fortwährend fallen, sie erreicht als preisbereinigter Durchschnittswert in der Dekade 2000 bis 2010 schließlich nur noch 1 Prozent.19
Bewertungen des tatsächlichen Wirtschaftswachstums anhand der Wachstumsrate führen demnach in die Irre! Immer wieder ist zu hören: 1954 hatten wir 8 Prozent Wachstum, heute nur noch 1 Prozent – als könnte das etwas über die tatsächliche Situation aussagen. „Die Tatsache, dass in Deutschland mittlerweile jährlich etwa dreibis viermal so viele Güter und Dienstleistungen geschaffen werden wie noch in den so genannten Wirtschaftswunderjahren, bleibt dabei weitgehend unbeachtet.“20
Es hat in Nachkriegsdeutschland niemals exponentielles Wirtschaftswachstum gegeben. Der vorübergehend starke Trend entpuppte sich nach 1974 trotz aller Prognosen als konjunkturelle Schwankung. Die rot gestrichelte Linie in Abbildung 5