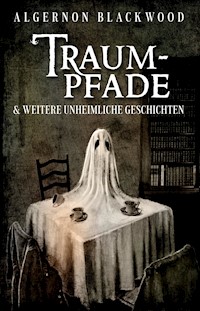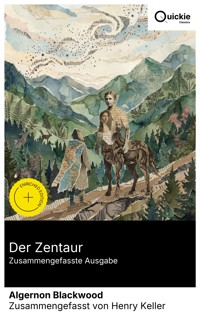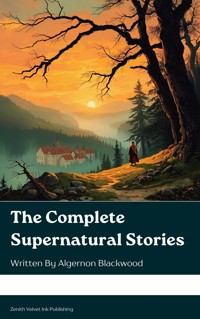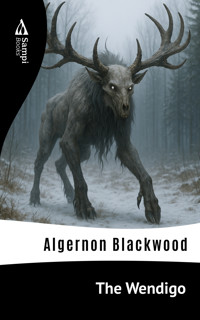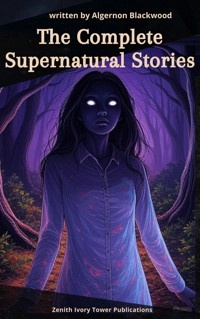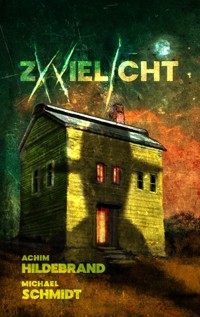Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Die 20. Ausgabe des Magazins Zwielicht. Das Titelbild ist wie immer von Björn Ian Craig. Vorbestellbar als E-Book Mit Illustrationen von Frank G. Gerigk. Geschichten: Julia A. Jorges - Zwischen zwölf und Mittag Nele Sickel - Ein Mädchen in Gold mit Schuhen aus Glas Silke Brandt - Die Burg über den Rheinwüsten Ina Elbracht - Mein wunderschöner Supermarkt Nikolaus Schwarz - Wer glaubt schon an Hexerei Moritz Boltz - Der Tschonk Maximilian Wust - Salz, Glas und Silber Timothy Granville - Einige unlängst gestiftete Objekte Christian Blum - Der Arhang Lena Marlier - Schnee Ansgar Sadeghi - Geliebte Schwester Karin Reddemann - Roter Regen John Martin Leahy: In Amundsens Zelt Algernon Blackwood - Hass auf den ersten Blick Max P. Becker - Die Hypnose Arthur Machen - Die Geschichte des Sergt Richard Haughton und was ihm an der Somme widerfuhr Yvonne Tunnat - Der Hotelflur Sascha Dinse - Lethe Artikel: Karin Reddemann - Märtyrer, Schlampertoni und der Heilige Bimbam Michael Schmidt - Die Kurzgeschichten beim Vincent Preis
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 481
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Hrsg. Michael Schmidt & Achim Hildebrand
Zwielicht 20
Horrormagazin
Horrormagazin Zwielicht
Band 20
Herausgegeben von Michael Schmidt & Achim Hildebrand
Kontakt: [email protected]
Das Copyright der einzelnen Texte liegt bei den jeweiligen Autorinnen und Autoren
Die Vorworte der Übersetzungen sind vom jeweiligen Übersetzer
Titelbild: Björn Ian Craig
Illustrationen: Frank G. Gerigk
Lektorat: Marianne Labisch, Lena Marlier, Achim Hildebrand
April 2024
Inhalt
Vorwort
Geschichten
Julia A. Jorges – Zwischen zwölf und Mittag
Nele Sickel – Ein Mädchen in Gold mit Schuhen aus Glas
Silke Brandt – Die Burg über den Rheinwüsten
Ina Elbracht – Mein wunderschöner Supermarkt
Nikolaus Schwarz – Wer glaubt schon an Hexerei?
Moritz Boltz – Der Tschonk
Maximilian Wust – Salz, Glas und Silber
Timothy Granville – Einige unlängst gestiftete Objekte
Christian Blum – Der Arhang
Lena Marlier – Schnee
Ansgar Sadeghi – Geliebte Schwester
Karin Reddemann – Roter Regen
John Martin Leahy – In Amundsens Zelt
Algernon Blackwood – Hass auf den ersten Blick
Max P. Becker – Die Hypnose
Arthur Machen – Die Geschichte des Sergt Richard Haughton und was ihm an der Somme widerfuhr
Yvonne Tunnat – Der Hotelflur
Sascha Dinse – Lethe
Artikel
Karin Reddemann – Märtyrer, Schlampertoni und der Heilige Bimbam
Michael Schmidt – Die Kurzgeschichten beim Vincent Preis
Autoreninfos
Vorwort
Liebe Freundinnen und Freunde des gepflegten Grauens!
Manche feiern Geburtstag, andere Silvester, Bayern Münchens Niederlagen oder montags krank, und die meisten schlicht den Abend. Wir feiern mit Zwielicht 20 nicht nur ein kleines Glatte-Zahlen-Jubiläum, sondern auch unser 15-jähriges Bestehen, was sich unter anderem in einer besonders umfangreichen Ausgabe ausdrückt, die alle zum Mitfeiern einlädt. Ein ganz persönliches Jubiläum kann Karin Reddemann feiern, die mit gleich zwei Texten als Erste auf ein Dutzend Veröffentlichungen in Zwielicht stolz sein darf.
Zwielicht hat feste Wurzeln geschlagen, ist gewachsen, und wir sind zuversichtlich, dass es auch künftig düster-verlockende Blüten treiben wird. Sozusagen als Frühlingsknospen sind in dieser Ausgabe Yvonne Tunnat, Maximilian Wust, Moritz Boltz und Nikolaus Schwarz erstmals dabei und setzen frische Akzente – oder beklemmend düstere, wie Yvonne Tunnat mit Der Hotelflur.
Ebenfalls zum ersten Mal dabei ist Frank G. Gerigk, der sein beeindruckendes Debüt als Illustrator gibt.
Wie gewohnt bietet auch dieser Band ein breites Spektrum an Themen, das uns aus der düsteren Dystopie ins schleichende Grauen, und über plötzlichen Schrecken zum entspannenden Lachen führt.
Die moderne internationale Szene ist mit Timothy Granvilles Einige unlängst gestiftete Objekte vertreten, einer stilistisch ungewöhnlichen Bestandsaufnahme unheimlicher Gegenstände und ihrer Auswirkungen.
Geschmückt wird das Ganze durch ein kleines Collier vergessener Perlen aus der Pulp-Ära und den Federn klassischer Meister, von denen ich hier stellvertretend John Martin Leahys antarktischen Schrecken In AmundsensZelt erwähnen möchte.
Es sollte also wieder für jeden Geschmack etwas dabei sein.
Noch eine Meldung aus der Redaktion: Mit Lena Marlier hat unser Lektoratsteam engagierte Verstärkung erhalten. Sie wird künftig, zusammen mit der unvergleichlichen Marianne Labisch, dafür sorgen, Zwielicht noch besser und professioneller zu machen.
Wie immer freuen wir uns über euer Feedback, sei es in Form von Anregungen, konstruktiver Kritik oder einfach einem Lob. Geht ganz einfach unter [email protected] oder in die Phantastik-Kneipe (phantastik-literatur.de).
Darüber hinaus sind wir auch immer auf der Suche nach neuen Talenten. Wer also eine schriftstellerische Ader in sich pochen fühlt, sei hiermit ermuntert, es einfach mal zu versuchen. Natürlich achten wir sehr auf Qualität und können nur die besten Texte nehmen, aber auch bei Absagen sind wir stets bemüht, hilfreiche Kritik zu üben und Tipps zur Verbesserung zu geben.
Mit dunklen Grüßen
Achim Hildebrand
Geschichten
Julia A. Jorges – Zwischen zwölf und Mittag
Mir fehlt die Zeit für Träumereien, doch ich kann den Blick nicht abwenden. Der Mann auf dem Foto, sein Lächeln. Es wirkt echt, vielleicht weil es so traurig ist. Außerdem erinnert er mich an Ferdi, Ferdi, wie er war, als ich ihn zum ersten Mal sah. Der Name des Mannes lautet nicht Ferdinand, sondern Alfons. Alfons Schmechtig. Fünf Jahre älter als ich, gestern war sein Geburtstag. Morgen wird er den Ablehnungsbescheid im Briefkasten finden. Sein Haar ist hell und schulterlang. Laut Akte misst er einsvierundachtzig und hat braune Augen. Auf dem Foto lässt sich ihre Farbe nur erahnen, und ich stelle mir vor, sie wäre von einem dunklen Blau, so wie das Meer in der Vorabendserie im Fernsehen. Es tut mir leid, dass sein Antrag auf Bürgerunterstützung abgelehnt wurde. Die Sollvorgabe sitzt mir im Nacken, dennoch nehme ich mir Zeit, aus den vorgegebenen Textbausteinen diejenigen auszuwählen, die in meinen Augen am besten zu dem Mann auf dem Bild passen, bevor ich die Sätze in ordentlicher Schreibschrift in das Begründungsfeld einfüge. Die handschriftlich verfasste Ablehnung zeigt dem Bürger, dass in der Behörde echte Menschen arbeiten und er nicht bloß eine Nummer ist. Noch der Stempel, er hinterlässt blaue Tinte und einen schalen Geschmack. Wir von der Behörde machen uns die Entscheidung nicht leicht, selbst dann, wenn wir gar nichts zu entscheiden haben. Anschließend lege ich Alfons Schmechtig, wohnhaft Block 4, 9. Straße, Apartment 36c, ledig, keine Kinder, auf den Ausgangsstapel.
Ein schwerer Schatten fällt auf meinen Tisch. „Während die Tinte trocknet, gleich den nächsten Fall“, dröhnt die Stimme Globbels, versetzt mit Spucketröpfchen und dem Geruch von Pfefferminzbonbons. Finger, den vierten schnürt ein Ehering bedenklich ein, grabschen nach dem obersten Blatt des Stapels unbearbeiteter Anträge und klatschen es auf den Tisch.
Ich zücke den Füllfederhalter, aber jetzt tippt Globbel auf den Ausgänge-Korb, also ziehe ich Schmechtigs Akte unter der anderen hervor und bete, die Tinte möge getrocknet sein. Falls nicht, bekomme ich die verschmierten Unterlagen vom Gehalt abgezogen, mitsamt den Kosten jeder beteiligten Verwaltungsstufe. Innerlich aufatmend lege ich den einwandfreien Bescheid in den Korb. Eben widme ich mich dem nächsten, da spüre ich Globbels Atem an meiner Ohrmuschel.
„Zu langsam, Hinkebein“, schreit er. Genau genommen spricht er lediglich sehr laut, aber so dicht an meinem Gehörgang klingt es wie das Brüllen eines zornigen Gorillas. „Dreißig pro Stunde! Absolute Untergrenze! Sie schaffen nicht mal das.“ Die Hände auf den Tisch gestützt, mustert er mich von der Seite. Ich halte den Blick auf das Formular gesenkt. „Letzte Verwarnung“, dröhnt er, Wolken von Pfefferminznebel ausstoßend. „Noch mal erwischt werden beim Träumen, dann geht’s ab in den Keller. Unser Staat füttert keine Faulenzer durch.“
Wieder droht er mit dem Keller, wo doch die nächstuntergeordnete Abteilung, der Versand, bloß ein Stockwerk tiefer liegt. Statt eines Einzelpults im Großraumbüro säße ich mit anderen Angestellten zusammen, um die gesamte Behördenpost zu falten und in Umschläge zu stecken, die danach in der nächsten Abteilung mit dem Absender-Amtsstempel gekennzeichnet wird, bevor sie über lange Rutschen in der untersten Sektion, dem Keller, landet. Wenn Globbel mich dorthin verfrachten will, wird er einen Weg finden, egal, wie das übliche Herabstufungsverfahren aussieht.
Endlich geht er, die Abdrücke seiner Handflächen bleiben noch eine Weile auf der Tischplatte zurück. Meine Hände haben sich um den Füllfederhalter verkrampft, als wäre das Schreibinstrument Globbels Hals. Mein Name lautet nicht Hinkebein, das weiß er. Als ich aufschaue, ob er noch irgendwo in der Nähe lauert, trifft mein Blick den von Sandrine. Sie grinst mich an, dann streckt sie mir die Zunge raus. Gerüchte besagen, sie habe was mit Globbel. Ich kann das nicht beurteilen, aber es fällt auf, dass sie nie zu denen gehört, die das Stakkato seiner Standpauken über sich ergehen lassen müssen.
Ich will nicht in den Keller, wo man bei flackerndem Neonlicht an langen Tischen steht und acht Stunden lang nichts anderes tut, als die Umschlagsgummierung der Briefbescheide und Versandmarken anzulecken, bis die Zunge einreißt und die Lippen zu Pergament werden. Der Klebstoff zerstört die Geschmacksknospen und mitunter auch den Geruchssinn, heißt es.
Warum ich?, geht mir durch den Kopf, mehr innerlicher Stoßseufzer denn Frage. Jemanden wie mich gibt es in jeder Abteilung, die anderen brauchen einen, auf den sie herabschauen können, es schweißt die übrige Gruppe zusammen. Mal ist es die Haarfarbe – wer hasst nicht die Rothaarigen, die im Herzen allesamt religiöse Fanatiker und potenzielle Attentäter sind, auch wenn sie harmlos tun –, mal ein anderer körperlicher Makel oder die familiäre Herkunft. Freilich gilt dieses Konzept nur für die unteren Abteilungen, ab dem mittleren Verwaltungsdienst ist körperliche und geistige Untadeligkeit Voraussetzung.
Ich gehe als Letzte in den Feierabend, um noch schnell die geforderten dreißig Bescheide vollzumachen. Hinter den auseinandergleitenden Fahrstuhltüren unterhalten sich zwei Mitarbeiter aus der Bewilligung. Die Kabine bietet Platz für sechs Personen, aber die Art, wie sie ihr Gespräch unterbrechen und mich ansehen, hält mich vom Zusteigen ab. Sie fürchten wohl, eine, die den ganzen Tag mit Ablehnungs-post beschäftigt ist, könnte die Luft verpesten, so als wäre ich einer der Adressaten, einer, der Unserem Staat und den rechtschaffenen Bürgern auf der Tasche liegt. Ob das auch für Alfons Schmechtig gilt? Ich will es nicht glauben, andererseits – warum sonst wurde er abgelehnt?
Ich brauche nicht lang für den Heimweg, gerade mal zwanzig Minuten, wenn ich mich beeile, was ich heute tue, um wenigstens die zweite Hälfte der Serie zu sehen. Ein paar Blocks weiter, das Verwaltungsgebäude noch in Sichtweite, verändert sich das Aussehen der Stadt. Scherben und Trümmer, von niemandem beseitigt, übersäen Straßen und Bürgersteige, die hier und da von Autowracks versperrt sind. In den Straßenschluchten heult der Novemberwind, treibt Zeitungspapier gegen schwärzliche Haufen matschigen Schnees, als wollte er sie aufwischen. Fauliges Laub, herangeweht aus den Parks im Stadtzentrum, ballt sich zusammen in Rinnsteinen, verstopft die Gullys. Hier gibt es keine Bepflanzung, nur borstiges Unkraut, das sich durch Ritzen bröckelnden Pflasters schiebt. Die Horden räudiger Katzen, die früher die Gassen durchstreiften, sind längst verschwunden. Zu wenig Nahrung, kaum eine Ratte oder Maus wagt sich auf die Straße. Die Nager waren schlau genug zu fliehen, bevor sie selbst zur Beute wurden.
Eine hatte es nicht geschafft, sie steckt an einem Spieß, den ein zerlumpter Mann in einer Hofdurchfahrt über einem Tonnenfeuer dreht, hungrig beobachtet von einem anderen, der die Arme um den hageren Leib schlingt, wie um zu verhindern, dass dieser auseinanderfällt. Der Geruch von brutzelndem Rattenfleisch und brennendem Müll treibt mich weiter. Hinter mir flackert Blaulicht, die Polizei kommt, um die Obdachlosen zu vertreiben, die sich unerlaubt im Bürgerbezirk eingenistet haben; vielleicht gibt es hier immer noch mehr Ratten als drüben im Gürtel. Den Schal festgezurrt, Schneeregen im Haar, trabe ich in Richtung meines Wohnblocks, der sich aus dem nie ganz verschwindenden, nahtlos in die Dämmerung übergehenden Dunst erhebt. Dahinter, über die nächste Querstraße, liegt eins der Elendsviertel der Stadt, Teil des Pariagürtels, der das Zentrum mit seinen Regierungs- und Verwaltungsgebäuden sowie die bürgerlichen Wohngebiete in einem unregelmäßigen Ring umschließt. Eine feste Grenze gibt es nicht, doch es gilt die Faustregel, dass Armut und Verwahrlosung zunehmen, je weiter man sich vom Zentrum entfernt.
Der Fahrstuhl ist kaputt, zu Fuß quäle ich mich hoch in den 9. Stock. Wenn ich es darauf anlegte, könnte ich mir eine Wohnung in einem etwas besseren Bezirk leisten. Aber dann bliebe nichts zum Sparen übrig, das Wenige, das ich Monat für Monat beiseitelege, wäre einfach weg, und mein Traum würde nie Realität werden. Mit schmerzenden Beinen und nach Luft schnappend komme ich oben an, schließe die Tür zu meinem Ein-Zimmer-Apartment auf. Bevor ich Schuhe und Mantel ausziehe, schalte ich den Fernseher ein, gerade rechtzeitig zum Serienabspann und Ausblick auf die morgige Folge. Ich frage mich, seit wie vielen Jahren die Serie bereits läuft. Während ich noch darüber nachdenke, ploppt in meinem Hirn eine andere Frage auf. Wie lange wohne ich schon allein? Früher lebte Ferdi bei mir, bis er von einem auf den andern Tag verschwand mit all seinen Sachen.
Von der Straße her schallt das Geräusch eines fahrenden Autos herauf, vor dem Haus stoppt es. Ich gehe zum Fenster, ziehe die Gardine beiseite. Unten steht ein Leichenwagen, aus dem zwei Männer steigen, zwischen sich eine zusammengeklappte Tragbahre, sie gehen ins Haus. Minuten später höre ich Rumoren in der Wohnung links neben meiner. Ein alter Mann bewohnt sie, ab und zu haben wir uns unterhalten, wenn wir uns im Flur begegneten. Er war nett, manchmal habe ich mir vorgestellt, er wäre mein Vater.
Die Nachrichten verkünden neuerliche Produktivitätssteigerungen in der Lebensmittelherstellung: fünfzehn Prozent mehr in der Algenindustrie, beim In-Vitro-Fleisch sogar knapp zwanzig Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der Bericht schließt mit dem Versprechen, ab Januar könne sich jeder Bürger dreimal pro Woche Fleisch- oder Fischgerichte leisten. Wenn ich Appetit darauf habe, gönne ich mir sonntags ein Schnitzel oder Wurst, Fisch mag ich nicht. Ferdi mochte Fisch, besonders Sardinen aus der Dose. Wo ist er bloß hin? Er ist schon so lange fort, dass ich mich nicht mehr an sein Gesicht erinnere. Aber halt, etwas hat heute an meinem Gedächtnis gerührt, das Foto von Alfons Schmechtig, 41 Jahre alt. Ich kenne seine Augenfarbe – blau – und seine Adresse. Vielleicht besuche ich ihn eines Tages.
Früh am übernächsten Morgen, ich sitze bei Tee und Hafergrütze am Tisch, klopft es. Ich öffne. Vor der Tür steht ein Mann vom Amt für Verteilung. Mein verstorbener Nachbar, Maximilian Abelli, habe mir etwas aus seinem Privatbesitz vererbt, sagt er, wobei er privat ausspricht, als wäre das ein unanständiges Wort. Ob ich es mir ansehen will, er und seine Kollegen seien gerade dabei, die Wohnung auszuräumen. Ich folge ihm ins Nebenapartment, in dem es unangenehm riecht, obwohl die Fenster offen stehen. Klumpige Schneeflocken fallen auf die Fensterbank. Zwei Leute packen den Besitz des Toten in Pappkartons. Mein Blick wandert zu einem Regal mit einem halben Dutzend Büchern darauf, die auf der einen Seite umgekippt sind. Darüber und darunter verlaufen weitere Regale, auf denen bis vor Kurzem möglicherweise noch mehr Bücher standen, denn die Tapete ist heller dort und es liegt nur an den Rändern Staub. Dem Beamten, der mich hergebracht hat, fällt das ebenfalls auf. „Die gehen alle in die Prüfstelle“, ordnet er an und zeichnet mit rotem Filzstift ein X auf den Karton. „Seht nach, ob irgendwo noch mehr versteckt sind.“
„Dort“, sagt er zu mir und deutet auf eine mächtige, knapp zwei Meter hohe Standuhr. Überwältigt starre ich auf das altertümliche Zifferblatt, die verschnörkelten Verzierungen im polierten, dunkel gemaserten Holz des geschlossenen Uhrenkastens. Noch nie habe ich so etwas Schönes gesehen. Der Mann zieht mich beiseite und flüstert mir etwas ins Ohr. „Das Ding überschreitet womöglich die Zulässigkeitsgrenze. Aber ich hab heut meinen Spendablen, deshalb drück ich ein Auge zu, falls Sie sie haben möchten.“
Ich schätze, seiner Großzügigkeit liegt eher die Tatsache zugrunde, dass seine Leute und er den sperrigen Gegenstand sonst die vielen Treppen hinunterschleppen müssten. „Ich nehme sie“, sage ich und mache den Weg frei für die Männer, damit sie die Uhr an dicken Tragegurten in mein Apartment manövrieren.
Erst am Abend, nachdem ich von der Arbeit zurück bin, habe ich Zeit, mir meinen neuen Besitz genauer anzusehen. Die Zeiger der Uhr stehen still. Ich öffne den Uhrenkasten. Die drei Gewichtszylinder, die das Uhrwerk antreiben, sind bis zum Boden abgesunken, ich ziehe sie an den Ketten hoch, in der Hoffnung, das Uhrwerk dadurch zum Laufen zu bringen. Mit leisem Ticken setzen sich die Zeiger in Bewegung, ich richte sie nach der im Fernseher eingeblendeten Zeitanzeige aus. Als ich fertig bin, fällt mir ein Bogen Papier auf, der oberhalb des Federkastens mit Klebefilm an der Innenseite des Gehäuses befestigt ist. Ich nehme ihn heraus, schließe die Tür, entfalte einen in eleganter Handschrift verfassten Brief.
Liebe Frau Henkelein,
gern würde ich Sie mit Ihrem Vornamen anreden, wo Sie doch vom Alter her meine Tochter sein könnten, aber leider kenne ich ihn nicht. Aber Sie kenne ich gut genug, um zu verfügen, dass diese Uhr nach meinem Tod Ihnen gehören soll. Sie hatte eine ganz besondere Bedeutung für mich, und die soll sie nun für Sie haben. Öffnen Sie den Kasten mittags, wenn die Uhr schlägt, dann kommen Sie dahinter. Denken Sie auch daran, sie täglich aufzuziehen, indem Sie die Gewichte an den Kettenzügen hochziehen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute.
Maximilian Abelli
Ich lege den Brief aus der Hand, betrachte die Uhr. Ein Geheimnis spricht aus den Zeilen, doch ich muss mich bis Sonntag gedulden, mittags bin ich in der Behörde. Erst nach Mitternacht finde ich in den Schlaf, müsste die Uhr nicht auch dann schlagen? Doch sie macht einen Unterschied zwischen zwölf Uhr am Tage und nachts, denn alles bleibt still. Ich warte auf das Wochenende, ziehe die Uhr auf, bewundere ihr gleichmäßiges Ticken. Sonntagmittag, Punkt zwölf, ertönt leises, melodiöses Glockenspiel. Klopfenden Herzens öffne ich die Tür des Uhrenkastens in Erwartung irgendeiner ausgefallenen mechanischen Spielerei.
Stattdessen blicke ich in ein Zimmer, es misst rund fünfzehn Quadratmeter und ist mit dunkelbraunem Holz vertäfelt. Ein wuchtiger alter Schreibtisch nimmt mehr als die Hälfte der gegenüberliegenden Wand ein. Links der Tür stehen ein Ohrensessel und ein kleiner Tisch. Über die Wände ziehen sich vom Fußboden bis zur Decke Bücherregale. Ohne lange nachzudenken steige ich über den Absatz des Uhrenkastens, erschrecke über meinen Wagemut und drehe ich mich sofort wieder um. Da ist der Ausgang, eine schmale Holztür, die, als ich sie öffne, in mein Apartment führt, wo der Fernseher läuft und alles ist wie immer. Solcherart beruhigt erforsche ich die Kammer. Noch nie habe ich so viele Bücher auf einmal gesehen, fast scheint es, als bestünden die Wände daraus. Zwei Lampen spenden Licht, eine kleine auf dem Schreibtisch, die andere, eine Stehlampe mit grünem Schirm und Troddeln, erfüllt die Leseecke mit anheimelnd gelblichem Schein; es gibt weder Lichtschalter noch Kabel. Ich wende mich den Büchern zu, entdecke Werke über Naturkunde, Philosophie, Medizin und alle nur erdenklichen Wissensgebiete. Eins befasst sich mit der jüngeren Historie. Mit angehaltenem Atem ziehe ich es heraus, lese das Inhaltsverzeichnis. Rasch stelle ich es zurück an seinen Platz, die Brust eng vor Unbehagen. Verbotene Literatur, nicht nur dieses Buch, bestimmt auch die übrigen, darunter literarische Werke von Autoren mit unbekannten, fremdartigen Namen. William Shakespeare, Gotthold Ephraim Lessing, Jane Austen, Fjodor Michailo-witsch Dostojewski … Hunderte, Tausende. Bücher sind gefährlich, sie setzen den Lesern falsche Gedanken in die Köpfe, indem sie ihnen eine irreale, verzerrte Wahrheit präsentieren. Es gibt nur wenige Bücher heutzutage.
Eingeschüchtert von der gewaltigen Präsenz verbotenen Wissens wende ich mich ab und lasse mich in den mit weinrotem, leicht verschlissenem Samt gepolsterten Sessel fallen. Erst jetzt fällt mir der Bogen eng beschriebenen Papiers auf dem Tischchen auf, die Schrift kenne ich bereits.
Liebe Frau Henkelein,
willkommen in meinem ehemaligen Refugium, das nun Ihnen gehört! Ich hoffe, es sind wirklich Sie, die diese Zeilen liest, und „Unser Staat“, respektive das Verteilungsamt, hat mir keinen Strich durch die Rechnung gemacht. Aber ich denke nicht, dass eine alte Standuhr für irgendjemanden von Interesse ist, heute, wo man den knappen noch bewohnbaren Raum lieber für nützliche Dinge wie eine Nähmaschine oder eine Werkbank verwendet. Früher war das anders. Vor dem Zusammenbruch des alten Systems besaß jeder, der etwas auf sich hielt, eine solche Standuhr oder mindestens eine, um sie an die Wand zu hängen. Lebten mehrere Personen in einem Haus oder einer Wohnung zusammen – als Familie, was früher als normal galt –, gab es dort ebenso viele Uhren wie Menschen, und die große Kunst war es, sie synchron ticken zu lassen. Das nannte man Familiensynchronizität.
Ich will Sie nicht mit Nebensächlichkeiten langweilen, indem ich Ihnen meine Geschichte erzähle, aber ein Weniges sollen Sie dennoch erfahren. Da Sie nun meinen Platz einnehmen, erscheint es mir angemessen. Vor den „Reformen“ führte ich ein Leben als Professor für Psychologie und Philosophie und lehrte an der Universität der heutigen Hauptstadt. In seiner unergründlichen Weisheit misstraut „Unser Staat“ allen Akademikern, weshalb ich mich nach den großen politischen Umwälzungen, sämtlicher Rechte und Mittel beraubt, auf der niedrigsten Stufe sozialer Hierarchie wiederfand, gezwungen, jede Arbeit anzunehmen, um einen kärglichen Lebensunterhalt zu verdienen. Dass ich mich trotz mannigfaltiger Entbehrungen, Anfeindungen und jahrelanger Überwachung guter Gesundheit erfreue und sogar eines gewissen Maßes an Lebensfreude, verdanke ich zu einem nicht geringen Teil der Uhr.
Ich hoffe, Sie lernen den Schatz des hier gesammelten Wissens schätzen. Seien Sie offen, erlesen Sie sich einen kritischen Geist. Suchen Sie zu gegebener Zeit jemanden aus, an den Sie dieses Vermächtnis weitergeben – so wie Sie von mir ausgesucht wurden und ich selbst von meinem Vorgänger, in dessen Privatbesitz sich die Uhr einst befand, damals, als es noch jede Menge persönlichen Besitzes gab.
Zuletzt noch eine Anweisung, an die Sie sich unbedingt halten müssen: Verlassen Sie den Raum, wenn die Uhr erneut schlägt!
Außerdem noch ein Rat: Nutzen Sie Ihre Zeit weise, sie ist das Wertvollste, das wir besitzen.
Ihr Max Abelli
Ausgeschlossen, denke ich, morgen ist Montag, ganz bestimmt werde ich keine 24 Stunden hier ausharren bis zum nächsten Glockenschlag. Unruhig wandere ich im Zimmer auf und ab. Es wäre meine Pflicht, die Bücher zu melden. Aber das Ganze ist so rätselhaft, dass ich mich nicht dazu durchringen kann, diesen Schritt sofort zu gehen. Schließlich greife ich nach dem Buch einer Schriftstellerin mit Namen Virginia Woolf. Aufgrund seines Titels, Ein Zimmer für sich allein, mutmaße ich, es handele von dem Zimmer im Uhrenkasten, aber das stellt sich als falsch heraus, und ich verstehe nicht, worüber die Autorin eigentlich schreibt. Danach blättere ich in einem Buch über Meereskunde, betrachte die farbigen Abbildungen exotischer Fische und anderer Seegeschöpfe, bis mich ein neuerlicher Gongschlag aus meiner Versunkenheit reißt. Jetzt schon? Eingedenk Abellis Mahnung lasse ich das Buch fallen und eile zur Tür, steige aus dem Uhrenkasten, während das Glockenspiel erklingt. Im Fernsehen beginnen die Zwölf-Uhr-Nachrichten wie zu dem Zeitpunkt, da ich hineinging, laut Datumsanzeige ist es derselbe Tag. Als ich mich herumdrehe, blicke ich auf einen gewöhnlichen Uhrenkasten mit Gewichten und Ketten. Es ist, als hätte es den Raum und die Stunde, die ich darin verbrachte, nie gegeben.
Ab jetzt besuche ich jeden Sonntagmittag die geheime Kammer und lese. Ungeduldig warte ich auf das Glockenspiel, das den Eingang öffnet, und mit Bedauern verlasse ich den Uhrenkasten, wenn es das Ende der zusätzlichen Stunde einläutet. Und mit jeder Woche verstärkt sich mein Eindruck, der Irrtum liege auf dieser Seite der verborgenen Holztür und nicht in den alten Büchern. Die Moderatoren im Fernsehen – plappernde Marionetten, meine vormals geliebte Serie schamlos geschönte Wirklichkeit. Ich schalte den Fernseher nur ein, weil es Pflicht ist und um die Uhrzeit zu erfahren, lasse den Ton ausgestellt. Wenn ich außerhalb der Standuhr darüber nachdenke, dass Abellis Bücher eine Wahrheit kennen, die der Welt verloren gegangen ist, bekomme ich Kopfschmerzen. Ich habe das Gefühl, als gäbe es auch in meinem Kopf eine verborgene Kammer und das, was sich darin befindet, drückt schwer gegen die verschlossene Tür.
Manchmal möchte ich nicht lesen, dann träume ich mich aus dem behaglichen Ohrensessel in eine mögliche Zukunft. Ich stelle mir vor, wie ich zu Alfons Schmechtig gehe und ihm den Antrag mache. In allen Details male ich mir unsere Hochzeit aus, unsere Liebe und wie es ist, Mutter zu sein. Viel zu schnell verrinnt die geschenkte Stunde. Ich beschließe, künftig in der Mittagspause nach Hause zu gehen; das tun nicht viele, doch verboten ist es nicht. Wenn ich etwas Puffer einkalkuliere, auch wegen des noch immer kaputten Fahrstuhls, kosten mich Hin- und Rückweg zusammen eine Dreiviertelstunde, es lohnt sich also.
Anfangs genieße ich die zusätzliche Stunde Mittagspause, fernab des überfüllten Speisesaals und der Lästereien meiner Kollegen, in der Abgeschiedenheit des Uhrenkastens, wo ich lese oder von Alfons Schmechtig träume, bis der zweite Zwölf-Uhr-Gong zur Rückkehr mahnt. Eines Tages aber – am Vormittag hat Globbel mir erneut mit dem Keller gedroht – kommt mir eine bessere Idee. Mit flauem Magen schmuggele ich in meiner Tasche einen Stapel Bescheide aus dem Verwaltungsgebäude, um sie in der Uhr zu bearbeiten. Wieder zurück an meinem Platz lege ich sie heimlich auf den Ausgangsstapel. Nachdem mir die ersten Tage vor Angst die Knie zitterten, wird das Mitnehmen der Akten nach einer Weile zur Routine. Das bleibt nicht ohne Folgen. Zum ersten Mal, seit ich in der Abteilung für Ablehnung arbeite, zollt Globbel mir Anerkennung und ich erhalte einen Prämienzuschlag auf meinen Lohn. Mehr noch, nach drei Monaten stellt Globbel mir in Aussicht, sich dafür einzusetzen, dass ich auf die Warteliste derer komme, die in die Bewilligungsabteilung wechseln. Meine Zukunftsträume rücken in greifbare Nähe! Eisern spare ich, um das Geld für die Heiratsbewilligung zusammenzubekommen. Sobald man verheiratet ist, kann man den Antrag auf ein Kind stellen, natürlich kostet auch der etwas, aber wenn ich erst befördert bin, stellt das kein Problem mehr dar. Alfons Schmechtigs trauriges Lächeln hat sich tief in mein Gedächtnis gebrannt; wenn er mein Ehemann und Vater unseres Kindes ist, wird es ein glückliches sein.
In letzter Zeit schlafe ich schlecht. Schuld daran ist der Mann, der in Abellis Wohnung eingezogen ist und unter schrecklichen Albträumen leidet. Jede Nacht höre ich ihn schreien, zwei- manchmal auch vier- oder fünfmal. Ich traue mich nicht, bei ihm zu klopfen und um Einhaltung der Nachtruhe zu bitten, ebenso wenig möchte ich ihn bei der Wohnungsbehörde melden, schließlich kann er nichts dafür, dass er schlecht träumt. Es graust mich vor seinen Schreien, so klingt jemand in Todesangst. Die ersten Male dachte ich an ein Verbrechen und lag zitternd wach, bis ich nebenan das Bett knarren hörte und alsbald gleichmäßiges Schnarchen.
Trotz Müdigkeit halte ich fest an meinem Vorsatz, befördert zu werden, schleuse Bescheide aus der Behörde, um sie an meinem Schreibtisch im Uhrenkasten zu bearbeiten. Heute fällt mir die Konzentration besonders schwer. In Sorge, mir könne aus Übermüdung ein Schreibfehler unterlaufen, lehne ich mich zurück im ledernen Drehstuhl, schließe die Augen. Kurz ausruhen. Als ich erwache, blicke ich gegen die holzvertäfelte Decke, im Schlummer ist mein Kopf nach hinten gesunken. Die Muskeln im Nacken schmerzen, als ich ihn vom Polster der Lehne hebe. Fassungslos starre ich auf die leere Wand gegenüber. Ich habe den zweiten Mittagsgong verschlafen und jetzt ist die Tür fort. Steifgliedrig stakse ich zu der Stelle, an der sie sich befand, taste die Vertäfelung ab in der naiven Hoffnung, auf einen verborgenen Mechanismus zu stoßen, der den Ausgang zurückbringt. Die Sinnlosigkeit meines Tuns wird mir bewusst und ich schwanke zum Sessel, lasse mich hineinfallen und vergieße bittere Tränen ob meiner Unbesonnenheit.
Zwischen den Schluchzern fällt mir ein Geräusch auf, das ich im Innern der Uhr sonst nie hörte, ein regelmäßiges Ticken. Außerdem das leise Schnarren von Zahnrädern, die ineinandergreifen. Die Geräusche des Uhrwerks beruhigen mich ein wenig. Alles was ich tun kann, tun muss, ist bis zur nächsten Mittagsstunde abzuwarten. Eine Zeitlang zähle ich die Sekunden, alle sechzig mache ich einen Strich auf ein Stück Papier. Fünfzig Minuten halte ich durch, dann gebe ich es auf und blättere in einem Buch über Vulkanismus, das ich wahllos aus dem Regal gegriffen habe. Zermürbendes, endloses Warten. Ich stelle das Buch zurück, ziehe weitere aus den Regalen, aber die darin enthaltenen Wörter und Sätze wollen keinen Sinn ergeben. Ich kann nicht länger sitzen, beginne im Kreis zu laufen: tick, Schritt, tick, Schritt, hin und her, vorwärts, rückwärts. Die Minuten dehnen sich zu Stunden, die Stunden zu Tagen. Ich verspüre weder Hunger noch Durst, und auch keine Müdigkeit, es ist, als stünde die innere Uhr meines Körpers still, eingeschüchtert von all dem Ticken und Schnarren, das klingt wie Donnergrollen und mein Blut im selben Rhythmus pulsieren lässt.
Endlich, endlich, dringt der melodische Gongschlag an mein Ohr. Ich raffe die Akten an mich, haste zu der mit dem ersten Ton sichtbar gewordenen Tür, stolpere in mein Wohnzimmer. Der Fernseher läuft, ich lese die Datumsanzeige im Laufband, es ist der Folgetag. Jetzt erst begreife ich Abellis Anweisung, die Uhr beim zweiten Gongschlag zu verlassen … Die Arbeit! Die Akten! Ich muss sie zurückbringen, bevor jemandem auffällt, dass sie fehlen.
Sämtliche Köpfe wenden sich mir zu, als ich die Abteilung betrete. Wortlos schleiche ich zu meinem Tisch, verfolgt von heimlichen Blicken. Der von Sandrine ist nicht heimlich, sie hat sich auf ihrem Stuhl umgedreht und beobachtet, wie ich mich setze, die Tasche neben mich stelle. Wie nur die Akten auf den Tisch bekommen?
„Hinkebein, wie nett.“ Globbels ungewöhnlich sanfte Stimme geht seiner Erscheinung voraus, die ich hinter mir spüre wie die Anwesenheit von etwas sehr Großem und Gefährlichem. Eine Hand legt sich auf meine Schulter. „Wir haben Sie vermisst“, sagt er, immer noch mit dieser veränderten Stimme. „Haben gedacht, es ist Ihnen was zugestoßen in der Mittagspause. Wo Sie doch immer nach Hause gehen.“ Er umrundet den Tisch, bezieht mir gegenüber Position. „Kommen Sie, Hinkebein, geben Sie mir die Akten.“
Ich hebe den Blick, ohne meinen Kopf bewegen, versuche ahnungslos dreinzuschauen. „Welche Akten?“
Globbels Gesichtshaut durchläuft einen erschreckenden Farbwandel von Rötlich über Rot zu Purpur. „Die Akten, die Sie mitgenommen haben“, sagt er, und seine Stimme knirscht wie die dünne Schicht erstarrter Lava in einem Vulkankrater kurz vor dem Ausbruch.
Ich kann nicht anders als ihn anzustarren. Seinen Hals, der über Kragen und Krawatte quillt, die von der morgendlichen Rasur entzündete Haut, das rasche Pulsieren der Schlagader darunter.
„Wir alle bekommen mächtig Ärger, wenn bei uns Akten verschwinden“, knirscht Globbel.
Mir wird klar, dass er Angst hat, große Angst. Für einen Moment beschert mir das einen kleinen Triumph, der sogleich in sich zusammenfällt. „Rück die Akten raus, Hinkebein“, zischt Globbel. „Sonst sorge ich dafür, dass dir die Aussicht, im Keller zu schuften, wie der Himmel erscheint.“ Seine Faust knallt vor mir auf den Tisch, das Zittern in seiner Stimme verrät, dass er sie lieber in meinem Gesicht platziert hätte. „Bist du taub?“, brüllt er los.
Tränen schießen mir in die Augen. Während ich mich zu meiner Tasche bücke, presse ich die Lider zusammen. Nicht losheulen, diese Genugtuung will ich Globbel nicht geben. Bevor ich die Papiere auf den Tisch legen kann, reißt er sie mir aus der Hand, zählt durch. Sein Gesichtsrot erhellt sich um Nuancen. „Raus hier“, knurrt er, ohne mich eines weiteren Blickes zu würdigen. „Sie sind fristlos entlassen. Papiere beim Pförtner.“
Am nächsten Tag stelle ich einen Antrag auf Bürgerunterstützung. Parallel dazu sehe ich mir im Teletext die Stellenanzeigen an. Der Staatsdienst ist für mich gelaufen, einmal aus der Behörde entlassen, werde ich nicht einmal im Keller Beschäftigung finden.
Nach einer Woche finde ich den Ablehnungsbescheid im Briefkasten. Unterschrieben von Sandrine: Sehr geehrte Frau Henkelein, nach gründlicher Prüfung Ihres Anliegens teilen wir Ihnen mit, dass Sie für Inanspruchnahme von Bürgerunterstützung nicht infrage kommen. Es steht Ihnen frei, nach Ablauf der Frist von zwölf Monaten einen erneuten Antrag zu stellen. Die formellste unserer Vorlagen, nicht einmal das Wörtchen leider kommt darin vor. Das Mittagsgeläut ertönt, ich fliehe in den Uhrenkasten. Sobald dessen Tür geschlossen ist, überkommt mich Ruhe, meine Sorgen sind wie in einem Filter hängen geblieben und behelligen mich nicht länger. Mehrere Stunden hallt die Wirkung nach, bis mich zum Abend hin neues Grübeln und Sorge um meine Zukunft überkommen. Ich lese weit mehr als früher, wage manchmal sogar, ein Buch mit in mein Apartment zu nehmen, und bei all dem Lesen verfestigt sich meine Ahnung, dass nicht die Bücher lügen. Der Staat lügt. Die Nachrichten lügen. Die Ämter und staatlichen Organe lügen. Ich möchte nicht mehr hinaus in eine verlogene Welt, in der es keinen Platz gibt für mich. Aber ich muss.
Wo ich auch frage, niemand will mich einstellen, obwohl ich alles abklappere, was irgendwie erfolgversprechend scheint: Fabriken, Wäschereien, Warenlager, Bedarfsverteilzentren. Sobald der Personalleiter in meine Papiere geschaut hat, bescheidet er mir mal mehr, mal weniger bedauernd, es sei gerade keine Stelle vakant. Mein Erspartes geht drauf für Miete und Lebensunterhalt, vier Monate wird es maximal reichen. Acht Wochen nach meiner unehrenhaften Entlassung kündigt mir die Wohnbehörde das Mietverhältnis, zum nächsten Ersten muss ich mein Apartment räumen. Was wird aus der Uhr, den Büchern? Ohne Arbeit oder staatliche Unterstützung werde ich in keinem bürgerlichen Bezirk eine Bleibe finden, alle werden von der Behörde zugewiesen, die mich aus meiner jetzigen rauswirft. Zwei Nächte liege ich wach und weine, während sich drüben mein Nachbar seine Albträume von der Seele schreit, dann reift in mir ein Plan.
Mein Herz klopft aufgeregt, als ich in die Buslinie steige, die mich in den westlichen Teil der Stadt bringt. Wohnblocks, Straßen und Plätze ziehen an mir vorbei. Sekundenlang lässt der Blick aus dem Fenster die Sicht zu auf einen durch Mauern und Zäune abgetrennten Stadtteil. Dort wohnen Regierungsangehörige, Würdenträger Unseres Staats, prominente Schauspieler. Personen, die aufgrund ihrer gesellschaftlichen Stellung und Verantwortung einer Umgebung bedürfen, die, obgleich bescheiden, speziellen Anforderungen an Sicherheit und Abgeschiedenheit genüge, heißt es. In einem dünnen Heftchen, das zwischen zwei Geschichtsbüchern steckte, habe ich Luftaufnahmen gesehen; Villen wie kleine Schlösser, umgeben von Parks und Seen, verborgen hinter stacheldrahtgesäumten Mauern. Keine angrenzenden höheren Gebäude, und der Dunst, der fast durchgängig über den Straßenschluchten hängt, tut sein Übriges. Eine Stadt innerhalb der Stadt, nur von oben zu erkennen, selbst der Nebel wird durch riesige Ventilatoren auf Abstand gehalten, die Sonne lacht hinunter auf saftig-grüne Rasenflächen, rote Tennisplätze und azurblaue Pools.
Die Fahrt dauert beinahe eine Stunde. Anfangs geht es durch das Labyrinth der Verwaltungsgebäude, es folgen Straßen mit Lebensmittelgeschäften, Bekleidungsläden und Gaststätten, bis auch diese hinter den Rückleuchten des Busses zurückbleiben. An ihre Stelle rücken einfache Wohnblocks wie mein eigener. An der am weitesten vom Zentrum entfernten Haltestelle verlasse ich den Bus, der über eine andere Route zurückfährt. Meinen Mantel habe ich bis oben zugeknöpft und die Kapuze aufgesetzt. An der Umgebung lässt sich unschwer ablesen, dass ich mich im Gürtel befinde, die Gebäude sind verfallener, die Straßen schmutziger, die Menschen zerlumpter und verwahrloster. Was in meinem Wohnbezirk Randerscheinung ist, bildet hier die Regel, Stadtstreicher, herumlungernde Halbstarke, Säufer an jeder Ecke. Aus alten Brettern und Plastikplanen zusammengeschusterte Behausungen, die an den schimmeligen Betonwänden lehnen und vom nächsten starken Regen weggespült werden.
Der Wohnblock, in dem Alfons Schmechtig lebt, hebt sich nur durch einen Farbtupfer an einem Fenster in der ersten Etage von den anderen ab. Ein Kasten hängt dort, darin Blumen mit Blüten wie kleine Gesichter. Leider ist es nicht seine Wohnung. Im Erdgeschoss sind alle Fenster eingeschlagen, der Putz schält sich von den Mauern wie alte Haut. Türlos gähnt der Eingang, es gibt kein Licht. Die Wände des düsteren Hausflurs übersäen alte Graffitis und neuere Schmierereien aus Kreide – Farbsprühdosen sind heutzutage unerschwinglich –, Aufrufe zum Boykott der Samstagskundgebungen, unleserliche Namenszüge, obszöne Zeichnungen. Neben dem offenen, ungesicherten Fahrstuhlschacht liegt die Eingangstür auf geborstenen Fliesen. Ein infernalischer Gestank entströmt der Tiefe, die Hausbewohner entsorgen dort ihren Müll. Als ich mich zur Treppe wende, kommt mir schlurfenden Schritts ein Mann entgegen, barfuß, am Leib nichts als einen zerschlissenen Bademantel. Kurz springt mich der Gedanke an, Alfons Schmechtig könne mir in ähnlicher Aufmachung die Tür öffnen, unrasiert und in Lumpen gehüllt. Aber nein, niemand mit einem so traurigen Lächeln und diesen famosen blauen Augen würde sich derart gehen lassen.
Fünf Stockwerke, je höher ich komme, desto mehr Wohnungen stehen leer. Die Türen sind offen oder herausgerissen, dahinter gebrauchte Spritzen, leere Flaschen und Konservendosen, gammelige Matratzen. In den Ecken der kurzen Flure hat sich Müll angesammelt wie Treibgut, es knistert und raschelt darin, sechsbeinige Schatten huschen darüber hinweg. Über drei Etagen werde ich verfolgt von einer zahnlosen, erstaunlich flinken Alten, die unablässig vor sich hin brabbelt und mit dem Finger auf eine Stelle zu meiner Linken zeigt, wann immer ich mich zu ihr umdrehe. Ich steige über einen Penner, der seinen Rausch auf dem Treppenabsatz ausschläft, dann stehe ich vor Apartment 36c. Ich setze die Kapuze ab, streiche meine Haare zurück und knöpfe den formlosen Mantel auf, unter dem ich mein bestes Kleid trage, dann atme ich durch, hebe die Hand und klopfe an.
Der Mann, der die Tür öffnet, hat einen Dreitagebart, aber er ist ordentlich gekleidet. Wieder muss ich an Ferdi denken, obwohl es gar keine Ähnlichkeit gibt, höchstens die Augen, denn die sind braun, nicht blau. Er hat blonde, etwas verzottelte Haare, die auf seine Schultern fallen. Ferdis Haar war kurz und dunkelgelockt, das Bild taucht so plötzlich vor meinem inneren Auge auf, dass es mir vorübergehend die Sprache verschlägt.Ich stottere eine Begrüßung, stelle mich vor.
Er sagt nichts, aber die Art, wie er mich anschaut, zeigt, dass ich ihm gefalle. Ich möchte nicht hier mit ihm sprechen, die unheimliche Alte lungert am Treppenabsatz herum und beobachtet uns. Er macht mir Platz, und ich betrete seine Wohnung, die aufgeräumt und vergleichsweise sauber ist, sieht man vom Schimmel in den Zimmerecken ab und den schmierigen Fensterscheiben. Natürlich fehlen viele Dinge, die einen bürgerlichen Haushalt ausmachen, insbesondere der Fernseher, das Herzstück jeder Wohneinheit, allein schon, um zu wissen, wie spät es ist, und morgens pünktlich aus dem Bett und zur Arbeit zu kommen. Und um die Propaganda zu hören, ein Begriff, den ich aus einem der Bücher kenne.
„Warum bist du hier?“, fragt mich Alfons Schmechtig vom Sofa aus. Obwohl ich die Szene viele Male im Kopf durchgespielt habe, schaue ich zu Boden, zupfe an meinem Ärmel.
„Willst du mich heiraten?“ Kaum sind die Worte von meiner Zunge gesprungen, als mir wieder einfällt, dass das mit dem Heiraten so bald nichts wird. „Ich hatte schon fast genug gespart, aber dann hab ich meine Arbeit in der Abteilung für Ablehnungsbescheide verloren“, plappere ich los. „Das Meiste ging für die Miete drauf, und jetzt muss ich trotzdem ausziehen …“
„Warum ich?“ Alfons Schmechtig klopft auf den freien Platz neben sich. „Setz dich, es sieht lächerlich aus, wie du da herumstehst.“
Eine Feder unter mir ächzt lautstark, als ich mich in der Ecke des ältlichen Möbels niederlasse. „Auf deinem Antrag auf Bürgerunterstützung war ein Foto“, sage ich und füge schnell hinzu: „Ich entscheide nicht darüber, wer abgelehnt wird.“
„Verstehe“, sagt er und ich sehe ihm an, dass er wirklich versteht. Ich kann nichts dafür, dass er keine Hilfe von Unserem Staat erhält.
„Also?“ Ich wende ganz leicht den Kopf in seine Richtung.
Er legt den Finger unter mein Kinn und hebt es an, um mein Gesicht genauer zu betrachten. Dann lächelt er und sagt: „Ja, warum nicht.“
Zwei Tage später ziehe ich bei Alfons ein. Ächzend und schwitzend wuchten Alfons, einer seiner Freunde und ich die schwere, sperrige Uhr Stufe um Stufe die fünf Stockwerke hinauf. Transportiert haben wir sie in dem uralten Lieferwagen von Alfons Freund, ein riskantes Unterfangen. Wenn ein Paria mit Auto erwischt wird, auch noch in einem bürgerlichen Wohngebiet, wirft das Fragen auf, wobei die nach der Fahrerlaubnis noch die harmloseste ist. Aber wir hatten Glück, es lief alles glatt. Alfons und sein Bekannter bringen die Kartons mit meinen wenigen Habseligkeiten herein, während ich schon dabei bin, die Uhr aufzuziehen, die ihren Platz in der Ecke des Wohnzimmers gefunden hat.
Anfangs leben wir von dem Rest meines Ersparten, aber nachdem es aufgebraucht ist, sind wir auf Sozialleistungen angewiesen. Früh morgens, noch bevor mein Zukünftiger erwacht, verlasse ich das Haus und gehe in den übernächsten Bezirk, wo Leute von der Sozialbehörde in einer aufgegebenen Kirche Lebensmittel, Seife und andere Dinge an Bedürftige verteilen. Der Weg zieht sich, ich brauche eine Dreiviertelstunde pro Richtung, an guten Tagen für den Rückweg länger, weil mein Rucksack schwer beladen ist. Einmal verstellte mir eine Bande Jugendlicher den Weg und forderte meinen Rucksack. Sie kippten den Inhalt aus, suchten nach Dingen, die sie gebrauchen konnten, vermutlich Süßigkeiten und Zigaretten. Natürlich befand sich nichts dergleichen darin, also kickten sie die Sachen durch die Gegend und amüsierten sich über meine flehentlichen Bemühungen, sie davon zu überzeugen, mir wenigstens den Kohlkopf zu lassen. Unter großem Hallo wurde dieser durch die Fensteröffnung einer halb verfallenen Fabrikhalle geschossen, woraufhin es drinnen schepperte und eine raue Männerstimme etwas in einer fremden Sprache brüllte. Die Bande suchte das Weite, ich schnappte mir den leeren Rucksack und machte ebenfalls, dass ich fortkam. Alfons war sehr verärgert, weil ich mich hatte ausrauben lassen, und gab mir eine Ohrfeige, seitdem achte ich darauf, wer mir entgegenkommt, und nehme lieber Umwege in Kauf.
Wenn ich nach dem Besorgungsgang wieder zu Hause bin, räume ich Alfons’ Geschirr vom Frühstück weg, putze die Wohnung und kümmere mich um die Wäsche. Meist muss ich sie in der Badewanne säubern. Im Keller stehen eine Reihe Waschmaschinen, manche funktionieren, aber der Strom ist die meiste Zeit ausgefallen, sodass sie oft mitten im Waschgang für unbestimmte Zeit stoppen. Aber wir haben es gut, es gibt fließend Wasser. Alfons ist meistens weg, bevor ich zurück bin, wohin, weiß ich nicht. Er sagt, er besucht Freunde und sieht sich nach Arbeit um. Manchmal bringt er ein wenig Geld mit heim, dann kaufen wir uns etwas Anständiges zu essen und eine Flasche Wein und verbringen einen schönen Abend. Es ist mir recht, dass er tagsüber wenig da ist, so kann ich mittags in die Uhr verschwinden. Danach bereite ich das Essen auf dem Gaskocher zu, sofern es etwas zu kochen gibt. Oft ist es bloß Getreidebrei, aufgepeppt mit Kunsthonig und gerösteten Brocken altbackenen Brots. Alfons kommt nach Hause und wir essen und reden ein bisschen. Nachdem wir ins Bett gegangen sind, machen wir Liebe. Ich darf auf keinen Fall schwanger werden, schließlich sind wir noch nicht verheiratet. Hoffentlich findet Alfons bald eine Anstellung, ich hätte so gern ein Kind.
Nur noch ab und zu begebe ich mich in die bürgerlichen Bezirke auf der Suche nach einem Job, oft bin ich dafür zu müde. Auch die Standuhr benutze ich mit der Zeit immer seltener. Früher erschien mir die Stunde im Uhrenkasten wie ein kostbares Geschenk, jetzt dehnt sich die Zeit auch ohne sie schrecklich in die Länge. Die Stunden, die ich auf Alfons warte, in der blitzsauberen Wohnung, weil so wenig da ist, was man rein halten muss.
Eines Vormittags, ich bin gerade von meinen Besorgungen zurück und Alfons ist ausnahmsweise zu Hause, ertönen schlurfende Schritte vor unserer Tür, gleich darauf klopft es. Alfons springt auf, einen merkwürdigen Ausdruck auf dem Gesicht. Er öffnet die Tür, ein alter Mann steht davor, der sich mit einer skelettartigen Hand am Türrahmen abstützt. Hose und Hemd schlottern um den ausgemergelten Körper. Er trägt Turnschuhe, so verschlissen, dass sie ihm fast von den Füßen fallen, und keinen Mantel, trotz des Regens, nur eine verfilzte Wollmütze. Bartstoppeln auf den eingefallenen Wangen, eine Brandnarbe verunstaltet seine linke Gesichtshälfte. Augen wie schlammige Teiche, ihr trüber Blick irrt im Zimmer umher und findet mich. Sein Mund öffnet sich, zwei einzelne weiße Zähne blitzen auf. Seine Hand ballt sich zur Faust.
Alfons legt ihm die Hände auf die Schultern, flüstert ihm etwas ins Ohr, führt ihn zum Sofa, auf das der Alte mehr fällt als sich zu setzen, sein Gesicht zuckt gequält. Ich stehe auf, um Platz zu machen. Der alte Mann zählt längst nicht so viele Jahre, wie ich glaubte. Er war nur wenig älter als ich, als er fortging, und ich bin erst 36. Ich ertrage seinen trüben Blick nicht länger und stehle mich zur Tür hinaus. „Ferdi“, flüstere ich in den scheinbar leeren Flur. Da schleicht die unheimliche alte Frau, von der ich noch immer nicht weiß, auf welcher Etage sie wohnt, aus einem Winkel hinter der offen stehenden Tür der leeren Nachbarwohnung. Heute sieht sie nicht an mir vorbei, sondern blickt mich an und nickt, so als wüsste sie über alles Bescheid. Über Ferdi und mich, und was mit ihm geschah, nachdem er verschwand. Aus der Wohnung klingt Gemurmel, ich ziehe die Tür ins Schloss. Vor langer Zeit habe ich eine andere Tür geschlossen, leise, damit Ferdi nicht von dem Geräusch erwacht. Damit ich ihm nicht in die Augen sehen muss.
Ziellos wandere ich durch die Straßen. Der Himmel besteht aus Wolken und schmierigem Dunst, der zäh in die Lungen sickert. Als ich am Nachmittag heimkomme, sind der alte Mann und Alfons fort. Ich koche eine Suppe aus Kohl und Graupen und warte auf Alfons. Das Essen ist seit Stunden kalt, als der Schlüssel im Schloss klirrt. Alfons kommt nicht ins Bett, am Morgen finde ich ihn schlafend auf dem Sofa. Ohne ihn zu wecken, ziehe ich Mantel und Schuhe an und mache mich auf den Weg zur Nahrungsausgabe. Meine Ausbeute ist bescheiden, ein steinharter Brotlaib, drei runzlige Kartoffeln und etwas Hafer, den ich in das Schraubglas fülle, das ich zu diesem Zweck immer im Rucksack habe. Welch ein Luxus, als ich mir einmal pro Woche Fleisch leisten konnte und frisches Obst. Die Haare gehen mir aus und meine Röcke haben alle Abnäher, so dünn bin ich geworden, wenn auch nicht so erschreckend mager wie der gestrige Besucher. Sein Blick geht mir nicht aus dem Kopf, die leblosen, schlammigen Augen, in denen plötzlich ein Funke aufblitzt wie die Glut eines erloschen geglaubten Feuers. Ich ziehe die Kapuze aus der Stirn und lasse den Sprühregen den Schmerz aus meinem Gesicht waschen.
Ich bin längst wieder zu Hause, als es zwölf schlägt, die Melodie ist Balsam für meine angespannten Nerven, ich folge ihr in den Uhrenkasten. Der weiche Sessel empfängt mich bedingungslos und ich kauere mich hinein, bedecke mein Gesicht mit den Händen. Mein Denken verlangsamt sich zu angenehmer Leere. Die Distanz zur Außenwelt hält die Erinnerungsfetzen auf Abstand. Träge verrinnen Sekunden und Minuten, versickern in der Bedeutungslosigkeit eines Jetzt, das mir entgleitet.
Irgendwann bemerke ich, dass etwas hinter der Ecke des Schreibtischs hervorlugt, die Spitze eines Turnschuhs. Mein Herz beginnt zu rasen. Jemand ist hier eingedrungen, gestern Mittag muss das gewesen sein, als ich nicht daheim war. Die Beine gehorchen mir widerwillig, als ich auf Zehenspitzen zum Schreibtisch schleiche. Ein Unterschenkel wird sichtbar, der in einem ausgefransten Hosenbein steckt. Ich bin drauf und dran, mich umzudrehen und aus dem Uhrenkasten zu fliehen. Aber dann höre ich leises, gequältes Stöhnen. Ich kann ihn nicht dort liegen lassen, allein mit seinen Schmerzen, gehe um den Schreibtisch herum. Er liegt auf dem Rücken, die Arme schlaff neben sich, immer wieder durchläuft ein Zittern seinen Körper. Schweißperlen stehen auf Stirn und Schläfen. Sein Kopf ist unbedeckt, Grau überzieht gelocktes schwarzes Haar wie feiner Zementstaub. Auf die Stirn ist in schwarzer Farbe ein Zeichen tätowiert, das ihn als Dissidenten und ehemaligen Strafgefangenen kennzeichnet.
Ich knie mich hin, leise spreche ich ihn an. Strecke die Hand aus und fasse seine Schulter, da hebt er die Lider. Das Weiß seiner Augen ist rot geädert. Er öffnet die aufgesprungenen Lippen, es dauert eine Weile, bis sich aus den röchelnden Lauten verständliche Worte formen. „Mo“, krächzt er. „Erkennst du mich?“
Ich nicke, Tränen in den Augen. „Was haben sie dir angetan?“ Die Worte zittern in der Luft, hallen nach in dem Schweigen, das auf sie folgt. Ich berühre seine Wange, das wulstige Narbengewebe.
Die Worte kommen stockend, mühsam, aber ein vertrauter Klang schwingt darin mit. „Weißt du’s nicht? Was mit den Leuten in den Lagern passiert?“
In den Straflagern werden die Feinde Unseres Staats rehabilitiert, wenngleich sie zur Mahnung fortan das Zeichen am Leib tragen. Ferdi hebt die Hände, zieht sein Hemd hoch. Er muss mehrmals ansetzen, bis es ihm gelingt. Über Brust, Bauch und Seiten verlaufen breite Striemen, die Rippenbögen sind gespickt mit Brandnarben, kleinen von Zigarettenstummeln und großen, deren Ursache ich nicht wissen möchte.
„Es geht nicht um Umerziehung und Wiedereingliederung.“ Er schaut mich unverwandt an mit seinen leeren Augen, die früher angefüllt waren mit Leben und mit Leidenschaft. „Menschen werden gefoltert, verhungern, sterben an Erschöpfung oder Krankheiten.“
Ich weiß, dass er die Wahrheit sagt. Ich habe zu viel gelesen, um seine Worte anzuzweifeln. „Wie bist du rausgekommen?“, flüstere ich.
Das Gespenst eines Lächelns huscht über sein Gesicht, und ich muss weinen, so sehr erinnert er mich in diesem Moment an den früheren Ferdi. „Bin abgehauen“, erwidert er mit rauer Stimme. „Während der Rübenernte. Die haben nicht damit gerechnet, dass einer, der scheinbar kaum auf den Beinen stehen kann, Kilometer durch den Entwässerungskanal kriecht. Hab sie reingelegt.“ Er hustet, Blut sprenkelt seine Lippen.
„Du warst schon immer gewitzt. Und mutig.“ Damals hatte ich Angst um ihn, fand wagemutig, was er tat. Als Tochter von Akademikern hatte ich es immer schwer. Im Kinderheim brachten sie mir bei, was richtig und falsch ist. Je länger unsere Beziehung andauerte, desto mehr wuchs meine Sorge, nicht nur um ihn, auch um mich. Ich versuchte ihm seine Überzeugungen auszureden, ihn davon abzuhalten, weiter gegen Unseren Staat zu agieren. Er wollte nicht hören, ich schimpfte ihn einen Egoisten. Dann zeigten sie im Fernsehen eine Dokumentation über rehabilitierte Sträflinge. Es klang alles plausibel, überzeugend. Mit den besten Absichten, die ein Mensch haben kann, verriet ich ihn.
Ich schließe die Augen, weil ich ihn nicht länger anschauen kann. Erinnerungen fluten mein Bewusstsein, schwellen an zum reißenden Strom, die Wellen schmettern mein heutiges Ich gegen das felsige Ufer der Vergangenheit, es zerbirst in tausend Teile und zurück bleiben nichts als Schmerz und Tränen.
Sie kamen frühmorgens, als Ferdi noch schlief, und nahmen ihn mit. Mich klagten sie an wegen Mittäterschaft, obwohl meine unter der Wahrheitsdroge durchgeführte Vernehmung keine Informationen ans Licht beförderte. Meine Entscheidung, Ferdi schließlich doch der Behörde für Staatsschutz zu melden, führte zu meiner Begnadigung. Die Droge hat Nebenwirkungen, sie löscht Teile des Gedächtnisses. Ich hätte Glück, sagten sie mir, andere erlitten einen Identitätsverlust.
Schluchzend liege ich an Ferdis Brust. Ich kann nicht wiedergutmachen, was ich tat, kann Ferdi die gestohlenen Jahre nicht zurückgeben. „Es tut mir leid. Bitte verzeih mir.“ Ich spüre seine Finger in meinem Nacken, die sich plötzlich verkrampfen. Dann gleiten sie von mir ab, ein lang gezogener Seufzer leert seine Lungen.
Ich hebe den Kopf. Ferdis Augen starren hinauf zur Decke. Sein Mund ist geöffnet, aber ich werde nie erfahren, ob er mir verziehen hat.
Die Uhr schlägt zum zweiten Mal zwölf, ich springe auf. Die Tür lässt sich nicht aufdrücken, mein Rütteln erzeugt ein klirrendes, metallisches Geräusch an der Außenseite des Uhrenkastens. Ich hämmere gegen das Holz, bis der letzte Ton die Tür fortnimmt. Ich muss warten bis morgen Mittag, hoffen, dass das, was die Tür blockiert, dann verschwunden ist.
Zäh verrinnen die Minuten. Ich lehne mit dem Rücken gegen die Stelle, an der die Tür erscheint in der geschenkten Stunde, die mir Segen war und jetzt Fluch. Noch einmal bin ich zu Ferdinand gegangen. In seiner Hosentasche steckte ein Brief, der zerknickte, fleckige Umschlag enthielt ein altes Foto, sonst nichts. Es müsste längst wieder Mittag sein. Inmitten der geronnenen Zeit sitze ich, halte in meinen Händen das Foto, das den jungen Ferdi zeigt, ohne Grau im Haar, ohne Narben an Körper und Seele. Ein grimmiges Lächeln liegt auf seinen Zügen. Er steht vor einer Backsteinmauer inmitten weiterer Männer, zwei von ihnen kenne ich. Einer ist Maximilian Abelli, der andere Alfons Schmechtig.
Das Gewicht der Zeit lastet schwer auf mir. Das Ticken des Uhrwerks liefert keinen Anhaltspunkt, wie spät es in der Welt draußen ist. Etwas stimmt nicht damit, erst denke ich, ich bilde es mir ein, aber nach einer Weile kann ich es nicht mehr leugnen: Das Ticken verlangsamt sich. Bald wird es ganz verstummen, ich habe vergessen die Uhr aufzuziehen. Die Kraft des Pendelwerks wird nicht ausreichen bis zur zwölften Stunde. Zwischen den Sekunden liegen schwarze Abgründe, in denen die Zeit nicht länger existiert. Das Licht der beiden Lampen wird schwächer, ich ahne, wenn das Uhrwerk still steht, wird es verlöschen, und ich werde allein im Dunkeln zurückbleiben. Allein mit Ferdi, der so tot ist wie meine Vergangenheit und Zukunft, gefangen in der ewigen Gegenwart zwischen zwei Augenblicken.
Nele Sickel – Ein Mädchen in Gold mit Schuhen aus Glas
Der Beat war perfekt. Vor allem laut. Die Gäste zahlreich, ausgelassen und durstig. Zane lehnte sich in den Polstern seiner schwebenden VIP-Plattform zurück und sah den Tänzern zu. Schwarzlicht ließ Zähne und Tattoos erstrahlen. Es fing sich im zarten Flügelschlag der Libellenmädchen auf ihren Podesten, blitzte auf den scharfen Krallen der Wild Girls.
Das Nox war der angesagteste Club der Stadt. Hier war es immer voll. Und seit Zane gestern den Jubiläumsball ausgerufen und die Preise aller Drinks um fünfzig Prozent reduziert hatte, konnte man selbst auf dem größten Floor kaum noch treten. Die Luft stand still vor Hitze. Sie knisterte vor Leidenschaft und Leichtsinn, war durchtränkt von Abgründen, Liebesschwüren und schlecht gehüteten Geheimnissen.
Normalerweise nutzte Zane Events wie dieses, um sich nach neuen Business-Gelegenheiten umzuhören. Mit kybernetisch verbesserten Ohren blendete er Bässe aus, lauschte brisanten Gesprächen. Er folgte den Bewegungen gut betuchter Kunden mit seinen aufgerüsteten Falkenaugen, plante, sammelte Informationen, knüpfte Kontakte.
Heute Nacht allerdings stand ihm der Sinn nach etwas anderem. Besser gesagt: nach jemand anderem. Das Mädchen in Gold hatte seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen, seit sie den Club gestern zum ersten Mal betreten hatte. Ihre selbstbewusste Unschuld, ihr offenes Lächeln, ihr kurzer gemeinsamer Tanz hatten ihn gepackt. Und als sie Schlag Mitternacht ohne jede Erklärung abgehauen war, hatte sie ihm endgültig den Kopf verdreht. Zane begegnete nicht oft Frauen, die es ihm schwer machten – dabei ging er so gern auf die Jagd.
Er schloss die Finger um den Steuerknauf, und die VIP-Plattform schwebte höher. Zwei Meter unter der Decke war nicht nur die Luft besser. Von hier oben reichte Zanes Blick auch bis zum Eingangsbereich mit der pink ausgeleuchteten Garderobe. Wenn das Mädchen in Gold zurückkam, konnte er sie nicht verpassen.
Er würde zu ihr gehen, sie umgarnen, ihr einen Drink anbieten … Zwei Abende hintereinander konnte sie kaum ablehnen, nicht wahr? Schon gar nicht vom Clubbesitzer persönlich. Sie würden trinken, lachen, tanzen und dann … Das Mädchen würde ihm gehören. Zumindest für eine Weile. Er schmeckte schon beinahe ihre Erdbeerlippen.
Ein konzentrierter Gedanke, ein Blinzeln, und sein Sichtfeld schaltete sich um. Die Gäste wurden zu orangeroten Hitzesignaturen, ihre Waffen zu hellblau blinkenden Warnlichtern. Viele waren heute nicht hereingeschmuggelt worden. An der Bar trug jemand eine Klinge im Stiefelschaft. Auf der Tanzfläche hatten zwei, drei Leute kybernetische Pistolenläufe unter der Haut verborgen. Das Nox mochte eine pazifistische Sicherheitspolitik vertreten, aber Zane hatte nie darauf bestanden, sie auch umzusetzen. Bewaffnete Menschen führten oft die interessantesten Gespräche.
Noch ein Blinzeln und die Welt kehrte zu ihrem normalen Antlitz zurück. Gerade betrat ein ganzer Pulk von Gästen den Club. Und ganz hinten … Ja, tatsächlich! Sie kam allein. Trotzdem wirkte sie alles andere als verloren. Wie eine professionelle Tänzerin drückte sie den Rücken durch. Dunkle Locken ergossen sich über ihre bloßen Schultern und das pinkfarbene Licht der nahen Garderobe verlieh ihrem kurzen, goldenen Kleid einen warmen Glanz. Zum Anbeißen. Zielgerichtet wanderte ihr Blick durch den Raum bis hinauf zu Zane. Dort blieb er hängen.
Zane steuerte seine Plattform in ihre Richtung, schwebte herab, so dicht über die Köpfe der Tänzer, dass sie ihm Platz machten. Kaum war er gelandet, stand er auf, winkte die Plattform fort und trat an das Mädchen in Gold heran, ganz dicht, damit sie ihn über die Bässe hinweg verstand. Er atmete ihr Parfüm ein, diese verführerische Mischung aus Früchten und Gewürzen.
„Verschlägt es dich also erneut hierher?“
„Es scheint so.“ Mit ach so roten Lippen erwiderte sie sein Lächeln.
„Willst du einen Drink?“
Sie reckte das Kinn, musterte ihn. „Und ich dachte, man kommt hierher, um zu tanzen.“
„Das natürlich auch.“ Galant bot er ihr seine Hand. Wie ein Gentleman aus fast vergessenen Zeiten. „Darf ich bitten?“
„Na gut.“ Ihre kleine Hand landete sacht in seiner.
Zane führte sein Mädchen in Gold auf die frei gewordene Tanzfläche. Er streckte sich, ließ die Schöne sich drehen. Sie war so flink, Haar und Rock flogen nur so durch die stickige Luft. Kaum stand sie wieder, löste Zane sich von ihr. Er wiegte sich im Beat und gab ihr Raum, sich frei zu bewegen. Sie hob die Arme, schloss die Augen, jede Bewegung floss im Einklang mit der Musik.
Wie bezaubernd sie war. Auf eine unberührte, natürliche Art und Weise. Makellos von den schmalen Schultern bis hinunter zu den sorgfältig manikürten Füßen, die in transparenten High Heels aussahen, als würden sie schwerelos über die Tanzfläche schweben. Dasselbe Outfit wie gestern. Keine verbesserten Körperpartien, keine Tattoos, nicht einmal Ohrringe. Entweder das Mädchen war arm oder sie gehörte zu den Spinnern, die stolz auf ihren unverändert menschlichen Körper waren. Zane war es gleich. So oder so würde er sie bekommen. Erst mit einem Drink, dann mit etwas Stärkerem. Blue Crystal hieß die Partydroge der Stunde und Zane hatte bis jetzt noch jeden davon überzeugen können, sie zum Einstiegspreis zu probieren. Für dieses Mädchen würde er den Preis nur zu gern weiter senken. Vielleicht für einen Kuss …
Er trat dicht an sie heran, Brust an Brust, Hüfte an Hüfte. Eine Hand legte er an ihre Taille. So ließ er sich mit ihr kreisen, schaute ihr in die warmen braunen Augen.
„Siehst du etwas, das dir gefällt?“, fragte sie.
„Und ob.“ Er lächelte sie an. „Du bist mit Abstand der interessanteste Gast auf dieser Party.“
„Spricht vielleicht nicht für die Party.“
„Vielleicht nicht. Aber es spricht für dich.“ Beiläufig strich er ihr eine Locke aus dem Puppengesicht. Dann beugte er sich näher. „Ich habe Durst. Begleitest du mich zur Bar?“
„Wieso nicht.“
Er zog sie mit sich durchs Gedränge. Die Gäste, die nicht völlig in Musik und Rausch versunken waren, machten ihnen Platz, erkannten sie in Zane doch den Herrscher des Clubs. Am Tresen genügte ein Wink und schon standen zwei neongelb leuchtende Cocktails vor ihnen. Nox on the Rox. Unschuldig süß und doch der stärkste Drink im Sortiment. Hätte Zane sich nicht vor ein paar Jahren eine Luxusleber und innere Organe geleistet, die sogar Batteriesäure standhalten konnten, er wäre vorsichtig gewesen mit dem Zeug. Für seinen hübschen Ehrengast war es jedoch genau das Richtige. Mit etwas Glück würde er bald den Helden spielen und sie auf Händen in ein stilles Hinterzimmer tragen können.
„Also dann …“ Er reichte ihr eins der Gläser, nahm selbst das andere. „Auf eine unvergessliche Nacht!“
„Unvergesslich klingt gut.“ Sie hob ihr Glas, prostete ihm zu.
Er grinste und trank. Alles in einem Zug. Der Nox on the Rox rann leicht seine Kehle hinunter, machte nur umso durstiger. Teufelszeug.
Das Mädchen in Gold lächelte, stellte ihr Glas jedoch ab. Unberührt.
„Keinen Durst?“ Zane verbarg seine Enttäuschung.
„Nicht wirklich.“
„Hunger?“
Sie schüttelte den Kopf, schenkte ihm dabei einen koketten Blick. „Noch nicht. Später.“
„So?“ Grinsend lehnte er sich ihr entgegen. „Was machen wir denn später?“
„Wo wäre der Spaß, wenn ich dir das jetzt schon verrate?“
Zane lachte. Niedlich, wie sie meinte, die Kontrolle zu haben. Beiläufig griff er nach ihrem Glas, hob es an die Lippen. Dann stoppte er, sah sie an. „Und du hast wirklich keinen Durst?“
Sie schüttelte den Kopf.