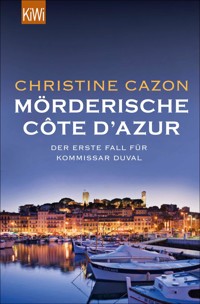9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Eine wunderbare Aussteigergeschichte mit Happy End. Nicht ausgedacht, sondern selbst erlebt. Als Christine Cazon vor mehr als zehn Jahren ihre Sachen packte, um in Frankreich auf einem Bauernhof ein Praktikum zu machen, da wollte sie eigentlich nur ein Jahr bleiben. Doch dann kam alles anders. Sie verliebte sich, heiratete und betrieb mit ihrem Mann eine kleine Auberge in den französischen Seealpen. Aus ihrem Blog, den sie über ihr Leben schrieb, entstand dieses Buch. Christine Cazon erzählt vom Dorfladen, der als Nachrichtenzentrale fungiert, vom Schlachtfest im Winter, das der Städterin einiges an Nervenstärke und Trinkfestigkeit abverlangt, vom Gemeinschaftsgefühl, aber auch von kulturellen Unterschieden. Über was sprechen die Franzosen beim Essen, und wie schaffen sie es eigentlich, zu zweit in diesen engen Betten zu schlafen? Und warum ist man für die Franzosen gleich ein Exot, nur weil man mal allein sein möchte? Mit einem feinen Gespür für alles Atmosphärische, mit einem offenen Blick für das Fremde und einer großen Portion Selbstironie geht Christine Cazon diesen Fragen nach und erzählt, wie sie in Frankreich eine neue Heimat gefunden hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 282
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Inhalt
CoverTitelWidmungLandungKräht der Hahn auf dem Mist …Libérez les betteraves! Rüben und kein EndeZwei Sterne leuchten in der NachtLand, Luft und LiebeDienstagLe jour du cochonLe chardon oder Wie eine Zeitung entstehtOrganisation und SpontaneitätWas mir fehlt …Die Braut trägt FuchsiaKüsschen, Küsschen …Frühling? Sagten Sie Frühling?Sauvage oder Von der Schwierigkeit des AlleinseinsMissverständnissePfingsten oder Wie geht eigentlich Schwarzwälder Kirschtorte?Ente chouledigain ziDas Glück liegt in der WieseMonsieur R.Allô ?!Bio à la française / Teil 1Bio à la française / Teil 2TranshumanceSaisonEine Liebesgeschichte… die Deutschen flirten sehr subtil ... Männer, Frauen, TraditionenMeine LieblingsfrageSchwalben unterm Hut AnmerkungGeburtsanzeigeEin Sommerphänomen: Spezialisten und KolporteureJagdsaisonFamilie oder im Zweifelsfall CousineZwischen Boule und BettenmachenHeimwehSauerkraut, Polka und wo liegt noch mal Deutschland?Bei Nacht sind alle Katzen … wach!NovemberDeutschlandhein?Holz machen und Schnee schaufelnKatzen im AdventBon appétit!Schnee!!! Schnee!!!WeihnachtenHessie James oder Der Mund stirbt zuletztBonne année!DankBuchAutorImpressumpour Patrick qui est devenu mon ami,
[Menü]
Landung
Oh Gott, wo bin ich denn hier gelandet?! Eben sind wir schon an alten Autowracks und verrosteten landwirtschaftlichen Geräten vorbeigefahren, und auf dem Parkplatz hier sieht es aus wie auf einem Schrottplatz: alte Autos, ein vorsintflutlicher Traktor, jede Menge alte Autoreifen, die aus einem rostigen VW – Bus quellen, Paletten und Holzkisten, eine alte Dachrinne liegen herum. Und als ich meine Autotür aufmache, stoße ich an das Gerippe eines Kinderwagens, dann stolpere ich über ausgebleichtes Plastikspielzeug, natürlich ein Traktor, eine Puppe liegt verlassen auf dem niedrigen Scheunendach, und kaum bin ich ausgestiegen, drängt sich ein riesiger schwarzer Hund an mich. Irgendwo höre ich einen anderen Hund wild bellen. Es friert mich mitten in der Sonne, ich habe aber keine Zeit, lange zu zögern, denn schon eile ich einen Abhang hinunter und stolpere hinter Martin her, der mich wieder irgendwelchen Leuten vorstellen will. Ich bin auf meinem Biohof angekommen.
Auf einer Holzveranda unübersichtlich viele Leute, es begrüßt mich freundlich ein sehr dicker Mann mit offenem, löchrigem Hemd, der freie Blick auf seinen großen Bauch und die fast leere Mundhöhle, mit der er mich anlacht, machen mich ein wenig fassungslos und verlegen. Das ist also Paul, seine Frau Agnès hab ich schon »unten« im Dorf kennengelernt, das mir jetzt unfassbar weit weg erscheint. So viele Kilometer sind wir steil bergauf gefahren, haben Serpentinen im 180°-Winkel genommen auf dem einspurigen Sträßchen, das so eng ist, dass zwei Autos nicht aneinander vorbeikommen und man bei Gegenverkehr rückwärts bis zur nächsten Ausweichstelle fährt, um auch dann das Gefühl von aneinanderschrammenden Außenspiegeln zu haben. Aber natürlich schrammen wir das andere Auto nicht, stattdessen bleiben wir mit offenem Fenster stehen, um ça va? zu fragen und ça va! zu antworten und zu sagen, dass es ganz schön heiß ist und dass es in Nizza noch viel heißer ist, und Gott sei Dank sind wir hier oben, und ob es wohl regnen wird? Ich spüre neugierige Blicke, aber es fragt dann doch niemand, wer ich denn nun bin, trotzdem ahne ich schon das »Und wer ist sie? Und was macht sie hier?«, und das frage ich mich jetzt auch schon: Was mache ich hier? Ein bisschen verloren sitze ich auf der wackeligen Außentreppe, die zu »meinem« Zimmer führt; ein mit einem Vorhang abgetrenntes Eckchen in einem Schlafsaal, oder besser: Matratzenlager unter dem Dach, zu niedrig um richtig darin zu stehen, ein Fenster mit einem wunderbaren Blick auf Berge und Himmel und einem mit Reißzwecken befestigten Küchenhandtuch als Vorhang. Eine Matratze, ein kleines Regal, eine alte Holztruhe, ein ebenso großer uralter Fernseher, und das ist es auch schon, »mein Reich« für die kommenden Wochen oder gar Monate?
Auf den Hof in den Vogesen hab ich nicht gewollt, weil er mir zu alternativ war, mit all dem Sperrmüllmobiliar und den kruschigen Ecken, den ungewohnten Holzöfen und ohne fließend warmes Wasser und mit all den Katzen und den Hunden. Und jetzt bin ich hier, tausend Kilometer weiter im Süden von Frankreich, und es ist noch viel alternativer. Wo bin ich nur gelandet und was mache ich hier?
Ein Jahr im Ausland wollte ich leben, eine Auszeit nehmen, ein Sabbatjahr, wie das jetzt gern mal heißt. Raus aus dem Job, den ich Knall auf Fall gekündigt habe, weil ich den Stress nicht mehr ertragen habe und überhaupt schon jahrelang so unzufrieden war. Und weit weg von den Erinnerungen an eine Beziehung, die es nicht mehr gibt. Bei jedem Film über glückliches Landleben in Frankreich dachte ich sehnsüchtig »Das ist es«, »Das will ich«. Und dann dachte ich »Ich mache das jetzt einfach, wann, wenn nicht jetzt?«. Durch Zufall bin ich auf diese Anzeige gestoßen, irgendwas mit Kühen und Käse, Garten, Sonne und Schatten, ein Biohof in den französischen Seealpen sucht freundliche Mithilfe. Na, DAS ist es doch! Keine Ahnung wo und was die französischen Seealpen sind, aber irgendetwas in mir ist sicher, das ist es. Eine Telefonnummer. Ein Anrufbeantworter. Mühsam stammele ich meinen kleinen Text zusammen, den ich vorher vor dem Spiegel geübt habe. Ich dachte, ich könne ein wenig Französisch, jetzt ist’s mir doch ein wenig mulmig. Aber eigentlich bin ich ganz froh, dass ich noch kein direktes Gegenüber hatte, doch jetzt bin ich zappelig, ob und wann mich jemand zurückruft?! Eine Stunde später habe ich einen französisch-schwäbisch sprechenden Mann am Telefon, wir erkennen uns als Deutsche, und schon ist alles ganz leicht. Überhaupt ist alles ganz leicht, abgesehen davon, dass er niemanden mehr braucht. Er duzt mich freundlich und gibt mir einfach mal ein paar andere Telefonnummern von anderen Höfen im gleichen Tal, da könne ich ja mal anrufen. Andere Höfe im gleichen Tal … ich sehe Heidi-Höfe vor mir und grüne Wiesen, was heißt wohl »im gleichen Tal«? Ich habe die Telefonnummer eines anderen Hofes, eine große Familie lebt dort, ein »aufgestellter Haufen«, sagt er, was soll das nun wieder heißen? Sie haben auch Kühe und machen ebenfalls Käse. Und dann habe ich noch die Nummer eines Freundes, der einen großen Obst-, Kräuter- und Gemüsegarten hat, Marmeladen und Chutneys macht und die dann auf dem Markt verkauft. Wie romantisch!
Ich rufe bei beiden an, hinterlasse bei dem Gemüsegarten-Mann eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter und erreiche bei dem lockeren Familienhaufen eine nette junge Frau, mit der ich in einem Kauderwelsch aus Französisch und Englisch eine halbe Stunde ein richtig nettes Gespräch habe. Auch hier ist alles ganz einfach, als wäre es das Normalste der Welt, dass am helllichten Tag jemand aus Deutschland anruft und sagt »Hallo, ich bin’s, und ich würde gern eine Zeit lang mit euch leben und arbeiten, und übrigens, ich bin schon 42 und hab auch gar keine Ahnung von Landwirtschaft«. Und was sagt sie, die nette junge Frau, »na klar, komm her, du bist mir sympathisch, und wenn du Lust hast, in der Landwirtschaft zu arbeiten, prima, das kann man alles lernen, pas de problem. Ich schick dir morgen eine E-Mail und ein Foto vom Hof, wann könntest du denn da sein?« Uups, wann? Na klar, wenn die jemanden brauchen, dann im Sommer und es ist schon Ende Mai. Ich bin völlig aufgedreht, so schnell kann’s gehen, wer hätte das gedacht? Ich muss meine Wohnung untervermieten und mit meinem Vermieter sprechen, ich muss den Herd reparieren lassen, meinen geklauten Führerschein nachmachen lassen, ich muss mich versichern, meine Steuererklärung machen, und wo sind die eigentlich die Seealpen?
Kaum hab ich mich abends ein wenig beruhigt, ruft auch noch der Gemüsegartenmann an und säuselt mir charmant ins Ohr, dass er es sehr nett fände, wenn ich zu ihm käme, und er bräuchte wirklich Hilfe jetzt im Sommer … Ich bin hin- und hergerissen, lediglich sein Schlusssatz gibt mir zu denken: »Es gibt hier übrigens keinen Strom und kein fließend Wasser und auch kein Badezimmer und keine Toilette, aber es gibt eine Quelle nah beim Haus.« Ach ja? Ich lache herzlich. Und bin leicht verstört. Wie soll das gehen ohne Toilette und ohne Badezimmer? Ich wasche mich wie ein Cowboy tapfer am Brunnen und immer nur unter den Achseln? Ach du liebe Güte. Und gibt es eigentlich ein Badezimmer auf dem anderen Hof? Auf die Idee, so etwas zu fragen, bin ich gar nicht gekommen.
Ich schlafe kaum vor lauter Aufregung, habe mich in der Nacht trotz der ungeklärten Badezimmerfrage und der leichten Furcht vor den Kühen vorerst für den Familienbetrieb entschieden und harre jetzt der E-Mail, die haben ja wenigstens Elektrizität und so was wie Internet!
Gleichzeitig häufen sich plötzlich die Möglichkeiten. Ich finde noch einen anderen Hof in den Vogesen, wo ich auch leben und arbeiten könnte, allerdings die meiste Zeit alleine wäre. Schreckt mich das? Will ich mir zumindest ansehen. Also fahre ich drei Tage später mit dem Zug nach Freiburg und werde dort von einer sehr alternativen, gummistiefeligen Frau mit großem Hund abgeholt. Wir zockeln mit ihrem Kleinwagen voll Erde und Stroh und Hundehaaren in die Vogesen. Der Hund hat mich schon adoptiert und liegt halb auf mir drauf. Mich juckt es, ich niese und schlucke heimlich Antihistamin und frage mich zum ersten Mal, ob ich eigentlich verrückt geworden bin, als Allergikerin auf einen Bauernhof zu gehen.
Wir verstehen uns eigentlich gut, die alternative Frau und ich, aber irgendwie fühl ich mich überfordert von der Idee allein hierzubleiben, auf dem riesigen Anwesen, weit weg von allem und allen, ohne Auto. So viel Einsamkeit. Überfordert auch von dem Leben, von den Hühnern, auf die man aufpassen muss, dass weder Fuchs noch Greifvögel sie töten, und von den Ratten in den Lebendfallen, die hingegen ertränkt werden müssen. Von den zu mähenden Wiesen und den beiden großen Gärten, von den alten Holzöfen, die ihre Tücken haben, und es ist ganz schön kühl Anfang Juni in den Vogesen und ich friere. Es gibt zwar fließendes Wasser, aber kein warmes, und am nächsten Morgen gibt’s gleich mal ein Problem mit dem Wasserdruck, also laufen wir über die taunasse Wiese zur Quelle, werfen uns auf den Bauch, kriechen in ein Loch, und die Gummistiefelfrau erklärt mir, was ich tun muss, wenn das noch mal vorkommt … Du liebe Güte, und ich dachte, ich müsse vielleicht nur ein paar Bohnen anbinden und Erdbeerpflanzen von Unkraut befreien.
So. Und das war mir alles zu alternativ und deswegen bin ich heute hier gelandet. Ich bin ein bisschen aus der Fassung und unglücklich, denke mir aber, tapfer ein paar Tage zu bleiben, wo soll ich denn auch sonst hin? Meine Wohnung habe ich für ein Jahr untervermietet, ich habe kein Zuhause im Moment. Also packe ich meinen Rucksack aus und versuche mein Eckchen wohnlich zu gestalten. Es ist die heure de la sieste, wie man mir erklärt hat, aber ich bin viel zu unruhig für ein Mittagsschläfchen. Draußen ist es völlig ruhig, die Sonne scheint, ein leichter Wind weht, Vögel zwitschern, Grillen zirpen, ich kucke auf die Berge und versuche anzukommen. So vielen Leuten hab ich die Hand geschüttelt ohne zu verstehen, ob das Freunde, Familie oder Nachbarn sind. Und wer ist jetzt der Mann von Fleur? Oder lebt sie allein mit ihrer Tochter in diesem winzigen Häuschen mit der schiefen Tür, bei der man sich bücken muss, um nicht an den Türrahmen zu stoßen? Und was ist das überhaupt für ein Name, Fleur? Das Haus von Paul und Agnès besteht im Prinzip auch nur aus einer Küche und dem darüberliegenden Schlafraum. Die Küche. So etwas kenne ich bislang nur aus dem Freilichtmuseum. Ein kleiner, niedriger Raum, schwarz vom Ruß, eine offene Feuerstelle in der einen, ein gusseiserner Holzofen in der anderen Ecke, riesige Steinplatten bilden den Fußboden, ein schwerer alter Holztisch und zwei einfache Bänke stehen in der Mitte, an den Deckenbalken hängen an Zimmermannsnägeln riesige Körbe, und weiter hinten sehe ich wirklich Schinken und Würste hängen. Eine ausgetretene Steintreppe führt nach oben in das kleine schiefe Zimmer von Paul und Agnès. Ein Bett, ein Schreibtisch, ein Schrank, ein Regal voller Bücher, ein winziger Fernseher. Das ist alles? Mehr privaten Raum gibt es anscheinend nicht für die beiden.
Zu meiner grenzenlosen Erleichterung gibt es aber eine Toilette und auch ein Badezimmer, untergebracht in einem winzigen Anbau an das alte Haus, aber ich weiß nicht, wie viele Menschen es sich teilen. Ich sehe diverse Zahnbürsten und Waschlappen herumliegen, viel Platz ist hier eigentlich nicht, und ich komme mir komisch vor mit all meinen Cremes und Döschen, und mit all den Dingen, die ich eigentlich so brauche, und wage schon mal nicht, mich damit auszubreiten. Wo auch? Aber immerhin ein Bad! Und eine Waschmaschine gibt es auch!
Vom Hof hab ich noch nicht allzu viel gesehen. Drei Kälbchen in einem dunklen und niedrigen Stall unter dem Haus, die mir Fiona, eines der kleinen Mädchen des Hofes, stolz gezeigt hat. Aber es sind schon Leute da gewesen, die Käse kaufen wollten, also muss es irgendwo noch die Käserei, die fromagerie, geben und natürlich auch Kühe. Und Schweine. Kaninchen hab ich in einem wackeligen Stall gesehen, Enten und Hühner laufen gackernd spazieren, ein Hahn kräht hin und wieder. Zwei große schwarze Hunde beherrschen den Hof, und viele Katzen huschen über die Terrasse.
Fleur sucht mich, sie hat ihre kleine Tochter Mel an der einen und einen der riesigen Körbe in der anderen Hand. Ob ich wohl Lust hätte, mit ihnen Kirschen zu pflücken? Na, was für eine Frage. Gemütlich spazieren wir zu einem knorrigen Kirschbaum, der vollhängt mit dicken schwarzen Kirschen. Und ich esse – seit wie vielen Jahren wieder? – süße Kirschen direkt vom Baum in den Mund. Fleur klettert wie ein Eichhörnchen im Baum herum und mir kommt das alles so unwirklich vor. Ganz sachte tauchen Erinnerungen aus meiner Kindheit auf. Irgendwann traue ich mich auch auf den Baum zu klettern und sitze noch ein bisschen unsicher, aber stolz auf einem Ast, pflücke Kirschen und versuche sie in den angebundenen Korb zu werfen, stopfe mir dabei immer auch Kirschen in den Mund und spucke die Kerne auf die Wiese. Der Himmel ist blau, Mels Mündchen ist kirschrot verschmiert, und ich bin hier. So schlecht ist es vielleicht doch nicht.
Ich glaube, das tut mir gut hier. Gerade habe ich mit Fleur und Camille über das Leben hier gesprochen. »Sei einfach du selbst«, sagte mir Camille. Hier ist nichts fest vorgegeben, jeder hat seinen eigenen Rhythmus und alles ist o.k. Wir saßen alle zusammengedrängt in der kleinen Küche des dritten Häuschens, tranken belgisches Bier aus kleinen Flaschen und redeten, wobei ich überwiegend stammelte und nach Worten suchte. Dennoch verstand ich, was sie mir sagten, »sei locker, entspann dich, alles ist gut wie es ist«. Auch hier sehe ich nur eine Küche und einen kleinen Wohnraum mit einem Alkoven, eine kleine Kammer als Kinderzimmerchen gibt es noch. Alles ist so beengt, improvisiert, fast primitiv. Aber sie Stimmung ist heiter. Alle sind unkompliziert, reden, lachen, »noch ein Bier, Christjann?«. Und niemand schämt sich für die Enge, die unbequeme, wackelige Bank und den dreibeinigen Sessel mit dem aufgeplatzten grünen Futter, und dass die kleine Tochter quietschvergnügt ein Bad in einem Waschzuber mitten in der Küche nimmt, wie auf den vergilbten Fotos im Fotoalbum meiner Großeltern … Ich denke an meine Altbauwohnung in Köln, die ich ganz alleine bewohne und die mir eigentlich nicht groß genug ist, ich denke an mein schickes weißes Bad und an all meine sorgfältig ausgesuchten Einrichtungsgegenstände.
Später sitze ich wieder auf der Treppe zu meinem Dachzimmerchen und versuche all meine Eindrücke zu verdauen. Es ist so ruhig. Grillen zirpen, sonst höre ich nichts. Ruhe. Schwarze Nacht und Sterne. Ich bin überwältigt von diesem Sternenhimmel. Ich sitze und schaue. Ich bin noch nicht wirklich angekommen und doch schon so weit weg von allem, was mich noch vor Kurzem so geplagt hat. Hier ist so eine andere Welt.
Irgendwann wird es doch empfindlich kühl, wir sind immerhin auf einer Höhe von 1300m, ich bin froh um meinen Fleecepulli und um meine Taschenlampe, die ich einer Eingebung folgend noch eingepackt habe. Denn abgesehen von den Sternen ist es um mich herum stockfinster, und ich muss ja nachts mindestens einmal raus. Es ist ein bisschen wie zelten, finde ich …
[Menü]
Kräht der Hahn auf dem Mist …
»Komm doch erst mal an«, sagt mir Fleur, weil ich trotz der gestrigen Botschaft »mich zu entspannen« unruhig nach Arbeit frage. »Wenn du Lust hast, kannst du ja noch mal Kirschen ernten, vielleicht machen wir dann einen Clafoutis, und später zeig ich dir den Garten. Hast du denn schon gefrühstückt?« Ja, habe ich. Ich bin schon ganz lange wach, auch ohne Wecker. Ich habe erstaunlich gut geschlafen und dachte, alle seien schon seit fünf Uhr früh am Arbeiten. Und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen, weil ich erst jetzt auftauche, aber niemand hat mich bislang gesucht. Also ziehe ich mit meinem Korb und einer alten Holzleiter los zum Kirschbaum. Die Sonne scheint. Um mich herum nur Himmel und Berge. Ich sehe Schmetterlinge, die ich nur vom Memory-Spiel kenne, Bienen summen, Grillen zirpen. Ich klettere auf den Kirschbaum, atme tief ein und aus und bin merkwürdig berührt. Ich habe einen Kloß im Hals. Ich werd’ doch hier nicht auf einem Kirschbaum sitzen und heulen?!
Zum Mittagessen finden sich zwölf Personen an dem großen Holztisch auf der Veranda ein. Es dauert einen Moment, bis alle da sind und bis wir anfangen können, denn wir essen alle zusammen, und keinesfalls essen wir ohne die Männer, die noch auf dem Feld sind oder im Stall oder was weiß ich wo. Also warten wir. Ich sitze auf dem Verandageländer, lasse die Beine baumeln und streichele Bijou, einen der großen schwarzen Hunde, der so unglaublich schmusig ist, dass ich meine Angst vor ihm schon nach Stunden verlor. Und dann essen wir. Und ich komme mir vor wie in einem der französischen Filme, die ich so gerne sehe. Es ist laut, und alle reden gleichzeitig, riesige Teller und Schüsseln werden weitergereicht. Es gibt Salat und dicke Scheiben rohen Schinken und selbst gemachte Paté, und ich bin jetzt schon satt, aber das war nur der Anfang. Dann wird eine riesige dampfende Tonschüssel auf den Tisch gestellt: pieds paquets. Ich habe keine Ahnung, was ich esse, »ça vaChristjann, schmeckt es dir?«. Oh ja, es schmeckt mir gut, ein bisschen fremd, aber gut, alle lachen und freuen sich. Ich freue mich auch, verstehe nicht, was sie mir erzählen, und plötzlich sehe ich befremdet, ja was sehe ich? Zähne? Fußknochen? auf dem Teller meines Tischnachbarn. Was habe ich da gerade voll Genuss gegessen? Später verstehe ich was pieds paquets meint: Die paquets, kleine »Pakete«, sind les tripes, gefüllter Schafsmagen, Kutteln auf Deutsch, und die pieds, na, das sind eben Schafsfüße. Beides wird zusammen in einer Art Tomatensauce gekocht und gegessen und ist im Übrigen eine Spezialität aus Marseille. Ich bin dann doch ganz froh, dass es noch Käse und den Clafoutis gibt, den ich mit Fleur gebacken habe. Die dreifache Rezeptmenge mit zwölf Eiern füllte eine gigantische Auflaufform, aber bei zwölf Personen bleibt kein Krümelchen davon übrig. Und dann ist es l’heure de la sieste, und heute bin ich auch tatsächlich müde und schwer in Kopf und Bauch. Ich lege mich dankbar in mein Bett und sinke in einen kleinen Mittagsschlaf.
Nachmittags gehen wir in den Garten, zwei kleine Mädchen an den Händen hopsen wir und rennen und machen abwechselnd mit ihnen »Engelchen flieg«, was hier schlicht un, deux, trois, uiii heißt, aber genauso funktioniert, und dann liegt er vor mir, der Garten. Vom Hang blicke ich hinunter auf eine Oase.
Grün, blumenbunt und riesig liegt ein richtiger Bauerngarten vor mir, ohne Zaun, einfach so auf dem Acker, umgeben von brachliegendem Land, Wiesen und Obstbäumen. Ich sehe Sonnenblumen, und zartes Rosa-, Weiß-, Pink- und Lilafarbiges und überall Flecken von kräftigem Orange. Cosmos und Arnika lerne ich, dann Kohl, Karotten, Salat, Bohnen, Tomaten, Zwiebeln, Lauch, Kräuter … alles, was man sich in einem Gemüsegarten vorstellen kann, ist da. Und auch Pflanzen, die ich nicht kenne, wie etwa les fèves, Saubohnen steht in meinem Wörterbuch, also Schweinefutter? »Neinnein, Christjann, kuck, das kann man essen …« Ich bin nicht ganz überzeugt und halte mich lieber an eine Karotte, die ich aus der Erde ziehe, mit den Händen säubere und schließlich doch an meiner Hose abreibe – ist doch nur Erde, Christjann, sag ich mir selbst – und knackend und krachend kaue. Schmeckt, wie Karotten früher mal geschmeckt haben, finde ich. Und mir fällt ein, dass meine Eltern, als ich klein war, bei einer alten Dame den Garten bestellt haben. Ich sehe das alles plötzlich ganz deutlich vor mir. Das kleine Siedlungshäuschen mit dem großen Garten, und da gab es auch den Kirschbaum, der gestern schon in meinem Kopf herumschwirrte, und ich hatte ein eigenes kleines Beet mit Karotten und Radieschen. Ich bin erstaunt, an was ich mich so alles erinnere.
Wir jäten Unkraut, und Agnès zeigt mir, wie ich die überflüssigen Triebe der Kürbispflanzen abzwicke, sodass an jeder »Abzweigung« nur eine Blüte und ein Blatt wachsen. Ich bin ganz vertieft und in Gedanken anderswo, als ich Ninon und Agnès rufen höre: »Christjann,viens, vite ...«Plötzlich sind die Wolken gar nicht mehr watteweiß, und der Himmel ist auch nicht mehr blau. Es ist grau, dunkel, die Wolken hängen tief, Wind kommt auf, und dann ist es ganz schnell da, das Gewitter, und wir rennen nach Hause. Das Gewitter ist heftig, es kracht und blitzt, unglaubliche Wassermassen stürzen vom Himmel, ein paar Minuten lang hagelt es auch, haselnussgroße Körner knallen auf das Blechdach, ein unglaublicher Lärm, das Licht flackert, und dann wird es plötzlich ganz dunkel, denn der Strom ist ausgefallen. Das ist hier bei jedem Gewitter so, erfahre ich. Beeindruckt ob dieser Gewalt trinke ich schweigend meinen Tee, und wir zählen die Sekunden zwischen Donner und Blitzen und kucken ehrfürchtig zu, wie die Blitze am helllichten Tag den schwarzen Himmel erleuchten.
Später sehe ich, was das Gewitter hinterlassen hat. Überall auf dem Hof steht das Wasser, Rinnsale, Bäche, Pfützen, weggeschwemmte Steine, der Weg am Hang ist eine einzige schlammige Rutschbahn, alles ist matschig und braun, und die nasse Erde quietscht und quatscht und bleibt satt und schwer an meinen Schuhen hängen, während ich zurück zu meinem Dachkämmerchen stapfe.
In den Garten gehen wir heute nicht mehr, aber es wird schon wieder Essen zubereitet. Dass man ganz selbstverständlich zweimal am Tag kocht, ist mir fremd, und dass man zweimal am Tag so viel essen kann, auch. Es gibt Melone und Salat und eine Art Fischsuppe mit Crevetten und Muscheln und dazu Brot, Käse und Wein, schon wieder für mehr als zehn Personen, denn auch wenn Fleur und Camille mit ihren kleinen Familien abends bei sich essen, heute Abend kommen noch ein paar Freunde von Paul und Agnès. Und der Nachbar, der heute Nachmittag vorbeikam, um ein Glas zu trinken, und vom Gewitter überrascht wurde, bleibt natürlich auch zum Essen. Aber vorher gibt es noch den Apéro. »Was willst du trinken, Christjann?« Keine Ahnung, ich bin überfordert von der Auswahl an Flaschen und schon hat Agnès riesige Platten mit Häppchen auf den Tisch gestellt. Und Oliven und Schinkenscheiben. Also Christjann, Whisky? Pastis? Rosé? Die Männer trinken alle Pastis, also probiere ich das. Es hat mir in Deutschland nie geschmeckt, wenn irgendwer eine Flasche Ricard oder 51 aus einem Frankreichurlaub mitbrachte und ganz schick und ganz frankophil in Originalgläsern servierte, aber jetzt bin ich ja hier, im Süden Frankreichs, im Midi, und ich erwarte ein erhellendes Geschmackserlebnis. Aber nein, ich finde das gelblich-milchige Anisgebräu auch hier nicht lecker, aber es ist gar nicht schlimm, denn ich lerne, dass Pastis eher ein Männergetränk ist. Frauen trinken eisgekühlten Rosé oder süßen Orangenwein oder Martini oder manchmal auch einen Weißwein. Aber irgendetwas wird auf jeden Fall genippt, während man schwarze Oliven oder kleine Häppchen mit Oliven- oder Sardellenpaste knabbert: Tapenade und Anchoiade. Der Apéro ist also weniger ein Aperitif als vielmehr eine Art ungezwungenes Essen vor dem Essen, und eigentlich bin ich schon jetzt satt.
Und alle reden. Vor allem über das Wetter: Junge, war das ein Gewitter heute Mittag. Auf der Straße zum Dorf ist ein Stück Hang weggebrochen und auf die Straße gerutscht, man kann kaum vorbeifahren und muss den Straßendienst anrufen. Und irgendwo hat der Blitz eingeschlagen. Und dann erzählt jemand die Geschichte von dem Unwetter vor zwei Jahren, wo der Blitz eine Kuh erschlagen hat. Und vor fünf Jahren, wo es tagelang regnete, sodass das ganze Flusstal einer reißenden dunkelgrauen Schlammlawine glich und alles mit sich riss, unter anderem eine Brücke weiter unten im Tal.
Das Wetter bleibt beherrschendes Thema heute Abend, wir haben schon den Wetterdienst auf zwei verschiedenen Fernsehkanälen gekuckt, fehlt noch der Regionalsender, aber klar ist schon, dass für die nächsten Tage hier weitere Gewitter angesagt sind. Ich versuche dem Gespräch zu folgen, ganz Frankreich leidet unter Trockenheit, es gibt Bauern, die mit Waffengewalt gezwungen werden, die Bewässerung ihrer Felder einzustellen, und hier zerstören Hagel und sintflutartige Wassermassen die Ernte. Ich höre das alles, und doch bleibt es für mich weit weg, denn es ist schon wieder hell und freundlich, und es ist immerhin so warm, dass wir auf der Veranda essen können. Bei einbrechender Dunkelheit sind wir plötzlich von Myriaden von Nachtfaltern umschwärmt, die wie betrunken um das Licht torkeln und halb verbrannt auf den Tisch und in die Suppe fallen. Ohne mit der Wimper zu zucken ziehe ich die unglücklichen Geschöpfe aus meinem Teller, werfe sie hinter mich in die Nacht und esse weiter. Bin ich das? Ich staune über mich selbst.
[Menü]
Libérez les betteraves!Rüben und kein Ende
Der Hagel hat die schönen Blätter der Kürbisse zerschlagen, gleichzeitig will es mir scheinen, als seien die Triebe gewachsen. »Ja«, sagt Agnès, »genauso ist es, die Pflanzen haben einen Instinkt, und bei Gewitter wachsen sie schubartig, als wollten sie der Zerstörung durch Hagel etwas entgegensetzen.« Ob ich eigentlich schon etwas von Rudolf Steiner zur biodynamischen Landwirtschaft gelesen hätte? Ich verneine verschämt. Rudolf Steiner? Hier? Ich bin platt.
Wir bleiben nicht im Garten, wir gehen weiter aufs Feld, das heißt, wir fahren. Mit einem der alten Autos, dem ich nicht mehr viel zugetraut habe, und tatsächlich ist es etwas gewöhnungsbedürftig: die Tür klemmt derartig, dass ich, als ich mit aller Kraft dran reiße und sie endlich aufgeht, vor Schreck hinfalle. Innen riecht es nach allem Möglichen, Kuhstall, Heu, Erde, Feuchtigkeit, und es sieht auch so aus. Ich wische den mit Heu und Erde verschmutzten Beifahrersitz halbwegs sauber und setze mich vorsichtig hin. Agnès rührt ein wenig in den Gängen, eigentlich geht nur noch der erste, aber den muss man auch erst mal finden. Dann röhren wir im ersten Gang und offenbar mit einem defekten Auspuff durch die stille Landschaft, rumpeln über matschige Feldwege, durchschlittern gigantische Pfützen, dass es meterhoch spritzt, und sind da. Wie zwei lange Bänder ober- und unterhalb einer Wiese liegen die Äcker leicht gewellt vor uns. Mais, Kartoffeln, Kohl, Rüben. Beim Aussteigen ziehe ich an der Verriegelung und werfe ich mich gleichzeitig mit aller Gewalt von innen gegen die Tür. Klappt.
Wir schalten den Strom vom Elektrozaun aus und klettern drüber. Agnès zeigt mit ausgestrecktem Arm auf das endlos wuchernde Grün vor uns und sagt mir: »Wie du siehst, ist es höchste Eisenbahn.« Ich sehe eigentlich gar nichts außer unendlichen Reihen unregelmäßig wachsender Pflanzen und verstehe nichts. Agnès sieht meinen verständnislosen Blick und wir gehen auf eine der wild wuchernden Pflanzenreihen zu: »Schau, Christjann, hier haben wir Rüben gesät, aber das Unkraut wächst viel schneller als die Rübenpflanzen und nimmt ihnen alles weg: Licht, Luft, Wasser.« Agnès hackt ein bisschen die Erde auf und reißt ruckzuck jede Menge Grünzeug raus. Zum Vorschein kommt ein kleines, vielleicht fünf Zentimeter großes Rübenpflänzchen. Ich fange an zu verstehen. Und sehe das Grün vor mir mit anderen Augen: Wir werden die nächste Zeit die kleinen Rübenpflänzchen von Unkraut befreien. Gleichzeitig lockern wir dabei die knochenharte Erde auf. Ich bekomme eine Hacke und Handschuhe und versuche mir abzuschauen, wie Agnès arbeitet. Die Schwierigkeit besteht darin, das Unkraut komplett mit der Wurzel rauszureißen und beim Aufhacken der Erde nicht das Rübenpflänzchen zu massakrieren. Es ist mühsam, aber es tut mir auch gut, mich körperlich anzustrengen. Aber wie langsam komme ich voran, Agnès hat mich schon um Längen überholt und arbeitet viel gleichmäßiger. Na ja, sage ich mir, sie macht das auch schon seit dreißig Jahren. Ich hacke und reiße, und ab und zu pflanze ich ein aus Versehen rausgerissenes Rübchen wieder ein. Es wird heiß, ich ziehe mein Hemd an und setze meinen Hut auf, denn die Sonne knallt unbarmherzig auf den schattenlosen Acker und auf meine blasse Haut. Gegen elf verlässt mich Agnès, weil sie das Mittagessen vorbereiten muss, sie lässt mir Wasser da und ermahnt mich viel zu trinken und sagt: »Wir rufen dich dann zum Essen.« Ich kann mir nicht recht vorstellen, wie man mich auf die Entfernung rufen will, sage aber nichts. Allein auf dem Acker ist es plötzlich ziemlich einsam. Ein paar Schmetterlinge gaukeln vorbei. Eine fette Hornisse röhrt wie ein kleiner Hubschrauber, als sie in schnurgerader Linie knapp an meinem Ohr vorbeifliegt. Sonst kein Geräusch. Weit und breit kein Mensch. Ich setze mich zwischen die Rüben und schaue in den Himmel und auf die Berge ringsum. Was für eine grandiose Landschaft. Und diese Stille. Ich schlucke. Warum bin ich hier nur so schnell so gerührt?
Dann höre ich ein Tröten von Ferne, der Wind weht leicht und ich weiß nicht, ob ich mich getäuscht habe. Dann noch ein Tröten, und leise aber deutlich höre ich ein lang gezogenes tiefes Chriiiiii-stjannnnnn, à taaaable … Sie haben mich tatsächlich gerufen! Ich schultere meine Hacke und komme mir vor wie ein Landarbeiter Anfang des letzten Jahrhunderts, während ich zum Essen stiefele.
Nach der sieste nehme ich meine Hacke und laufe zurück aufs Feld. Und alle sind schon da. Agnès und Fleur und Camille, die beiden kleinen Mädchen und die zwei Nachbarsjungen, die anscheinend sowieso viel mehr bei uns sind als bei sich. Zu viert geht das Hacken und Reißen schneller, wobei ich mit meiner Reihe nicht richtig vorankomme, weil mich die Frauen nach meinem Leben ausfragen und ich, während ich hoch konzentriert nach Worten suche und gestenreich erzähle, aufhöre zu hacken. Aber auch wenn sie mir etwas erzählen, höre ich unwillkürlich auf zu hacken und zu reißen, weil die Hälfte der Worte unverstanden an mir vorbeigleitet, wenn ich nicht durch Hinkucken und Aufnehmen von Gestik und Mimik versuche, das Erzählte zu verstehen. Es ist anstrengend. Ich dachte, ich könnte etwas Französisch. Und ich dachte auch, meine verschütteten Schulkenntnisse würden sich spielerisch zurückmelden. Irgendwie ist das nicht so. Schon beim Essen, wenn alle gleichzeitig sprechen, habe ich Probleme, dem Erzählten zu folgen. Ich verstehe, ob es ums Wetter, um Politik oder ums Essen geht, aber für die Details brauche ich immer jemanden, der es mir noch mal langsam in einfachen Worten sagt. Und so schalte ich oft einfach ab. Ich bin schon genug mit der anderen Art zu essen gefordert. Alle essen so langsam, es gibt so viele Gänge, fremde Gerüche und fremden Geschmack und immer so viel Fleisch. Mittags hatte ich verzweifelt an meinem Stück sehnigen und halb rohen Rindfleisch herumgekaut. Ich wusste nicht, wie ich das essen sollte, und suchte mit Blicken den Hund, dem ich das heimlich zustecken könnte, um dann plötzlich meinen Namen zu hören. Pardon? »Was hältst du von Europa, Christjann?« Ach du liebe Güte. Frankreich hat gerade in der Europafrage abgestimmt. Überall hängen noch kämpferische Plakate »Nein zu Maastricht«. Habe ich eine Meinung dazu? Ich stottere. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, wofür oder wogegen dieses Referendum war. Dann erläutern sie mir ihre Ansicht, es geht um Normen und Gentechnik und irgendwie fällt der Name José Bové. Kenne ich nicht. Wer ist das? Sie schauen mich fassungslos an. »Christjann, wo lebst du? JOSÉBOVÉ!« Ich komme mir unpolitisch und unwissend vor.
Am Abend haben wir siebeneinhalb Reihen geschafft. Sauber liegen die Reihen mit den kleinen, befreiten Rübenpflänzchen neben dem vom Unkraut überwucherten Rest. Leider ist der Rest zum Verzweifeln viel. Ich fange an zu zählen. Fünfzig Reihen Rüben. Wenn wir jeden Tag zu viert arbeiten und etwa fünf Reihen schaffen, dann sind wir in zehn Tagen fertig. Und wenn wir jeden Tag sieben Reihen schaffen, dann sind wir in etwa sieben Tagen fertig. Mir tut der Rücken weh und die Beine vom Bücken, und trotz Handschuhen habe ich raue Hände und Druckstellen von der ungewohnten Arbeit mit der Hacke. Aber ich bin auch unglaublich stolz und genieße meinen Muskelkater: Ich habe richtig gearbeitet.
Am nächsten Morgen ziehe ich wieder aufs Feld, aber heute bleibe ich allein. Agnès arbeitet im Garten. Fleur ist in der fromagerie und macht Käse, Camille hütet die Kinder und erwartet im Übrigen noch ihre Nichten und Neffen, die ein paar Tage Ferien auf dem Land machen. Mein Rechenexempel bezüglich der Rüben ist demnach hinfällig. Ich hacke und reiße also in aller Stille und hänge dabei meinen Gedanken nach.
»Bonjour Christjann, ça va?!« Ich hebe den Kopf, am Feldrand steht Roland, ein Nachbar, und strahlt mich an. »Ça va, ça va! Et toi?«