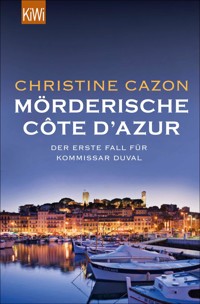9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar Duval ermittelt
- Sprache: Deutsch
Der Abschluss der Krimi-Reihe von Christine Cazon: Vertuschung, Intrigen, Korruption – Duvals letzter Fall führt in die Abgründe einer Staatsaffäre. Sein neunter Fall führt Kommissar Léon Duval noch einmal in die Vergangenheit, diesmal im Hinterland der Côte d'Azur. Das Staudamm-Unglück von Malpasset Ende der 1950er-Jahre wirkt bis heute nach. Der von Léon Duval sehr geschätzte Richter Dussolier wird auf den Stufen des Landgerichts in Grasse erschossen. Duval kannte den Richter gut, schließlich haben sie seinerzeit gemeinsam den Gangsterboss Cosenza dingfest gemacht. Alle Zeichen deuten auf einen Racheakt desselbigen, doch Cosenza streitet alles ab. Duval glaubt ihm, denn er erfährt, dass der Richter sich die Akte »Malpasset« hatte kommen lassen, in der es um die Staudammkatastrophe von 1959 im Hinterland von Cannes geht, bei der 423 Menschen ihr Leben verloren. Offenbar wollte der Richter diesen Fall wieder aufrollen. Musste er deshalb sterben? Duval arbeitet sich in den Fall ein, der schnell sehr kompliziert wird. Und sehr gefährlich. Duval sieht sich mit unguten Verstrickungen von Staat und Justiz konfrontiert – und mit realen Bedrohungen gegen sich und seine Familie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 297
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Christine Cazon
Verhängnisvolle Lügen an der Côte d’Azur
Der neunte Fall für Kommissar Duval
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christine Cazon
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christine Cazon
Christine Cazon, Jahrgang 1962, hat ihr altes Leben in Deutschland gegen ein neues in Südfrankreich getauscht. Sie lebt mit ihrem Mann und Katze Pepita in Cannes, dem Schauplatz ihrer Krimis mit Kommissar Duval. »Verhängnisvolle Lügen an der Côte d’Azur« ist ihr neunter Roman in dieser Reihe.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Der von Léon Duval sehr geschätzte Richter Dussolier wird auf den Stufen des Landgerichts in Grasse erschossen. Duval kannte den Richter gut, schließlich haben sie seinerzeit gemeinsam den Gangsterboss Cosenza dingfest gemacht. Alle Zeichen deuten auf einen Racheakt desselben, doch Cosenza streitet alles ab. Duval glaubt ihm, denn er erfährt, dass der Richter sich die Akte »Malpasset« hatte kommen lassen, in der es um die Staudammkatastrophe von 1959 bei Fréjus, nicht weit von Cannes, geht, bei der 423 Menschen ihr Leben verloren. Offenbar wollte der Richter diesen Fall wieder aufrollen. Musste er deshalb sterben? Duval arbeitet sich in den Fall ein, der schnell sehr kompliziert wird. Bald weiß auch der erfahrene Kommissar nicht mehr, was oder wem er glauben soll, sieht sich mit unguten Verstrickungen von Staat und Justiz konfrontiert – und mit realen Bedrohungen gegen sich und seine Familie.
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2022, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Alle Rechte vorbehalten
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © veesaw / Shutterstock
ISBN978-3-462-30422-0
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses Zusatzmaterial ist auch auf unserer Homepage zu finden:
www.kiwi-verlag.de/magazin/extras/die-karte-zu-verhaengnisvolle-luegen-an-der-cote-d-azur
Inhaltsverzeichnis
Hinweis zum Buch
Widmung
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Nachwort und Dank
Die Handlung des vorliegenden Romans spielt in Cannes und an anderen Orten in Südfrankreich.
Die Stadt und manche der erwähnten Örtlichkeiten sind real, die Geschichte hingegen ist fiktiv. Sie ist jedoch inspiriert von einem Ereignis, das noch immer Rätsel aufgibt.
Die in der Geschichte vorkommenden Personen, ihre beruflichen und privaten Handlungen und Konflikte sind frei erfunden. Jede Ähnlichkeit mit lebenden oder verstorbenen Personen wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
à Thierry
1
Richter Dussolier erhob sich mühsam. Das lange Sitzen hatte seinen Körper steif werden lassen. Er warf einen Blick auf das Smartphone. Kurz vor achtzehn Uhr. Er war noch nicht zu spät dran. Noch könnte er einen Strauß Blumen besorgen und wäre rechtzeitig zu Hause. Anne-Laure hatte ein Diner im Garten vorbereitet. Seit Monaten plante sie es. Es war ihr 60. Geburtstag und gleichzeitig ihr 40. Hochzeitstag. Seit Wochen bestürmte sie ihn immer wieder: »Sei bitte einmal da!« Nachdem er ihr den Ring, einen Rubin-Solitär umrahmt von Diamanten, in einem kleinen edlen Kästchen heute früh bereits neben ihre Tasse gelegt hatte, schien sie aufzuatmen. »Du hast daran gedacht«, lächelte sie ihn erfreut an. Wie sollte er nicht daran gedacht haben, fragte er sich, bei all den Planungen, die seit Wochen im Gang waren. Auch die Kinder sandten ihm beinahe täglich Vorschläge, was er Anne-Laure ihrer Ansicht nach schenken könnte. Die Kinder wollten ihnen beiden gerne eine gemeinsame Reise schenken. Eine Art zweite Hochzeitsreise auf den Spuren ihrer Jugend. Alles, nur das nicht, dachte er, aber er drückte sich etwas diplomatischer aus.
»Ist das wirklich eine gute Idee«, zweifelte er, »Stätten aufzusuchen, an denen man vor vierzig Jahren glücklich gewesen war und die Hotels von damals in einem desolaten Zustand und die seinerzeit leeren und unentdeckten Strände voller Touristen vorzufinden?«
»Du bist immer so negativ, Papa«, ärgerte sich seine Tochter. »Maman würde wirklich gerne eine schöne Reise unternehmen.«
»Ja, ja«, hatte er abgewinkt. Als hätten sie in all den Jahren immer noch nicht verstanden, dass er sich unwohl fühlte auf Reisen. Weder mochte er organisierte Gruppenreisen noch Reisen zu zweit, bei denen erwartet wurde, dass man wie ein frisch verliebtes Paar durch unbekannte Straßen unbekannter Städte lief und etwas »entdeckte«. Er hasste das alles. Das Einzige, was er in seiner Freizeit wollte, war ruhig im Garten sitzen und lesen. Und dann vielleicht in einem guten Restaurant etwas essen. Er aß gerne im Restaurant l’Amandier. Die Karte bot Bewährtes, aber auch immer wieder Überraschungen für Anne-Laure, alles in gewohnter erstklassiger Qualität.
»Wir dachten an einen Segeltörn. Es wäre eine Reise mit nur sechzehn Personen, und ihr bliebt hier im Mittelmeerraum. Entweder Sizilien und die Liparischen Inseln oder die Kykladen. Es gibt viel zu besichtigen, ihr hättet keine klimatischen Umstellungen, das Essen bleibt auch mediterran. Das wird bestimmt nett, und es würde dir guttun, Papa, tritt mal ein bisschen kürzer«, redete auch sein Sohn auf ihn ein und ließ absichtsvoll einen Prospekt mit dem verheißungsvollen Titel »Segeltörn zu den Inseln des Lichts« herumliegen.
Dussolier stopfte einen Teil der umfangreichen Akte in seine Tasche und packte den Rest, einen hohen Stapel an Aktenordnern und Dokumenten auf den Tisch seines Greffier, des Gerichtsassistenten. Er wusste, was damit zu tun war.
Anne-Laure hatte ihre deutsche Freundin Gisèle mit ihrer Familie eingeladen. Gisela hieß sie eigentlich, aber sie ließ sich gerne Gisèle nennen. Mitte der Siebzigerjahre hatten beide Frauen, damals noch verlegen kichernde Mädchen, an einem deutsch-französischen Schüleraustausch im Rahmen der seinerzeit noch recht neuen deutsch-französischen Freundschaftsbewegung teilgenommen, und aus der ersten unsicheren Begegnung der vierzehnjährigen Mädchen hatte sich im Laufe der Jahre eine tiefe Freundschaft entwickelt. Mit größeren Lücken hier und da, aber sie hatten sich nie wirklich aus den Augen verloren. Er hatte in seiner Rede, die er selbstverständlich vorbereitet hatte, auch auf diesen Aspekt im Leben von Anne-Laure eingehen wollen und hatte die eine oder andere Dokumentation über die deutsch-französische Annäherung angesehen.
Das Smartphone vibrierte. Es war Cécile, seine Tochter. »Du hast es nicht vergessen, Papa? Du wirst pünktlich da sein?«
»Ich bin schon unterwegs«, antwortete er knapp.
»Du weißt, wir haben eine Überraschung vorbereitet!«
»Ich weiß, ich weiß. Ich komme, ich gehe jetzt los«, versicherte er ihr.
»Super. Dann bis gleich, Papa!«
»Bis gleich.«
Was für eine Überraschung hatten sie sich jetzt ausgedacht? Er mochte keine Überraschungen. Er konnte sich nicht spontan freuen, vor allem nicht über Dinge, die er im Grunde hasste.
Er warf sich das Sakko über, griff nach seiner Tasche, steckte das Telefon ein und verließ sein Büro. Er verschloss die Tür sorgfältig zweimal und eilte durch den langen leeren Flur.
»Au revoir, Madame Poirier«, grüßte er die Empfangssekretärin in ihrem gläsernen Pavillon.
»Au revoir, Monsieur le Juge«, rief sie ihm hinterher. »Schönen Abend! Schönes Fest und grüßen Sie Ihre Frau ganz herzlich!«
»Wird gemacht«, nickte er. Woher wusste sie es? Er konnte sich nicht erinnern, die Sache mit ihr erörtert zu haben.
»Au revoir«, nickte er ebenso dem Sicherheitsbeamten an der Eingangspforte zu, der mit dem klirrenden Schlüsselbund herumwedelte.
»Au revoir, Monsieur le Juge.«
Richter Dussolier eilte die lang gezogenen Stufen hinab. Er hatte seinen Wagen auf dem Parkplatz gegenüber geparkt und suchte den Schlüssel in seiner Jackentasche. Er blieb kurz stehen und tastete die Taschen des Sakkos ab. Wo hatte er den Schlüssel hingesteckt? Er hatte abgeschlossen, daran erinnerte er sich … er öffnete die Aktentasche und wühlte suchend mit einer Hand darin herum.
Ein Motorrad jaulte auf und schoss in rasendem Tempo auf der Avenue Pierre Semard heran. Richter Dussolier blickte auf, sah das Motorrad mit den zwei schwarz behelmten Gestalten und wusste in dieser Millisekunde, dass es ihm galt. Nein, dachte er noch. Nein. Er hörte das Rattern des Maschinengewehrs und sah noch das Blitzen des Mündungsfeuers, sein Körper krümmte sich unter den Kugeln, dann brach er auf den Stufen zusammen.
»Monsieur, MONSIEUR!« Der Sicherheitsbeamte brüllte, flog die Stufen hinunter und warf sich nun schützend über den Richter, für den Fall, dass das Motorrad noch einmal auftauchte oder dass es Schüsse aus einer anderen Richtung geben sollte. Es gab keine weiteren Schüsse, doch für den Richter Dussolier kam jeder Schutz und jede Hilfe zu spät. Er war tot. Daran konnte weder der Sicherheitsbeamte, der ihn nun anschrie und versuchte, ihn mit leichten und weniger leichten Schlägen auf die Wangen zurückzuholen und gleichzeitig in sein Walkie-Talkie brüllte, etwas ändern noch das hysterische Kreischen von Madame Poirier, die am oberen Ende der Treppe aufgetaucht war. »MONSIEUR LE JUGE!«, schrie der Sicherheitsbeamte noch einmal verzweifelt und dringlich und schüttelte den Richter. »Wo bleibt ihr denn? Verdammte Scheiße!«, brüllte er dann in das Walkie-Talkie.
Kaum eine Stunde später waren bereits hundert Menschen in und um das Gerichtsgebäude versammelt. Die Staatsanwältin des Landgerichts, der Präfekt und der Bürgermeister von Grasse waren herbeigeeilt, ebenso waren knapp 50 Polizisten präsent, Feuerwehr, Notarzt und bereits jede Menge Journalisten, man sah bereits die Logos von FR 3 und BFMTV, Kameras und Mikrofone wurden installiert. Trotz des abgelegenen Ortes, an dem es kaum Wohnbebauung gab, und obwohl die Polizei die Szene großräumig abgesperrt hatte, standen bereits viele Schaulustige herum. Telefone wurden hochgehalten, und es wurde damit wild geknipst oder gefilmt. Man wusste nicht genau, was passiert war. Jemand war erschossen worden auf den Stufen des Gerichts, raunten die Menschen. Aber wer? Ein Politiker? Ein Krimineller?
Fabienne Attal, die Oberstaatsanwältin, ergriff das Wort und wandte sich an die versammelten Journalisten.
»Richter Dussolier, ein Mann, der sein Leben der Justiz verschrieben hatte, wurde hier und heute ermordet. Es ist eine schwerwiegende Tat«, sagte sie mit ernster Miene. »Sie sehen mich gleichzeitig erschüttert und zornig, dass so etwas am helllichten Tag an diesem Ort, in dieser Stadt, in diesem Land geschehen konnte.« Sie machte eine dramaturgische Pause. »Richter Dussolier war ein geschätzter Kollege, er war einer von uns. Alle Richter von Grasse, alle Staatsanwälte, die gesamte Justiz wurde heute tödlich getroffen. Wir sind, ich glaube, ich kann das so in unser aller Namen sagen, Wir sind Richter Dussolier!«, griff sie den Slogan auf, der seit dem Attentat auf Charlie Hebdo immer wieder verwendet wurde. Je suis Charlie. Ich bin Charlie. Heute »waren wir« Richter Claude Dussolier. »Alles, was in unserer Macht steht, wird getan werden, um den oder die Schuldigen zu finden«, fuhr sie fort.
In diesem Moment fuhr ein Wagen vor. Eine zierliche Frau in einem rubinroten Sommerkleid entstieg ihm, Anne-Laure Dussolier, sie wurde gestützt und begleitet von ihrem Sohn und ihrer Tochter. Einen Moment wurde es still. Aber dann setzten das Geraune »Wer ist das? Seine Frau? Ist das seine Frau?« sowie die Fotoapparate, Telefone und Kameras umso heftiger wieder ein. Klack, klack, klack machten die Fotoapparate. Die Polizisten schirmten die drei Personen ab und schlugen ihnen eine Bresche durch die Menge und öffneten die Absperrung. Langsam stiegen sie die Stufen hinauf.
Man sah, wie die Oberstaatsanwältin sich mit leiser Stimme an Madame Dussolier wandte und ihr und den Kindern die Hand reichte. Madame Dussolier näherte sich dem abgedeckten Körper, und man sah, wie sie sich herabbeugte. Noch einmal wurde es ganz still. Ein kleiner Schrei, Schluchzen. Dann aufgeregtes Raunen, und Menschen liefen hin und her. »Maman!«, schrie die Tochter. »Ein Arzt! Wo ist der Arzt?«, wurde gerufen. Anne-Laure Dussolier hatte auf den Stufen neben ihrem Mann einen Schwächeanfall erlitten und war zusammengesackt.
»Einen integreren Menschen gab es in der ganzen Justiz nicht«, sagte Duval mit rauer Stimme. Er faltete Nice-Matin zusammen, der dramatisch groß »Richter Claude Dussolier ermordet!« titelte und ein älteres Foto des kleinen mageren Mannes in seiner Richterrobe zeigte.
Der Artikel wiederholte, was Duval schon wusste, und ergänzte abschließend mit der privaten Geschichte, die die Leser vermutlich am meisten berührte: Der Richter war auch Ehemann und Vater gewesen. Der Tag, an dem man ihren Mann ermordet hatte, war Madame Dussoliers Geburtstag und Hochzeitstag gewesen. Ein erstaunlich unscharfes Foto zeigte Anne-Laure Dussolier, die auf den Stufen zusammengebrochen war. Das große Fest hatte sich in eine Tragödie verwandelt.
Am Montag sei eine ehrende Würdigung des Richters Dussolier vonseiten der Justiz geplant, las er.
»Warum also?«, fragte Annie. »Wer wollte ihm dann etwas?«
»Ha!«, machte Duval bitter. »Er hat jede Menge Leute gestört, denen das Gemauschel in der Justiz in den Kram passt.«
»Aber er stand kurz vor der Pensionierung, oder?«
»Ja, es war auch sicher keiner seiner Kollegen«, sagte Duval. »Beamte legen sich auf administrativen Wegen Steine in den Weg, wenn sie sich rächen wollen. Aber auf den letzten Metern macht das auch keinen Sinn mehr. Die Art, wie sie ihn eliminiert haben, das weist ganz klar ins Milieu. Ich tippe da auf Cosenza, der sich gerächt hat.«
»Oh!«, machte Annie erschrocken. »Cosenza, meinst du wirklich?«
Duval nickte.
»Aber dann hättest du genauso dran sein können!«
»Hm«, brummte Duval zustimmend.
»Léon!«, rief Annie, der die Tragweite gerade erst bewusst wurde. »Mon Dieu, dann STEHST du vielleicht auch auf der Abschussliste?« Sie riss die Augen auf, als fiele ihr eben erst auf, dass Duval einen nicht gerade ungefährlichen Beruf ausübte.
»Glaube ich nicht.«
»Glaubst du nicht?« Annie wurde laut. »Aber wenn Cosenza sich dafür rächt, dass ihr ihn ins Gefängnis gebracht habt, dann bist du auch dran! Daran warst du genauso beteiligt wie der Richter!«
»Sie haben sich für den Richter entschieden, das ist ein schweres Vergehen und wirbelt viel Staub auf. Viel höher können sie nicht zielen. Sie werden nicht noch zusätzlich einen weniger wichtigen Flic abknallen, um noch mehr Eindruck zu machen.«
»Na, du hast gut reden.«
Am folgenden Montag um elf Uhr versammelte sich die gesamte Gerichtsbarkeit von Grasse in ihren Roben zu einem Schweigemarsch vom Landgericht bis in die Innenstadt auf die Place aux Aires. Die Staatsanwältin erinnerte dort kurz an den Richter Claude Dussolier und bat um eine Schweigeminute, in die sie auch die anwesenden Fußgänger, Ladenbesitzer und Gastronomen miteinbezog.
Anwälte, Notare, Staatsanwälte und Richter von Cannes liefen vom Gerichtsgebäude am Boulevard Carnot bis zur Kreuzung Pont Carnot und blockierten dort ebenfalls für eine Schweigeminute den Verkehr, unterstützt und begleitet von einigen Männern und Frauen der Police Municipale ebenso wie von der Police Nationale. Duval betrachtete sie vom Fenster aus und hielt seine eigene Gedenkminute ab.
Vor dem Gerichtsgebäude in Nizza, mit seiner theatralischen Freitreppe im Zentrum der Altstadt, füllten sich die Stufen mit sämtlichen Justizangestellten in ihren schwarzen und roten Roben, wo sie dramatisch und schweigend den Platz mit seinem geschäftigen Treiben, seinen Terrassen, Cafés und Restaurants für eine Minute ebenfalls mit einer, zumindest annähernden, Stille überzogen. Die Touristen hoben verzückt ihre Smartphones und Kameras in Erwartung eines Flashmobs, eines Chors, wie er neulich abends vor der Oper stattgefunden hatte. Was würde man ihnen hier heute bieten? Den Gefangenenchor aus Nabucco vielleicht? Atemlos warteten sie, die Kameras auf die vermeintlichen Sänger gerichtet. Aber nichts dergleichen passierte. Niemand sang, niemand deklamierte. Nach einer Minute verschwanden die Männer und Frauen in ihren Roben so still, wie sie gekommen waren. Verständnislos, enttäuscht und verdrossen zogen die Touristen weiter. Komisches Volk, diese Franzosen.
»Mit äußerster Entschlossenheit« würden sie vorgehen, wiederholte der Polizeidirektor in offensivem Ton vor den Polizeibeamten während der Versammlung, die er einberufen hatte. Mit der Untersuchung würde eine Spezialeinheit aus Paris betraut. Alle Mittel würden den Kollegen aus Paris zur Verfügung gestellt, und er bat darum, dass man sich ihnen gegenüber kooperativ zeige.
Alle Hypothesen seien offen, wobei die Art der Tat ganz klar in die Unterwelt weise. Und ein Racheakt im Zusammenhang mit unliebsamen Urteilen, die der Richter gefällt hatte, sei nicht auszuschließen.
Louis Cosenza, der Name fiel, sei die Spur, der man als Erstes und mit großer Dringlichkeit nachgehen würde.
In der Nacht hatte man bereits die Altstadt von Grasse durchkämmt, hier lebten seit Jahrzehnten nordafrikanische Einwanderer in ungeregelten Verhältnissen, sprich, illegal. Häufig hausten sie ohne gültige Mietverträge unter miserablen Bedingungen in heruntergekommenen Häusern, schlugen sich mit Schwarzarbeit durch und waren nur allzu bereit, sich für alle möglichen Tätigkeiten, die ihnen Geld und damit eine trügerische Sicherheit vermittelten, zu verdingen. Aufgrund von Zeugenaussagen hatte man dort drei verdächtige Jugendliche in Gewahrsam genommen, sie am Morgen jedoch wegen erwiesener Unschuld wieder freigelassen.
Dass die Ermittlung einer speziellen Einsatzgruppe aus Paris übertragen wurde, die noch im Laufe des Tages anreisen würde, machte Duvals Hoffnungen zunichte, dass man ihn mit der Aufklärung des Falls betrauen würde. Ein paar Namen von Kollegen fielen, die direkt mit der Einsatzgruppe zusammenarbeiten sollte. Duval gehörte nicht dazu. Was war da los? Hatte jemand gegen ihn intrigiert? Wollten sie ihn schon aufs Abstellgleis schieben? Verärgert und gekränkt verließ er die Versammlung. In seinem Büro lief er unruhig hin und her. Schließlich nahm er die Stufen bis in den fünften Stock und bat die Sekretärin, ihn beim Direktor anzumelden. Er musste nicht lange warten.
»Duval, setzen Sie sich«, begrüßte ihn der Direktor mit ernster Miene.
»Monsieur le Directeur«, begann Duval, »bei allem Respekt, ich verstehe Ihre Entscheidung nicht. Ich möchte, ich will«, betonte er, »bei der Ermittlung um Richter Dussolier mitarbeiten. Die Spur führt zu Cosenza, da bin ich sicher, und ich glaube, dass ihn niemand besser kennt als ich.«
»Es ist noch zu früh, um sich festzulegen, aber unter uns, ich stimme Ihnen zu, Duval, Cosenza ist meiner Ansicht nach der Urheber dieses Mordes, und es mag durchaus sein, Commissaire, dass Sie ihn am besten kennen, es gibt aber auch niemanden, der so gefährdet ist wie Sie in diesem Fall. Ich kann Ihnen keinen Personenschutz geben, ich brauche im Moment jeden fähigen Mann. Was ich tue, ist, Sie buchstäblich aus der Schusslinie zu nehmen.«
»Wenn mich jemand erschießen will, kriegt er mich so oder so«, entgegnete Duval. »Ich glaube aber nicht, dass sie es auf mich abgesehen haben.«
»Darauf möchte ich es nicht ankommen lassen«, entgegnete der Direktor.
»Bitte«, insistierte Duval. »Ich möchte Richter Dussolier meine Ehre erweisen. Unsere Zusammenarbeit war immer«, er zögerte, »von Vertrauen und Respekt geprägt. Ich schulde es ihm. Ich käme mir vor wie ein Drückeberger, wenn ich hier drinnen am Schreibtisch sitze und Akten bearbeite.«
»Auch das ist eine ehrenvolle Aufgabe, Duval. Vielleicht entdecken Sie in den Akten etwas, was uns in diesem Fall weiterbringt. Sie sollten das nicht unterschätzen.«
»Bitte«, rang Duval sich ein zweites Mal ab.
Der Direktor überlegte einen Moment, dann nickte er. »Gut, Duval. Wir machen es ein wenig anders. Sie kümmern sich als Erstes um Cosenza. Und Sie berichten mir direkt, in Ordnung?«
»Danke, Monsieur le Directeur.«
»Schon gut, Duval.«
»Ausgerechnet Sie!« Louis Cosenza sah Duval mit unverhohlener Abneigung an. Der einst so muskulöse und stets braun gebrannte Mann war immer noch massig, aber in einer eher fett-schwammigen Art. Außerdem war er blass geworden. Auch wenn Cosenza sich Essen liefern lassen konnte und sich vermutlich zusätzlich den einen oder anderen Service erkaufte, so hatte der Aufenthalt im Gefängnis doch Spuren hinterlassen.
»Wie geht es Ihnen?«, fragte Duval ungerührt.
»Pah! Als würde Sie das interessieren. Was wollen Sie?«, schnauzte Cosenza.
»Sie wissen nicht, weshalb ich hier bin?«
»Machen wir jetzt ein Ratespiel?«
»Der Richter Dussolier«, begann Duval und ließ den Satz in der Luft hängen.
»Ah«, machte Cosenza.
»Sie wussten es schon«, stellte Duval fest.
Cosenza breitete die Hände in einer gespielt resignierten Art aus und verzog grimmig das Gesicht. »So ist es nun mal. Hier drinnen verbreiten sich die Nachrichten rasant. Bizarrerweise ist dies hier der Ort, wo man am besten informiert ist, zumindest was diese Art von Informationen angeht«, sagte Cosenza. »Ich werde ihm nicht nachweinen. So ein hinterfotziger Drecksack!«
»Er machte seine Arbeit.«
»Jaja. Auf meine Kosten. Und was wollen Sie jetzt?«
Duval starrte Cosenza stumm an.
»Was?«, polterte Cosenza erneut. »Was schauen Sie mich so an? Was ist los?«
»Sie wissen doch sicherlich auch, wie er ums Leben kam?«
»Ach so«, machte Cosenza langsam und leise. Er sah Duval aus schmalen Augen an. »Deshalb.« Er hatte sich gut unter Kontrolle. »Sie glauben, dass es jemand von meinen Leuten war.«
»Alles weist darauf hin.«
»Alles weist darauf hin«, wiederholte Cosenza spöttisch. »Sie täuschen sich, Commissaire. Ich habe damit nichts zu tun.«
Duval verzog gespielt ungläubig das Gesicht.
»Sie glauben mir nicht?«
»Sie haben allen Grund, nicht wahr? Gerade haben Sie ihn einen ›hinterfotzigen Drecksack‹ genannt.«
»Ach herrjeh, ja, das habe ich gesagt, aber man sagt viel, wenn der Tag lang ist. Man verroht hier drinnen und wird schnell ein bisschen vulgär, muss ich Ihnen das erklären? Aber Worte sind nur Worte, Commissaire. Sie nennen sicher auch mal jemanden einen Drecksack, ohne ihn deshalb gleich töten zu wollen.«
»Vielleicht wünschten Sie sich seinen Tod und haben das einmal laut ausgesprochen? Und jemand tat Ihnen den Gefallen?«
»Wer sollte denn so etwas tun?« Cosenza tat ungläubig überrascht.
»Ach«, machte Duval, im gleichen leicht spielerischen Ton, »da gibt es bestimmt den einen oder anderen, der unter Umständen dazu bereit ist. Wie geht es eigentlich Ihrem Sohn?«, fragte er unvermittelt. »Wie hieß er noch? Giorgio?«
»Na, nun reicht es aber! Lassen Sie meine Familie aus dem Spiel. Wie können Sie nur denken, dass mein Sohn so etwas täte!«
»Um die Familienehre und die Ehre seines Vaters im Besonderen zu verteidigen, halten Sie das für so ausgeschlossen?«
»Hm«, brummte Cosenza unbestimmt. Tatsächlich war er sich nicht so sicher, ob Giorgio die Geschäfte so führte, wie er sich das wünschte. »Hören Sie«, sagte er dann unvermittelt, »ich werde mich erkundigen. Ich mach mich schlau. Kommen Sie in ein paar Tagen noch einmal. Vielleicht weiß ich dann was.«
»Ich werde das Gefühl nicht los, dass er damit wirklich nichts zu tun hat«, endete Duval seinen Rapport beim Direktor.
Der sah ihn bekümmert an. »Lassen Sie sich nicht von ihm hinters Licht führen, Duval. Cosenza ist ein gewiefter Schauspieler, das müssten Sie doch wissen. Der wird Ihnen was erzählen, von der Konkurrenz, die seine geschwächte Situation im Gefängnis nutzt, um sich Vorteile auf dem Drogenmarkt zu verschaffen oder so etwas in der Art.«
»Das ist ja nicht auszuschließen.«
»Möglich. Nehmen Sie Kontakt mit Martinez von der STUP auf und hören Sie mal ein bisschen rum, was gerade so los ist, bleiben Sie dran an Cosenza und berichten Sie mir wieder.« Er öffnete eine Akte, die auf seinem Schreibtisch lag.
Duval verstand und erhob sich.
»Au revoir, Monsieur le Directeur.«
»Au revoir, Duval.«
Duval war schon an der Tür, als der Direktor noch einmal anhob: »Lassen Sie sich nicht einwickeln, Duval.«
»Bitte?«
»Von Cosenza, meine ich.«
»Natürlich nicht, Monsieur le Directeur.«
»Gut.« Der Direktor vertiefte sich in die Papiere.
Mit Louis Martinez von der Brigade des Stupéfiants, dem Drogendezernat, kurz STUP genannt, war Duval nicht mehr zusammengetroffen, seit ihnen bei einer Razzia sein Bruder mit Drogenbesitz in die Fänge geraten war. Die STUP war ein eingeschworener Haufen, die Kollegen von außerhalb nichts oder nur gegen eine Gegeninformation etwas preisgaben. Es war gut, bereits informiert zu sein, um nicht ganz dumm dazustehen. Man war außerdem gut beraten, so zu tun, als wüsste man noch mehr.
Ungeschickt nur, dass er bei Martinez wegen Fréd noch in der Kreide stand.
Was machte der eigentlich? Der meldete sich nur, wenn ihm das Wasser bis zum Hals stand. Duval wählte seine Nummer.
»Fréd?«
»Wer will das wissen?«, fragte sein Bruder unwirsch zurück.
»Ich bin’s, Léon.«
»Léon«, es hörte sich nicht erfreut an. »Was gibt’s?«
»Ich wollte mal hören, wie es dir geht?«
»Ach was.«
»Ja, wie geht’s dir? Was machst du?«
»Wie, was ich mache? Ich telefoniere mit dir«, gab er rotzig zurück.
»Was machst du beruflich? Kutschierst du noch diesen Winterstein herum?«
»Hmm«, brummte Frédéric zustimmend.
»Und das läuft gut?«
»Ganz okay.«
»Sag mal, fährst du eigentlich noch Motorradrennen?«
»Hin und wieder.«
»Wie viele Maschinen hast du?«
»Drei. Eine Motocross-Maschine, eine Enduro und eine schwere BMW. Warum interessiert dich das? Willst du eine kaufen?«
»Nein. Bist du in den letzten Tagen damit gefahren?«
»Was? Was fragst du denn da für einen Scheiß?«
»Hör zu Fréd, vielleicht hast du davon gehört, ein Richter wurde erschossen«, begann Duval. »Und du weißt vermutlich, dass es zwei Typen auf einem geländegängigen Motorrad waren?«
»Nee, das gibt’s doch echt nicht!«, fiel ihm Frédéric ins Wort. »Du verdächtigst mich? Deinen Bruder?«
»Ich will nur wissen, ob deine Maschinen noch an ihrem angestammten Ort stehen«, unterbrach Duval ihn wiederum.
Für einen Moment schwieg Frédéric.
»Wann hast du sie zum letzten Mal gesehen oder bewegt?«, insistierte Duval.
»Schon eine Weile her.«
»Kannst du nachsehen, ob sie noch an ihrem Platz stehen?«
»Jetzt?«
»Wenn’s geht, jetzt.«
»Okay, ich geh runter, bleib dran.«
Duval hörte, wie sein Bruder eine Tür öffnete, mehrere Treppen hinablief, wieder eine Tür öffnete, er hörte knirschende Schritte auf Kies, ein Garagentor öffnete sich quietschend.
»Bist du noch da?«, fragte Fréd.
»Ja.«
»Alles okay hier.« Er klang erleichtert. »Die stehen noch exakt so, wie ich sie zuletzt hingestellt habe.«
»Gut.« Duval war ebenfalls erleichtert. »Weißt du sonst etwas?«
Fréd zögerte.
»Fréd!«
»Ich weiß gar nix«, murrte er. Aber sein Ton klang weniger feindselig.
»Sicher?«
»Driss Abidi«, warf Fréd ihm zu.
»Driss Abidi? Der Schrotthändler?«
»Jo.«
»Den kennst du?«
»Ich finde bei ihm manchmal Ersatzteile.«
»Aha. Das ist alles?«
»Na ja«, murmelte Fréd halblaut, »ich hab auch schon mal Koks bei ihm gekauft.«
Duval schwieg. Das war nicht die Antwort, die er erwartet hatte.
»Mann, Léon! So ist es heute. Du bist so spießig! Alle ziehen sich was rein«, verteidigte sich Frédéric.
»Okay, vergiss es. Was ist mit Driss Abidi?«
»Keine Ahnung. Aber die Winterstein-Söhne sind nervös und telefonieren den ganzen Tag hin und her. Sie haben Angst, dass man ihnen die Sache anhängen will. Sie glauben, dass es im Auftrag von Driss Abidi geschehen ist. Ich habe das zufällig so aufgeschnappt, als ich auf den Alten gewartet habe und vor dem Wohnwagen von Jacky eine rauchte.«
»Jacky Winterstein?«
»Jo.«
»Okay, Fréd. Ich muss mich in den nächsten Tagen mit der STUP kurzschließen. Ich weiß nicht, was die wissen, aber du tust gut daran, für alle Fälle clean zu sein. Schmeiß alles, was bei dir von diesem Dreckszeug herumfliegt, ins Klo und spül es weg.«
Fréd schwieg.
»Mach, was du willst, Fréd. Es geht mich nix an, aber heul nicht nach mir, wenn sie dich wieder in Gewahrsam nehmen.«
»Wichser«, zischte Frédéric.
»Was?«
»Nix.«
»Na dann … tschau.«
»Tschau.«
Duval schnaufte. Was für ein beschissenes Verhältnis er zu seinem Halbbruder hatte. Sie hatten nicht einmal die üblichen Höflichkeitsfloskeln ausgetauscht.
»Was wissen wir denn über Driss Abidi?« Er steckte den Kopf in das Büro, das sich seine Mitarbeiter teilten.
»Der Schrotthändler?«, fragte LeBlanc zurück.
»Ebender.«
»Das haben wir gleich«, LeBlanc gab den Namen im System ein.
»Driss Abidi, geboren in Tunis, über Marseille und Toulon bis nach Cannes gekommen, angeblich, um aus der Marseiller Kriminellen-Szene zu entkommen, die ihm mehrere Aufenthalte in Les Baumettes beschert hat, hat hier in Cannes erst eine heruntergekommene Werkstatt in La Bocca gekauft, dann auf einem Gelände am Rande von Les Tourrades, gleich hinter der Mülldeponie, einen Schrottplatz aufgemacht. Dort hat er jetzt auch eine Werkstatt eingerichtet. Alles legal, wenn man den Informationen hier glauben kann.«
»Sagen wir, er hat zumindest eine legale Fassade. Vielleicht lässt er geklaute Autos verschwinden und dergleichen.« Duval betrachtete das Foto des dunkelhäutigen Mannes im Computer. »Da ist ein bisschen Schwarzafrika mit drin, oder?«
»Vater Tunesier, Mutter aus dem Senegal. Richtig.«
»Keine Drogen?«, fragte Duval.
»Doch, doch«, mischte sich Villiers ein. »Ich glaube, er hat die Finger nach Ranguin ausgestreckt. Seit ich bei diesem Einsatz damals dabei war, kriege ich immer mal was mit aus den Kreisen der STUP. Die sind ja sonst sehr verschwiegen.«
Die Hochhaussiedlung in Ranguin, einem sozialen Brennpunkt-Vorort von Cannes, war ein bekannter Drogenumschlagplatz, immer noch, selbst nachdem man den letzten großen Drogenhändler festgenommen und einen Teil seines Netzes zerschlagen hatte.
»Sieh an«, sagte Duval. »Halten Sie doch ein bisschen die Ohren offen«, bat er. »Ich will Louis Martinez aufsuchen, und es ist immer gut, nicht ganz unwissend zu sein.«
»Mach ich«, nickte Villiers.
»Dieser Driss Abidi hat vor einiger Zeit den Boxclub im Suquet übernommen«, ließ sich Léa Leroc hören. »In der Rue Hibert.«
»Ach so? Woher wissen Sie das denn?«
Léa grinste. »Am Kaffeeautomaten erfährt man so einiges. Ihre Anschaffung der Kaffeemaschine hat zwar zu einem qualitativ besseren Kaffee geführt, aber zu einem gewissen Informationsverlust, was den Flurfunk angeht. Hin und wieder ist es gut, am Kaffeeautomaten einen Kaffee zu trinken, auch wenn der Kaffee, zugegeben, ekelhaft ist.« Sie verzog das Gesicht zu einer Grimasse. »Einer der Kollegen boxt in diesem Club«, erklärte sie. »Er hat dort angefangen, als er noch dem alten Besitzer gehört hat. Mit dem Verkauf habe sich die gesamte Szene geändert, sagte er. Ein paar sind geblieben, die meisten sind gegangen, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ist jetzt eher in arabischer Faust, um im Bild zu bleiben.«
»Das ist nicht gerade politisch korrekt ausgedrückt, liebe Léa«, witzelte Villiers.
»Ich drücke mich so aus, dass ihr mich versteht«, gab sie zurück.
»Und der Kollege ist noch dort?«, fragte Duval.
»Ja, so habe ich das verstanden. Es scheint ihm einen besonderen Spaß zu machen, sich mit Arabern zu boxen, wenn auch unter geregelten Bedingungen.« Sie verzog abschätzig das Gesicht.
»Wer ist es?«
»Paul Garcia von der STUP.«
»Ach der.« Villiers machte ein verächtliches Gesicht. »Wundert mich nicht.«
»Was haben Sie gegen ihn?«
»Mit manchen Kollegen komme ich nicht klar. Das ist der Liebling von Martinez, und darauf bildet er sich was ein. Falscher Fuffziger.«
»Das beruhigt mich«, sagte Léa. »Ich kann ihn nicht ab, weil er jedes Mal, wenn er mich sieht, schmierige Witze erzählt.«
»Das passt zu ihm.«
»Ich geh mir den mal anschauen«, entschied Duval.
»Paul Garcia?«, fragte LeBlanc irritiert.
»Nein, den Boxclub, Michel«, erklärte Léa, »oder?« Sie sah Duval an, der bestätigend nickte. »Wollen Sie, dass jemand von uns mitgeht?«
Duval schüttelte den Kopf. »Nicht nötig. Wenn ich nicht wiederkomme, wissen Sie, wo Sie mich suchen müssen«, witzelte er.
Im Boxclub in einer Seitenstraße des Suquet war so früh am Nachmittag noch nicht viel los. Rapklänge hallten ihm schon auf der Straße entgegen, die großen Glastüren waren weit geöffnet. Zwei bärtige junge Männer in schwarzen T-Shirts und Shorts dribbelten und droschen mit eingezogenem Kopf und bulligen Boxhandschuhen abwechselnd auf einen schweren Boxsack ein, der an der linken Wand an einem Eisengalgen hing. Sie schwitzten, und ihre feuchten Ausdünstungen vermischten sich mit dem beißenden Geruch von Chlorreiniger. An den weißen Wänden rote und schwarze Graffiti, dazu der Kopf eines schwarzen Boxers, dessen überdimensionierte Faust den Betrachter auf Kopfhöhe zu treffen schien. Der Boxring aber war leer.
Die beiden jungen Männer waren kurz irritiert, als Duval neben ihnen auftauchte. »Eh, Driss!«, rief einer von ihnen keuchend, zwischen zwei Schlägen. »Du hast Besuch!«
Ein großer und bulliger Mann erschien. Er füllte die Türöffnung mit seinem Körper aus, stand etwas gebeugt, um sich nicht den Kopf am Türrahmen anzuschlagen. Duval erkannte den Mann vom Foto wieder, er war allerdings deutlich massiger geworden. Driss Abidi war ein métisse, sein tunesischer Vater hatte ihm seinen Namen und den Körperbau, seine schwarzafrikanische Mutter die dunklere Hautfarbe und die krausen Haare mitgegeben. Diese Afrohaare, die er hasste und sie daher regelmäßig auf drei Millimeter abrasierte. Das Weiße in seinen Augen war leicht gerötet, und er strahlte eine nur mühsam gezähmte Aggressivität aus.
»Monsieur Driss Abidi?«
»Wer will das wissen?«
»Duval, Police Nationale«, Duval zeigte seinen Dienstausweis.
Die Jungs am Boxsack rumorten und pfiffen durch die Zähne.
»Eh oh!«, machte Driss Abidi in ihre Richtung, und sie kuschten wie brave Hunde, ließen Duval aber nicht aus den Augen und hämmerten demonstrativ verächtlich auf den Boxsack ein.
»Ihre Kollegen waren schon da«, knurrte Driss Abidi. »Ich habe damit nichts zu tun. Das habe ich doch schon gesagt.«
Duval hörte, wie im Raum, dessen Zugang der bullige Mann mit seinem Körper versperrte, eine Tür geöffnet und geschlossen wurde.
»Womit haben Sie nichts zu tun?«
Fast zeitgleich sprang ein Auto an. Ein Alfa Romeo. Schon als kleiner Junge hatte Duval, zum Stolz seines Vaters, der leidenschaftlich Autoralleys fuhr, den Motorsound sämtlicher Automarken auseinanderhalten können. BMW, Mercedes, Porsche, Alfa, Lamborghini, Maserati. Eine Sekunde später röhrte ein hochgetunter knallroter Alfa am Boxclub vorbei. Den Fahrer, er ging davon aus, dass es ein Mann war, konnte er nicht erkennen.
»Ich habe Sie gestört, Sie hatten Besuch?«, fragte Duval.
Driss Abidi sah ihn aggressiv an, schwieg aber.
»Womit also haben Sie nichts zu tun?«, wiederholte Duval.
»Mit dem Richter. Das wollen Sie doch wissen, oder? Deswegen sind Sie doch da?«
Duval nickte.
»Das war der alte Italiener, der mir den Schwarzen Peter zuschiebt. Der ist schlau!«
»Der alte Italiener«, wiederholte Duval langsam. »Sie meinen Cosenza? Louis Cosenza, der zurzeit in Nizza im Gefängnis einsitzt?«
»Ach, jetzt tun Sie doch nicht so scheinheilig! Sie wissen genau, wen ich meine. Und Sie wissen auch genau, Sie am allerbesten, dass der mit Ihrem Richter noch eine Rechnung offen hatte.«
Zusammen mit Richter Dussolier hatte Duval damals Nicki, die junge Frau von Louis Cosenza, als Hauptverdächtige im Mordfall an ihrem Geliebten in Untersuchungshaft gesteckt. Nur um sie zu entlasten, hatte Cosenza, dem der perfekte Mord, den er begangen hatte, nicht nachzuweisen war, sich damals gestellt. Dass Cosenza von Rachegelüsten heimgesucht wurde, wäre nur zu verständlich. Dennoch hatte Duval das unbestimmte Gefühl, dass Cosenzas Unschuldsbeteuerungen diesmal glaubwürdig waren.
»Im Gegensatz zu Ihnen«, wandte er sich wieder an Driss Abidi. »Sie sind ja ein ganz unbescholtener Bürger, der nur seinen Geschäften nachgeht und sich nichts vorzuwerfen hat.«
»Sie sagen es, Monsieur le Commissaire«, grinste Abidi. »Ich sehe, wir verstehen uns. Ich habe rein gar nichts mit dieser Sache zu tun, egal, was dieser krumme Hund Cosenza meint. Und wenn Sie sonst keine Fragen haben –«
»Danke, das reicht fürs Erste«, sagte Duval. »Aber das heißt noch lange nicht, dass wir uns in dieser Sache das letzte Mal gesehen haben.« Mit diesen Worten wandte er sich um und verließ den Boxclub, in dem fast gleichzeitig die Musik laut gedreht wurde. »Oh oh contrôle de police, monsieur, systématique est la façon dont l’histoire se complique« dröhnte es über die Straße. Duval erkannte den Text eines Rap-Songs, der die verhasste Polizei zum Thema hatte. Er zog es vor, es nicht zur Kenntnis zu nehmen.
Später sah Duval einen roten Alfa, der über den Pont Carnot rauschte und in einer rasanten Linkskurve zur Tiefgarage des Kommissariats einbog. Zufall? Wie viele rote Alfas gab es in Cannes? Würde ein Flic, der vielleicht in unsaubere Geschäfte verwickelt war, ausgerechnet einen roten Alfa fahren, mit dem man ihn an jeder Straßenecke wiedererkennen könnte? Da musste er schon sehr dämlich sein. Oder sich sehr sicher fühlen.
»Bonjour, Louis«, grüßte Duval, »alles klar?«
»Sieh an, der Commissaire mit dem kriminellen Bruder. Alles gut mit dem Kleinen?«
»Halbbruder«, konnte Duval sich nicht verkneifen richtigzustellen.
»Ah ja, Halbbruder. Die schlechten Gene hat er von der Mutter, richtig?« Martinez lachte rau.
Da wäre ich nicht so sicher, dachte Duval, aber er verzog nur das Gesicht. »Er ist kein schlechter Kerl«, verteidigte er seinen Bruder gegen seine Überzeugung. »Verwöhnter Bengel, der zu jung zu viel Geld geerbt hat«, er zuckte mit den Schultern.
»Was verschafft uns die Ehre? Hast du was oder willst du was?«
»Teils, teils, hoffe ich.«
»Schieß los.«
»Driss Abidi ist im Drogenbusiness angekommen.«
Louis Martinez winkte ab. »Geschenkt. Damit erzählst du mir nichts Neues. Der hat Ranguin übernommen, kaum hatten wir den letzten Caïd festgesetzt, Tartar, du erinnerst dich?«
»Sicher«, nickte Duval. »Villiers war damals dabei.«
»Aber es war vorauszusehen. Die Jungs im Viertel haben sich gegenseitig bekriegt, aber keiner konnte sich wirklich durchsetzen. Die haben sich einen langen, aber