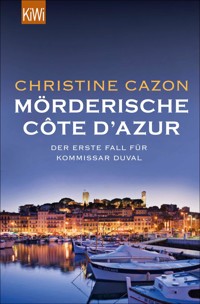19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Vive la France – Drei Mörder gesucht! Spannendes Lesefutter, nicht nur für Ihren Frankreichurlaub »Stürmische Côte d'Azur« von Christine Cazon Léon Duval, Kommissar in Cannes, wird für eine Mordermittlung auf die Insel Sainte Marguerite gerufen. Auf einer Yacht im Hafen der Insel wird ein Matrose ermordet aufgefunden. Doch nicht nur das Wetter ist stürmisch, auch der Mordfall entwickelt sich turbulent, denn kurz nach Duvals Eintreffen wird eine zweite Leiche gefunden ... »In tiefen Schluchten« von Anne Chaplet Tori Godon, ehemalige Anwältin, 42 Jahre alt, frisch verwitwet und auf der Suche nach einer neuen Aufgabe lebt seit einigen Jahren in Vivarais am Fuße der Cevennen. Als ein holländischer Höhlenforscher, der sich bei ihrer Freundin einquartiert hat, verschwindet, ist Tori beunruhigt. Als der alte Didier Thibon, der ihr von sagenhaften Schätzen in den Höhlen erzählte, tot aufgefunden wird, ist Tori alarmiert. Und als sie auf der Suche nach dem Holländer in eine Felsspalte stürzt, ist plötzlich auch ihr Leben in Gefahr. »Tödlicher Tramontane« von Yann Sola Perez, Kleinganove und Hobbydetektiv in Banyuls-sur-Mer, nahe der spanischen Grenze, würde gern in aller Ruhe sein Restaurant und seinen florierenden Schwarzhandel mit spanischen Delikatessen betreiben. Doch dann explodiert in Strandnähe eine stattliche Yacht. Als auch noch seine Freundin Marianne spurlos verschwindet, die gegen die geplante Erweiterung des Hafens demonstriert hat, ahnt Perez, dass es an der Côte Vermeille nicht mit rechten Dingen zugeht …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1140
Veröffentlichungsjahr: 2018
Sammlungen
Ähnliche
Christine Cazon / Anne Chaplet / Yann Sola
Mord unter französischer Sonne
(3in1-Bundle)
Stürmische Côte d’Azur - In tiefen Schluchten - Tödlicher Tramontane
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Christine Cazon / Anne Chaplet / Yann Sola
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Christine Cazon / Anne Chaplet / Yann Sola
Christine Cazon, Jahrgang 1962, lebt mit ihrem Mann und zwei Katzen in Cannes. »Wölfe an der Côte d’Azur« ist ihr fünfter Krimi mit Kommissar Léon Duval.
Anne Chaplet ist das Pseudonym von Cora Stephan, unter dem sie ihre mehrfach preisgekrönten Kriminalromane veröffentlicht hat. Cora Stephan ist Publizistin und Schriftstellerin, ihr Roman »Ab heute heiße ich Margo« erschien 2016 bei Kiepenheuer & Witsch.
Yann Sola ist das Pseudonym des Romanautors Werner Köhler. Gelüftet wurde dieses Geheimnis im Herbst 2017 im Laufe einer Fernsehdokumentation über den Autor. Er lebt und arbeitet in Deutschland und an der Côte Vermeille, im äußersten Südwesten Frankreichs, in unmittelbarer Nähe zur spanischen Grenze.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Vive la France – Drei Mörder gesucht!
Spannendes Lesefutter, nicht nur für Ihren Frankreichurlaub
»Stürmische Côte d’Azur«
Léon Duval, Kommissar in Cannes, wird für eine Mordermittlung auf die Insel Sainte Marguerite gerufen. Auf einer Yacht im Hafen der Insel wird ein Matrose ermordet aufgefunden. Doch nicht nur das Wetter ist stürmisch, auch der Mordfall entwickelt sich turbulent, denn kurz nach Duvals Eintreffen wird eine zweite Leiche gefunden …
»In tiefen Schluchten«
Tori Godon, ehemalige Anwältin, 42 Jahre alt, frisch verwitwet und auf der Suche nach einer neuen Aufgabe lebt seit einigen Jahren in Vivarais am Fuße der Cevennen. Als ein holländischer Höhlenforscher, der sich bei ihrer Freundin einquartiert hat, verschwindet, ist Tori beunruhigt. Als der alte Didier Thibon, der ihr von sagenhaften Schätzen in den Höhlen erzählte, tot aufgefunden wird, ist Tori alarmiert. Und als sie auf der Suche nach dem Holländer in eine Felsspalte stürzt, ist plötzlich auch ihr Leben in Gefahr.
»Tödlicher Tramontane«
Perez, Kleinganove und Hobbydetektiv in Banyuls-sur-Mer, nahe der spanischen Grenze, würde gern in aller Ruhe sein Restaurant und seinen florierenden Schwarzhandel mit spanischen Delikatessen betreiben. Doch dann explodiert in Strandnähe eine stattliche Yacht. Als auch noch seine Freundin Marianne spurlos verschwindet, die gegen die geplante Erweiterung des Hafens demonstriert hat, ahnt Perez, dass es an der Côte Vermeille nicht mit rechten Dingen zugeht …
KiWi-NEWSLETTER
jetzt abonnieren
Impressum
Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. KGBahnhofsvorplatz 150667 Köln
© 2018, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Gestaltung Bundle-Cover: Barbara Thoben, Köln
»Stürmische Côte d’Azur«
© 2016, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Gulliver Theis/laif
»In tiefen Schluchten«
© 2017, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Barbara Thoben, Köln
Covermotiv: © Anette Kühnel
Karten: Markus Weber \ Guter Punkt, München
»Tödlicher Tramontane«
© 2016, Verlag Kiepenheuer & Witsch, Köln
Covergestaltung: Sabine Kwauka
Covermotiv: © privat
Karte: Oliver Wetterauer
ISBN978-3-462-31922-4
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt. Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen der Inhalte kommen. Jede unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Alle im Text enthaltenen externen Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Inhaltsverzeichnis
Stürmische Côte d’Azur
Disclaimer
Widmung
Motto
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Epilog
Danksagung
Un mot de remerciement
In tiefen Schluchten
Karten
Widmung
Motto
Kapitel I
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
Kapitel II
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Kapitel III
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
Kapitel IV
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
Kapitel V
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
Kapitel VI
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
Dank
Adressen
Tödlicher Tramontane
Karte
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Einige Monate später
Bildnachweis
Christine Cazon
Stürmische Côte d’Azur
Der dritte Fall für Kommissar Duval
Der vorliegende Roman spielt in Cannes und auf seiner vorgelagerten Insel Sainte-Marguerite. Stadt und Insel und manche der beschriebenen Orte sind reell und haben mich zu der vorliegenden Geschichte inspiriert. Die Handlung des Romans ist fiktiv und die darin vorkommenden Personen, ihre beruflichen und privaten Handlungen und Konflikte sind ebenso frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig und ist nicht beabsichtigt.
Aux Amis des Îles
Cris de mouette, signe de tempête.
Französisches Sprichwort
Les marins croient en Dieu.
Quand on est tout seul en mer, c’est bien plus facile de croire.
FLORENCE ARTHAUD, Paris Match, 25 mars 1993
1
Es regnete immer noch. Eintönig, nicht enden wollend, monoton. Am frühen Abend des Vortags hatte es begonnen und seither nicht nachgelassen. In der Nacht war auch noch Wind aufgekommen. Alice zog unter der Decke die Schultern zusammen und rollte sich ein. Es war kalt geworden. Aber vielleicht war es auch nur ihre Müdigkeit, die sie frösteln ließ. Die halbe Nacht hatte sie wach gelegen, immer wieder hatte sie in das stete Rauschen des Regens gelauscht und den Nachrichteneingang ihres Mobiltelefons überprüft. Gegen Morgen war sie schließlich kurz eingeschlafen, aber schon bald war sie wieder aufgeschreckt. Ihr Herz klopfte und sie lauschte in die Stille des Hauses. Sie stand auf und blickte aus dem Fenster, aber von hier konnte sie außer den ausladenden Baumkronen der Pinien, die sich ächzend im Wind bewegten, nicht viel sehen. Ohne Licht zu machen, zog sie sich an und verließ leise das Forsthaus. Drei Möwen flogen laut kreischend über sie hinweg. Eilig lief sie über die matschig gewordenen Wege zum kleinen Bistro am Fährableger, es schmatzte und knirschte unter ihren Füßen und im Nu waren ihre Turnschuhe durchnässt, der Regen trommelte ihr auf den Kopf, sie hatte ihn tief in der Kapuze ihres Pullovers verborgen. Vorsichtig öffnete sie das Tor, gerade so weit, dass sie hindurchschlüpfen konnte, ohne dass es anfing zu quietschen. Sie tastete mit klammen, nassen Fingern nach dem Schlüssel unter einem der Blumentöpfe und schloss leise die Tür auf. Le Bistro de la Guerite stand auf einer Holzplanke, die über der Eingangstür hing. Im Bistro zog sie eilig den kleinen Gasofen aus der Ecke und presste mit einer Hand den knatternden Anzünder, während sie mit der anderen gleichzeitig am Thermostat drehte. Wie durch ein Wunder sprangen diesmal alle drei Heizfelder an. Sie atmete auf und kauerte sich einige Sekunden vor die wohlige Wärme. Dann heizte sie die Kaffeemaschine auf, sie lechzte nach einer großen Tasse frischen heißen Kaffees. Sie hoffte, dass Regen und Wind die Geräusche im Bistro dämpften, keinesfalls wollte sie Pascal, der in einem Anbau neben dem Bistro schlief, mit dem dröhnenden Gebrumm und Gezische der Kaffeemaschine wecken. Ihren ersten Kaffee und die erste Zigarette nahm sie gern allein und in aller Ruhe ein. Sie mochte noch nicht sprechen, und schon gar nicht wollte sie von Menschen umgeben sein, die ihr auf die Nerven gingen. Pascal ging ihr zunehmend auf die Nerven. Sie setzte sich mit dem Kaffee an die Fensterfront, drehte sich eine Zigarette, zündete sie an und zog daran. Dann öffnete sie eines der Fenster einen Spalt weit und blies den Rauch hinaus: Es war ihre Variante des »draußen« Rauchens, wenn sie alleine war. Sie seufzte und zog noch einmal tief an der Zigarette. Zeit, den Abflug zu machen, dachte sie.
Ein Sommerjob als Surflehrerin hatte sie auf die Insel gebracht und sie hatte die langen sonnigen Sommermonate hier verbracht. Wie in einem Traum hatte sie sich anfangs hier gefühlt, geborgen und seltsam fern von allen drängenden Fragen und Weltproblemen. Grün und lieblich war die Insel, stundenlang war sie immer wieder die kleinen Wege abgelaufen, ohne sie sattzuhaben. Beinahe täglich hatte sie sich auf die schroffen Klippen auf der Südseite gesetzt und hinaus aufs Meer gesehen. Wie hatte sie es genossen, wenn die Schwärme von Tagesausflüglern abends mit der letzten Fähre wieder verschwunden waren und die Schreie und das Geplapper der Cannoiser Schulkinder im Fort langsam verstummten, bis es endgültig still wurde auf der Insel. Wie wundervoll war es gewesen, im sanften Abendlicht zu schwimmen und dabei den dahingleitenden Möwen zuzusehen. Es war unglaublich, dass nur einen Steinwurf entfernt von Luxus und Eitelkeiten der Côte d’Azur diese kleine, fast unberührte Insel existierte, die sich trotz des Touristenansturms bislang gegen alle modernen Errungenschaften behauptete. Hier gab es nichts. Nur einen Kiosk, der aber nicht einmal Souvenirs verkaufte, sondern nur ein Minimum an Sandwiches, Eis und Getränken anbot, daneben ein paar kleine Häuschen, die ausschließlich im Sommer bewohnt waren, das alte Fort, in das ein Museum integriert war und ein paar Hütten, in denen Naturschützer in großen Aquarien etwas von der Meeresfauna und Flora zeigten. Das Forsthaus natürlich und die Segelschule, wo man den Schulkindern bei ihrem Inselaufenthalt die Anfänge des Segelns und des Surfens beibrachte. Nicht zu vergessen das Bistro.
Sie hatte den Sommer über mit den wechselnden Kindergruppen und den anderen Surf- und Segellehrern in den ehemaligen Kasernen im Fort gewohnt. Aber nun war die Saison vorbei. Die Schlafsäle und die Großküche waren geschlossen. In der Segelschule lagen die Boote an Land, die Surfbretter waren in den Hallen verstaut und Nico, Jérôme und Julien waren aufs Festland gefahren und bereiteten sich auf ihre Wintersaison als Skilehrer vor. Jérôme. Kurz dachte sie an ihre Sommerliebe. Auch er war gegangen. Aber sie hatte bleiben wollen. Gegen etwas Mithilfe in Haus und Garten des Forsthauses hatte Philippe ihr angeboten, kostenfrei dort zu wohnen. Aber Philippe war ein Spinner mit seinen Bienen und seiner asketischen Lebensweise. Letztlich reduzierte sich die Mithilfe bei ihm auf einen Putzjob und sie hatte es bald sattgehabt. Pascal vom Bistro hatte ihr später ebenso gegen Mithilfe angeboten, umsonst bei ihm zu essen. Aber auch die Hilfe im Bistro war weniger spannend als erhofft und sie mochte es immer weniger, wie Pascal sie herumkommandierte.
Es war deutlich weniger amüsant auf der Insel nur mit Pascal und Philippe. Und langsam spürte sie auch die Enge. Inzwischen kannte sie jeden: René und Lionel, die Angestellten der Gemeinde, die den Müll abfuhren, sie kannte Jocelyne, Sévérine, Thomas und Patrick, die sich den Dienst im Museum teilten und sie kannte die immer gleichen Sprüche des alten Damien und der wenigen Menschen, die hier den Sommer über in den kleinen Häuschen lebten. Sie hatte die Ankunftszeiten der Fähren im Kopf, die jeden Tag Hunderte von Tagesausflüglern auf die Insel ausspuckten und jeden Tag sehnte sie noch mehr den dreimaligen Hupton der letzten Fähre herbei, mit der sie endlich alle wieder von der Insel verschwanden. Jeden Tag aufs Neue. Immer das Gleiche. Nein, sie konnte nicht bleiben. Manchmal wünschte sie auch, es würde sich etwas ändern. Das Herumziehen war anstrengend. Aber bislang hatte sie noch nicht gefunden, was sie suchte. Noch nicht.
Alice nahm hin und wieder einen Schluck Kaffee, rauchte und blies den Rauch aus dem Fensterspalt hinaus. Von hier konnte man normalerweise die Boote am Steg liegen sehen. Aber noch sah sie nur Regen und tief hängende Wolken. Der Tag begann zögerlich, es dauerte heute lange, bis sich der Nebel hob und die Umrisse der Boote sichtbar wurden. Sie sah erneut auf das Display ihres Mobiltelefons. Keine Nachricht. Aber die Zephyr lag noch genauso da wie gestern, ebenso die anderen drei Boote, die in den letzten Tagen angekommen waren. Nichts schien sich dort zu rühren. Die King II, eine klobige weiße Jacht, wartete seit zwei Tagen auf ein Ersatzteil und ihr Besitzer, ein bärtiger Muskelprotz mit schwerer Goldkette, brüllte deswegen ununterbrochen wütend in sein Mobiltelefon, während er die kleine Inselstraße auf und ab lief. Auf der kleinen Motorjacht schliefen die Brüder Michelet vermutlich ihren Rausch aus. Und auch auf der schicken Segeljacht Melodie der Familie aus der Schweiz rührte sich noch nichts.
Die Zephyr hatte gestern angelegt. Ein Zweimaster, eine 24-Meter-Ketsch, ein edles altes Holzsegelschiff von 1914, das James Longley 2001 zu einem lächerlich geringen Preis, aber in desolatem Zustand von einem Kanadier erworben hatte. Das Schiff war in seinem bewegten Leben durch die Hände mehrerer Eigner gegangen und immer wieder umgetauft worden. Longley hatte es für eine exorbitante Summe in jahrelanger Arbeit originalgetreu instand setzen lassen und ihm seinen ursprünglichen Namen zurückgegeben: Zephyr. Den Innenausbau hatte man deutlich und luxuriös modernisiert, immer darauf bedacht, den Stil des Schiffes nicht zu verändern. Die neu gestalteten Kabinen waren bis ins kleinste Detail durchdacht und verfügten jede über eine separate Nasszelle mit Bordtoilette. Nun konnte der alte Segler mit dem Komfort jeder modernen Segeljacht mithalten. Die betuchte englische Familie Longley, die ihre Sommer in einer Ferienresidenz im noblen Viertel La Californie in Cannes verbrachte, bediente sich ihrer hin und wieder, um einen Ausflug zu verborgenen Buchten zu machen. Nur selten gönnte sich James Longley das Vergnügen, mit einer angeheuerten Crew an einer Regatta teilzunehmen. Die meiste Zeit lag die stattliche Jacht nur im Hafen von Cannes. Eine Schande, dachte Jean-Louis Théolien, dass so ein fantastisches Schiff Menschen gehörte, die es nur für banale Bade- und Picknicktörns nutzten. Aber Ira Longley wurde schon bei der kleinsten Welle seekrank, sodass sie immer nur hinausfuhren, wenn der Wind gerade noch das Segeln zuließ. An einer Regatta hatten sie schon lange nicht mehr teilgenommen. Er würde mit der Zephyr die Welt umsegeln, aber die Zephyr war nicht sein Schiff, auch wenn er es nach all den Jahren, die er schon für die Longleys arbeitete, beinahe als seines betrachtete. Für dieses Jahr hatte Théolien seinen Dienst als Skipper beendet. Seine Auftraggeber waren gestern Morgen Richtung London zurückgeflogen. Théolien hatte sich und seiner Crew einen kurzen sportlichen Ausflug gönnen wollen, bevor er die Zephyr für eine kleine Revision nach La Ciotat zu einer Schiffswerft brachte. Aber der einsetzende Regen und Sturm hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht, sodass sie, um wenigstens das Ambiente zu wechseln, am äußersten Ende des Stegs der Insel Sainte-Marguerite angelegt hatten, dort, wo es gerade noch tief genug war für einen Segler seiner Klasse. Den Abend hatten sie im Bistro verbracht und mal wieder mehr getrunken, als ihnen guttat. Das dachte Théolien zumindest, der nur mühsam zu sich kam. Er drehte seinen muskulösen Körper mehrfach hin und her und stöhnte dabei. Er fühlte sich schwer und unbeweglich. Es kostete ihn einige Anstrengung, die Augenlider zu öffnen. Der Mund war trocken, sein Hals war rau, vermutlich hatte er wieder die ganze Nacht auf dem Rücken gelegen und geschnarcht. Er löste mühsam die Zunge, die ihm am Gaumen klebte, alles fühlte sich dick und klebrig an. Wir müssen los, dachte er, aber noch konnte er sich nicht regen. Langsam setzte er sich auf. Es kostete ihn Kraft und er atmete schwer. Du bist auch keine zwanzig mehr, Alter, dachte er und versuchte sich an den gestrigen Abend zu erinnern. Sie hatten erzählt, getrunken, gelacht, mit der Kleinen im Bistro gescherzt, Karten gespielt und immer wieder hatte einer eine Runde ausgegeben. Was sollte man auch sonst tun, im Regen auf der Insel? Die anderen Bootsbesitzer waren ebenfalls da. Die Männer zumindest. Nicht die Schweizer Familie, natürlich, denen war es wohl zu derb gewesen. Madame hatte mit ihrem Sohn in aller Eile gegessen und war bald wieder auf ihr Boot zurückgekehrt. Aber ihr Skipper war auch im Bistro gewesen. Alle hatten sie ein Auge auf die Kleine geworfen. Wen hatte sie wohl erhört? Er hatte irgendwann begriffen, dass er das Rennen nicht machen würde. Das Lächeln, das sie ihm schenkte, war nur eines, das sie allen Männern schenkte, wenn sie noch etwas zu trinken bestellten. Lächerlich war er sich plötzlich vorgekommen und irgendwann war er gegangen. Spät immerhin und er hatte ordentlich geladen. Die Scham, als er erkannte, dass er zu alt war für das Balzen um ein junges Mädchen, hatte ihn noch schnell den einen oder anderen Rum abkippen lassen. Er erinnerte sich nicht, wie er in seine Kabine gekommen war. Er versuchte aufzustehen. Oh, là, là. Er stöhnte. Zu viel getrunken hatte er. Das war sicher.
»Jungs, wir müssen los!«, rief er, aber seine Stimme hatte fast keine Kraft. Er räusperte sich und rief nun noch einmal lauter und mit rauer Stimme: »Heeho, ihr faulen Säcke, los raus, wir müssen los!«
Keine Antwort. Er tappte schwerfällig zur benachbarten Kabinentür und sein nackter Fuß stieß an einen metallischen Gegenstand, der daraufhin über den hölzernen Kabinenboden glitt. Er bückte sich mühsam, betrachtete ihn, hob ihn auf und steckte ihn in seine Hosentasche. Es war sein Talisman. Ein Amulett des Heiligen Nikolaus, das er immer bei sich trug. Hatte er es in der Nacht verloren? Warum? Er erinnerte sich wirklich an gar nichts mehr. Eieiei, stöhnte er leise. Der Tag nach einem Besäufnis ist nicht schön.
»Los Jungs! Wir müssen …«, rief er erneut, öffnete die Tür zur kleinen Kabine gegenüber und blieb überrascht stehen. Er zog die Augenbrauen hoch. Es war halb dunkel in der kleinen Crewkabine und es dauerte einen Moment, bis er begriff, was er sah. Er konnte nur einen der Jungs ausmachen, der quer auf der unteren Koje lag. Der andere wird bei Alice gelandet sein, dachte er und näherte sich dem noch schlafenden jungen Mann. »He, Lanvalle«, sagte er mit unsicherer Stimme. Der Mann war völlig angezogen. Er lag auf dem Bauch und hatte seinen Kopf im linken Arm verborgen. Théolien sah das blonde lockige Haar und erkannte seinen Fehler. »He, Frénet«, sagte er jetzt. Denn es war Sébastien Frénet, der auf Lanvalles Koje lag. Aber wo war Pierre Lanvalle? Die obere Koje war leer. War Lanvalle etwa schon an Deck? Aber Sébastien Frénet rührte sich immer noch nicht. »Du hast auch zu viel gesoffen, mein Guter, aber jetzt ist die Nacht rum, hopp, los.« Théolien war jetzt ungeduldig und machte zwei Schritte auf den schlafenden Mann zu, der sich nicht rührte und rüttelte ihn an der Schulter. Erschrocken hielt er inne und fluchte: »Merde, was ist das denn für ein Dreck?« Sein nackter Fuß war wieder gegen etwas gestoßen – diesmal war es kalt, fettig und glitschig, beinahe wäre er darauf ausgerutscht. Er betrachtete irritiert seinen Fuß, der voller Blut war und dachte verwundert, dass er sich geschnitten haben müsste, um derart zu bluten. Er verspürte dabei gar keinen Schmerz, aber er blutete stark, das Blut war überall, eine riesige Pfütze hatte sich in der Mitte des Raumes gesammelt, genau da, wo er jetzt stand. Dann begriff er und schrie nun den Namen des Mannes, während er gleichzeitig an ihm zog, um ihn umzudrehen: »Frénet, oh mein Gott, Frénet!« Der Körper des jungen Mannes war leblos und hatte bereits begonnen sich zu versteifen. In dem wenigen Morgenlicht, das durch das Bullauge fiel, sah er ein erschreckend weißes blutleeres Gesicht. Der Körper war kalt. Frénet hatte Blut am Kinn, es klebte in seinem Dreitagebart, am Hals, auf der Brust, überall Blut, sein hellblaues Poloshirt war über den Bauch hochgerutscht und getränkt von Blut. Théolien sah eine grässliche Wunde auf dem Bauch, aus der all das Blut geflossen war. Er starrte darauf und hatte es jetzt begriffen, endlich, Sébastien Frénet war tot.
Er wich zurück und fluchte. So etwas hatte ihm gerade noch gefehlt. »Lanvalle!«, brüllte er nun. »LANVALLE!« Aber niemand antwortete ihm. Wo war dieser Kerl abgeblieben? War er schon weg? Vermutlich war er gar nicht heimgekommen. Oder wie sonst sollte man es sich erklären, dass er aus der Kabine verschwunden war, ohne Alarm zu schlagen?
Théolien rief ihn dennoch immer und immer wieder mit einer Stimme, die sich beinahe überschlug, und riss wild die anderen Kabinentüren auf: »LANVALLE!« Schließlich gab er es auf. Er war allein mit dem Toten und hörte nur das regelmäßige Prasseln des Regens auf dem Deck. Er schwang sich den Niedergang hinauf und zog energisch die Luke auf. Er steckte den Kopf hinaus und schrie noch einmal nach Lanvalle, als ihm eine Regensalve entgegenpeitschte. Er taumelte zurück und hustete. Der Regen hatte ihn durchnässt, das Wasser troff von ihm bis hinunter zu seinen noch immer nackten, blutbesudelten Füßen. Das Blut von Frénet. Théolien wurde bewusst, dass er immer noch barfuß war. Trotzdem steckte er noch einmal den Kopf hinaus und warf einen Blick über das Deck, aber es war leer, entsetzlich nackt und leer, nur der Regen prasselte unablässig darauf.
In seiner Kabine trocknete er sich ab, riss die neongelbe Regenjacke vom Haken, nahm seine Stiefel in die Hand und noch während er den zweiten Arm in die Ärmel seiner Jacke steckte, war er wieder an Deck geklettert. Er rief nun nicht mehr nach Lanvalle und auch nach niemand anderem. Sein Gesicht war angespannt und sein Blick war dunkel. Zwei Männer hatte er bis gestern an Bord gehabt, nun war einer tot und der andere verschwunden. Und er, der Skipper und Verantwortliche, hatte währenddessen geschlafen, tief und fest geschlafen und nichts davon bemerkt, weil er sich besoffen hatte wie ein Idiot. Schöne Scheiße. Théolien zog seine Stiefel an, sprang mit einem Satz von Bord, lief über den Steg und suchte dabei am Ufer mit den Augen ein eventuelles Zeichen von Lanvalle. Im Bistro war Licht und er sah leichten Rauch aus dem Schornstein steigen. Vielleicht war er bei Alice geblieben? Von Weitem sah er die Silhouette eines Mannes, der aus dem Bistro kam. War es Lanvalle? Nein, er glaubte vielmehr die massige Figur des Besitzers der King II zu erkennen, der sich entfernte.
Pascal Moriani, der Wirt, stand trotz des Regens unbeweglich vor dem Eingangstor des Bistrogeländes und sah ihm schon von Weitem entgegen. Er rauchte einen seiner Zigarillos.
»Bonjour Käpt’n, na, wieder unter den Lebenden?«, grüßte er ironisch.
Théolien sah ihn finster an und antwortete nicht.
»Siehst aus, als sei dir ein Gespenst begegnet«, scherzte der Wirt nun, und fügte, als er den düsteren Blick des Skippers sah, ein fragendes »Alles klar, Käpt’n?« hinzu.
»Nichts ist klar. Ich wünschte, es wäre nur ein Gespenst gewesen.« Er krächzte es nur. Théoliens Stimme war vom vielen Schreien gebrochen.
In dürren Worten berichtete der Skipper dem Wirt von seinem grausigen Fund. Pascal Moriani hörte ihm schweigsam zu und verzog keine Miene. »Schöne Scheiße!«, war sein ganzer Kommentar. Er dachte nach. »Hast du die Polizei schon benachrichtigt?«, fragte er nun.
Théolien schüttelte stumm den Kopf. Er kam sich wie ein Idiot vor. Nicht einmal daran hatte er gedacht.
»Willst du, dass ich sie anrufe? Oder willst du …?« Der Wirt sah den Skipper fragend an.
Der schüttelte apathisch den Kopf. »Mach ruhig.«
So wurde die Polizei verständigt. Danach saß Théolien im Bistro am Tresen und schlürfte seinen Kaffee. Er hing seinen Gedanken nach. Wo war nur dieser Lanvalle abgeblieben?
»Alice ist wo?«, fragte er den Wirt des Bistros.
»Keine Ahnung. Sie verschwindet immer mal. Raucht oder telefoniert. Wird schon wieder auftauchen.«
Wie auf ein Zeichen öffnete Alice in diesem Moment die Tür, schob die Kapuze ihres Pullovers vom Kopf und schüttelte ihre dunklen kurzen Locken.
Théolien starrte sie an. Sie war blass und hatte tiefe Augenringe. Sie verstaute ein kleines Päckchen Tabak in ihrer Tasche, ging dann wie selbstverständlich hinter den Tresen und begann automatisch die herumstehenden Gläser und Tassen zu spülen.
Sie blickte zu Théolien. »Katerstimmung?«, fragte sie spöttisch.
Théolien sah sie stumm und eindringlich an.
»Stimmt was nicht?«, fragte sie jetzt und in ihr stieg eine leichte Nervosität auf.
Der Skipper blickte sie nur weiterhin stumm an. Alice sah unruhig von ihm zum Wirt. »Was ist los?«
»Alice …«, begann der Wirt langsam und brach dann ab.
Sie spürte, wie eine leichte Panik ihren Nacken hinaufkroch. »Wollt ihr mir vielleicht sagen, was los ist, verdammt noch mal?«
»Einer der Jungs von Théolien …«, ergriff der Wirt erneut das Wort, »nun … Théolien hat ihn in seiner Kabine gefunden … er ist tot.«
»Was?« Sämtliche Farbe war nun aus ihrem Gesicht gewichen. Sie atmete kaum noch und lehnte sich an die Wand. Ihre Augenlider flatterten. »Oh mein Gott, wie furchtbar, wie …« Sie stockte. Dann sah sie Théolien an. »Welcher ist es?«
»Frénet.«
»NEIN!« Sie schrie es. »Nein, nein, nein. Nein! Oh mein Gott, nein …«
»Beruhige dich, Alice.« Der Wirt versuchte sie in den Arm zu nehmen, aber sie wand sich heraus.
»Lass mich!«, zischte sie ihn an.
»Was ist passiert?«, fragte sie Théolien, ihre Stimme zitterte, sie suchte mit zitternden Händen nach dem Tabak, den sie gerade noch verstaut hatte.
Aber Théolien sagte immer noch nichts.
»Haben Sie ihn gefunden?«
Er nickte. Dann fragte er seinerseits. »War Lanvalle heute Nacht bei dir?«
»Geht Sie das was an?«, gab sie patzig zurück.
»Er ist verschwunden.«
»Ah.« Sie blickte düster vor sich hin und schien zu überlegen.
»Ich dachte, er sei vielleicht bei dir gewesen.«
»Nein. War er nicht.« Sie sah ihn offen an. »Ich will ihn sehen«, sagte sie dann in entschiedenem Ton.
Der Kapitän sah sie verständnislos an. »Lanvalle?«
Sie schnaubte. »Quatsch, Lanvalle, der ist mir egal. Sébastien natürlich. Ich will Sébastien sehen. Jetzt! Seid ihr überhaupt sicher, dass er tot ist?« Sie schaute die beiden Männer herausfordernd an. »Vielleicht ist er nur verletzt und bewusstlos, während ihr hier dumm herumsteht und schwafelt, vielleicht kann man noch etwas tun …«
»Der ist mausetot, Mädchen, mach dir keine Hoffnung, glaub mir, ich …« Théolien sprach nicht zu Ende.
»Ich will ihn trotzdem sehen, bitte!« Ihre Stimme bebte.
Théolien seufzte leise und zuckte die Achseln. »Wenn du dir das antun willst, Mädchen … na, meinetwegen.«
Zu dritt gingen sie los. Alice war bleich und zitterte. Der Wirt Pascal hielt fürsorglich einen alten Schirm, der an einer Seite schon abgeknickt war, über sie, aber sie schien es nicht einmal zu merken. Er kämpfte sich damit ab, den Schirm gegen den Wind zu stemmen. Urplötzlich drehte der Wind und nun musste er das Gestänge zusätzlich mit einer Hand festhalten.
»He«, rief eine laute Stimme. Es war der Schweizer, der mit seinem Skipper Dan auf dem Vordeck stand. »Bonjour, na, Mademoiselle hat wohl Geleitschutz?! Wohin geht’s denn so früh am Morgen bei dem Regen?«, scherzte er mit seinem schweizerischen Akzent. Niemand antwortete ihm. Fragend sah er seinen Skipper an, der den Kopf schüttelte. Beide beschlossen, dem merkwürdig stummen Grüppchen zu folgen. Es gesellten sich bald auch noch der alte Damien und der Muskelprotz der King II dazu. Und so kam es, dass sich trotz des Regens und der Wellen, die sich immer wieder schäumend über den Steg brachen, in kürzester Zeit ein Grüppchen Neugieriger am äußersten Ende des Stegs vor der Zephyr wiederfand. »Was ist wohl passiert?«, fragte man sich und sprach mit halblauter Stimme gegen den Wind an.
Théolien und Alice waren an Bord gegangen. Der Wirt folgte zögerlich. Der alte Damien machte Anstalten ebenfalls auf das Boot zu springen, aber der Skipper sah ihn nur grimmig an. Dies hier war sein Schiff und nur er entschied, wer es zu betreten hatte. Nur der Wirt stand mit auf Deck und hielt wieder den flatternden Schirm über Alice. Sie stand zwischen beiden Männern und es sah aus, als würden ihr die Beine wegsacken, als sie sich der Luke näherten.
»Bist du sicher, dass du dir das antun willst, Alice? Ich geh für dich runter, wenn du willst«, schlug Pascal Moriani ihr leise vor.
»Du wirst mir da unten nicht ohnmächtig, ist das klar?!«, herrschte der Skipper sie gleichzeitig an.
Sie schüttelte den Kopf. Ihre Beine zitterten, aber als hätten die Worte ihr Kraft verliehen, stieg sie nun mit Entschlossenheit die steilen Stufen des Niedergangs hinab.
»Was steht ihr hier rum und glotzt? Geht nach Hause! Der wird auch durch eure Anwesenheit nicht mehr lebendig«, rief Théolien den Männern unfreundlich zu. Aber keiner rührte sich vom Fleck. Auch Pascal blieb weiter auf dem Deck stehen und hielt den flatternden Schirm nun über sich. Théolien machte ein Geräusch, das seine Unzufriedenheit ausdrückte, und stieg dann ebenfalls hinab.
Alice stand vor der kleinen Kabine und sah hinein, der Regen troff von ihren Kleidern und hinterließ kleine Wasserpfützen, die sich mit dem Blut, das der Kapitän am frühen Morgen mit seinen nackten Füßen verteilt hatte, vermischte. Aber sie merkte es nicht. Sébastien war tot. Sie wusste es sogleich. Sie ging auf den leblosen Körper zu und berührte ihn vorsichtig am Hals, wo sich ihrer Meinung nach die Halsschlagader befand. Sie spürte nichts. Sie schluchzte auf. Sie strich ihm mit zärtlicher Geste sachte durch die blonden Locken und küsste dann ihre Fingerspitzen, mit denen sie anschließend seine bereits wächsern aussehende Wange berührte. Er sah schon so fremd aus.
Théolien, der vor der Tür gewartet hatte, räusperte sich. Sie schrak zusammen, verließ die Kabine und blieb mit hängendem Kopf vor ihm stehen. Er hob ihren Kopf an. Sie hatte Tränen in den Augen. Er hielt ihr Kinn mit Daumen und Zeigefinger fest.
»Was weißt du?«, herrschte er sie an.
Ihr Blick wurde dunkel und wütend. Sie antwortete nicht.
Der Skipper wiederholte seine Frage mit Nachdruck. »Was weißt du?« Er betonte jedes Wort.
Sie schüttelte seine Hand ab. »Gar nichts. Was soll ich denn wissen?« Sie funkelte ihn an.
»Hör mir gut zu, meine Kleine, mit mir machst du das nicht. Du weißt etwas und ich will wissen, was! Was ist heute Nacht passiert?« Sein Ton wurde drohend,
»Das weiß ich doch nicht! Ich war doch nicht hier. Sie haben doch nebenan geschlafen, oder? Sie müssten doch etwas wissen!«
»Lenk nicht ab. Was hattest du mit Frénet? Was mit Lanvalle? Weißt du, wo Lanvalle ist?«
»Gar nichts. Ich weiß nichts und ich weiß nicht, wo Lanvalle ist und ich hatte nichts mit niemandem, nichts … mit ihm!«, stieß sie hervor und zeigte auf Frénet. Noch nichts. Noch gar nichts, außer ein paar verlangenden Küssen und einer vagen Hoffnung auf ein übermütiges Glück, das es endlich auch für sie geben sollte, auf etwas, an das sie manchmal schon nicht mehr glauben konnte. Das aber behielt sie für sich.
»Wann sind sie gegangen?«
»Was weiß ich. Um Mitternacht, vielleicht später, keine Ahnung.«
»Sind sie zusammen gegangen?«
»Keine Ahnung. Ich führe doch kein Buch darüber, wer wann kommt, mit wem was trinkt und wieder geht.«
»Ich glaube dir kein Wort, Mädchen, ich empfehle dir …«
»Es reicht! Lassen Sie mich in Frieden!« Sie unterbrach ihn patzig. »Wie reden Sie überhaupt mit mir? Und hören Sie auf, mich zu duzen! Wer bin ich denn in Ihren Augen? Die kleine Thekenschlampe? Die jeder mal ins Bett ziehen kann? Ich hatte mit niemandem was, ist das klar? Ich vögele nicht mit jedem und es braucht schon etwas mehr, um mich zu beeindrucken als das eitle Gockelgehabe alternder Machos.«
Er wich einen Schritt zurück, verwundert über ihren Ausbruch. Und fühlte sich persönlich getroffen von ihren Worten. Ihm wurde heiß, als er sich daran erinnerte, wie er gestern im Bistro schwadroniert hatte – ein eitler alter Gockel war er in ihren Augen. Ihm wurde heiß vor Wut und Scham. »Hör mir gut zu, Mädchen …« Er sprach leise und drohend, aber dieses Mal unterbrach er sich selbst und folgte dem Blick Alices, die starr auf etwas blickte. In einer Ecke, auf dem Boden neben der Koje, auf der der tote Frénet lag, hatte sie etwas aufblitzen sehen. Sie machte einen Schritt darauf zu.
»Fass das nicht an! Nicht anfassen!«, brüllte er, aber es war schon zu spät.
Sie hatte es schon aufgehoben. Ihre Hand zitterte und sie hielt es weit von sich weg. Es war ein Messer, ein großes Taschenmesser, und es war voller Blut. Sie erkannte es sofort wieder. Die blutverschmierte Klinge mit den geschwungenen Linien aus Damaszenerstahl, der Handschutz aus Messing und der geschnitzte Griff aus Teakholz, der die Form eines nackten Frauenkörpers mit langem Haar hatte. Eine Art Meerjungfrau. War das die Mordwaffe? Sie hielt es ihm mit zitternder Hand entgegen.
»Ihr Messer, Kapitän, wenn ich mich recht entsinne?« Sie genoss trotz allem die Situation. »Sie haben es ja gestern lange genug herumgezeigt. Wie heißt sie noch, die Meerjungfrau? Thatis?«
Er korrigierte sie nicht. Zu verwirrt war er. »Ja, es ist mein Messer, aber du Idiotin hast es angefasst, bist du von allen guten Geistern verlassen?« Er nahm es ihr vorsichtig aus der Hand. »Hör zu Alice … ich …« Er versuchte sie am Arm festzuhalten.
»Lassen Sie mich los!« Sie riss sich los, drängte sich energisch an ihm vorbei, eilte durch den kleinen Salon und stieg behände den Niedergang hinauf.
Théolien hielt das Messer mit zwei Fingern, überlegte kurz und legte es dann vorsichtig in eine Schublade seiner Kabine. Dann stieg er ebenfalls nach oben. Aber als er auf Deck ankam, war das Mädchen schon von Bord gesprungen und eilte im Regen zum Bistro. Verdutzt sah der Wirt, der noch immer auf dem Deck stand, ihr nach und hielt nun geistesgegenwärtig den Schirm über den Skipper.
»Lass das!«, knurrte der ihn an.
Vom Kai aus hatten die anderen Männer zugesehen, wie Alice mit dem Kapitän unter Deck gegangen war. Auch die Brüder Michelet waren nun noch dazugekommen. In gedämpftem Ton tauschten sie ihre Ansichten aus.
Erst durch den Zuruf des wütenden Théolien hatten sie begriffen, dass etwas Schreckliches geschehen war. »Frénet ist tot«, hatte ihnen der Wirt auf ihre Fragen knapp bestätigt und eine drastische »abgemurkst«-Geste mit der Hand gemacht. Aber mehr war bislang nicht aus ihm herauszuholen.
Was für ein Schock. Zunächst schwiegen sie, aber dann redeten alle auf einmal. »Frénet tot!« Man musste es immer wieder sagen, um das Unfassbare zu verstehen. »Was ist wohl passiert?« – »Und wie?« – »Und warum war Alice unter Deck?«
»Frénet, war das der Blonde?«, fragte der Muskelprotz.
»Ja, der Blonde«, bestätigte Dan, der Skipper.
»Grauenhaft, wirklich grauenhaft ist das! Schien doch ein netter Kerl zu sein.« Das war der Schweizer.
»Gestern Abend war er noch so ausgelassen, er hat gelacht und gesungen – wer hätte gestern gedacht, dass er heute tot sein könnte.« Eric Michelet wiegte den Kopf.
»Und Théolien hat nebenan geschlafen und nichts davon mitgekriegt?« Sein Bruder war skeptisch.
»Mit so einem besoffenen Kopf? Der hatte ganz schön geladen. Ich bin mal nach einer Feier in einem fremden Bett gelandet und morgens lag da eine dralle Brünette neben mir – ich dachte, ich träume noch, aber nein, ich lag neben einer fremden Frau in einem fremden Bett und ich weiß bis heute nicht, wie ich da hingekommen bin. Und was nachts passiert ist, weiß ich auch nicht – aber ich fürchte, nicht viel, ich war zu nichts mehr fähig …« Der Muskelprotz zog eine Grimasse, die anderen lachten verhalten, aber angesichts des Geschehens ebbte die Heiterkeit gleich wieder ab.
»Der andere Kerl hat aber wohl auch nichts gehört«, warf der alte Damien trocken ein.
»Welcher andere Kerl?«, fragte Pat Michelet.
»Na, der zweite Maat, Lanvalle.«
»Ah oui«, Pat Michelet pfiff durch die Zähne, »wo ist der überhaupt? Hat den schon jemand gesehen?«
Die Männer blickten sich an. Einhellig schüttelten sie den Kopf. Nein. Niemand hatte Lanvalle gesehen.
»Na, das ist doch merkwürdig, oder?« Nun wurde einheitlich genickt. »Allerdings ist das merkwürdig.«
»Hat denn schon jemand die Polizei informiert?«, erkundigte sich nun der Schweizer.
Schulterzucken. Die Männer sahen sich an. Man einigte sich darauf, dass sicher schon jemand angerufen habe.
»Von wo kommen die? Aus Nizza?« Das war der Schweizer.
»Cannes, oder? Die Inseln gehören doch zu Cannes?«, vermutete Dan, der Skipper.
»Ja«, der alte Damien nickte bestätigend, »Cannes, natürlich Cannes.« Er sah hinaus aufs Meer. Aber bei dem diesigen Wetter konnte er nichts ausmachen. Er sah auf die Uhr. Die nächste Fähre käme erst in einer Viertelstunde, und wer wusste schon, ob da bereits jemand von der Polizei mitkam. »Lasst uns ins Bistro gehen. Hat ja keinen Sinn hier noch länger im Regen herumzustehen«, schlug er vor.
»Und davon wird der Junge auch nicht mehr lebendig.«
»So was.« Der Schweizer schüttelte immer wieder den Kopf. »Unfassbar.«
»Hast du gesehen, Alice war ganz mitgenommen.« Eric Michelet sah seinen Bruder an.
»Hab’ ich bemerkt«, knurrte Pat Michelet.
»Ich denke, die hatten was miteinander«, vermutete der bullige Mann.
»So schnell?« Eric Michelet schien erstaunt.
»Naja, Liebe auf den ersten Blick, schon mal gehört?« Pat Michelet war spöttisch.
»Kommt, wir gehen was trinken«, insistierte der alte Damien. »Ich persönlich mag nicht mehr hier herumstehen. Bin total durchnässt und durchgefroren.«
So lief das Grüppchen Männer, alle in der gleichen Haltung, leicht vorgebeugt, Regen und Wind trotzend, zum Bistro. Natürlich war es für den Apéro noch zu früh, aber wer wollte das heute schon so genau nehmen? Ein Gläschen Roten oder ein pousse-café gegen die feuchte Kälte und den Schock könnten nicht schaden.
Alice stand am halb offenen Fenster und rauchte schon wieder. Als die Männer hereinkamen, nahm sie einen letzten Zug, blies den Rauch hinaus, drückte die Zigarette aus und schloss das Fenster. Dann fand sie sich hinter der Theke ein. Ihre Augen waren gerötet und sie war blass. Die Ringe unter ihren Augen schienen noch dunkler zu sein.
»Bring uns doch mal was zu trinken, Alice, ich glaube, das können wir jetzt alle gebrauchen«, sagte der alte Damien, lehnte sich an den Tresen und sah sich nach Zustimmung suchend um. Die Brüder Michelet hatten geräuschvoll zwei Tische zusammengeschoben und zogen nun die Stühle hin und her. Dann setzten sie sich.
»Was wollt ihr denn? Pastis?« Alice sah die Männer fragend an.
»Vielleicht noch ein bisschen früh für Pastis«, meinte Damien. Er wandte sich an die Männer im Bistro. »Was wollt ihr trinken? Die Runde geht auf mich.«
»Bravo, gute Initiative, also ich nehme dann einen Whisky.« Der Muskelprotz war schnell entschieden.
»Nur einen Kaffee für mich, aber einen verlängerten«, bat der Schweizer.
»Kaffee«, orderten auch die Brüder Michelet wie aus einem Mund.
»Und du?« Damien sah den Skipper der Schweizer an. »Eine Cola bitte.«
»Eine Cola.« Gedehnt wiederholte Damien die Bestellung und sah den Skipper spöttisch an. »Willst du vielleicht einen Schuss Whisky in deine Cola?« Der Skipper warf Damien einen unfreundlichen Blick zu und schüttelte stumm den Kopf. »Nun gut«, Damien wandte sich an Alice. »Und einen Café-Calva für mich«, bestellte Damien. »Hast du das alles, Alice?«, fragte er. Sie nickte.
»Und was trinkst du, Mädchen?«, fragte er sie freundlich.
»Ach, ein Café-Calva ist vielleicht keine schlechte Idee«, sagte sie leise und wagte ein kleines Lächeln.
»Braves Mädchen«, sagte Damien und tätschelte ihr väterlich die Hand. »Trink was, das wird dir guttun.«
Am Tisch hatte Eric Michelet begonnen, Spielkarten zu mischen. »Wer spielt?«, fragte er nun.
Sein Bruder sah ihn an und schüttelte den Kopf. »Ich glaub’, das ist jetzt nicht der Moment, Eric.«
»Nein?« Eric war überrascht. Er sah in die Runde. Tatsächlich, niemand schien spielen zu wollen. »Na, dann nicht.« Resigniert steckte er die Karten wieder ein.
Alice servierte die Getränke, während die Männer sich erneut über das Geschehene austauschten. Es war so unglaublich und unbegreiflich, man musste es einfach immer wieder erzählen.
Die Tür ging auf, es war Pascal, der Wirt, der nun düster blickend eintrat. Er schüttelte das Regenschirmgerippe aus und stellte es in einen Plastikeimer neben der Tür.
»Wo ist wohl Lanvalle abgeblieben?«, hörte Alice einen der Männer sagen. Sie zuckte zusammen. Ja, wo war eigentlich dieser Lanvalle? So sehr ihr Sébastien auf Anhieb gefallen hatte, so wenig hatte sie Lanvalle gemocht. Sie erinnerte sich nicht mal mehr an seinen Vornamen. Wie hieß er noch? Pierre. Genau. Pierre Lanvalle. Warum konnte eigentlich nicht dieser Lanvalle tot sein, anstelle von Sébastien?
Hatte Lanvalle Sébastien getötet? Das mutmaßte jetzt einer der Männer, der goldkettenbehängte Muskelprotz, der Besitzer der King II, der sein Glas Whisky stehend am Tresen trank. Und ohne dass sie es wollte, hatte Alice ein kleines Lächeln im Gesicht. Ein kleines böses Lächeln. Denn immerhin wusste sie etwas, was die anderen nicht wussten. Sie hatte das Messer gefunden. Kurz überlegte sie, ob sie es wie nebenbei beim Spülen sagen würde: »Sébastien Frénet wurde mit dem Messer von Théolien getötet! Erinnert ihr euch? Das Messer, das er uns gestern noch so angeberisch gezeigt hat.« Hier würde sie kurz hochschauen, nur um zu prüfen, wie ihre Worte ankamen. »Mit dem Griff, der den Körper dieser Meeresgöttin symbolisiert, Thais, oder wie sie hieß …« Spätestens jetzt wären alle stumm. Ihr Herz begann zu flattern, ihre Hände zitterten, als sie ein weiteres Glas ins Spülwasser senkte. Sie wagte es dann doch nicht. Es reichte, wenn sie es später der Polizei sagte.
Pascal stellte sich neben sie und goss sich einen Calvados ein. »Schlimmer Anblick?«, fragte er sie leise.
Sie nickte fast unmerklich.
»Hat man ihn …«, er zögerte, »ich meine, konntest du sehen, wie …« Er brachte den Satz nicht zu Ende.
»Erstochen«, sagte sie trocken, ohne das Gläserspülen zu unterbrechen.
»Erstochen? Bist du sicher?«
Na, wenn sie sich einer Sache sicher war, dann dieser. Sie nickte. Dann platzte es doch aus ihr heraus. »Ich habe das Messer gefunden.«
»Du hast was?!« Pascal sah sie an, als habe sie den Verstand verloren.
»Das Messer. Ich habe das Messer gefunden, es lag neben der Koje und es war voller Blut.«
Jetzt hörten auch die anderen Männer zu. Perplex und sprachlos starrten sie sie an, als sie erzählte, wie sie das Messer des Skippers gefunden hatte. »Das Messer mit dem Frauenkörper, das er gestern noch herumgezeigt hatte, ihr erinnert euch doch?« Sie dachte daran, wie anzüglich Théolien die Brüste der Frauenfigur vor ihren Augen gerieben hatte. Und wie das Messer dann von Hand zu Hand gegangen war. Die Männer nickten, natürlich erinnerten sie sich an dieses Messer.
»Schönes Messer«, befand Damien. Die anderen Männer murmelten zustimmend.
»Pfh.« Alice schnaubte verächtlich.
»Es ist keine Frauenfigur, es ist die Göttin des Wassers«, ergänzte der Wirt etwas oberlehrerhaft, »und sie heißt Téthys.«
»Téthys!« Alice wurde wütend. »So ein Schwachsinn, dieses Messer ist …« Alice verstummte. »Eine reine Wichsvorlage«, wollte sie sagen, aber sie entschied sich dagegen. »Es ist sein Messer«, sagte sie stattdessen.
»Es ist sicher sein Messer, aber bist du sicher, dass der Junge damit erstochen worden ist?«
»Es war ganz voller Blut.«
Im Bistro herrschte Schweigen. Was hätte man auch noch sagen sollen. Oder fragen. Angesichts dessen, was Alice erzählt hatte. Jeder hing seinen Gedanken nach und überlegte, ob …
Plötzlich öffnete sich die Tür. Alle Köpfe wandten sich dem Eingang zu. Die Polizei? Nein, es war Théolien. Das Schweigen wurde nun frostig, geradezu tödlich. Théolien war vollkommen durchnässt und blieb unschlüssig in der offenen Tür stehen, als spüre er die Feindseligkeit, die ihm entgegenschlug, während sich unter ihm sofort eine kleine Pfütze bildete.
»Salut!«, sagte er rau und hob kurz die Hand zum Gruß. Ein unruhiges Gemurmel und Geräusper antwortete ihm. Jemand scharrte mit dem Stuhl. »Re-Salut, um genau zu sein«, versuchte er zu scherzen.
Der Wirt fasste sich als Erster. »Komm rein und mach vor allem die Tür zu, sonst geht die ganze Wärme raus«, sagte er autoritär. »Was trinkst du?«, setzte er nach. »Einen Roten?«
Théolien schloss die Tür und machte unentschlossen einen Schritt Richtung Theke. Alice blickte nicht auf und schien ganz in das Gläserspülen vertieft zu sein. »Nein«, Théolien winkte ab, »keinen Alkohol. Eine Cola vielleicht. Oder etwas Warmes, einen Tee.«
»Was also?«
»Einen Tee, mach mir einen Tee mit einer Scheibe Zitrone, wenn du hast.«
»Keinen Grog?«
»Nein, nein, ich sage doch, keinen Alkohol. Mir reicht’s noch von gestern.«
»Alice, einen Tee mit Zitrone!« Die Stimme des Wirts klang befehlend.
Alice verzog keine Miene und stellte wortlos eine große Henkeltasse auf den Tresen. Sie ließ das heiße Wasser aus der Dampfdüse in eine kleine Teekanne schießen und legte einen Teebeutel und ein Stück Zucker neben die Tasse. Dann schob sie dem Skipper alles hin. »Zitrone is’ nich’«, murmelte sie und vermied seinen Blick. Sie dachte an Sébastien Frénet. Das Bild, wie er dort auf seiner Koje gelegen hatte, würde sie so bald wohl nicht vergessen. Ganz voller Blut, das in seinem Gesicht schon angetrocknet war, mit dem verzerrten Mund und den großen offenen Augen, die Richtung Bullauge starrten, gerade so, als würde er dem prasselnden Regen zusehen. Gestern Abend noch hatte er sie mit diesen Augen angesehen. Mit einem Blick … ihr wurde noch immer heiß, wenn sie daran dachte. »Sébastien.« Sie hatte es fast unhörbar geflüstert, während sie die Hände erneut in das Spülwasser senkte. Sie musste seinen Namen aussprechen. Sie klapperte laut mit den Gläsern. »Sébastien, Sébastien«, wiederholte sie leise und voller Zärtlichkeit. Wohin jetzt mit all dieser Sehnsucht? Ihre Augen füllten sich mit Tränen.
Théolien war am Tresen stehen geblieben und rührte stumm den Zucker in den Tee. Er schien abwesend, sorgenvoll und müde. Dann plötzlich hob er den Kopf und sagte: »Die Polizei ist angekommen. Wir müssen alle bis auf Weiteres hierbleiben.«
»Wie?« – »Was?«, fragten der Besitzer der King II und die Brüder Michelet zeitgleich. »Hier im Bistro?«
»Ob im Bistro oder anderswo. Hier auf der Insel«, präzisierte Théolien.
»Und wie lange?«
Der Muskelprotz polterte sofort los: »Wie stellen die sich das vor? Ich habe noch was anderes zu tun, und wenn heute endlich dieses Ersatzteil kommt, dann bin ich weg!«
»Das ist nicht von mir, das haben die Flics so entschieden«, verteidigte sich der Skipper.
»Und was haben sie sonst noch gesagt?«
»Nicht viel. Sie fangen gerade erst an.« Er fuhr sich durch die Haare. War er nervös? »Aber ich habe keine Wahl, mich lassen sie sowieso nicht weg. Und solange Lanvalle noch verschwunden ist …«
Ah oui, Lanvalle. Wo war der nur abgeblieben?
»Man hat ihn also nicht gefunden?«, fragte nun der alte Damien.
»Bis jetzt nicht«, gab Théolien zurück.
»Und auch sonst nichts? Kein Indiz? Kein Zeichen?« Alice sah Damien befremdet an. Worauf wollte er hinaus?
»Hm, naja … sie haben mein Messer beschlagnahmt«, sagte der Skipper nun mit rauer Stimme.
Mit dieser Eröffnung hatte niemand gerechnet. Schon gar nicht Alice. »DAS haben Sie ihnen gezeigt? Ihnen gesagt, meine ich, also …« Sie verstummte.
»Warum hätte ich es ihnen nicht sagen sollen? Und warum hätte ich ihnen denn nicht mein Messer zeigen sollen?« Er sah Alice prüfend an und warf einen Blick auf die Männer, die ihn nun mit einem gewissen Respekt ansahen. »Du hast es allen brühwarm erzählt, was?«
Er lachte kurz auf und trank einen Schluck Tee. »Sicher, ich hab den Flics alles erzählt. Dass du das Messer gefunden hast, dass es voller Blut war. Zu meinem Ärger haben sie es mir weggenommen.« Er schüttelte den Kopf. »Naja, war ja nicht anders zu erwarten, aber ich hoffe, ich kriege es zurück, ich hänge sehr dran – na, warten wir’s ab.« Er blickte prüfend in die Runde. »O. k., Männer, ich geb’ einen aus.« Mit einem Blick auf die Kaffeetassen, die Alice gerade einsammelte, fügte er hinzu: »Was immer ihr wollt, kann auch ein Tee sein … Zum Wohl allerseits! Auf das Leben … und auf den Tod!«
2
Schon lange wollte Duval den Inseln vor Cannes einen Besuch abstatten, aber er hätte sich gewünscht, dass es nicht gerade an einem absolut verregneten Tag stattfände, bei dem die Fähre zudem noch mit böigem Wind und entsprechendem Wellengang zu kämpfen hatte. Der Bug des kleinen Fährschiffs hob und senkte sich und die Wellen klatschten hart an die Fenster. Ihm war schlecht und er war angespannt. Sein Magen hob und senkte sich im Rhythmus der Fähre und er wusste nicht, ob er weiterhin im Inneren der Fähre ausharren sollte: In der Mitte des Bootes sei von den Schlingerbewegungen am wenigsten zu spüren, hieß es immer, oder ob er sich für alle Fälle vorsichtshalber Richtung Heck bewegen sollte. Auch wenn er sich keinesfalls übergeben wollte. Er hoffte inständig, dass auch kein anderer sich übergeben müsste. Schon die Vorstellung davon ließ ihn würgen. Der Schiffsmotor unter seinen Füßen stampfte, dröhnte und vibrierte. Obwohl die Fähre halb offen war, roch es im Inneren leicht nach Diesel. Das machte die Sache nicht besser. Er sah sich nach Villiers um. »Leiche am Morgen bringt Kummer und Sorgen«, hatte Villiers vorhin noch gescherzt und mit den Fährleuten gelacht. Dass er nun ganz gegen seine Gewohnheit weder sprach noch Witze riss, konnte nur bedeuten, dass auch er mit Übelkeit zu kämpfen hatte. Jawohl, auch Villiers starrte nur stur geradeaus und Duval fand ihn etwas blass im ansonsten kaffeebraunen Teint. Duval betrachtete ihn argwöhnisch. Er hoffte inständig, dass Villiers sich nicht übergeben würde. Er selbst konnte sich nicht übergeben. Er wusste selbst nicht, warum. Als Kind, wenn er zu viel gegessen hatte, hatte er manchmal stundenlang auf den kühlen Fliesen des Badezimmerbodens gelegen und wimmernd und stöhnend darauf gewartet, dass die Übelkeit nachlassen würde. Keinesfalls konnte er den Kopf über die Toilettenschüssel beugen und sich erleichtern, so wie andere es taten. Allein die Vorstellung vom Erbrechen war ihm so zuwider, dass er sofort würgen musste, aber erbrechen konnte er sich nicht. Tapfer ertrug er die Übelkeit beim Autofahren und hielt stets eine Hand in den Fahrtwind und drückte die Stirn an die kühle Scheibe. Ihm wurde auch aus anderen Gründen schnell übel, so ekelte er sich vor allem Schleimigen, vor Exkrementen und deren Geruch. Er ging mit dieser Empfindlichkeit vor allem seinem Vater auf die Nerven, der ihn wiederholt in den Ferien auf einen Bauernhof geschickt hatte: Der Umgang mit Kühen und Schweinen, ihr Geruch und vor allem der Anblick und Geruch ihrer Exkremente sollten ihn wohl abhärten. Vielleicht war es sogar gelungen, er hatte den Anblick der Kuhfladen und ihren Geruch mit Todesverachtung durchgestanden, aber es war vor allem der säuerliche Geruch des Silofutters, der ihm auf dem Hof zu schaffen gemacht hatte. Er hatte ihm jedes Mal so auf den Magen geschlagen, dass er während des gesamten Aufenthaltes so gut wie nichts essen konnte. Duval verzog angewidert das Gesicht, als er daran dachte. Er warf erneut einen Blick zu Villiers. Er war blass und schweigsam, sah aber nicht aus, als würde er sich gleich über die Reling hängen, um die Fische zu füttern. Diese Ausdrücke auch. Duval würgte es erneut.
Commandant Noah Villiers hatte seine Hautfarbe und seine Unbeschwertheit von seiner Mutter geerbt, einer kleinen fröhlichen und rundlichen Réunionnaise. Dass er Polizist geworden war, lag am Einfluss seines Vaters, eines Angehörigen des französischen Militärs, das auf der Insel La Réunion stationiert war.
Duval streifte mit einem prüfenden Blick die ältere Dame, einziger Passagier neben ihm und Villiers auf der kleinen Fähre. Die PTS, die Police Téchnique et Scientifique, und der Gerichtsmediziner waren schon vor Ort. Der Dame schienen die Schlingerbewegungen der Fähre ebenso wenig auszumachen wie der Besatzung. Sie schrie vielmehr gegen den Lärm des Bootes an, um sich mit einem Mann der Besatzung zu unterhalten. Sie hatte einen Trolley bei sich, vermutlich hatte sie Einkäufe auf dem Festland gemacht.
Die Fähre pflügte unbeirrt durch die Wellen, die noch höher geworden waren, seit sie aus der Bucht von Cannes aufs offene Meer gelangt waren. Duval sah stumm geradeaus. »Die Bewegungen des Schiffes vorwegnehmen«, hatte er irgendwo gelesen, aber, so fürchtete er, wenn er jetzt versuchte sich »mit wiegenden und federnden Schritten« zu bewegen, würde er genauso rhythmisch seinen Mageninhalt von sich geben. Vielleicht hätte er weniger Kaffee trinken sollen. Das Schiff rollte wieder heftig und Duval schoss bitterer Magensaft in den Mundraum. Er krampfte sich an der Bank fest, schluckte und schloss die Augen, nur um sie sofort wieder zu öffnen. Schweiß brach ihm aus. Angestrengt starrte er vor sich hin. »Konzentrier dich, konzentrier dich. Ganz ruhig!«, befahl er sich. »Atmen. Einatmen, ausatmen.« Es musste ja gleich vorbei sein. Die Inseln lagen nur wenige Kilometer vor Cannes. Eine Viertelstunde dauerte die Fahrt normalerweise, und trotz des widrigen Wetters wäre die Fähre auch heute nicht länger als zwanzig Minuten unterwegs, wie ihm die freundliche Kassiererin in ihrem kleinen Kassenhäuschen versicherte, als sie ihm seine Fahrkarte ausdruckte. Hatte sie ihm die Seekrankheit schon angesehen? Woher hatte er das? Auch Matteo, seinem Sohn, wurde beim Autofahren jedes Mal und fast sofort in der ersten Kurve schlecht. Anders als ihm gelang es seinem Sohn aber, selbst in die kleinste Papiertüte zu spucken, die man ihm in aller Eile hinhielt. Die Hélène ihm hinhielt wohlgemerkt, denn Duval sprang jedes Mal panisch aus dem Auto. Weder das Geräusch noch den Geruch konnte er ertragen. Und danach konnte er nur mit weit geöffnetem Fenster weiterfahren und sah das blasse Gesichtchen seines Sohnes gequält durch den Rückspiegel an. Hélène war abwechselnd wütend oder sie schämte sich für ihn. Niemals konnte sie vergessen, dass er Matteo als Baby angeekelt beinahe fallen gelassen hatte, als dieser auf seiner Schulter einen feuchtwarmen Rülpser geblubbert hatte. Duval hatte es auch nie vergessen und er schämte sich dafür. Aber er wusste einfach nicht, wie er den Ekel abstellen sollte. »Du hast eine Emetophobie«, hatte Hélène ihm eines Tages erklärt, und ihm eine Internetseite gezeigt, wo diese seltene Störung erklärt wurde. Er zuckte die Achseln. Jetzt hatte sein Verhalten einen Namen. Na und? Tatsächlich kamen ihm die beschriebenen Symptome bekannt vor, aber er war weder magersüchtig noch depressiv, auch schränkte er weder sein Essverhalten und sein Leben besonders ein, fand er. »Du könntest mit einem Therapeuten die Ursache suchen, dann löst sich diese Phobie vielleicht!«, hatte Hélène mehr als einmal genervt gefordert, die fand, dass er seine Kinder mit seiner Phobie anstecke und zu übertriebener Reinlichkeit anhielt. Mit abgewandtem Kopf reichte er ihnen demonstrativ ein Taschentuch, wenn sie schniefend die Nase hochzogen oder ihnen Rotz aus der Nase lief. »Es schadet ihnen nicht, rechtzeitig ein Taschentuch zu benutzen anstatt Nasenpopel zu Kügelchen zu rollen und irgendwohin zu schnippen!«, insistierte Duval streng und damit war das Thema für ihn erledigt. Und einen Psychiater würde er deswegen schon gar nicht aufsuchen. Er hatte sich im Laufe der Jahre mit diesem Ekel arrangiert. Er versuchte allerdings Situationen, in denen es ihm oder anderen schlecht werden konnte, weitestgehend zu meiden, was nicht eben leicht war, vor allem nicht in seinem Job. Aber alles ging, solange er die Kontrolle über die Situation behielt. So ertrug er es durchaus, einen verwesenden Körper zu sehen, überraschend über das Erbrochene eines Betrunkenen zu stolpern aber war grenzwertig. Duval würgte allein beim Gedanken daran und zwang sich an etwas anderes zu denken. »Konzentrier dich, konzentrier dich. Einatmen, ausatmen.« Die zwanzig Minuten kamen ihm unendlich lang vor. Ohne den Kopf zu drehen, versuchte Duval aus den Seitenfenstern zu erspähen, wie weit sie noch von der Insel Sainte-Marguerite entfernt waren, aber die ungestümen Wellen vor dem hüpfenden Horizont ließen ihn schwindlig werden. Er stöhnte leise, und um sich abzulenken, memorierte er das, was er von den Inseln wusste.
Sainte-Marguerite und Saint-Honorat hießen die beiden kleinen Inselchen vor Cannes, die im 6. Jahrhundert zu Ligurien gehörten und damals die Namen Lero und Lerina trugen, weshalb sie bis heute auch als die Îles de Lérins bekannt sind. Saint-Honorat, die kleinere von beiden, lag von Cannes kommend versteckt hinter Sainte-Marguerite und wurde von der Abbaye de Lérins, einem Zisterzienserkloster, dominiert, in dem eine Handvoll Mönche abgeschieden lebte, die, über die Grenzen Südfrankreichs hinaus bekannte Weine und Liköre produzierten. Das Boot rollte erneut heftig und Duval verbot sich sogleich an Essen und Trinken zu denken. Er wandte sich gedanklich der ungleich kriegerischeren Geschichte von Sainte-Marguerite zu, deren mächtige Festung bis ins 19. Jahrhundert auch als Gefängnis genutzt worden war. Der berühmteste Gefangene war sicherlich der »Mann mit der Eisenmaske«, der mehr als elf Jahre hier in einer Zelle gedarbt hatte. Seine Identität war niemals preisgegeben worden, ebenso wenig der Grund, der dazu geführt hatte, dass Ludwig XIV. ihn hier hatte einsperren lassen. Legenden ranken sich bis heute um diese Gestalt. Hatte der absolutistische König sich in einem Willkürakt seines Zwillingsbruders entledigt und so seine Macht gesichert?
Die Fähre verlangsamte ihre Fahrt und Duval atmete auf. Er wagte erneut einen Blick Richtung Insel. Dunkel erstreckte sich der ausladende Pinienwald vor ihm, der die gesamte Insel bedeckte. Links erhob sich majestätisch das alte Fort. Direkt vor ihm lagen aneinandergeschmiegt ein paar winzige Fischerhäuschen und zwei Anlegestege.
Der Kapitän drosselte den Motor und die Fähre schaukelte nun zusätzlich von rechts nach links, bis sie stotternd anlegte. Duval versuchte aufzustehen, seine Beine fühlten sich taub an und er stützte sich ab. Herrgott, war ihm schlecht. Er schwankte langsam zum Ausgang und atmete auf, als er die frische kühle Luft spürte. »Die letzte Fähre geht heute um 17 Uhr!«, sagte ihm eindringlich einer der Männer der Fähre. »Und passen Sie auf, wenn Sie hier entlanggehen, die Wellen überspülen hin und wieder den Steg!« Duval nickte, aber er wollte keinesfalls schon an die Rückfahrt denken. Noch rumorte sein Magen. Wie benommen stand er auf dem Anlegesteg und atmete durch, während der kalte Regen auf seinen Kopf trommelte. Er spürte es nicht. Die alte Dame hatte sich in ein Regencape gehüllt und zog nun tapfer ihren Trolley über den Steg. An dessen Ende wurde sie von einem älteren Mann in Empfang genommen. Villiers hatte die Kapuze seines Sweatshirts über den neuerdings fast kahl rasierten Kopf gezogen und sprintete nun bereits los. Duval sah sich um. Am Nachbarsteg lagen vier Boote: ein beeindruckendes zweimastiges Holzsegelschiff, eine klassische weiße Segeljacht, eine protzige, breite Motorjacht und ein kleineres Motorboot, das wild in den Wellen schaukelte. Gelbes Absperrband flatterte im Wind, das den Zugang zu dem Holzsegler provisorisch versperrte. Regen klatschte Duval ins Gesicht. Ein paar Möwen kreischten wild, als sie sich lustvoll in den böigen Wind warfen. Dann versetzte ihm eine Regenbö einen Schlag, sodass er einen kurzen Satz nach vorne machte. Was für ein ungemütliches Wetter. Eilig lief er los. Zurückfahren würde er erst, wenn die See wieder ruhig war, so viel war sicher.
»Bonjour, Monsieur le Commissaire.« Yves Dermez, einer der Polizeitechniker, gab Duval die Hand und hielt mit der anderen einen flatternden Schirm fest. »Gut hergekommen? Was für ein Wetter! Wir sind noch nicht fertig, wollen Sie den Tatort sehen?«
Eigentlich wollte Duval immer sofort den Tatort sehen. Aber im Augenblick wollte er vor allem vermeiden, sich gleich wieder auf ein schaukelndes Schiff zu begeben. Er schüttelte den Kopf. »Später«, sagte er.
Yves Dermez verstand. »Die Überfahrt war kein Vergnügen, was?« Er zog eine Grimasse.
Duval machte eine vage Kopfbewegung. Er hatte keine Lust, seine persönliche Leidensgeschichte auszubreiten. »Also?«, fragte er stattdessen. »Was gibt’s?«
»Ziemliches Massaker.« Der Polizeitechniker sprach laut gegen den Wind und das rauschende Meer an, während er den Schirm gegen den Wind hielt. »Blut überall. Alles sieht nach einer gewalttätigen Auseinandersetzung aus. Leider sind der Skipper, der die Leiche entdeckt hat und eine junge Frau aus dem Bistro«, der Polizist machte eine Kopfbewegung Richtung Inseldorf, »mehrfach durch das Schiff und die Kabine gelaufen und natürlich auch klitschnass mitten durch die Blutlache. Die Spuren sind futsch.«
Duval verdrehte die Augen. »Warum das denn? Das weiß doch inzwischen jedes Kind, dass man den Tatort nicht betreten soll, oder?«
»Die junge Frau wollte den Toten wohl unbedingt sehen. Er war ihr Freund oder Liebhaber, was weiß ich. Glücklicherweise sind nicht alle anderen aus dem Dorf auch noch neugierig hinterhergelaufen. Hatten wir auch alles schon.« Er verzog ironisch das Gesicht. »Wir haben das hier vom Skipper der Zephyr bekommen.« Der Techniker hielt dem Kommissar das Messer in einer Plastiktüte entgegen. »Vermutlich die Tatwaffe.«
»Ah bon?« Duval zog die Augenbrauen hoch.