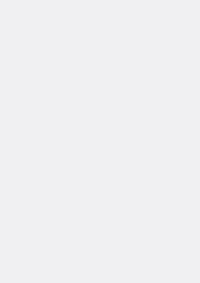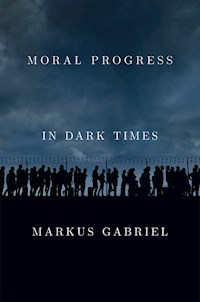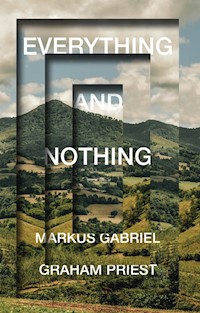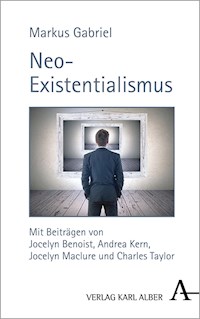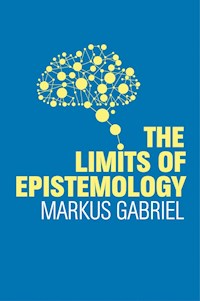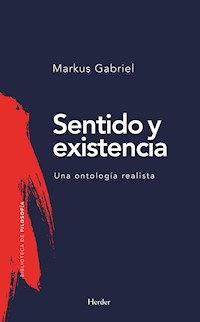Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Edition Körber
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Ein gutes Leben, das Richtige tun: Wie kann das gelingen? Gert Scobel und Markus Gabriel entwerfen eine neue Ethik, auf die wir – als Einzelne, als Gesellschaft und als Staat – unser Handeln auch in Krisenzeiten aufbauen können. Zwischen Gut und Böse liegen unzählige Möglichkeiten. Entsprechend weit spannen die beiden Philosophen ihre Gedanken: Anknüpfend an Traditionen der guten Lebenspraxis, an abendländische und asiatische Denkwege gehen sie der Frage nach, wie wir in einem komplexen Leben mit begrenzter Erkenntnis gute Entscheidungen treffen können. Im Dialog entwickeln Gabriel und Scobel das Prinzip der "radikalen Mitte", in der sich unser Wissen, Denken, Fühlen, unsere Werte und Erfahrungen in einer Entscheidung und zugleich im Handeln verdichten. Werden wir uns dieser Mitte bewusst und kultivieren sie, erkennen wir in ihr die Wirklichkeit, aber auch den gewaltigen Raum der Möglichkeiten: und dazwischen uns selbst. In dieser Mitte, davon sind Markus Gabriel und Gert Scobel überzeugt, ist das Gute immer eine reale Option.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 306
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Markus Gabriel | Gert Scobel
ZWISCHEN GUT UND BÖSE
Philosophie der radikalen Mitte
Inhalt
Vorwort
Aporie
Anfangen
Unterscheiden
Das Gute
Dazwischen
Sensus communis
Moralischer Fortschritt
Das Studien-Problem
Das Tugendhat-Problem
Unmoralische Küche
Maß und Mitte
Antinomie
Kapuzineräffchen
Differenz ohne Normen?
Moral Machine
Die stalinistische Strategie
Datensouveränität
Historizität und Normativität
Perspektivwechsel
Spielräume und Fiktionen
An-Archie
Tugend
Menschlichkeit?
Gut und Böse
Gleichgültigkeit
Die Radikalität der Mitte
Weisheit der leeren Mitte
Räume dazwischen
Die Wirklichkeit
Komplexität und Nichtwissen
Auswege finden
Die Praxis der radikalen Mitte
Anmerkungen
Über die Autoren
»Thoughts don’t come from ›within‹; neither do they come from ›without‹. They emerge ›between‹.« BAYO AKOMOLAFE, »THESE WILDS BEYOND OUR FENCES«
Vorwort
Denken, darin waren und sind sich Philosophinnen1 von Platon bis Hannah Arendt einig, geschieht als Dialog – mit sich selbst, aber in erster Linie im Gespräch mit anderen Menschen. In einer der frühesten Bestimmungen des Denkens in der westlichen Tradition verweist Platon in Gorgias darauf, dass selbst derjenige, der als Einer für sich selbst denkt, stets mit sich selbst im Kontext anderer denkt. Philosophie entsteht daher, wie alles Denken, aus und in Gesprächen. Wer philosophiert, tritt, wie die Wissenschaften oder die Politik, in einen Raum gemeinsamen Lebens. Zu philosophieren bedeutet Teil einer Lebensform zu sein. Eine ihrer Spielregeln ist es, die Wirklichkeit möglichst gut zu erfassen. Dabei setzt man sich im Denken wie übrigens auch im alltäglichen Handeln sowohl mit anderen Menschen als auch mit sich selbst auseinander. »So wie ich mein eigener Partner bin, wenn ich denke«, schreibt Hannah Arendt in ihrer Analyse des Bösen, »bin ich mein eigener Zeuge, wenn ich handle. Ich kenne den Täter und bin dazu verdammt, mit ihm zusammenzuleben.«2 Einer, der denkt oder handelt, bleibt nie »schlicht Einer«. Er oder sie steht im Zusammenhang des Ganzen und ist mittendrin. Niemand kann sich aus der Wirklichkeit herausnehmen. Damit ist einer der Kerngedanken dieses Buches expliziert. Wir sind mittendrin, mitten in der Wirklichkeit. In dieser Wirklichkeit mit all ihrer Komplexität geschieht unter anderem moralisches Handeln. Als moralisches steht es in einem Spannungsverhältnis zwischen Gut und Böse. So wie das logische Denken zwischen verschiedenen Denkmöglichkeiten oszilliert, um ihre Wahrheitswerte zu erschließen, ereignet sich Denken als Gesamtprozess, als ein an Sprache gebundenes Geschehen zwischen Menschen. Allerdings geschieht dies, anders als Nietzsche suggerierte, nie jenseits von Gut und Böse. Es gibt nichts außerhalb des Wirklichen. Auch das Jenseits wäre, wenn es existierte, Teil einer Wirklichkeit und insofern Diesseits. Entsprechend gibt es auch keinen transzendenten Maßstab. Denken und Handeln ereignen sich zwischen Gut und Böse, nicht jenseits davon. »Gut« oder »Böse« zu ermitteln, bedeutet daher, inmitten der Wirklichkeit zu urteilen, vollständig eingebunden in ihre Vielfalt ebenso wie in ihre Verbundenheit.
Das Gespräch über das, was ist, und das, was sein soll, erfordert, viele Stimmen zu hören. Unser Buch hat diese Einsicht ernst genommen. Es ist entstanden als gemeinsames »Fließen von Worten«. Die Gedanken dieses Buches sind in Gesprächen entstanden und wollen ins Gespräch führen. Denn dies halten wir für die primäre Form, in der Philosophieren geschieht: als gemeinsames Denken, um Wirklichkeit (besser) zu verstehen. Denken ist Dialog, ein Sich-mit-sich-und-anderen-Unterreden.
Eine solche Unterredung kann sich aus jedem Ereignis ergeben, schreibt Arendt. Insbesondere kritische Lagen wie die, in der wir uns gegenwärtig mit der Klimakrise, einer Pandemie und zunehmenden Spannungen in Gesellschaften weltweit befinden, stellen Anlässe dar, sorgsam zu denken und gut und verantwortungsvoll zu handeln. Das Böse setzt für Hannah Arendt deshalb hier an. Denn »Böses tun heißt, diese Fähigkeit beeinträchtigen«.3
Das vorliegende Buch verdankt sich dieser Tradition des freien Gesprächs, das weit in die Geschichte zurück- und über den westlichen Kulturkreis hinausreicht. Es knüpft damit auch an David Hume an, den Autor der Untersuchung über die Prinzipien der Moral. Wie die Gegenwart in Form einer Zunahme an Spaltungserscheinungen, Verschwörungstheorien und Gewalt zeigt, die keineswegs allein Wirkungen der Pandemie sind, können gerade Gespräche über Fragen der Moral »besonders ärgerlich« sein, weil sie zwischen Menschen stattfinden, »die einen hartnäckigen Eigensinn in ihren Prinzipien beweisen«, wie Hume formulierte.4 Insofern sind Gespräche über Moral nicht nur besonders geeignet, ärgerlich zu sein: Sie sind auch in hohem Maße schwierig, weil man sich zwischen die Stühle und Meinungen setzt. Unserer Überzeugung nach muss sich insbesondere die Philosophie solchen Schwierigkeiten bewusst aussetzen und bereit sein, sich mutig zwischen die Stühle zu setzen. Am Ende lebt nicht nur die Philosophie, sondern jede offene Gesellschaft und insbesondere demokratische Lebensformen, denen wir uns verbunden fühlen, von Kommunikation, Streit und der gewaltfreien Auseinandersetzung realer Menschen miteinander. Gespräche verdanken sich wie Demokratien der Einsicht, dass Menschen nur im Plural existieren. »Der« Mensch ist eine Fiktion. Wird versucht, »den« Menschen zu bestimmen und ihn zu fixieren, gleich, ob er zum Objekt der Wissenschaften gemacht wird oder in Form eines Narrativs, bringt die Fixierung statt der erhofften Klärung im Gegenteil meist Unglück – zumindest für die- oder denjenigen, die oder der nicht der einmal gefundenen und festgelegten Definition dessen, was oder wer »der« Mensch sei, entspricht.5
Für Hume wie für uns stand daher nicht nur fest, dass der Dialog im Zentrum ethischer Reflexion und Urteilsfindung stehen sollte; sondern auch, dass mit der Anerkennung unterschiedlicher Menschen auch unterschiedliche Standpunkte, unterschiedliche Einteilungen der Wirklichkeit sowie unterschiedliche Handlungsweisen gegeben sind. Doch es ist die eine Realität, um die es den Wissenschaften, aber auch der Ethik oder der Politik geht, deren besonderes Interesse einer guten Entwicklung dieser Realität gilt. Ein guter Ausgang all dieser unterschiedlichen Bemühungen ist unter den gegenwärtigen Bedingungen keineswegs sicher. Tatsächlich hat die Anzahl der autokratischen, antidemokratischen politischen und sozialen Systeme in den letzten Jahren auch in Europa ebenso zugenommen wie die Anzahl der Probleme, die nahelegen, dass wir im Anthropozän in die Nähe einiger Kipppunkte gelangt sind, die zu einer radikalen Veränderung unserer Leben führen könnten.
Zwischen Gut und Böse verdankt sich einem Gesprächszusammenhang, der sich über Jahre entwickelt hat. Aus diesen Gesprächen und einem gemeinsamen Anliegen ist das entstanden, was wir hier skizzenhaft Philosophie der radikalen Mitte nennen. Diese Philosophie ist im Wesentlichen jener Fluss der Gedanken, den das Buch in Ausschnitten dokumentiert. Die aufgezeichneten Gespräche fanden im Oktober und November 2020 sowie im Januar 2021 statt. Einwände gegen die Darstellung einer Philosophie als Gespräch sind nicht neu. In seinem posthum 1779 erschienenen Buch Dialoge über natürliche Religion bemerkte Hume, »daß die Dialogform, obschon die antiken Philosophen die meisten ihrer Lehren in dieser Darstellungsweise vorgetragen haben, in späterer Zeit wenig Anwendung fand«. Als Grund führt er an, dass sie »denen, die sich darin versuchten, selten gelang … Es erscheint wenig natürlich, ein System in Form eines Gesprächs vorzutragen; und wer in Dialogform schreibt, möchte seinem Werk durch Verzicht auf die direkte Schreibweise ein freieres Ansehen geben und den Anschein des Verhältnisses von Verfasser und Leser vermeiden … Selbst wenn es ihm gelingt, das Gespräch durch Einstreuung vielfältiger Themen und durch Wahrung eines angemessenen Gleichgewichts zwischen den Gesprächspartnern auf natürliche und aufgelockerte Weise verlaufen zu lassen, so verliert er doch oft so viel Zeit mit den Vorbereitungen und Überleitungen. Es gibt jedoch einige Gegenstände, für welche die Dialogform besonders angemessen und der direkten und einfachen Darstellungsweise immer noch vorzuziehen ist.«6
Wir hoffen, mit dem vorliegenden Buch einen solchen Gegenstand behandelt zu haben und zu weiteren Dialogen anzuregen. Denn wie Hume bemerkt: »Jede philosophische Frage, die so dunkel und ungewiss ist, dass die menschliche Vernunft sie nicht mit Bestimmtheit zu entscheiden weiß, scheint – wenn man sie denn überhaupt behandeln will – ganz natürlich zum Dialog- und Gesprächsstil zu führen. Man darf vernünftigen Menschen unterschiedliche Meinungen dort gestatten, wo niemand vernünftigerweise eine definitive Position beziehen kann.«
Kurzum, wir sind davon überzeugt, dass im Leben wie in der Philosophie der Satz gilt: »It needs two to tango.«
APORIE
»Triff eine Unterscheidung. Laß einen Zustand, der durch die Unterscheidung unterschieden wurde, markiert sein durch eine Markierungder Unterscheidung.«
GEORGE SPENCER BROWN, »LAWS OF FORM«, 1969
Anfangen
GERT SCOBEL: Fangen wir mit dem Sprechen und Denken an. Die Form, in der wir über Ethik nachdenken wollen, erscheint ein bisschen ungewöhnlich, weil es eine dialogische Form ist. Statt mit Leitsätzen oder Prämissen zu beginnen, die wir vorher ausgeknobelt haben, lassen wir uns auf einen nicht planbaren Vorgang des Denkens ein.7 Nur der Anfang ist immer schon gemacht: dadurch, dass wir jetzt hier sind. Denn wir können immer nur »mittendrin« anfangen, inmitten einer komplexen Wirklichkeit.
MARKUS GABRIEL: Genau das war unsere Idee, uns zu treffen und einen echten philosophischen Dialog zu führen, dessen Ziel es ist, nicht Annahmen, die wir ohnehin schon mitbringen, in einen Vergleich zu setzen, sondern gemeinsam einen Weg zu gehen, der so noch nicht gegangen wurde, allerdings natürlich mit dem Ziel, uns darüber zu verständigen, was das überhaupt heißt, ethisch zu denken, und wie man zu guten ethischen Urteilen kommt.
GERT SCOBEL: Deshalb mündet unser Buch in drei Kapitel, denen wir jeweils ein Symbol und einen Begriff zuordnen. Das erste ist ein logisch-mathematisches Symbol, das von Spencer Brown stammt und die Operation des Unterscheidens charakterisiert. Das zweite ist das klassische Symbol der Differenz: das griechische Delta, das sich etymologisch auf das Nildelta bezieht und damit auf das fruchtbare, von der Wüste begrenzte Gebiet. Das dritte ist das chinesische Zeichen für Mitte, Zhong, welches dann die eigentliche These unseres Buches mehr in den Vordergrund rückt, nämlich dass Ethik mit der Radikalität der Mitte zu tun hat. Wir betten Ethik also in einen Zusammenhang des Lebens und der Erkenntnis ein.
MARKUS GABRIEL: Und wir sind uns einig, dass wir die Ethik nicht einfach, wie man so sagt, auf ein neues Fundament stellen müssen, sondern dass wir in der Ethik mit einer spezifischen Form von Unsicherheit zu ringen haben, die in anderen Teildisziplinen der Philosophie nicht in derselben Weise instanziiert ist. Aristoteles hat vielleicht als einer der Ersten – in dem Kontext, in dem er überhaupt das Wort Ethik geprägt hat, nämlich in der Nikomachischen Ethik – den Gedanken geäußert, es gehe in der Ethik darum, unter endlichen Zeitbedingungen, das heißt unter niemals hinreichend idealen Bedingungen, dennoch die richtigen Entscheidungen zu treffen. Das ist ein Gedanke, von dem wir uns, glaube ich, auch leiten lassen: der phronêsis bei Aristoteles, der besonnenen Abwägung in komplexer Lage.
GERT SCOBEL: Dazu fallen mir zwei Dinge ein. Das erste: Die Komplexität der Wirklichkeit ist die Ausgangslage und letztlich auch die Grundbedingung allen Nachdenkens. Wenn du anfängst nachzudenken, stehst du ja bereits mitten im Leben. Das heißt, es gibt bereits gewisse Voraussetzungen, die einfach da sind, zunächst unhinterfragt. Du hast eine Sprache erlernt, du bist in einer Lebensform groß geworden. Das ist ein Grundproblem: Die Frage, womit man den Anfang der Wissenschaft machen sollte, wie Hegel sich ausdrückt, kommt immer zu spät. Daher das Nach-Denken. Im Fall der Ethik kommt noch hinzu, dass es eben nicht nur um das Denken oder um Logik geht, sondern auch darum, dass ich mich in der Welt unter anderem mit Hilfe von Denken mir selber und anderen gegenüber verständige und dann auch noch richtig handle. Das zweite betrifft die Folgerungen, die sich aus der Komplexität des Jetzt ergeben. Die Wirklichkeit ist immer noch komplexer als jede Erwartungshaltung oder Prognose, die wir gebildet haben, um uns in ihr zurechtzufinden. Die Ethik kann deswegen niemals in ein finales System moralischer Prinzipien gegossen werden. Sie bleibt ebenso beweglich wie kontingent.
MARKUS GABRIEL: Erst einmal sollten wir vielleicht festhalten, dass jedes Denken und Urteilen eine Art von Handlung ist, mithin etwas, was jemand tut und das dadurch zurechenbar ist. Die Gedanken, die ich habe, sind mir zurechenbar, und deine dir. Alles Urteilen ist Handeln, es gibt keine reine Theorie, aber auch keine reine gedankenfreie Praxis. Bei den Handlungen, bei denen ethische Fragen eine Rolle spielen, sind das Gute, Böse oder Neutrale Eckpfeiler beziehungsweise Werte eines Spektrums. Wir werden uns über das Spektrum noch ausführlicher unterhalten. Jedenfalls gibt es Extrempunkte, an denen sich die Ethik orientiert. Damit befinden wir uns bereits in den hochgradig ausdifferenzierten Urteilspraktiken, die uns überliefert sind. Und schon sind wir mittendrin, auch im ethischen Urteilen. Bei den Fragen, bei denen ethische Überlegungen eine Rolle spielen, ist es auf eine bestimmte Weise erheblich weniger gleichgültig, sich zu täuschen, als in den sogenannten theoretischen Fragen. Wenn ich in ethischen Fragen das Falsche denke und im Ergebnis auch das moralisch Falsche tue, tue ich im Extremfall das Böse, und wer das Böse getan hat oder vielleicht systemisch im Bösen festsitzt, der ist zu Revisionen in seiner eigenen Lebensform genötigt, kommt in andere Verhältnisse – auch existenzielle –, anders als jemand, der lediglich ein falsches Urteil in einer x-beliebigen neutralen Angelegenheit fällt.
GERT SCOBEL: Ein Fallstrick wäre es jetzt, zu folgern: Denken ersetzt Handeln. Natürlich ist auch Denken ein Handeln – aber es kann nicht an die Stelle des Tuns treten, welches man mit einem ethisch verantworteten Verhalten erst einzuleiten gedenkt. Man kann nicht anstelle eines im Moment notwendigen Handelns – zum Beispiel jemandem zu helfen – sagen: Ich denke jetzt erst mal darüber nach.
Du hast gesagt, dass sich Aristoteles’ Ethik als ein Nachdenken unter Bedingungen endlichen Wissens und endlicher Zeit versteht. Das klingt extrem modern. Heute sprechen wir in Entscheidungstheorien von Komplexitätsbewältigung unter Bedingungen begrenzter Rationalität, der bounded rationality.8 Die Frage ist daher, ob wir Rationalität heute nicht entsprechend neu verstehen müssen. Lange Zeit war meine Auffassung von Aufklärung diese: Wenn du und ich uns über ein ethisches Thema streiten, legen wir alle Argumente auf den Tisch und wägen mit Hilfe eines rationalen Diskurses, das heißt mit den Mitteln der Logik auf der einen Seite, mit Kenntnis der Fakten auf der anderen, diese Fakten und deren logische Interpretation gegeneinander ab; und wenn wir das lang genug machen, kommen wir beide oder eine Gruppe von Menschen, letztlich in der Demokratie sogar eine ganze Gesellschaft dazu, vernünftige Entscheidungen zu treffen und vernünftige Regeln zu verabreden. Das Motto würde lauten: Alle Widersprüche, alle Konflikte lassen sich am runden Tisch der Vernunft lösen. Meine Erfahrungen, speziell mit Corona, aber auch mit vielen anderen Diskussionszusammenhängen, sind jedoch völlig andere. Ein Beispiel ist die Frage: Ist die Atomkraft eine gute Antwort auf unsere Probleme des Klimawandels? Wenn man diese Diskussion mit Leuten führt, die bereits gut informiert sind und die die Fakten kennen, ist man nach zehn Minuten so weit, dass beide Seiten, Pro und Kontra, alle strittigen Argumente vorgebracht haben. Jetzt müsstest du auf eine Metaebene gehen, das heißt, du müsstest in ein übergeordnetes rationales Verhältnis zu diesen Argumenten treten. Von dieser Warte aus müsstest du dann ebenfalls rational entscheiden können: Was ist jetzt als das Richtige zu tun? Mir scheint, dass die Aufklärung lange Zeit über angenommen hat, diese Art von Verfahren anwenden zu können, um auf diese Weise zu einer eindeutigen, klaren Lösung zu kommen. Wir müssen uns aber heute eingestehen – und das ist eines unserer aktuellen Probleme –, dass dieses Verfahren nicht funktioniert. Warum? Weil es die Metaebene nicht gibt. Das Verfahren des Diskurses alleine reicht also nicht aus. Und jetzt sagst du: Das hat sich Aristoteles eigentlich von Anfang an so gedacht.
MARKUS GABRIEL: Genau, das ist der Grundgedanke der aristotelischen Ethik, den er gegen Platon ins Feld führt. Platon setzt, wenn man so will, stark auf die Algorithmizität der Ethik. Das heißt, Platon ist der durchaus richtigen Meinung, dass es unter maximal idealen Bedingungen keine Fehlbarkeit mehr geben kann, sondern quasi-mathematische, strenge philosophische Beweise. Deswegen hat Platon in der Akademie, soweit wir wissen, tatsächlich formale mathematische Kalküle zur Berechnung des Guten angeboten, karikiert von ihm selbst – ich halte das bewusst für eine Karikatur – in der berühmten Hochzeitszahl in der Politeia, wo darüber gesprochen wird, unter welchen Bedingungen wer mit wem verheiratet sein muss. Wir haben zum Beispiel das Gefühl, dass politische Entscheidungen ab einem bestimmten Prozentsatz rechtspopulistischer Vertretungen in Landtagen zu einer moralischen Katastrophe führen. Auch da glauben wir an die eine genaue Zahl, und ab dieser Zahl müssen wir nervös werden. Oder wir fordern eine Studie über Rassismus in der Polizei, und wenn sich dann ein Prozent der Polizisten als Rassisten herausstellen, sind wir noch beruhigt, bei 23 Prozent werden wir langsam nervös.
GERT SCOBEL: 50 COVID-19-Infektionen auf 100 000 Einwohner in einer Woche. Wenn es 51 sind, sind wir sehr nervös.
MARKUS GABRIEL: Das ist Platonismus in der Ethik: Man glaubt, es müsste doch eine Zahl auffindbar sein, an der sich ethische Entscheidungen orientieren müssen. Die gibt es aber nicht.
GERT SCOBEL: Und die Zahl bildet ja eigentlich nichts anderes als ein klares digitales Verhältnis ab, nämlich eine scharfe, eindeutig umrissene Grenze, wie die zwischen 0 und 1. Dazwischen gibt es in der digitalen Logik nichts. Im Bereich der Mathematik kann ich jedoch unendlich viele Zahlen zwischen 0 und 1 konstruieren. Aber so funktioniert unsere digitale Logik ja gerade nicht. Weshalb Soziologen, wie zum Beispiel Armin Nassehi, darauf hinweisen, dass die Digitalisierung der Gesellschaft nicht etwa mit den Computern Einzug hielt, sondern die Wurzel viel älter ist, zumal wir seit Jahrtausenden bereits messen und vermessen.9 Warum? Weil wir versuchen, gesellschaftliche Verhältnisse mit einer 0/1-Logik zu messen und Grenzen zu bestimmen, etwa von Einkommen, Lebensalter …
MARKUS GABRIEL: Bruttoinlandsprodukt …
GERT SCOBEL: Schon ist das, was später die Maschinen übernehmen, weil sie viel mehr Daten sammeln und verarbeiten können, im Grunde genommen präformiert. Die Digitalisierung der Gesellschaft ist demnach keine neue Entwicklung. Platon ist derjenige, wie du gesagt hast, der behauptet: Ich kann das Gute und das Böse eindeutig wie 0 und 1 voneinander unterscheiden, und weil ich das kann, kann ich logische Argumente konstruieren, die im Grunde genommen digitalisierbar sind und eins zu eins in die Logik eines regelbasierten Computersystems übersetzt werden können.
MARKUS GABRIEL: Genau. Platon hat eben nicht nur – Stichwort: Höhlengleichnis – das Kino erfunden, sondern auch das Internet. Wenn man Internet ins Altgriechische übersetzen möchte, wäre eine gute Übersetzung symplokê, was von syn (zusammen) und plékein (flechten) kommt. Die symplokê ist das Zusammengeflochtene. Platon spricht im Sophistes vom Gebiet der Ideen, dem reinen logischen Raum als einer Verflechtung der Ideen, was natürlich über das derzeitige Internet weit hinausgeht, das leider keine logische Verflechtung der Informationen, also keinen gut strukturierten allumfassenden Zusammenhang, sondern eine Verwirrung der Ideen anbietet. Jetzt kommt Aristoteles, der erstens gewisse Kritikpunkte an der Ideenleere im Allgemeinen anzumelden hat, aber – und das ist jetzt viel interessanter – den man so lesen kann, dass er sagt: Selbst wenn es im platonischen Sinne das objektiv Gute gäbe, nämlich das Gute als Maximalobjekt, heißt das natürlich noch lange nicht, dass ich weiß, wie es beschaffen ist, wenn ich unter Zeitdruck handele. Und, so Aristoteles, ich handele immer unter Zeitdruck. Für keine ethisch relevante Entscheidung habe ich jemals genug Zeit. Deswegen kann das Gute als Maximalobjekt in der Entscheidungsfindung nicht angemessen in Rechnung gestellt werden, sodass es auch nicht als Orientierungspunkt dienen kann. Das ist ein echtes Problem, denn es gilt für alle Fakten, die man kennen muss, um eine ideale Rechtfertigung für seine Entscheidungen zu treffen. Die Frage lautet also, wie man unter endlichen Bedingungen das Richtige tun kann, wenn das Gute selbst keinen Leitfaden zu seiner Entdeckung anbietet.
GERT SCOBEL: Meine Lebenszeit ist endlich. Also ist alle Erkenntnis, auch die in der Ethik, gemessen an der faktischen Komplexität der Wirklichkeit endlich, begrenzt und weniger komplex. Das heißt, wir haben es eigentlich mit zwei Formen von Unbestimmbarkeit oder Unsagbarkeit zu tun. Die eine ist die Unbestimmbarkeit, die es in der Wirklichkeit gibt, weil wir zum Beispiel Zeitreihen nicht unendlich laufen lassen können. Das heißt, wir haben es bei der Bestimmung dessen, was Tatsache ist, immer wieder mit Ungewissheiten zu tun. Das ist die erkenntnistheoretische Unbestimmtheit. Darüber hinaus gibt es noch eine zweite Form, die sich auf das bezieht, was gut für uns ist, was gut in unserem Handeln ist oder was eine »gute Qualität« unseres Handelns ausmacht. Auch dieses »Gut-Sein« bleibt auf eine zweite, nämlich praktische Art, unbestimmt. Wir haben also eine Unbestimmbarkeit der Meinungen und Urteile, der dogmata – und wir haben eine Unbestimmbarkeit unserer Lebensbedingungen und Lebenshaltung, der pragmata.
MARKUS GABRIEL: Im Allgemeinen gilt: Wenn ich Wissen über irgendetwas beanspruche, zum Beispiel zu wissen, dass wir gerade in Bonn sind, dann muss ich dafür Gründe haben. Meine Gewissheit, in Bonn zu sein, gründet darin, dass ich heute Morgen in Bonn aufgewacht bin, den üblichen Weg zu dem Ort genommen habe, an dem wir uns gerade unterhalten usw. Das sind die Gründe, die ich anführen kann. Wenn du mich also fragst, »Woher weißt du, dass du in Bonn bist?«, kann ich dir darauf solche Gründe nennen. Jetzt wirst du mich aber vielleicht fragen, »Woher kennst du deine Gründe?«, und dann wird es philosophisch interessant: »Woher weißt du denn, dass du heute Morgen in Bonn aufgewacht bist?« Dann kann ich sagen: »Ich erinnere mich daran, heute Morgen in Bonn aufgewacht zu sein.«
GERT SCOBEL: Erinnerst du dich genau? Weißt du, dass du dich genau erinnerst?
MARKUS GABRIEL: Und überdies: Woher weißt du, welche Bedeutung das Wort »Erinnerung« hat oder das Wort »Grund«? Du hast vorhin mit dem Hinweis begonnen, dass wir uns in dem Augenblick, in dem uns ethische Fragen überhaupt wichtig sind, bereits in einer komplexen Lage vorfinden, die wir nicht selbst herbeigeführt haben. So haben wir die Staatsverfassung, in der wir uns befinden, nicht selbst geschrieben. Uns hat man natürlich nicht zum Grundgesetz befragt, denn wir existierten noch nicht. Die Grundlagen unseres Handelns und Urteilens werden überliefert, und wir modifizieren sie dann durch unsere Lebensvollzüge, also durch weitere Denkakte sowie ethisch relevante Handlungen.
GERT SCOBEL: Wir haben die Sprache, die wir sprechen, nicht selber gemacht. Wir haben viele der Lebensbedingungen, in denen wir uns befinden, nicht hergestellt. Die technischen Geräte, mit denen wir jetzt aufzeichnen, die gesamte Infosphäre, die ich nur sehr eingeschränkt überblicke: All das existiert bereits.
MARKUS GABRIEL: Jeder versteht diese Zusammenhänge nur bedingt. Das fängt alles freilich schon auf einer viel elementareren Ebene an. Nehmen wir den Tisch, der vor uns steht. Ich möchte das Folgende mal behaupten: Es ist uns im striktesten Sinne unmöglich, herauszufinden, wo der Baum stand oder die Bäume, aus denen dieser Tisch gezimmert ist. Obwohl man denken würde, das müsse doch entdeckbar sein. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob ich noch genau weiß, wo ich diesen Tisch gekauft habe. Ich glaube, bei einem Händler, ich meine noch zu wissen, wo der mal war, und ich glaube, er wurde durch ein Reisebüro abgelöst. Wie hieß der Händler noch mal? Lebt der Mensch noch? Und selbst wenn ich den finde, gilt, dass ich den Tisch als eine Antiquität gekauft habe, sodass auch der Händler womöglich nicht weiß, wo er genau herkommt, geschweige denn der Baum stand, aus dem er gemacht ist.
GERT SCOBEL: Selbst so etwas Einfaches können wir nicht bestimmen.
MARKUS GABRIEL: Wir können nicht herausfinden, woher dieser Tisch kommt. Und das gilt für die allermeisten Dinge, die uns umgeben.
GERT SCOBEL: Dennoch glauben wir zu wissen, wir könnten genau bestimmen, erstens, aus welchen Gründen wir uns so und nicht anders verhalten, zweitens, welche Motive wir haben, genau dies zu tun. Aber auch diese Bestimmung lässt sich erweitern, wenn ich etwa eine Psychotherapie mache und meine Motive vielleicht auf einer anderen Ebene hinterfragen kann. Die Idee der Aufklärung, mit der ich groß geworden bin, fordert uns jedenfalls heraus, alles radikal und bis zum Ende zu klären. Und wenn du es nicht radikal bis zum Ende klären kannst, bleibst du mir oder bleiben wir uns etwas schuldig. Aber wir beide sind jetzt bereits zu dem Schluss gekommen, dass es völliger Unsinn ist, das verlangen zu wollen. Es ist unmöglich, das ethische Urteilen in einen finalen Zustand der vollständigen Ersetzung unserer Freiheit durch einen Algorithmus oder ein großes Prinzip zu überführen, sei es die Goldene Regel, der Kategorische Imperativ oder irgendein utilitaristisches Kalkül-System.
MARKUS GABRIEL: Bei Kant muss man schon vorsichtig sein, denn er hat immer auf die Grenzen der Erkenntnis verwiesen und versucht zu zeigen, dass wir uns selbst nicht kennen können, weil wir eine intelligible Seite haben, die außerhalb unseres Zugriffs liegt. Deswegen sagt Kant ja: Ich kann nicht wissen, ob ich jemals aus den richtigen Motiven, also gut gehandelt habe. Das Einzige, was gut genannt werden kann, ist ein guter Wille, aber ob ich jemals einen im Kant’schen Sinne guten Willen hatte, sagt Kant, kann ich nicht wissen. Das heißt, eigentlich ist die Aufklärung Kants auf unserer Seite, weil er die Komplexität der Anwendungsbedingungen seiner universalen Regeln berücksichtigt. Kant glaubt gerade nicht, dass wir faktisch die Art von Klarheit herstellen können, die in der Aufklärung in Frankreich von Denkern wie dem Marquis de Condorcet als mathematische Kalküle entwickelt wurden. Die französische und auch die britische Aufklärung haben zu dem Gedanken geführt, Denken sei letztlich eine Art Rechnen, Vernunft sei, wie Thomas Hobbes gesagt hat, »nothing but reckoning«, also letztlich durch eine Maschine ersetzbar. Gegen solche Gedankenexperimente hat sich Kant gewendet, aber auch andere Aufklärer wollten den Gedanken verabschieden, wir könnten berechnen, was wir tun sollen. Das wäre nämlich mit dem Gedanken der Freiheit unvereinbar.
GERT SCOBEL: In England und Frankreich wurde ja damals vor allem die Wahrscheinlichkeitsrechnung entwickelt.
MARKUS GABRIEL: Theoreme des Marquis de Condorcet oder von Thomas Bayes, der die Grundlagen der heutigen Wahrscheinlichkeitstheorie entwickelt hat, aber auch andere Rationalitätstheorien der frühen Aufklärung, etwa bei Adam Smith, neigen zu dem Gedanken, wir könnten Ethik durch Statistik ersetzen. Das ist, wie mir scheint, der Versuch, Platon und Aristoteles zu überbrücken. Doch das ist ein Fehler. Aristoteles hat zu Recht gedacht, dass der Bereich menschlichen Handelns qualitativ ist und nicht quantitativ. Also, ein bestimmter Typ der Aufklärung, der Ethik durch Kalküle ersetzen möchte, was etwa im Utilitarismus gipfelt, ist das Problem, das in eine Sackgasse führt, nicht hingegen der Gedanke der Aufklärung im Allgemeinen, dass wir eine Rationalitätstheorie benötigen, um uns selbst als Vernunftwesen zu verstehen, die zu höherer Moralität durch ethische Einsicht fähig sind.
GERT SCOBEL: Was wir doch sagen können, ist: Wir brauchen Rationalität. Das, was unserem Nachdenken über Ethik vorangeht, ist ja bereits ein Nachdenken, das immer schon angefangen hat. Das heißt, wir müssen eigentlich – und das ist ein Weg, den traditionell die Ethik nicht immer beschritten hat – über das Denken nachdenken, ist es doch das »Medium«, in dem sich ethische Reflexion überhaupt abspielt. Folglich müssen wir die Operation des Denkens klären. Wir haben ja das Spencer-Brown’sche Symbol der Unterscheidung gewählt, weil es den Prozess fortschreitender Unterscheidungen deutlich macht. Das, was man gerne Anfang nennt, liegt immer schon hinter uns und hat sich bereits ins Spiel gebracht. Statt diesen Anfang zu suchen, beginnen wir inmitten des Geschehens, jetzt. Das ist in unseren Augen der beste Ansatz, um überhaupt zu erklären, was Denken ist. Denken bedeutet, eine Unterscheidung ins Spiel zu bringen. Das heißt, ich unterscheide diesen Tisch von allem anderen, was nicht dieser Tisch ist. Damit bleibt der Tisch selbst natürlich zunächst unbestimmt. Jetzt besteht meine Aufgabe deshalb darin, zu sagen: Ja, gut, was aber ist dieser Tisch? Worin unterscheidet sich dieser Tisch von allem anderen, das existiert? Da sind wir mitten in einem ganzen Haufen von Problemen, von denen eines die Frage ist, ob ich wirklich ganz streng benennen kann, was diesen Tisch von allem anderen unterscheidet, denn wie du schon gesagt hast, sein Holz ist irgendwo gewachsen. Und es findet sich wahrscheinlich auch in irgendeinem anderen Stuhl oder Tisch. Somit hat dieser Tisch eine Gemeinsamkeit mit irgendeinem anderen Gegenstand. Und nicht nur diese eine, unzählige Gemeinsamkeiten! Schließlich sind all die Atome des Tisches in irgendwelchen Fusionsprozessen in Sternwolken und Sonnen entstanden. Auch das ist eine universale Gemeinsamkeit aller Dinge.
MARKUS GABRIEL: Es gibt keinen Anfang! Das Denken in Anfängen, nennen wir das ruhig die Archäologie, ist letztlich immer falsch. Auch wenn wir den Tisch jetzt auf Atome zurückführen, ist da kein Ende, weil wir dann weiter fragen werden: Woher kommen die Atome? Heute können wir zwar auf noch kleinere Elementarteilchen verweisen, doch diese kommen ihrerseits irgendwoher, sie sind Produkte von Prozessen, die mit dem Urknall zusammenhängen, der eine Erkenntnisschranke darstellt. Wir werden also immer die »Woher kommt denn X?«-Frage stellen. Stellen wir die Frage so, dass wir glauben, relevant zu wissen wäre, woher die Atome des Tischs kommen, also glauben wir, dass die Mikroebene von Bedeutung ist, stoßen wir da an die Grenzen des physikalischen Wissens, die spätestens bei der Singularität unüberwindbar sind. Und selbst wenn wir sie eines schönen Tages überwunden hätten, wenn wir also auf die andere Seite der Firewall des Universums schauen könnten, wären da ziemlich sicher irgendwelche Überraschungen. Also die alten Fragen »Warum ist überhaupt etwas und nicht vielmehr nichts, warum ist alles so und nicht anders?« sind unsinnig und schlicht nicht zu beantworten. Ich kann nur sagen, warum jenes so ist und dieses anders, aber der Gedanke, dass es einen Punkt gibt, auf den alles zuläuft, ist immer falsch. Es gibt keinen Punkt, von dem alles ausgeht, und auch keinen Endpunkt aller Entwicklungen. Nirgends, auch nicht im Denken und auch nicht in der Ethik. Wir befinden uns in radikal offenen Situationen. Die Wirklichkeit ist immer noch bunter und heterogener, als man es einmal dachte. Komplexität eben, wie du sagen wirst.
Unterscheiden
GERT SCOBEL: Genau das ist Komplexität: eine Vielzahl unterschiedlicher Elemente, die auf lineare, vor allem aber auch nicht lineare Weise miteinander verknüpft sind und Netzwerke bilden. Interessanterweise besteht ja auch das Denken selber darin, diese Unterscheidung etwa der Elemente immer weiter zu verfeinern und dabei andere Unterscheidungen ins Spiel zu bringen, feinere Unterscheidungen beispielsweise, sodass man sagen kann: Denken ist das, was uns in immer weitere Unterscheidungen treibt. Das ist einer der Gründe, warum das griechische Wort krínein sowohl für Unterscheiden als auch für krísis steht, das unserem deutschen Wort »Krise« verwandt ist und ursprünglich auch »Beurteilung« und »Entscheidung« bedeutet. Wenn sich das fortgeführte Unterscheiden zuspitzt, kann es uns, indem es in Aporien mündet oder Voraussetzungen, die wir gemacht haben, im Nachhinein problematisch erscheinen lässt, in eine fundamentale Krise stürzen. Eine solche Krise fordert unsere Urteilskraft heraus: Wir müssen aufgrund neuer Argumente ein gutes Urteil fällen und zu einer Entscheidung kommen, die wiederum für unser Handeln im Allgemeinen und für das ethische Handeln im Speziellen von Bedeutung ist.
MARKUS GABRIEL: Die Zeit, in der wir leben, können wir als die Krisenzeit bezeichnen. Und selbst wenn wir jetzt diese eine globale virale Pandemie bewältigen, sind viele andere Krisen noch da. Dann fällt uns vielleicht auf, dass wir uns in vielen Pandemien befinden, in vier weiteren Coronavirus-Pandemien, in einer AIDS-Pandemie, in einer Rotavirus-Pandemie etc.
GERT SCOBEL: Darüber hinaus haben wir ein Armutsproblem, ein Hungerproblem, ein Ungerechtigkeitsproblem.
MARKUS GABRIEL: Ein Klimaproblem. Ein Digitalisierungsproblem, ein Problem der liberalen Demokratie usw. Alle diese Probleme werden heute als »Krisen« angesprochen. Und sie haben kein Ende …
GERT SCOBEL: Eine endlose Pluralität von Krisen?
MARKUS GABRIEL: Ich nenne das Stapelkrise. Wir stecken in einer völlig chaotischen, hochdynamischen Stapelkrise, das heißt in einer Verschachtelung unzähliger Krisen und damit in einer Krisenzeit ohne Ende. Wir haben Haufen von Problemen, und jedes einzelne Problem erscheint uns schon gesondert als Krise – als Zeit, die uns zum Denken herausfordert. Man könnte sogar positiv sagen, die Krisenzeit, in der wir uns befinden, ist eigentlich eine Denkzeit, wir denken jetzt, ob wir wollen oder nicht. Und dabei stellen wir alle auf jeweils verschiedene Weisen fest, wie ungeübt wir darin sind. So bringt einem eine noch so gute Ausbildung in Logik und damit im Denken über das Denken nicht allzu viel, um eine adäquate Einstellung zur Corona-Pandemie zu gewinnen, weil diese viel zu irrational verläuft, um logisch erfasst zu werden. Die Logiker kommen hier nicht voran, auch Virologen nicht und auch nicht Politiker, keiner, den man anrufen könnte, der die Lösung kennt. So ruft man viele an und erkundigt sich, um ein Bild der Sachlage zu erstellen, doch das verschiebt sich ständig, und zwar für alle. Niemand kontrolliert die Krise derzeit, auch nicht die Bundeskanzlerin oder die Bundesregierung, die sind ebenso irritiert und schockiert angesichts der Komplexität, woraus die Überforderung, die Widersprüche, der Aktionismus, die Hoffnungen und Enttäuschungen resultieren, die wir alle seit Monaten erleben müssen. Als die Kanzlerin laut Medienberichten in einer Konferenz jüngst gesagt haben soll: »Das Ding ist uns entglitten«, hatte sie nur halb recht: Wir hatten es nie in der Hand! Niemand kontrolliert eine virale Pandemie, das Infektionsgeschehen ist in niemandes Hand, das ist Teil des Traumas, das wir gerade gemeinsam durchleben.
GERT SCOBEL: Und das, finde ich, ist in hohem Maße paradox oder auch verstörend, weil Aristoteles seine Nikomachische Ethik mit dem Hinweis auf die verschiedenen Zünfte in der Polis beginnt. Übersetzt in die Gegenwart: die Zunft der Statistiker, der Virologinnen, der Biologen oder der Medizinerinnen, die noch mal einen anderen Standpunkt vertreten, oder die der Pflegerinnen und Menschen in systemrelevanten Berufen. All die Zünfte zählt Aristoteles gleich in den ersten Abschnitten seiner Untersuchung auf und sagt dann: Wer muss denn nun über unser richtiges, über das gute Leben in der Polis entscheiden? Die einzelnen Gruppen haben natürlich ihre je eigenen und unterschiedlichen Interessen. Seine Antwort lautet: Die Politik entscheidet. Die Frage für uns ist aber: Wie entscheidet die Politik? Und was bedeutet in dem Zusammenhang »verantwortliche Entscheidung«, wenn doch, wie wir gesehen haben, der Prozess der Verantwortung nicht abschließbar ist, weil es kein erstes Prinzip, keinen absoluten Anfang gibt, von dem alles ausgeht? Ist der Vorgang des Entscheidens tatsächlich eine rationale Entscheidung, die man bis zum Ende begründen kann? Nach dem, was wir bis jetzt überlegt haben, kann das nicht der Fall sein. Wie kann aber dann Politik entscheiden, außer dezisionistisch oder willkürlich? Das kann zumindest in einer Demokratie nicht unsere Spielregel sein.
MARKUS GABRIEL: Und dieses tiefe Entscheidungsproblem ist fatal, weil komplexe Prozesse der Arbeitsteilung als solche nicht auf eine perfekte Lösung, das Gute, zielen, es darauf aber ankommt, herauszufinden, was wir jetzt als Menschheit, also aus universal gültigen Gründen tun sollten, um die Krisenlage zu bewältigen. Das Gute im ethischen Sinne kann nichts anderes sein als etwas, das objektiv gut ist.
GERT SCOBEL: Es muss für uns alle gut sein.
MARKUS GABRIEL: Richtig. Ein Gutes, das nur gut für einige ist, ist kein moralisch Gutes, sondern allenfalls ein moralisch irrelevantes Gut. Das heißt, wenn es in der Ethik um irgendetwas geht, dann um etwas, was alle betrifft. Das ist ja der besondere Appeal auch der Ethik. Deswegen interessieren sich die Menschen, was Philosophie angeht, eher für Ethik als – sagen wir mal – für Metaphysik oder Philosophie der Mathematik. Jetzt aber, inmitten der Krise, scheinen wir zu glauben, die Rationalität der politischen Entscheidungen ließe sich an eine andere Rationalität delegieren, die die Probleme endgültig löst. Einerseits hören wir bei der Politik auf – das ist unser Regress-Stopper –, so wurde ja in der Pandemie dauernd argumentiert, das müsse die Politik entscheiden. Und die Politik delegiert weiter an die Forscherinnen und Forscher am Robert-Koch-Institut. Da wird eine Behörde aufgerufen, und wenn die nicht weiterkommt, werden die wissenschaftlichen Akademien gefragt, die den Ball möglichst schnell an die Politik zurückspielen, um sich die Finger nicht schmutzig zu machen, mit Triage-Empfehlungen und dergleichen mehr.
GERT SCOBEL: Runden mit Expertinnen und Experten.
MARKUS GABRIEL: Genau, da kommen Expertenrunden, in der Form eines argumentativen Zirkels.
GERT SCOBEL: Die hat Gerhard Schröder damals öffentlichkeitswirksam wie selten zuvor in die Politik eingeführt. Viele, viele Expertenrunden – was der Politik den Anstrich höherer Rationalität geben sollte.
MARKUS GABRIEL: Dann wäre die nächste Frage: Aha, also entscheidet doch nicht die Politik? Den Dezisionismus gilt es in jedem Fall zu vermeiden, aber da war doch dieses Statistikmodell des Thomas Bayes aus dem 18. Jahrhundert – nicht umsonst ist der Bayesianismus auch in der politischen Philosophie so beliebt und in der Risikoethik, dort, wo es um wahrscheinlichkeitstheoretische Handlungskalküle geht, weil man da glauben darf, es gäbe ein höheres Prinzip, es gäbe doch einen Anfangspunkt, nämlich das kalkülhaft übersetzbare probabilistische Nachdenken, für das die formale Epistemologie in der Philosophie und eben aber auch in der Verhaltensökonomie usw. zuständig ist. Und vor diesem Hintergrund stellt sich erst die eigentliche Frage: Entscheidet also doch nicht die Politik, sondern ein bayesianisches Kalkül? Oder epidemiologische Modelle? Das wird aber doch kein stolzer Ministerpräsident so sagen wollen. Wenn wir sie oder ihn jetzt fragen, »Wer hat hier entschieden?«, sagen sie nicht, ein bayesianisches Kalkül, weil wir dann die Politiker auch abschaffen und an deren Stelle Statistiker setzen könnten. Das aber wollen wir auch nicht. Der Gedanke der Expertenrunde führt uns also in eine handfeste Aporie: Die Politik soll entscheiden, dafür braucht sie aber die Expertinnen, die ihr sagen, was sie tun soll, was aber wiederum voraussetzt, dass die Politik entscheidet, welche Expertinnen angehört werden usw. Und all das, um den schrecklichen Dezisionismus abzuwehren, den wir nicht wollen, aber auch nicht vermeiden können.
GERT SCOBEL: