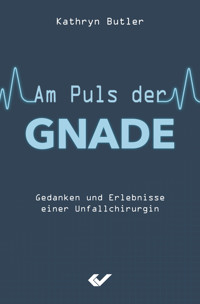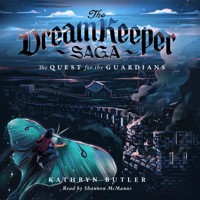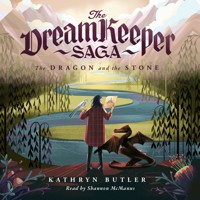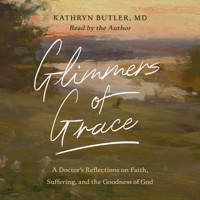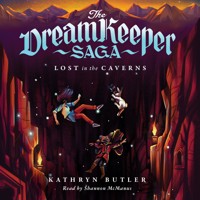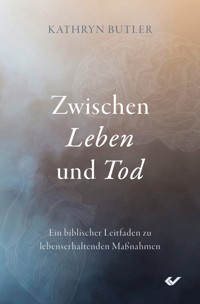
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Christliche Verlagsgesellschaft
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
Der Fortschritt in der Medizin rettet unzählige Leben. Doch trotz all ihrer Vorzüge haben die hochentwickelten Technologien auch eine beängstigende neue Dimension geschaffen, indem sie die Grenzen zwischen Leben und Tod verwischen. Der Sterbeprozess verbirgt sich oft hinter einem komplexen Geflecht aus medizinischer Terminologie, Statistiken und ethischen Entscheidungen, sodass Patienten und Angehörige kaum noch wissen, wie sie das Lebensende auf eine würdevolle, gottesfürchtige und vom Glauben erfüllte Weise angehen können. Dieses Buch rüstet die Leser aus, indem es den medizinischen Fachjargon erklärt, biblische Prinzipien erforscht, die sich auf alltägliche medizinische Situationen beziehen, und Anleitungen für kritische Entscheidungen bietet. Auf diesen Seiten finden die Leser das medizinische Wissen und die biblische Weisheit, die sie brauchen, um diesen schmerzhaften und verwirrenden Prozess mit Klarheit, Frieden und Unterscheidungsvermögen zu bewältigen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 309
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für meine Patienten, deren Mut mich dazu inspirierte, dieses Buch zu schreiben.Und für Scott, Jack und Christie, die mich täglich an Gottes Liebe erinnern.
Kathryn Butler
Zwischen Leben und Tod
Ein biblischer Leitfaden zu lebenserhaltenden Maßnahmen
Best.-Nr. 275534 (E-Book)
ISBN 978-3-98963-534-0 (E-Book)
Titel des amerikanischen Originals:
Between Life and Death
© 2019 by Kathryn Butler
Published by Crossway, 1300 Crescent Street, Wheaton, Illinois 60187
Es wurde folgende Bibelübersetzung verwendet:
Elberfelder Bibel 2006, © 2006 by SCM R.Brockhaus in der SCM Verlagsgruppe GmbH Witten/Holzgerlingen.
1. Auflage (E-Book)
© 2025 Christliche Verlagsgesellschaft mbH
Am Güterbahnhof 26 | 35683 Dillenburg
Übersetzung: Svenja Tröps
Satz und Umschlaggestaltung: Christliche Verlagsgesellschaft mbH
Umschlagmotive: © Freepik.com/pch.vector (Organe), Unsplash.com/Hamish (Hintergrund)
Wenn Sie Rechtschreib- oder Zeichensetzungsfehler entdeckt haben, können Sie uns gern kontaktieren: [email protected]
Inhalt
Einleitung
Teil 1: Sterbend, aber lebendig in Christus
1. Worum es geht: Eine Einleitung ins Thema
2. Weisheit beginnt mit dem Wort Gottes
Teil 2: Maßnahmen zur Unterstützung der Organfunktion – eine kritische Betrachtung
3. Wiederbelebung bei Herzstillstand
4. Einführung in die Intensivpflege
5. Künstliche Beatmung
6. Kardiovaskuläre Unterstützung
7. Künstliche Ernährung
8. Dialyse
9. Hirnverletzungen
Teil 3: Nach reiflicher Überlegung – vernünftige Entscheidungen am Lebensende
10. Palliativmaßnahmen und Hospizpflege
11. Ärztlich assistierter Suizid
12. Advance Care Planning – die gesundheitliche Versorgungsplanung
13. Jemandem Gehör verschaffen
Fazit
Danksagung
Anhang 1: Beispiel für eine Vorausverfügung
Anhang 2: Überblick über organunterstützende Maßnahmen
Anhang 3: Tröstende Bibelverse
Glossar
Links zu deutschen Formularen
Allgemeines Stichwortverzeichnis
Bibelstellenverzeichnis
Endnoten
„Wenn ich von einer ernsthaften, lebensbedrohlichen Krankheit betroffen wäre, würde ich von einem erfahrenen Mediziner betreut werden wollen, der sich mit den neuesten wissenschaftlichen Studien auskennt, der freundlich und mitfühlend ist und der meinen Glauben an Jesus respektiert. Ich würde jemanden wollen, der mir hilft, dem medizinischen Personal die richtigen Fragen zu stellen, und der mich bei konkreten Entscheidungen unterstützt. Kurz gesagt, ich würde Dr. Butler wollen. Sie würde mir helfen, das Ende meines Lebens so zu gestalten, dass ich das Evangelium verkünde und Gott die Ehre gebe. Wenn sie nicht verfügbar wäre, würde ich dieses Buch noch einmal lesen.“
John Dunlop, Doktor der Medizin und Facharzt für Innere Medizin, Yale School of Medicine; Autor von Finishing Well to the Glory of God
„Dr. Butler hat mit diesem klaren und umfassenden Leitfaden, der uns durch die schwierigen und komplexen Themen der Versorgung in der letzten Lebensphase führt, eine Meisterleistung vollbracht. Obwohl das Buch Zwischen Leben und Tod für Patienten und ihre Familien geschrieben wurde, ist es ebenso für gläubige Schüler und Schülerinnen aus dem Bereich des Gesundheitswesens ein willkommenes und wertvolles Hilfsmittel, denn es vermittelt die notwendigen biblischen Grundlagen, um sich angesichts dieser Herausforderungen zurechtzufinden.“
Bill Reichart, Vize-Präsident von Campus and Community Ministries, Christian Medical & Dental Associations
„Unweigerlich stehen wir alle irgendwann einmal vor schwierigen oder sogar herzzerreißenden medizinischen Entscheidungen. Vielleicht müssen wir Entscheidungen treffen, die unsere eigene Versorgung betreffen oder, was noch schwieriger ist, die Versorgung eines geliebten Menschen. Um sich darauf vorzubereiten, solche Entscheidungen auf eine eindeutig christliche Art und Weise zu treffen, können Sie nichts Besseres tun, als Zwischen Leben und Tod zu lesen. Dieses Buch wird Sie informieren, ermutigen, stärken und dazu befähigen, so zu handeln, dass wir unsere Menschenwürde bewahren und gleichzeitig unserem Gott die Ehre geben.“
Tim Challies, Blogger und Betreiber der Internetseite Challies.com
„Einige unserer schwersten Entscheidungen werden erst am Lebensende getroffen. Welche medizinischen Behandlungen wollen wir angesichts des bevorstehenden Todes annehmen oder ablehnen? Selbst Christen, die Jesus lieben, fällt es schwer, diese Fragen zu beantworten, und wir brauchen erfahrene Ärzte, die uns über die verschiedenen Möglichkeiten und deren Vor- und Nachteile aufklären. Dr. Butler klärt auf, beantwortet Fragen und lädt den Leser auf eine unvergessliche Reise ein, die durch die anschauliche Prosa einer begnadeten Schriftstellerin und erfahrenen Unfallchirurgin lebendig wird. Dieses bemerkenswerte, christuszentrierte Buch ist voller Realitäts- und Seelenprüfungen und wird Christen und Gemeindeverantwortliche noch viele Jahre lang dabei unterstützen, diese endgültigen Entscheidungen aus dem Glauben und nicht aus der Angst heraus zu treffen.“
Tony Reinke, Journalist, Autor des Buches Wie dein Smartphone dich verändert: 12 Dinge, die Christen alarmieren sollten
„Dr. Butler hat ein bemerkenswertes, einzigartiges und hochaktuelles Buch geschrieben. Sie verbindet ihr medizinisches Fachwissen mit biblischer Barmherzigkeit und moralischer Einschätzung und erklärt anschaulich, was wir bei medizinischen Fragen, bei denen es um Leben und Tod geht, wissen müssen. Sie gibt keine vagen Ratschläge, sondern gründet ihre Empfehlungen auf medizinische Fakten, rechtliche Hintergründe, geistliche Prinzipien und Beispiele aus dem wirklichen Leben.“
Douglas Groothuis, Professor für Philosophie am Denver Seminary; Autor von Walking Through Twilight: A Wife’s Illness – A Philosopher’s Lament
„Das ist ein hervorragendes Buch. Die christliche Intensivmedizinerin Dr. Butler verknüpft verständliche Erklärungen detaillierter und komplexer medizinischer Sachverhalte mit ihrem fundierten Bibelwissen. Daraus ist ein Buch entstanden, das für Patienten, Angehörige und Verantwortliche in Kirchen und Gemeinden von unschätzbarem Wert ist, wenn sie sich den scheinbar unerschöpflichen Fragen der Intensivpflege und der Versorgung am Lebensende stellen müssen. Es lässt sich gut lesen, enthält Beispiele aus dem wirklichen Leben und strotzt nur so vor Barmherzigkeit und Gnade, sowohl ihrer eigenen als auch der unseres Erlösers.“
Robert D. Orr, Doktor der Medizin, Chirurg, Klinikethiker, Autor des Buches Medical Ethics and the Faith Factor
„Als Ehefrau eines Pastors, als Mutter, Tochter, Enkelin, Freundin, Nachbarin und Gemeindeglied wird das Leben von meinen Mitmenschen und mir immer wieder von den in diesem Buch aufgeworfenen Fragen überschattet. Wie können wir Kranken und Sterbenden am besten unsere Liebe zeigen? Woher wissen wir, wann wir nach medizinischen Maßnahmen streben müssen und wann wir unseren Angehörigen erlauben sollten, sich, wie Dr. Butler es ausdrückt, „in die Arme unseres Herrn fallen zu lassen“? Das sind komplexe Fragen ohne simple Antworten. Zwischen Leben und Tod bietet jedoch einen hilfreichen Rahmen biblischer Weisheit, um Licht in die ansonsten düsteren Szenarien zu bringen. Dr. Butler erklärt die komplexen medizinischen Fachausdrücke, die die ohnehin schon überforderten pflegenden Angehörigen ziemlich verwirren können. Und mit unerschrockener (aber nicht unsympathischer) Klarheit führt sie uns ans Krankenbett und erzählt, wie sich Wiederbelebungsmaßnahmen, ein Beatmungsgerät oder künstliche Ernährung anfühlen. Die tatsächlichen Auswirkungen und wahrscheinlichen Folgen solcher Behandlungen sind weit entfernt vom glamourösen Glanz medizinischer Fernsehdramen, aber wir müssen die nackte Realität kennen, um gottgefällige und gnädige Entscheidungen für uns und unsere Liebsten treffen zu können. Zum Glück hat auch dieses Buch ein Verfallsdatum. Eines Tages, wenn wir in der Gegenwart Christi versammelt sind, werden wir nicht mehr wissen müssen, wie wir Entscheidungen über den Tod treffen sollen. Aber in der Zwischenzeit bin ich froh, dass dieses Buch in meinem Regal steht.“
Megan Hill, Autorin der Bücher Praying Together und Contentment; Redakteurin bei The Gospel Coalition
„Bei allen Segnungen der modernen Intensivmedizin sind wir uns ihrer Schattenseiten noch nicht ausreichend bewusst: Was passiert, wenn Medizintechnik und Eingriffe nicht das Leben bewahren, sondern nur das Sterben verlängern? Mit ihrer fundierten medizinischen Ausbildung und Berufserfahrung lüftet Dr. Kathryn Butler den Vorhang und gewährt Einblicke in eine Reihe von lebensbedrohlichen Situationen, die uns oder den Menschen, die wir lieben, zustoßen können. In Zwischen Leben und Tod weist uns Dr. Butler auf die Hoffnung des Evangeliums hin und zeigt, wie christliche Nachfolge in einigen der quälendsten Momente des Lebens aussehen kann. Möge dieses Buch als nützlicher Leitfaden und Gesprächsgrundlage dienen, wenn wir uns auf den Tod vorbereiten und auf Christus blicken.“
Ivan Mesa, Buchredakteurin bei The Gospel Coalition
„Dr. Kathryn Butler nutzt ihr christuszentriertes Leben sowie ihre Erfahrungen als Unfallchirurgin, damit der Leser am Ende des Lebens eigenständig Entscheidungen zur Ehre Gottes in Jesus Christus treffen kann. Ihr Buch unterstreicht, dass wir durch die Gnade Gottes in Jesus Christus leben. Dr. Butler führt zahlreiche Bibelstellen an, die im Zusammenhang mit dem Leben und Sterben in Jesus Christus äußerst hilfreich sind. Es ist eine Pflichtlektüre für alle Christen, Kirchen- und Gemeindeleiter und medizinischen Fachleute, die sich mit dem Problem des Sterbens und den damit verbundenen Schwierigkeiten auseinandersetzen müssen.“
Bob Weise, emeritierter Professor für Praktische Theologie, Concordia Seminary
Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn.Römer 8,38-39
Einleitung
Mit einem Flüstern geriet der Albtraum von Bluttransfusionen und Notoperationen in Vergessenheit.
Als die Narkoseärztin den Schlauch entfernte, der ihn an das Beatmungsgerät fesselte, begann er zu keuchen und zu husten. Dann kniff er die Augen zusammen. Der aus der Sauerstoffmaske austretende Nebel befeuchtete sein Gesicht, und er sah seiner Frau in die Augen. Zum ersten Mal seit zwei Wochen sprach er, seine heisere Stimme war kaum zu hören: „Hallo, Schatz.“
„Du hast uns gefehlt“, antwortete sie. Tränen schossen ihr in die Augen, und ihre Glieder entspannten sich wie straffe Blütenblätter, die sich entfalteten. In diesem Moment schien ihr die Last des Autounfalls und das Drama, das sie so viele Tage lang durchlebt hatten, wie Seide von den Schultern zu gleiten.
Die Krankenschwestern, die Pfleger und ich strahlten. Geschichten wie diese waren dafür verantwortlich, dass wir unseren Beruf auf der Intensivstation ausüben wollten. Nach langen Nächten, in denen wir über ihn gewacht, an Reglern gedreht, Medikamente eingestellt und unsere rasenden Herzen beruhigt hatten, bedrohten ihn seine Verletzungen – seine zerfetzte Leber, seine vor Blut schäumende Lunge – nicht mehr. Seine Tage wurden nicht mehr von Laborergebnissen und den Einstellungen des Beatmungsgeräts bestimmt. Mit einem Luftzug hatte Gott Mann und Frau wieder zusammengeführt.
Während das Pflegepersonal noch seine Genesung feierte, ging ich in ein Nachbarzimmer, um nach einem anderen Patienten zu sehen. Meine Freude verflog, als ich durch die Tür trat und den älteren Herrn erblickte, der verkümmert auf seiner Matratze lag. Er war auf die gleichen Maschinen angewiesen, die auch den Überlebenden des Autounfalls gerettet hatten, doch seine Krankheit hatte einen völlig anderen Verlauf genommen. Ein schwerer Schlaganfall hatte ihn gelähmt und sein Sprachvermögen ausgeschaltet. Die Gelbsucht färbte seine Haut gelb wie Kurkuma. Seine Arme waren mit blauen Flecken übersät, da das Blut überall ins Gewebe gesickert war. Obwohl ein gewaltiges Netz von Schläuchen und Leitungen pumpte und pulsierte, versagten seine Organe. Er lag im Sterben.
Als ich im Türrahmen stand, blickte ich auf seine Frau, die neben ihm saß und die Hände schlaff im Schoß ruhen ließ. Wir hatten bereits Stunden damit verbracht, über Zahlen und Statistiken zu brüten. Wir hatten über Prognosen, Perspektiven, Krankheitsverläufe und Forschungsarbeiten gesprochen. Und doch hatte ich es während dieser langen Stunden versäumt, die Angst anzusprechen, die in ihrem Herzen brodelte.
„Habe ich überhaupt das Recht, über sein Leben oder Sterben zu entscheiden?“, fragte sie, als mein Team und ich nachgefragt hatten, ob die lebenserhaltenden Maßnahmen fortgesetzt werden sollten. „Müsste das nicht Gott allein entscheiden? Ich glaube nicht, dass er [ihr Ehemann] das alles hier überhaupt gewollt hätte, aber ich weiß nicht, was richtig ist.“ Sie suchte in unseren Gesichtern nach der Bestätigung, die ihr fehlte, und als wir ihr keine gaben, legte sie eine Hand auf seine, um die Konturen zu streicheln, die ihr einst so vertraut gewesen waren und die die Krankheit bis zur Unkenntlichkeit aufgequollen hatte.
Als ich dieses Mal in der Tür stand, hob sie nicht den Blick, um mich zu begrüßen. In dem schwachen Licht konnte ich kaum die silbrigen Linien erkennen, die ihre Wangen befleckten. Sie musste schon eine ganze Weile geweint haben. „Normalerweise ist er derjenige, der mir bei solchen schwierigen Entscheidungen hilft“, sagte sie, den Blick immer noch auf die Vergangenheit gerichtet. „Ich wünschte so sehr, mit ihm reden zu können. Ich habe das Gefühl, dass ich diejenige bin, die stirbt.“ Schließlich sah sie mich an, ihr Blick war müde und flehend. „Ich wünschte, Gott würde mir einfach sagen, was ich tun soll.“
Unter den richtigen Umständen rettet die moderne Intensivmedizin Leben. Die Momente, in denen ich den Herrn am intensivsten und aufrichtigsten angebetet habe, ereigneten sich innerhalb der Mauern der Intensivstation, wenn ich Zeuge seiner Gnade und Barmherzigkeit wurde, die sich in der Genesung eines Kindes manifestierten, das gegen eine weit fortgeschrittene Infektion ankämpfte, in einem Mann, der nach einem Motorradunfall um sein Leben rang, oder in einer Frau, deren Herz nach einem Infarkt in Mitleidenschaft gezogen war.
Doch die Medizintechnik hat auch eine dunkle Seite. Wenn eine Krankheit nicht geheilt werden kann, verlängern aggressive Eingriffe das Sterben, verursachen Leiden und rauben uns die Fähigkeit, in unseren letzten Tagen mit unseren Angehörigen und mit Gott zu sprechen. Beatmungsgeräte stehlen unsere Stimme und unser Bewusstsein. Wiederbelebung hat große Ähnlichkeit mit Körperverletzung. Auf der Intensivstation wacht man oft voller Panik auf, nur um festzustellen, dass man an ein fremdes Bett gefesselt ist und der vertrauten, tröstlichen Umgebung des eigenen Zuhauses beraubt wurde. Wir ringen nach Luft, nur um zu begreifen, dass wir keine Freiheit und keine Stimme mehr haben.
Wenn unsere todkranken Angehörigen nicht mehr mit uns sprechen können, ringen wir mit der schier unmöglichen Entscheidung, ob wir die Therapie fortsetzen oder abbrechen sollen, während wir uns danach sehnen, eine geliebte Stimme wieder zu hören. Wie die Frau, die die Hand meines sterbenden Patienten hielt, stürzen uns solche Nöte in Trauer, Zweifel, Angst, Wut und sogar Schuldgefühle, wenn wir darum ringen, ein Geflecht von Krankenhausinstrumenten mit der Stimme einer Mutter, dem Lachen eines Vaters oder dem Lächeln eines Kindes in Einklang zu bringen. In diesem Ringen werden wir außerdem von Glaubensnöten gequält. Der Tod ist ein zutiefst geistliches Ereignis, das uns die Menschen entreißt, die wir am meisten lieben, und uns angesichts des großen Leids an der Barmherzigkeit des Gottes zweifeln lässt, dem wir dienen. Was ist der Wille Gottes?, fragen wir uns. Warum lässt Gott zu, dass dieser von mir geliebte Mensch leidet? Was erlaubt die Bibel in diesem Fall? Solche Fragen betreffen unsere tiefsten Ängste und jenen Schmerz, der seinen Ursprung darin hat, dass wir als Ebenbilder Gottes von unserem Schöpfer losgerissen wurden. Der Tod ist der Lohn für unsere Sündhaftigkeit und der letzte Feind (vgl. Röm 6,23; 1Kor 15,26). Sogar Christus weinte angesichts des Todes (vgl. Joh 11,35).
Doch wenn Ärzte eine Hiobsbotschaft überbringen, ignorieren sie diese Nöte allzu oft und empfehlen in einem versöhnlichen Nachsatz die Krankenhausseelsorge – in diesem Punkt bin auch ich selbst schon schuldig geworden. Wir konzentrieren uns ausschließlich auf Monitore und Maschinen und verwandeln den Tod so von einem himmelwärts gerichteten Prozess in einen, der von Nomenklatur und Unsicherheit geprägt ist. Prozentzahlen trösten wenig, wenn wir uns nach Hoffnung sehnen. Medizinische Begriffe spenden keinen Trost, wenn die Seele nach Gott dürstet (Ps 42,2-3). Wenn die Medizin uns Entscheidungen über Leben und Tod aufbürdet, ohne sich dabei auf den Glauben und die Heilige Schrift zu stützen, haben wir keinen Halt und sind völlig orientierungslos. Wir stehen unter Zugzwang, ohne zu verstehen, wie die Katheter, Schläuche und Zahlen in Einklang mit der Wahrheit „Verschlungen ist der Tod in Sieg“ zu bringen sind (1Kor 15,54).
Der Wunsch zum Schreiben dieses Buch reifte in meinem Herzen während der zehn Jahre, die ich mich um Intensivpatienten kümmerte, zunächst während meiner Ausbildung in der Chirurgie und Intensivmedizin und dann als Unfallchirurgin, wo ich hauptsächlich auf der chirurgischen Intensivstation arbeitete. Im Laufe jenes Jahrzehnts hatte ich das Vorrecht, Menschen beizustehen, die sich in ihren schwersten Lebenssituationen befanden. Aber ich verabscheute die Diskrepanz zwischen den technischen Details, die ich erläuterte, und dem Schmerz, der mein Gegenüber zerriss. Wenn ich mich in meinem weißen Kittel vorbeugte, um über Wiederbelebung und Ernährungssonden aufzuklären, lastete das Gewicht der unausgesprochenen Fragen auf uns – Fragen nach Gottes Autorität, seiner Güte, der Heiligkeit des Lebens und dem Leid. Diese Fragen entsprangen den Grundsätzen des christlichen Glaubens, verbargen sich aber hinter der Routine und dem Ambiente eines säkularen medizinischen Systems.
Um Gott in der trostlosen Umgebung der Intensivstation zu ehren, müssen wir wieder mehr Klarheit über die Grenzen zwischen Leben und Tod schaffen, die durch den medizinischen Fortschritt verwischt wurden. Weil immer mehr Menschen im Krankenhaus sterben und nicht zu Hause, müssen wir die Möglichkeiten und Grenzen der Technologie, auf die wir uns stützen, anerkennen und sie in einer Weise nutzen, die das Evangelium in den Mittelpunkt stellt. Eine barmherzige, am Evangelium orientierte Beratung in der letzten Lebensphase erfordert, dass wir die medizinische Technologie durch die Linse des Himmels betrachten. Wir müssen den Jargon und die Statistiken entwirren und sie vor dem klärenden Licht des Wortes Gottes beurteilen.
Wenn ich von „lebensverlängernder“, „lebenserhaltender“ oder „organunterstützender“ Technik spreche, beziehe ich mich auf eine Reihe von medizinischen Maßnahmen, die versagende Organsysteme unterstützen oder ersetzen, z. B. Beatmungsgeräte für versagende Lungen und Dialyse für versagende Nieren. Ärzte wenden solche Maßnahmen in der Regel bei Notfällen bzw. auf der Intensivstation an, wenn ein Organversagen das Leben bedroht. Die einleitenden Kapitel dieses Buches dienen als Grundlage, um solche Therapien grob zu verstehen, und enthalten eine Erörterung der biblischen Grundsätze, die der christlichen Medizinethik zugrunde liegen. Die darauffolgenden Kapitel befassen sich mit spezifischen Formen lebenserhaltender Maßnahmen. Diese Ausführungen beziehen sich auf tatsächlich erlebte Krankengeschichten und wurden für den Laien verständlich formuliert. Medizinische Eingriffe, ihre Grenzen und ihr Heilungspotenzial werden dabei ehrlich erklärt.
Um die Privatsphäre der Patienten und Familien, die dieses Buch inspiriert haben, zu schützen, habe ich identifizierende Details, einschließlich Geschlecht und Diagnose, verändert. Außerdem habe ich an einigen Stellen individuelle Geschichten miteinander kombiniert, um wichtige Themen besser herausstellen zu können. Ich habe mich jedoch stets bemüht, ungeschminkt darzustellen, mit welchen Fragen und Nöten die Patienten und ihre Angehörigen konfrontiert wurden, wenn es auf das Lebensende zuging. Insbesondere die Gespräche sind authentisch, da ich mir im Laufe der Jahre zu vielen Fällen Notizen gemacht habe, weil ich viele der Begegnungen nicht vergessen wollte.
Dieses Buch wurde für Christen geschrieben, die schwierige Entscheidungen über lebensverlängernde Maßnahmen zu treffen haben, damit sie diese hoffentlich mit Frieden im Herzen und im Verstand angehen können. Obwohl Menschen mit geistlicher Verantwortung und Fachleute im Gesundheitswesen das Buch Zwischen Leben und Tod ebenso als hilfreich empfinden werden, habe ich es in erster Linie für Patienten und ihre Angehörigen geschrieben, die sich mit dem Undenkbaren auseinandersetzen müssen. Wenn Sie mit einer unheilbaren Krankheit konfrontiert werden oder mit einem Arzt über Ihre Wünsche für die Gestaltung Ihres Lebensendes sprechen wollen, empfehle ich Ihnen, dieses Buch komplett zu lesen. Wenn Sie sich jedoch im Wirbel der Ereignisse einer schweren Erkrankung befinden und eine akute Entscheidung treffen müssen und nur wenig Zeit zum Lesen und Verarbeiten haben, empfehle ich Ihnen, die Kapitel „Worum es geht: Eine Einführung ins Thema“ und „Weisheit beginnt mit dem Wort Gottes“ zu lesen und sich dann auf die Abschnitte zu konzentrieren, die sich auf Ihre spezielle Situation beziehen. Die Kapitel „Advance Care Planning“ und „Jemandem Gehör verschaffen“ geben Ihnen Hilfestellung bei der Entscheidungsfindung für sich selbst oder Ihre Angehörigen. Die Zusammenfassung der wichtigsten Punkte am Ende jedes Kapitels bietet einen schnellen Überblick, und in den Anhängen finden Sie relevante Ressourcen, einschließlich eines Beispiels für eine Vorausverfügung und Literaturempfehlungen. Ich habe mich bemüht, mich verständlich auszudrücken, habe jedoch im gesamten Buch medizinische Fachbegriffe in Klammern angegeben. Die Definitionen dieser Begriffe finden Sie im Glossar.
Ich habe nicht die Absicht, Ihnen vorzuschreiben, welche Therapie in welchem Fall zu wählen ist. Medizinische Entscheidungen sollten immer auf individueller Basis getroffen werden, in Zusammenarbeit mit einem Arzt Ihres Vertrauens und unter Berücksichtigung Ihrer einzigartigen Voraussetzungen, Werte und der jeweiligen Umstände. Vielmehr möchte ich informieren, den Fachjargon entschlüsseln und einen biblischen Rahmen für die wichtigsten Fragen bieten, denen Sie auf einer Intensivstation begegnen können. Ich hoffe, dass ich vielen Menschen Klarheit und Trost spenden kann: dem Sohn am Krankenbett, der Großmutter, die ihre Optionen abwägt, und der Patientin, deren Leben flackert und verblasst, bevor das kommende Leben beginnt.
Ich habe nie eine Bibelschule besucht. Ich schreibe als Nachfolgerin Christi und als Fachärztin für Intensivmedizin, die während ihrer Ausbildung auf der Intensivstation gläubig wurde und daraufhin fast täglich Patienten und Familien in herzzerreißenden Situationen beraten musste. Dabei stellte ich fest, dass ein Dialog über medizinische Entscheidungen im Kontext christlicher Werte schlichtweg fehlte. Mentoren aus dem Bereich der Seelsorge und der Ethik haben mich beim Schreiben dieses Buches freundlicherweise unterstützt, und ich bin ihnen aufrichtig dankbar für ihre Anregungen.
Wenn wir nun in ein Schattenreich eintauchen, bete ich für diejenigen von Ihnen, die mit den herzzerreißenden Fragen kämpfen, die auf diesen Seiten angesprochen werden. Ich bete, dass der Herr Ihnen, wie auch immer die Entscheidung ausfallen mag, Kraft und Frieden schenken möge, selbst in den düsteren Stunden, wenn das Leben schwindet. In der Begleitung von Sterbenden geht es nicht um richtig oder falsch, denn die beste Antwort ist die Gnade Gottes, die sich in Christus offenbart (Joh 3,16). Mögen wir in der Gewissheit ruhen, dass Gott über die Sünde triumphiert hat, dass seine Liebe zu uns unseren Verstand übersteigt und dass diese zerbrochene Welt nicht das Ende ist, wie groß auch immer unser Herzensleid sein mag und wie verheerend der Weg, der vor uns liegt. Wie Paulus schreibt: „Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn“ (Röm 8,38-39).
TEIL 1
Sterbend, aber lebendig in Christus
1.
Worum es geht: Eine Einleitung ins Thema
Sie erinnerte mich an einen vom Wind zerzausten Sperling. Ihre zierliche Gestalt zitterte, und ein Pfleger legte ihr eine beruhigende Hand auf die Schulter, als sie wankend neben dem Bett ihres Mannes stand.
Ihr Mann sah sie mit glasigen Augen an. Sein Brustkorb hob und senkte sich in einem kränklichen Rhythmus, wie der eines verkrüppelten Vogels, der mit den Flügeln flattert, aber nicht fliegt. Er wirkte entrückt; seine Gedanken schienen durch ein vergessenes Land zu wandern. Nach einer schwierigen Operation hatte er sich eine Lungenentzündung zugezogen, und als die Infektion seine Lungen verstopfte, fiel er in ein Delirium. Sein trüber Blick erfasste einen Raum, den keiner von uns sehen konnte.
„Er will das nicht!“, beharrte seine Frau.
Der Chirurg trat näher an sie heran. „Ich glaube, Sie verstehen mich nicht. Er hat die Operation bereits überstanden. Er hat es bis hierher geschafft. Ich denke, er würde beatmet werden wollen.“
„Nein, Doktor, das würde er nicht wollen“, erwiderte sie mit brüchiger Stimme. „Wir haben das so oft besprochen, und er ließ sich da auf keine Diskussionen ein. Er hat immer gesagt: ‚Wenn Gott mich nach Hause ruft, lasst mich gehen.‘“
Der Chirurg verschränkte die Arme. „Aber wie können Sie so sicher sein, dass Gott ihn gerade jetzt nach Hause ruft? Ihnen ist doch klar, dass er ohne den Schlauch sterben wird, oder?“
Ihr Gesicht rötete sich. Sie öffnete den Mund, um zu sprechen, aber einige Augenblicke lang fehlten ihr die Worte. Die Adern in ihrem Hals schwollen an. „Keinen Schlauch!“, brachte sie schließlich hervor.
Die Krankenschwester sah mir in die Augen und flehte mich stumm an einzugreifen. Ich überzeugte den Chirurgen, mich mit der Frau des Patienten unter vier Augen sprechen zu lassen.
„Bitte mach ihr klar, was los ist“, forderte er mich auf, als er das Zimmer verließ. Kopfschüttelnd ging er auf die Doppeltür der Intensivstation zu.
Ich setzte mich neben die Frau meines Patienten und nahm eine ihrer Hände in die meine. Mit ihrer anderen Hand umklammerte sie die Finger ihres Mannes. Im Gegensatz zu ihrem gebrochenen Geist erschien ihr Griff wie Schraubzwingen.
„Wollen Sie mir nicht ein bisschen von Ihrem Mann erzählen?“, fragte ich sie behutsam. „Was können Sie mir über ihn sagen?“
Ein dünnes Lächeln zierte ihr Gesicht, und ihre Miene hellte sich auf. Sie beschrieb mir ihre 60 Ehejahre, ihr partnerschaftliches Verhältnis, wie zärtlich sie miteinander umgingen und wie blind sie einander vertrauten. Sie schilderte, wie sich sein Gesundheitszustand im letzten Jahr verschlechtert hatte und dass er nicht mehr in der Lage war, sich mit den Dingen zu beschäftigen, die seinen Verstand und sein Herz begeisterten. Schmerzen, eingeschränkte Bewegungsfreiheit und Kurzatmigkeit fesselten ihn ans Haus. Besuche bei Freunden, die ihn einst belebt hatten, erschöpften ihn nun. Der Nebel aus Schmerzen und Medikamenten trübte sein Denken so sehr, dass er sich nicht mehr lange genug konzentrieren konnte, um zu lesen, nicht einmal, um die Bibel zu überfliegen, die auf seinem Nachttisch lag und die ihn jahrzehntelang durch Stürme geführt hatte. Sein eigener Vater war auf der Intensivstation einen langsamen, qualvollen Tod gestorben, und ihr Ehemann hatte sie angefleht, ihn vor solchen Eingriffen zu bewahren, deren Zeuge er damals gewesen war. Allein der Gedanke an ein Beatmungsgerät löste Entsetzen bei ihm aus.
„Er wollte noch nicht einmal diese Operation“, erzählte sie mir. „Ich habe ihn dazu überredet, weil ich so gerne noch mehr Zeit mit ihm verbringen wollte. Auf dem Weg ins Krankenhaus musste ich ihm versprechen, dass ich weder einen Beatmungsschlauch noch eine Herz-Lungen-Wiederbelebung oder etwas Ähnliches zulassen würde. Er konnte den Gedanken daran nicht ertragen. Er hat immer gesagt: ‚Lass mich nach Hause zu Gott gehen.‘“ Ihre Stimme wurde wieder brüchig. „Er liegt hier nur aus Liebe zu mir. Das Beatmungsgerät – das ginge zu weit.“
Ich drückte ihre Hand. „Ich glaube, er hat uns die Entscheidung abgenommen.“
Danach setzten wir den Verzicht auf künstliche Beatmung wieder in Kraft, den er vor der Operation ausgesetzt hatte.1 Ohne Beatmungsgerät würde seine Atmung aussetzen; aber ihn gegen seinen Willen an eines anzuschließen, wenn der Erfolg zweifelhaft und sein Leiden gewiss war, entbehrte jeglichen Anscheins von Mitgefühl. Wir konzentrierten uns nicht mehr auf Heilung, sondern auf Linderung. Der Chirurg war zwar enttäuscht, zeigte aber Verständnis.
Sein Pfleger blieb rund um die Uhr an seiner Seite, um ihm Medikamente zur Linderung von Schmerzen und Ängsten zu geben. Als ich die Intensivstation am Abend verließ, lag seine Frau neben ihm gekuschelt, ihren Kopf in seinem Schoß. Obwohl sein Blick weiterhin distanziert blieb, streichelte er ihr mit einer Hand den Arm.
Als ich am nächsten Morgen meinen Dienst antrat, saß die alte Dame wieder weinend am Bett ihres Mannes. In der Nacht war ihr Sohn wütend ins Krankenhaus gestürmt, weil sie sich gegen eine künstliche Beatmung entschieden hatte.
„Sie werden meinen Vater nicht umbringen!“, hatte er das Personal angebrüllt. „Ich kenne meinen Vater. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der bis vor sechs Monaten jeden Sonntag in den Gottesdienst gegangen ist. Er wäre mit so etwas nicht einverstanden.“ Bevor er hinausstürmte, drohte er damit, die Polizei einzuschalten.
Als ich eintrat, fand ich die Frau des Patienten zusammengesunken und gebrochen am Bett ihres Mannes vor, dessen Hand sie noch immer umklammert hielt.
„Frau Doktor, ich möchte keinen Ärger machen“, sagte sie. „Vielleicht sollte ich mich nicht so wehren und einfach tun, was alle anderen sagen. Aber ich habe es ihm doch versprochen. Ich weiß, dass er bereit ist zu gehen, wenn Gott ihn ruft. Er vertraut auf Gott, nicht auf all diese Maschinen. Was soll ich denn sonst tun?“
Eine fremde Umgebung
So dramatisch diese Situation auch erscheinen mag, die Zerrissenheit dieser Familie spiegelt die Realität in der heutigen Zeit der Intensivmedizin wider. Die Angehörigen befinden sich in der kaum tragbaren Verantwortung, sich in einer fremden Umgebung mit einem unverständlichen Vokabular für ihre Lieben stark machen zu müssen. Die Familienmitglieder zanken sich und werden sich nicht einig. Das Pflegepersonal kämpft mit den Tränen, während die Patienten bei jeder weiteren Drehung, jedem weiteren Verbandswechsel und jedem weiteren Nadelstich eine Grimasse ziehen. Im Mittelpunkt des Geschehens steht eine Frage, die meistens nicht ausgesprochen wird, wie nämlich der Glaube diesen herzzerreißenden, komplexen Verlauf beeinflusst. Ärzte, Patienten und Familien diskutieren offen über Prognosen, Prozentsätze und Vorausverfügungen. Innerlich aber rufen wir: „Bis wann, HERR?“ (Ps 13,2).
Dieser Aufruhr und dieser Stress lassen sich nicht so einfach mit unserer Vorstellung vom Ende des Lebens vereinbaren. Seit Jahrhunderten benutzt die westliche Kultur Euphemismen und poetische Formulierungen für den Tod. Wir alle sehnen uns danach, „sanft in die gute Nacht zu gehen“,2 und vergleichen wie Hamlet das Sterben mit dem Einschlafen3. Wir mildern die Anstößigkeit des Todes mit der Formulierung „jemand ist von uns gegangen“ ab, als wäre das Leben ein gemütlicher Spaziergang oder eine flüchtige Brise, die durch die Luft wirbelt, bevor sie verstummt. In der Literatur, der Philosophie, der Politik und bei den Nachbarn wird der Tod als ein gedämpftes Überschreiten einer Schwelle dargestellt, erfüllt von stiller Resignation, so subtil wie ein vorübergehendes Flüstern.
Und obwohl wir uns an solche Metaphern klammern, hat sich die Landschaft um uns herum verändert. Im Jahr 1908 verbrachten 86 Prozent der Menschen in den Vereinigten Staaten ihre letzten Tage zu Hause, im Kreise der Familie und lieb gewonnener Freunde und somit in den Räumen, in denen ihre Erinnerungen geprägt worden waren.4 Die Umstände des Sterbens spiegelten eine geistliche Realität wider: den Übergang aus der Gegenwart der Sünde zur vollkommenen Erneuerung in Christus. Es war zutiefst persönlich und von zwischenmenschlichen Beziehungen geprägt.
Ein Jahrhundert später halten wir immer noch an diesem Verständnis des Todes fest und bezeichnen das Zuhause als dessen rechtmäßige Domäne. Mehr als 70 Prozent der US-Amerikaner wünschen sich, ihre letzten Tage so zu verbringen, wie es unsere Vorfahren taten – zu Hause, im Kreise derer, die wir lieben.5 Doch in unserer Zeit tun dies nur 20 Prozent.6 Der Tod hat sich aus dem Zuständigkeitsbereich von Familien, Pastoren und der Stille des Zuhauses in sterile Räume verlagert, in denen Alarmsysteme piepen. Die meisten von uns sterben heute in irgendwelchen Einrichtungen, in der gesamten Bandbreite vom Alterspflegeheim bis zum Hospiz. Bis zu 25 Prozent der über 65-Jährigen verbringen ihre letzten Tage auf einer Intensivstation, hermetisch abgeriegelt von geliebten Freunden und den sichtbaren Zeugnissen ihrer Vergangenheit.7
Der medizinische Fortschritt der letzten 50 Jahre hat den Ärzten technische Möglichkeiten an die Hand gegeben, die unter den richtigen Umständen Leben retten können, aber auch den Tod von einem endlichen Ereignis in einen langwierigen und schmerzhaften Prozess verwandeln. Der Tod tritt heutzutage häufig in Schüben auf, in einer langsamen, verwirrenden Zerstückelung eines Lebens. Er findet in Institutionen und unter der Aufsicht von medizinischem Personal statt, weit entfernt vom Blick der Familie und dem Trost des Zuhauses. Wenn die Technik ein natürliches Geschehen zu einer komplizierten Tortur degradiert, gerät unser Verständnis ins Wanken. Poetische Formulierungen sprechen zwar vielleicht unser Herz an, versagen aber, wenn der Tod mit Beatmungsgerät, Brustkompression und Magensonde einhergeht. Sogar als Christen fällt es uns schwer, zu verstehen, wie sich die Zahlen und Geräte mit der Wahrheit aus Psalm 73,26 vereinbaren lassen: „Mag auch mein Leib und mein Herz vergehen – meines Herzens Fels und mein Teil ist Gott auf ewig.“ Gottes perfektes Timing erscheint weniger präzise, wenn Maschinen die Grenzen zwischen Leben und Tod verwischen. Wir können seinen Willen nicht erkennen, wenn wir uns für oder gegen Beatmungsgeräte und Wiederbelebung entscheiden müssen, indem wir nur noch Kästchen ankreuzen. Wir haben ein Verständnis vom Tod, das in der Hoffnung – im Evangelium – verwurzelt ist und nicht mit den erschütternden Entscheidungen übereinstimmt, die unsere letzten Momente kennzeichnen.
Ein beunruhigendes Schweigen
Da das Sterben nicht länger im häuslichen Bereich, sondern meist im Krankenhaus geschieht, wird die Realität des Todes vor einer ganzen Kultur versteckt. Mit der Zeit schrumpft die Zahl derer, die den Tod kennen, bevor er uns persönlich trifft. Unsere ohnehin vorhandene Angst vor dem Sterben vertieft sich noch, wenn er hinter dem Unbekannten lauert. Selbst Ärzte geben zu, dass sie Gespräche mit ihren Patienten über die letzte Lebensphase vermeiden, weil sie befürchten, dadurch emotionales Leid auszulösen.8 Das Thema verunsichert uns, und so sprechen nur wenige von uns offen über ihre letzten Tage. Wir ziehen es vor, diese Angelegenheit aus unseren Köpfen zu verdrängen, bis sich die Notwendigkeit ergibt.
Leider werden die meisten von uns nicht in der Lage sein, ihre Wünsche zu formulieren, wenn die Zeit gekommen ist, geschweige denn unter Gebet über Gottes Willen nachzudenken. Schwere Krankheiten führen häufig zu Bewusstseinsstörungen, Delirium und Hirnausfällen, die uns desorientiert, paranoid und sogar halluzinierend zurücklassen. Der Silikonschlauch, der zur Unterstützung eines Beatmungsgeräts erforderlich ist, blockiert die Stimmbänder, sodass man nicht mehr sprechen kann. Damit der Patient den Schlauch in den Atemwegen toleriert, benötigt er sedierende Medikamente, die sogar die nonverbale Kommunikation verhindern. Die Intensivpflege lässt den Betroffenen nicht nur verwirrt zurück, sondern beraubt ihn auch noch der Stimme.
Wenn wir vor lauter Angst nicht rechtzeitig über unsere Sterblichkeit sprechen möchten, bürden wir den Menschen, die wir lieben, kaum zumutbare Entscheidungen auf. In einer kürzlich durchgeführten nationalen Umfrage hatten nur 26,3 Prozent der befragten Erwachsenen eine Vorausverfügung ausgefüllt, d. h. ein Dokument, das die Behandlungswünsche für den Fall regelt, dass wir nicht mehr für uns selbst sprechen können.9 Wenn Ärzte nicht direkt mit uns kommunizieren können und ihnen von uns keine Vorausverfügungen zur Orientierung vorliegen, wenden sie sich an unseren gesetzlichen Betreuer oder an die nächsten Angehörigen, die dann die Entscheidungen treffen müssen. Doch viele Familienmitglieder und Freunde fühlen sich dieser Aufgabe nicht gewachsen. Die gleichen Ängste, die uns daran hindern, offen über den Tod zu sprechen, führen dazu, dass wir unsere Wünsche vor denjenigen verbergen, die letztendlich die schweren Entscheidungen für uns treffen werden.
Selbst wenn wir eine Vorausverfügung ausfüllen, sind solche Dokumente oft zu stark vereinfacht und spiegeln nicht die Realität der Versorgung am Lebensende wider.10 Standardformulare reduzieren komplexe und sehr nuancierte Themen auf eine Reihe von Ankreuzfeldern. Sie verlangen von uns, dass wir über eine Zukunft nachdenken, über die wir nur wenig wissen, und dass wir mit einem Schwarz-Weiß-Denken urteilen, das keinen Mittelweg zulässt. Wir erklären auf solchen Formularen, dass wir ein Gerät zur künstlichen Beatmung entweder akzeptieren oder nicht. Wir geben an, dass wir Herzdruckmassagen ablehnen oder nicht. Ein solch nüchterner, konkreter Ansatz lässt die chaotischen Gegebenheiten der Intensivpflege außer Acht, einem Bereich, in dem es viele Unabwägbarkeiten gibt. Wenn Sie auf einer Vorausverfügung „Verzicht auf künstliche Beatmung“ angekreuzt haben, würden Sie dieser Maßnahme auch dann widersprechen, wenn sie nur für eine vollständig reversible Situation notwendig ist? Was wäre denn, wenn Sie nur für 24 Stunden lang beatmet werden müssen? Oder wenn die Unterstützung zwar zwei Wochen dauern würde, Sie sich aber danach erholen und nach Hause zurückkehren könnten? Ein Kästchen kann solche Feinheiten kaum beschreiben. Der tatsächliche Nutzen einer Vorausverfügung hängt von dem Gespräch mit Ihrem Arzt beim Ausfüllen und der ausdrücklichen Dokumentation Ihrer Wertvorstellungen ab, nicht von dem Formular selbst.
Der Wert von Vernunft
Wenn wir uns nicht dazu geäußert haben, welche lebenserhaltenden Maßnahmen wir wünschen, haben unsere Angehörigen wenig Anhaltspunkte. Von der Tür eines Krankenhauszimmers aus betrachtet kann ein genesender Patient genauso aussehen wie einer, der um sein Leben kämpft. In beiden Fällen benötigen wir möglicherweise eine künstliche Beatmung, während sedierende Medikamente uns in der Bewusstlosigkeit festhalten. Eine Reihe von Ständern mit Infusionsbeuteln und Pumpen wird uns umgeben. Drähte von Monitoren winden sich um unsere Brust und Kopfhaut. Der verstörte Ehepartner neben dem Krankenbett kann den drohenden Tod nicht mehr von einem langsamen Genesungsprozess unterscheiden.
Die Unterscheidung zwischen lebensbedrohlichen Erkrankungen und zeitlich begrenzten Zuständen mit nur vorübergehendem Unterstützungsbedarf setzt voraus, dass man die Zahlen richtig interpretieren kann: die Einstellungen des Beatmungsgeräts, die Medikamentendosierung, die Laborwerte, die Röntgenuntersuchungen und die Vitalzeichen. Die spezifischen Krankheitsprozesse und ihre Behandelbarkeit sind von entscheidender Bedeutung. Um sie zu verstehen, ist zumindest ein ausführliches Gespräch mit einem Arzt erforderlich, der die Zahlen und Statistiken auch für Laien verständlich machen und die Situation für die Familie nachvollziehbar darstellen kann.
Leider fallen die Erfahrungen in Bezug auf die Kommunikation mit Klinikärzten sehr unterschiedlich aus. Ärzte, die sich nicht mit Palliativmedizin auskennen, geben an, dass es ihnen unangenehm ist, Fragen zum Lebensende zu erörtern. Sie haben Bedenken und vermeiden solche Gespräche lieber, weil die Prognose unklar und die Zeit knapp ist, die Patienten emotional belastet sind und man als Arzt für solche Situationen nicht ausreichend ausgebildet wurde. In akuten Fällen müssen wir sofortiges Vertrauen in einen Arzt setzen, den wir bislang nicht kannten. Studien zeigen, dass Ärzte in solchen Situationen eher zu aggressiven Therapien neigen, die möglicherweise nicht unseren Wünschen entsprechen.11 In den USA wird einer von zehn Patienten, die Mitglied in der öffentlichen Medicare-Krankenversicherung sind, in seiner letzten Lebenswoche operiert, obwohl nur zehn Prozent ihre letzten Tage im Krankenhaus verbringen möchten.12
Wenn man von ungewohnten medizinischen Details überfordert ist, muss man sich mit aller Kraft auf seine Zuversicht in Christus stützen. In einer Studie über die Dynamik zwischen Ärzten und den Angehörigen sterbender Patienten wurde jedoch nur in 20 Prozent der Gespräche das Thema Spiritualität angesprochen, obwohl 77,6 Prozent der Personen, die stellvertretende Entscheidungen treffen, angaben, dass ihnen der Glaube wichtig sei.13 In der gleichen Studie brachten die Angehörigen das Thema Spiritualität in der Mehrzahl der Fälle selbst zur Sprache, und nur in 20 Prozent dieser Fälle gingen die Ärzte auf dieses Thema ein. Umfragen unter Ärzten und Pflegekräften zeigen, dass die meisten zwar die religiösen Bedürfnisse ihrer Patienten am Lebensende berücksichtigen möchten, sich aber in der Regel nicht wohl dabei fühlen, Gespräche über den Glauben zu führen.14 Ärzte und Pflegekräfte berichten von einer unzureichenden Vorbereitung auf Gespräche über religiöse Fragen, meinen aber auch, dass diese nicht in ihren Aufgabenbereich fallen würden.15