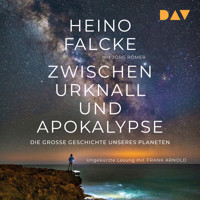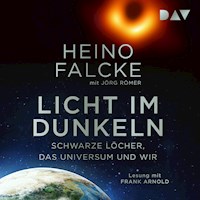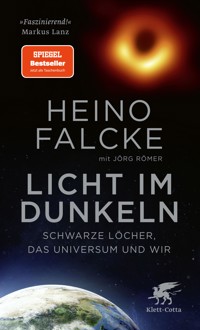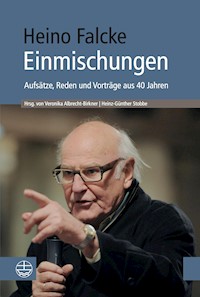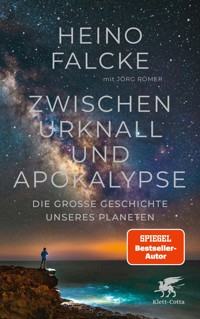
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Klett-Cotta
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
»Heino Falcke ist der Mario Götze der Radioastronomie.« Jörg Thadeusz, WDR Vom Geheimnis des Lebens und von der Suche nach der Geschichte der Menschheit Der Astrophysiker Heino Falcke begibt sich mit dem Wissenschaftsjournalisten Jörg Römer auf die Suche nach den Ursprüngen unseres Universums und unserer Zivilisation. Sie fragen nach: Was war am Anfang? Woher kommt das Leben? Wie konnte unsere heutige Welt entstehen? Welche Rolle spielt Gott für unser Dasein? Wie geht es mit uns weiter? Eine atemberaubende Reise vom Anfang bis zum Ende unserer Welt. Seit Urzeiten erzählen Menschen sich mythische Geschichten über die Entstehung und den Untergang der Welt. Dank dramatischer Durchbrüche in der Forschung haben wir heute eine neue, große Erzählung über unseren Ursprung und unsere Zukunft. Aus einem Urchaos entstand vor 13,8 Milliarden Jahren in einem schicksalhaften Moment das erste Licht des Kosmos, danach Materie, Sterne, Galaxien und Planeten. Von einer Klimakatastrophe zur nächsten schlingernd entwickelte sich unsere Erde. Am Ende steht der weite Blick in die Zukunft: Hat die Welt ein Ende oder gelingt uns der Weg durch die Apokalypse? Heino Falcke und Jörg Römer gehen Herkunft und Zukunft unserer Welt auf den Grund. Sie sprechen mit Persönlichkeiten aus Quantenphysik, Evolutionsbiologie, Klimaforschung, Philosophie und Theologie und entwerfen eine anschauliche und lebendige Geschichte unseres blauen Planeten und der Entwicklung des Menschen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 746
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Heino Falcke
mit Jörg Römer
Zwischen Urknall und Apokalypse
Die große Geschichte unseres Planeten
Klett-Cotta
Impressum
Dieses E-Book basiert auf der aktuellen Auflage der Printausgabe zum Zeitpunkt des Erwerbs.
Klett-Cotta
www.klett-cotta.de
J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH
Rotebühlstraße 77, 70178 Stuttgart
Fragen zur Produktsicherheit: [email protected]
© 2025 by J. G. Cotta’sche Buchhandlung Nachfolger GmbH, gegr. 1659, Stuttgart
Alle Rechte inklusive der Nutzung des Werkes für Text und Data Mining i.S.v. § 44b UrhG vorbehalten
Cover: Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung einer Fotografie von © Evgeni Tcherkasski
Lektorat: Eckard Schuster, München
Gesetzt von Dörlemann Satz, Lemförde
Gedruckt und gebunden von Friedrich Pustet GmbH & Co. KG, Regensburg
ISBN 978-3-608-96655-8
E-Book ISBN 978-3-608-12372-2
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
Der Ursprung
Auge in Auge mit dem Urknall
Der Ur-Doppelknall
Die Schöpfung hat einen Sprung in der Schüssel
Die Naturkonstanten – ein 6er im Lotto?
Nicht Universum, sondern Multiversen?
Alles nur Einbildung?
Dunkle Energie – die Hefe des Universums
Der erste unbewegte Beweger – die alte Frage nach Gott
Kapitel 2
Materie, Sterne, Galaxien und Schwarze Löcher
Ein bescheidener Entdecker
Die ersten Sekunden des Weltalls – Geburt der Materie
Die ersten drei schicksalhaften Minuten – die Rettung der Neutronen
Die Dunkle Materie übernimmt
Erste Atome – die Hochzeit von Protonen und Elektronen
Kosmische Hintergrundstrahlung – mehr als nur
ein
Nobelpreis
Das »Dunkle Zeitalter« des Kosmos
Wolken kollabieren, Sterne werden geboren
Sterne – die wahren Alchemisten
Das Leben der ersten Sterne
Wenn ein Stern erstirbt, bringt er neue Frucht
Die ersten Galaxien
Das Zeitalter der Sternenblüte
Staubige Wolken bekommen Geschmack und Geruch
Die Kraft der Schwarzen Löcher
Auf dem absteigenden Ast – das Universum wird ruhiger
Kapitel 3
Die Erde wird geschmiedet
Kosmische Narben – ein Krater in Arizona
Die Geburt unserer Sonne
Die Krippe der Planeten – eine staubige Scheibe
Ein Schmelzofen für Silikate und anderes Gestein
Eine Bleiuhr beginnt zu ticken, neue Moleküle entstehen
Planetenembryos
Die Erde und ihre Geschwister wachsen heran
Planeten – Ringkampf der Giganten
Der Einschlag von Theia und die Geburt des Mondes
Die Erde wird bombardiert
Kapitel 4
Ozeane und Atmosphäre
Die Hades-Zeit
Die Geburt der Atmosphäre und der Treibhausgase
Wie Wasser und Ozeane auf die Erde kommen
Schwache Sonne, starker Mond
Die ersten Kontinente erheben sich
Kohlendioxid wird recycelt
Kapitel 5
Der große Schleier – die Entstehung des Lebens
Die Jägerin der außerirdischen Welten
Leben nur auf der Erde?
Leben aus dem Labor?
Der Ursprung des Lebens
Die Gaia-Hypothese
Es grünt – endlich Sauerstoff
Überlebenskampf auf der Schneeball-Erde
Rettung durch Plattentektonik und Asteroiden
Die Erde taut und atmet auf
Zellen mit Teamspirit
Die erneute Schneeball-Erde
Leben blüht auf und wächst
Die kambrische Explosion des Lebens
Kapitel 6
Die Eroberung der Kontinente
Ein Wald stirbt
Das Leben springt aufs Land
Das große Sterben beginnt
Die ersten Landtiere
Schreitende Fische
Der Sumpfkontinent Pangaea und das Kohlezeitalter
Das Land wird getrocknet und gesalzen – und unseren Vorfahren wird es warm ums Herz
Das Perm-Trias-Massenaussterben
Zwei Millionen Jahre Dauerregen für die Dinos
Der Jurassic-Park füllt sich
Die Blütenpflanzen übernehmen
Der Einschlag von Mexiko und das Ende fast aller Dinos
Ein unglaubliches Comeback – Klimakapriolen im Paläogen
Gräser übernehmen das Kommando
Kosmischer »Klimawandel«
Landbrücken kommen und gehen
Der kosmische Rhythmus der Eiszeiten – Fitnesstraining für das Leben
Kapitel 7
Der erste Mensch
Die Jäger der verlorenen DNA
Von den Bäumen, ihr Affen!
Mit Kopf und Hand
Vom Homo erectus zum Homo sapiens
Afrika – die Wiege der Menschheit
Der Neandertaler
Geschichten vom Lagerfeuer
Geschichten vom Sternenhimmel
Wir müssen mal miteinander reden
Sex mit den neuen Nachbarn
Soziale Intelligenz – die Kraft der Gemeinschaft
Die Frucht der Erkenntnis
Kapitel 8
Vom Jäger zum Bauern – von der Sintflut zur Zivilisation
Im Gletschergarten
Es taut – die große Flut
Die Erfindung der Landwirtschaft
Feste Siedlungen, Dörfer und erste Städte
Klima macht mobil … und sesshaft
Keramik – Landwirtschaft in Topfform
Migration – neue Bauern, alte Jäger und Jamnaja
Kalender – Leben im Rhythmus von Planeten und Sternen
Metallverarbeitung – es ist nicht nur Gold, was glänzt
Bronze – es darf etwas härter sein
Das Leben wird vergoldet
Kunst und Religion – der Himmel wird in Metall gegossen
Von der Bronze zum Eisen
Umbrüche durch Eisen und Klima
Die Eisenzeit dauert eigentlich noch an
Kapitel 9
Von Städten zu Imperien
Ein Prachtbau, verwinkelt wie ein Labyrinth
Von der Stadt zur Megacity
Städte erweitern Horizonte
Städte befeuern Religionen
Babylon übertrumpft Uruk
Das Alte Ägypten – von Klimaflüchtlingen zum Pharaonenstaat
Die größten Grabsteine aller Zeiten
Die Wiege des europäischen Denkens – das antike Griechenland
Von Weltbildern und Wissenschaftlern
Das Römische Reich
Der Aufstieg des Christentums – ein geistliches Imperium
Wenn Klimaturbulenzen durch die Jahrhunderte fegen
Der ewige Kreislauf der Imperien
Wenn die Neugier neues Wissen schafft
Kapitel 10
Apokalypse und Hoffnung
Zukunftsängste
Industrielle Revolution
Der Mensch verändert Umwelt und Klima
Essen und Klima
Revolution in der Physik – das Atomzeitalter
Vom Atomzeitalter zum Informationszeitalter
Klimawandel – ein Blick in die Zukunft
Rettung durch KI, Roboter und Marskolonien?
Zukunft und Glaube
Es gibt Grund zur Hoffnung
Die Kraft der Gemeinschaft
Wandernde Kontinente und feurige Vulkane
Geoengineering und die heiße Sonne
Generationenübergreifendes Handeln und die Zähmung des Planeten
Planetare Verteidigung gegen kosmische Einschläge
Die kosmische Apokalypse
Von der Sonne verschlungen?
Erkaltete Liebe – die Sonne verglimmt
Das Ende der Milchstraße und der Sterne
Das Universum verblasst
Sternenzombies
Das Geheimnis der Quantenfelder – das Universum verdampft
Über Hawking hinaus?
Das Higgs-Feld und die Welle der Zerstörung
Alles aus?
Zwischen Genesis und Apokalypse
Die wundersame Komplexitätsvermehrung
Unsere kosmische Sekunde
Dank
Chronologie unserer Welt
Tafelteil
Bildnachweis
Haupttext
Bildtafel
Anmerkungen
Vorwort
Kapitel 1: Der Ursprung
Kapitel 2: Materie, Sterne, Galaxien und Schwarze Löcher
Kapitel 3: Die Erde wird geschmiedet
Kapitel 4: Ozeane und Atmosphäre
Kapitel 5: Der große Schleier – die Entstehung des Lebens
Kapitel 6: Die Eroberung der Kontinente
Kapitel 7: Der erste Mensch
Kapitel 8: Vom Jäger zum Bauern – von der Sintflut zur Zivilisation
Kapitel 9: Von Städten zu Imperien
Kapitel 10: Apokalypse und Hoffnung
Personenregister
Sachregister
Für Eleaund für alle Kinder, die uns Barmherzigkeit, Liebe und Lebensmut lehren
Vorwort
Unser Anfang liegt im Dunkel des Himmels verborgen – buchstäblich und sprichwörtlich. Seit Jahrtausenden erzählen prophetische Geschichten von unserem Ursprung wie auch von unserem Untergang, und sie faszinieren Menschen bis heute. Die europäische Kulturgeschichte ist dabei stark durch die Erzählungen der biblischen Genesis und der Apokalypse geprägt. Sie sind Türen zur Gedanken- und Erfahrungswelt unserer Vorfahren, ein leises Echo aus frühen Zeiten. Wie haben sie sich die Entstehung der Welt vorgestellt? Der Evolutionsbiologe Carel van Schaik und der Historiker Kai Michel nennen die Genesis sogar ein Tagebuch der Menschheit.[1]
Heute gibt es neue wissenschaftliche Erzählungen und neue Propheten, die uns mit wissenschaftlicher Akribie zurück in die Vergangenheit, aber auch vorwärts in die Zukunft schauen lassen. Propheten der neuen Zeit, die mit ihren Fernrohren und Teleskopen zurückschauen und horchen, versuchen die ersten Worte der Schöpfung, die wir Naturgesetze nennen und die heute noch nachhallen, zu ergründen. Aber auch für sie liegt der wahre Anfang hinter einem undurchdringlichen glimmenden Vorhang verborgen.
Dass es einen Anfang gab, aus dem Menschen entstanden sind, die fragen, rechnen und sehen können, ist eine der beeindruckendsten Tatsachen unseres Universums. Bis wir in der Lage waren, zu dieser Erkenntnis zu kommen, bis wir zu denen geworden sind, die wir heute sind, war es ein langer, gewundener und wundersamer Weg.
In diesem Buch nehme ich Sie mit auf eine persönliche Entdeckungsreise durch die Zeit, von der Geburt unseres Universums über die Entstehung unserer Erde bis zur Entwicklung des Lebens und des Menschen und ein Stück darüber hinaus. Wir sind Kinder des Kosmos, der unser Denken und unser Sein bis heute beeinflusst. Viele neue Aspekte dieser Geschichte haben wir dank moderner Forschung in den letzten Jahrzehnten neu oder zumindest besser entschlüsseln können. Das Schreiben dieses Buches wurde so auch für mich zu einer packenden Reise. Vieles durfte ich dabei selber neu entdecken, aber manch großes Rätsel wartet noch immer auf seine Lösung. Als aktiver Wissenschaftler habe ich das große Privileg, mein Leben lang ein neugieriges Kind sein zu dürfen und meine vielen Fragen herausragenden Experten zu stellen, die ich mal gezielt, mal zufällig treffe und die mich mit ihrem Wissen und ihrer Weisheit immer wieder in neue Welten entführen. In der Wissenschaft geht es nicht nur darum, Artikel zu schreiben, man muss auch miteinander im Gespräch sein. Auch diese Begegnungen fließen in dieses Buch ein, und ich bin dankbar all den Kollegen gegenüber, die mich in den letzten Jahren immer wieder haben staunen lassen.
Es ist somit ein Reiseführer durch Raum und Zeit geworden. Dabei können wir weder alle Epochen und Regionen ausführlich besuchen, noch immer die chronologische Reihenfolge der Weltgeschichte streng einhalten. Auf der Suche nach wichtigen Entwicklungsschritten der Menschheit verweilen wir hier und da etwas länger, wenn es mich besonders interessiert; manchmal ist es nur eine kurze Stippvisite, und an vielem eilen wir auch schnellen Schrittes vorbei. Die Endnoten im Onlineteil sollen helfen, tiefer einzusteigen, wenn man möchte. Am Rand sind manchmal Zeitangaben zu finden, um die Orientierung zu erleichtern. Dabei bedeutet »Ga« Milliarden Jahre und »Ma« Millionen Jahre.
Machen wir uns also nun gemeinsam auf eine besondere Zeitreise und lauschen den alten und neuen Propheten. Vielleicht verstehen wir ein wenig besser, wer wir sind und wohin wir gehen, wenn wir begreifen, woher wir kommen.
Kapitel 1
Der Ursprung
»Was war am Anfang?«, fragte das Kind. »Am Anfang war das Wort«, sagte der Prophet.
»Am Anfang war kein Mensch, keine Materie, kein Licht und keine Zeit. Nur das Wort schwebte brütend über dem Tohuwabohu. Und doch war schon alles da. Jeder Gedanke, der jemals gedacht wurde; jede Geschichte, die jemals geschrieben wurde; jeder Traum, der jemals geträumt wurde, war schon da, ohne dass sie schon gedacht, geschrieben oder geträumt waren. Denn alles, was jetzt ist, entstand aus dem, was damals noch nicht war – mithilfe des Wortes, das so ist, wie es ist und das Innere unserer Welt zusammenhält. Es sind die ungeschriebenen Regeln, nach denen sich alles entwickelt. Aus diesem mächtigen Wort des Anfangs entstanden Licht, Zeit, Materie, Erde, Mond und Sterne, Pflanzen, Tiere und letztlich der Mensch.
Der Anfang des Wortes aber liegt hinter einem undurchdringlichen Vorhang verborgen. Was vor dem Anfang war, weiß kein Mensch. Was nach dem Anfang kam, können wir ahnen und danach schauen mit unserem Geist und unserem Gerät. Das Wort, das den Kosmos schuf, schuf auch dich, mein Kind.«
Auge in Auge mit dem Urknall
Im Oktober 2021 führte mich Thomas Hertog, einer der letzten Studenten des berühmten Physikers Stephen Hawking, in der belgischen Stadt Leuven (Löwen) durch eine Ausstellung, die Teil eines großen Events mit dem passenden Namen »Knallfestival« war – ein Stadtfestival über den Urknall. Die Ausstellung in der ehrwürdigen Universitätsbibliothek aus dem 17. Jahrhundert hatte er selbst mit zusammengestellt. Sie enthielt Kunstwerke sowie Memorabilia aus der Wissenschaft. In einem Raum hingen ein paar unscheinbare Bleistiftzeichnungen auf vergilbtem Millimeterpapier an der Wand, bei denen jemand fein säuberlich geschwungene Linien gezogen hatte. Alle Linien fangen links unten in einem Punkt an, streben nach oben und gehen dann fächerförmig auseinander. Einige Kurven beschreiben einen weiten Bogen und fallen wieder zu Boden, andere verharren erst, um sich dann immer schneller nach oben zu schrauben und scheinbar im Unendlichen zu verschwinden.
»Das sind Originalzeichnungen von Georges Lemaître«, sagte Thomas fast beiläufig. Mir stockte der Atem. Normalerweise bin ich nicht leicht zu beeindrucken, und als Protestant bin ich auch kein Freund von Heiligen- oder Reliquienverehrung, aber ich hatte plötzlich das Gefühl, mich auf heiligem Boden zu befinden. Wie Moses vor dem brennenden Dornbusch stand ich vor diesem Stückchen Papier. Zum Glück zog es mir nur im übertragenen Sinne die Schuhe aus, in denen ich schon den ganzen Tag unterwegs war.
Diese Grafik erkennt jede Astronomiestudentin, die jemals eine Vorlesung über Kosmologie gehört oder auch nur ein entsprechendes Lehrbuch angeschaut hat, sofort. Sie beschreibt die Entwicklung des gesamten Universums in einem einfachen Bild. Auf der x-Achse ist horizontal die Zeit eingetragen, die y-Achse zeigt in vertikaler Richtung die Größe des Universums.
»Als er das etwa 1927 oder 1928 gezeichnet hatte, war Lemaître der einzige Mensch auf der ganzen Welt, der verstanden hatte, was der Lauf des Universums ist«, fügte Thomas hinzu. »Und hier, siehst du diese kleine Beschriftung?« Ich musste meine Brille aufsetzen, um zu erkennen, was dort klein mit blauer Tinte geschrieben steht: »t = 0«, las ich. Der Buchstabe »t« steht in der Physik für die Zeit, von »tempus« im Lateinischen oder heute oft »time« im Englischen. »t = 0« bedeutet: Hier ist der Ursprung der Zeit, der absolute Nullpunkt der Zeitkoordinate unseres Universums. Unser Weltall hat einen Anfang! Heute nennen wir das den Urknall. Was für eine fundamentale Entdeckung, was für ein monumentaler Gedanke! Dieser Gedanke war in den 20er-Jahren des letzten Jahrhunderts eine absolute Häresie, und Lemaître, der nicht nur Universitätsprofessor, sondern nach seinen Erlebnissen im Ersten Weltkrieg auch Priester geworden war, stand damals unter Generalverdacht, sein biblisches Weltbild mit der reinen Wissenschaft zu vermengen.
Der berühmte und in seiner Zeit tonangebende Physiker Sir Arthur Eddington, der in einer kühnen Expedition mithilfe einer Sonnenfinsternis die Relativitätstheorie von Albert Einstein als Erster bewiesen hatte, nannte den Gedanken, das Universum könne einen Anfang gehabt haben, »widerlich«. Und Einstein sagte über Lemaître, dass seine Mathematik zwar korrekt, aber seine Physik »abscheulich« sei.
Ja, in der Physik wird nicht immer mit dem feinen Florett gefochten, sondern manchmal auch mit der Keule. Dabei hatte der arme Lemaître nur ausgerechnet, was die Relativitätstheorie von Albert Einstein hergab. Aber anscheinend war der Gedanke an einen physikalischen Ursprung des Alls damals selbst für den genialen Begründer der Relativitätstheorie zu groß – er traute seiner eigenen Theorie nicht. Noch kühner war aber, dass Lemaître sogar schon sichtbare Anzeichen für sein neues Modell des Kosmos ausgemacht hatte. Er stellte nämlich fest, dass die gerade erst neu entdeckten Milchstraßen, die aus Hunderten von Milliarden Sternen bestehen, alle von uns wegstreben.
1 Der Bedenker des Urknallmodells Georges Lemaître (rechts) im Jahr 1933 im Gespräch mit Albert Einstein, dessen Allgemeine Relativitätstheorie er zur Berechnung seiner Weltmodelle benutzt hatte.
Es waren nur zwei Absätze in einem französischsprachigen Artikel (den damals viele ignorierten), in dem das Hubble-Lemaître-Gesetz, das heute aber über jeden Zweifel erhaben ist, formuliert wurde: Je weiter wir hinausschauen ins All, je weiter wir dadurch in die Vergangenheit zurückschauen, desto schneller fliegen alle Galaxien auseinander und voneinander weg.
Lemaître war ein wahrer Visionär und Prophet einer neuen Zeit, der bis zu seinem Lebensende nach weiteren Beweisen für seine kühne Theorie suchte. Weltruhm, den er nicht suchte, blieb ihm zu Lebzeiten verwehrt. Es brauchte vier Jahrzehnte und drei weitere Nobelpreise, bis deutlich wurde, dass einer dieser dünnen Bleistiftstriche Lemaîtres unserem heutigen Universum entspricht.
Die Galaxien in unserem Universum gleichen aufgeklebten Punkten auf der Oberfläche eines aufgeblasenen Luftballons, der einstmals zusammengezogen auf kleinstem Raum in einer Tüte lag. Natürlich ist unser Raum dreidimensional, aber einen zusammengeknüllten dreidimensionalen Raum können wir uns nicht gut vorstellen. Heute ist das Universum groß und ausgedehnt, der Ballon ist aufgeblasen. Die Galaxien sind weit voneinander entfernt, aber alle Punkte in unserem heutigen Weltraum, so weit sie heute auch auseinanderliegen möchten, liegen damals, im Anfang, ganz dicht beieinander.
Das ist eigentlich unvorstellbar. Der Ort, an dem jetzt in 55 Millionen Lichtjahren Entfernung ein supermassereiches Schwarzes Loch im Herzen der Galaxie M87 liegt, ist damals direkt neben dem Ort, an dem heute mein Sofa steht, auf dem ich schreibe. Das ganze sichtbare Universum passt in mein Wohnzimmer: das Volumen meines Sofas, meines Hauses, des Kölner Doms, der Raum unserer Erde, des Sonnensystems, unserer Milchstraße – einfach alles. Damals, am Anfang.
Bläst man den Ballon auf, so bewegen sich alle Punkte voneinander weg, und zwar desto schneller, je weiter sie voneinander entfernt sind. Eine Galaxie, die auf der Oberfläche des Ballons ein Viertel Ballonumfang von unserer Milchstraße entfernt ist, bewegt sich auch einen Bruchteil eines Viertels Umfang pro Atemstoß von uns weg. Eine Galaxie, die aber schon einen halben Ballonumfang entfernt ist, bewegt sich doppelt so viel pro Atemstoß von uns weg. Je weiter weg, desto schneller – genauso wie im Hubble-Lemaître-Gesetz angegeben. Dies gilt für jeden beliebigen Punkt auf der Ballonoberfläche. Wo immer man auch sein Kreuzchen macht, jeder andere Fleck wird sich mit jedem Atemstoß desto schneller von diesem Kreuzchen entfernen, je weiter er davon weg ist. Was für ein kühner Gedanke! Der unglaubliche Lemaître beschrieb das Universum zwar nicht als Luftballon, aber als expandierenden Raum, der mit einem »Uratom« begann, quasi als kosmisches Ei, aus dem das ganze All explosionsartig geschlüpft ist.
Der Ur-Doppelknall
vor 13,8 GaUrknall und Inflation
Heute reden wir sogar über zwei Urknalle, die vor 13,8 Milliarden Jahren (13,8 Ga) direkt hintereinander passiert sind, wobei die Physik des ersten viel spekulativer als die des zweiten ist. Beim ersten Knall dehnt sich der Raum und mit ihm eine geheimnisvolle Energie innerhalb von 10–33 bis 10–32 Sekunden schlagartig aus – das sind 32 Nullen hinter dem Komma. Dieser kurze Moment ist sozusagen der erste Ur-Atemstoß beim Aufblasen des kosmischen Ballons, der unser Universum werden soll. Mindestens hundertmal Milliarden mal Milliarden mal Milliarden wird der Durchmesser des fast leeren Weltraums inflationär größer – und so nennen wir diese Zeit auch die Phase der Inflation. Aber nicht nur der Raum wird größer, auch die verfügbare Energie. Aus der Masse einer einzelnen Erbse – und Masse ist laut Einstein immer auch Energie – wird ein ganzes Universum mit genügend Energie und Masse für unzählbare Galaxien.[1]
10–32 SekundenDer heiße Urknall
Dann, nach den ersten 10–32 Sekunden, kommt es zum zweiten Knall. So wie ein mit ultraheißer Luft unter Überdruck stehender Ballon platzt und seine Energie in eine Stoßwelle umsetzt, die wir als lauten Knall hören, so setzt der expandierende, energiegeschwängerte Raum seine Kraft um in einen zweiten, heißen Urknall. Die freiwerdende Energie ergibt einen einzigen Blitz heißester Quantenmelasse, die später zu der Materie ausfrieren wird, aus der wir alle bestehen. Materie, wie wir sie heute kennen, existiert aber noch gar nicht. Die zur Materie werdende Energie ist in diesem Moment freier als ein Vogel. Sie bewegt sich so schnell und so beflügelt, ohne jegliche Trägheit, wie das Licht. Fiat Lux.
»Es werde Licht, und es wurde Licht«, heißt es in der Genesis, womit eine völlig neue Welt gedacht wird.[2] An diesem ersten Tag der Schöpfung, der keine Sekunde dauert, ist alles eins im Licht, und es entstehen Raum und Zeit, vielleicht sogar durch das Licht.
Auch alle uns bekannten Kräfte sind irgendwie noch eins und ununterscheidbar: Kernkraft, magnetische oder elektrische Kräfte, sie alle sind Teil einer einzigen Urkraft. Erst nach und nach – während das Universum weiter auseinanderstiebt – schälen sich einzelne Kräfte und die damit verbundenen Teilchen heraus.
Ungefähr eine Pikosekunde (10–12 Sekunde) nach dem Urknall beginnt das geheimnisvolle Higgs-Feld zu wirken und sich an die lichtähnlichen Teilchen zu schmiegen. Das Higgs-Feld ist der Bremsklotz im Universum und sorgt dafür, dass die ursprünglichen lichtschnellen Teilchen eine Masse erhalten.[3] Durch die Abkühlung des Universums kann nun Materie entstehen, mit der man wirklich etwas anfangen kann.
So wie aus dem Wasserdampf von Gewitterwolken plötzlich Schneeflocken, Regentropfen oder Hagelkörner werden, so werden nun nach und nach aus dem kosmischen Urblitz die verschiedenen subatomaren Teilchen unserer heutigen Welt: Protonen, Neutronen, Elektronen und die Kräfte, die sie zusammenhalten. So trennen sich Licht und Materie, das Feste und das Unfassbare voneinander und bilden die elementare Ursuppe unserer Welt.
Die Schöpfung hat einen Sprung in der Schüssel
Das alles funktioniert aber nur, weil das scheinbar perfekte System von Naturgesetzen und Teilchen einen unerklärlichen Defekt hat, der dafür sorgt, dass von der aus Licht gezeugten Materie überhaupt etwas übrigbleibt. Denn im Übergang von Energie zu Materie werden normalerweise zwei genau entgegengesetzte Teilchen erzeugt: Teilchen und Anti-Teilchen, Engelchen und Teufelchen. Sie sind wie die zwei Pole einer Batterie. Bringt man sie zusammen, kommt es zum quantenmechanischen Kurzschluss, und die beiden Teilchen vernichten einander in einem Blitz. Genau das passiert im frühen Universum: Teilchen und Anti-Teilchen werden aus Licht und Energie erzeugt, vernichten einander und werden wieder zu reiner Energie und Licht.[4]
Im Prinzip hätten im Urknall also genau gleich viele Teilchen und Anti-Teilchen erzeugt werden und sich dann wieder gegenseitig vollständig vernichten sollen. Nichts wäre mehr übriggeblieben. Was so hoffnungsvoll begann, wäre genauso schnell wieder vorbei gewesen.
Stattdessen werden aber für jede Milliarde Anti-Teilchen eine Milliarde und ein normales Teilchen erzeugt. Im frühen Feuerwerk vernichten sich zwar die Milliarden Teilchen und Anti-Teilchen gegenseitig, aber – wie durch ein Wunder – überlebt eins von einer Milliarde. Wegen des opulenten Überflusses an Energie und Teilchen bleibt so, trotz der massenhaften Teilchenverschwendung, am Ende noch ein genügend großer Rest übrig. Im ganzen sichtbaren Universum sind von diesem kleinen Bruchteil noch 1080 Atome, also circa 100 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000, verteilt. Aus diesen Überlebenden des ersten Massenvernichtungsfeuerwerks unserer Geschichte sind später alle Galaxien, Sterne und Planeten entstanden. Kleinste Spuren von Anti-Materie findet man heute nur noch in hoch-energetischen Teilchenkollisionen in Beschleunigern oder in der kosmischen Strahlung.
Wobei »Anti-« eine Frage der Definition ist. Hätte es einen Überschuss an Anti-Materie gegeben, würden wir diese als »normal« betrachten und sie Materie nennen. Das, woraus heute unsere Welt gemacht ist, wäre dann für uns exotische Anti-Materie. Es gibt auch keinen ersichtlichen Grund, warum eine Welt, die nur aus Anti-Materie gemacht ist, nicht genauso funktionieren würde. Vielleicht wäre ich dann Linkshänder, denke ich manchmal, aber das ist wahrscheinlich nur eine dumme Idee.
Woher dieses fruchtbare Ungleichgewicht zwischen Teilchen und Anti-Teilchen kommt und warum es die eine und nicht die andere Sorte ist, wissen wir einfach nicht. Riesige Teilchenbeschleuniger versuchen diese Frage heute zu beantworten,[5] aber noch immer versteckt sich dort ein tiefes Geheimnis. Das Einzige, das wir mit Sicherheit wissen, ist, dass eine perfekte Symmetrie im frühen Universum zu einem perfekt leblosen und öden Universum geführt hätte. Alles wäre wieder zu Licht geworden. Licht ist zwar schön, aber ohne Materie, die es absorbiert, reflektiert und emittiert, um Konturen und Oberflächen sichtbar zu machen, doch irgendwie langweilig. Wir verdanken unsere Existenz also letztlich der Tatsache, dass die Schöpfung einen Sprung in der Schüssel hatte.
Die Naturkonstanten – ein 6er im Lotto?
In dieser frühen Phase des Universums – wann genau, ob vor, während oder kurz nach seiner Geburt, ist nicht klar – kristallisieren sich auch alle heutigen Naturgesetze und -konstanten heraus. So wie Roulettekugeln in einem Spielcasino nach wilden Drehungen klackernd in willkürliche Zahlenfächer fallen, so rasten nun auch die Kugeln mit den Werten für Naturkonstanten bei bestimmten Fächern ein.
Nur Naturgesetze und Naturkonstanten gemeinsam erlauben es, eine realistische Welt zu formen. Das Gravitationsgesetz sagt zum Beispiel, dass zwei Massen sich stärker anziehen, je näher sie einander kommen, und zwar quadratisch: Eine doppelt so weite Entfernung bedeutet eine viermal geringere Anziehungskraft. Aber es braucht auch die Gravitationskonstante, die festlegt, wie stark diese Anziehungskraft wirklich ist.
So gibt es mindestens sechs fundamentale Parameter, welche die grundlegenden Skalen unserer wichtigsten Naturgesetze festlegen.[6] Hinzu kommt noch das Standardmodell der Elementarteilchenphysik, das bestimmt, wie sich die kleinsten Materieteilchen verhalten. Es enthält mindestens 19, vielleicht sogar 26 freie Parameter. Diese Parameter sind wie Lottozahlen. Vor der Ziehung weiß keiner, was dabei rauskommt. Man kann sie nicht aus Grundprinzipien herleiten und vorhersagen, sondern einfach nur im Nachhinein beobachten und messen.[7]
Die Gravitationskonstante hat zum Beispiel den Wert 6,67430 × 10–11 m3 kg–1 s–2. Sie hätte aber auch 1966 m3 kg–1 s–2 sein können, was meinem Geburtsjahr entspricht. Scheinbar hat bei der Erschaffung der Welt aber niemand meiner Geburt einen besonderen Tribut zollen wollen. Allerdings würden mit einem solchen Wert auch sämtliche Sterne und Planeten sofort unter ihrer erdrückenden Schwerkraft zu Schwarzen Löchern mutieren, was für die Entwicklung und das Wohlergehen der Menschheit, einschließlich meiner eigenen Existenz, eher kontraproduktiv gewesen wäre. Ja, selbst das gesamte Universum wäre bei dieser Konstante unter der Last seines eigenen Gewichts zusammengebrochen und nach dem Urknall gar nicht erst aus den Puschen gekommen.
Wäre die Gravitationskonstante hingegen viel kleiner als der Wert, den wir heute messen, würden wir alle hinaus ins All schweben, weil die Schwerkraft der Erde nicht groß genug wäre, uns festzuhalten. Auch würden Sonne und Erde nicht zusammenbleiben und wären gar nicht erst entstanden, weil die Anziehungskraft einfach zu gering wäre. Unser gesamtes Sonnensystem würde in der heutigen Form nicht existieren.
Warum also die Gravitationskonstante und all die anderen Konstanten in unseren physikalischen Gesetzen genau die Werte relativ zueinander haben,[8] wissen wir nicht. Die Frage ist auch müßig, denn in einem Universum mit dermaßen verkorksten Parametern hätte niemand die Frage stellen können, wer sowas denn verbockt hat.
Wollten wir selbst Gott spielen und ein Universum bauen und hätten alle Naturgesetze zur Verfügung, es wäre immer noch ein Buch mit sieben, oder passenderweise, sechs Siegeln für uns: Jedes einzelne dieser sechs Siegel wäre ein Zahlenschloss mit einer unendlichen Anzahl von Stellen. Jedes einzelne Schloss kann im Prinzip jede beliebige erdenkliche Zahl als Öffnungscode haben. Allein die Wahrscheinlichkeit, die ersten sechs Zahlencodes richtig einzustellen – oder auch nur halbwegs die richtigen Werte zu erraten oder vorherzusagen –, ist verschwindend gering. Ganz zu schweigen von den 19 Codes, die zur Entschlüsselung der Materie nötig wären.
Forscher reden daher von einem »Abstimmungsproblem«: Sind die Naturkonstanten vielleicht von einem allmächtigen und allwissenden Schöpfer exakt so abgestimmt worden, damit Leben möglich ist? Oder sind die Konstanten wirklich am Roulettetisch bestimmt worden, und wir sind nur zufällig hier, weil alle Kugeln ausnahmsweise in die richtigen Fächer gefallen sind? Es wäre bei dieser zweiten Lesart allerdings wirklich erstaunlich, wenn schon beim ersten Versuch ein Universum entsteht und die richtige Zahlenkombination herauskommt.
Nicht Universum, sondern Multiversen?
Ein abenteuerlicher Verdacht drängt sich auf: Hat es vielleicht mehrere Versuche gegeben? Gab es nicht nur ein Universum, sondern viele? Ein Multiversum? Eine Menge von Universen, von denen die meisten einfach sang- und klanglos gescheitert sind? Universen, die keine Geschichte geschrieben haben, die nie besungen wurden, weil niemand da war, der sie hätte beobachten können?
Vielleicht ist dieser Gedanke auch gar nicht so tollkühn. Ein solches Szenario ergibt sich durchaus folgerichtig aus unserem heutigen Weltmodell. Wenn das Universum sich aus einer zufälligen Quantenfluktuation heraus einmal ausgedehnt hat, vielleicht tut es das an anderer Stelle noch ein zweites Mal, ein drittes Mal, ja fast unzählige Male.
Denn was hat unseren Urknall angetrieben? Gibt es da vielleicht ein geheimnisvolles Kraftfeld, das den Raum expandieren lässt? Die Urhefe des Universums? Tatsächlich haben Kollegen ein solches postuliert: Sie nennen es das »Inflatonfeld«. Es soll den ganzen unendlichen Raum quer durch alle Universen hin durchziehen. Dieses Inflatonfeld wäre aber nicht völlig gleichförmig, sondern brodelte immer leise vor sich hin – sehr leise. Doch die Stille trügt!
Wie ein cholerischer Physikprofessor, der aus einer launischen Stimmung heraus schlagartig explodieren und mit hochrotem Kopf einen nervösen Studenten in einer mündlichen Quantenphysik-Diplomprüfung anschreien und der völligen Unfähigkeit bezichtigen kann, weil dieser nicht wie aus der Pistole geschossen die Frage beantworten kann, zu der selbiger Professor in seiner eigenen Vorlesung nie gekommen ist – man merkt, ich spreche aus Erfahrung –, so steht auch dieses Inflatonfeld immer am Rande der cholerischen Explosion. Wird es durch zufällige Fluktuationen aus Versehen einmal über den Rand gestoßen, dehnt es sich schlagartig und exponentiell aus, entlädt eine Menge Energie, bis endlich sein Ärger verpufft und ein neues Universum geboren ist.
Wenn das einmal bei unserem Universum passiert ist, kann es ja wieder an einer anderen Stelle passieren, so die Theorie. Choleriker explodieren ja meistens auch nicht nur einmal im Leben. Wenn dem so ist, dann könnten verschiedene Teile des Raumes sich ausdehnen. Wie Blasen an verschiedenen Stellen in einem Bierglas aufsteigen, so könnte also auch das Inflatonfeld überall neue kosmische Blasen erzeugt haben, die jeweils ihren ganz eigenen expandierenden Raum erzeugen. Der Raum hätte dann nicht nur einen Knall, sondern viele. Es gäbe nicht nur ein Universum, sondern viele Universen.
Der Gedanke, dass das gesamte Universum ein riesiges, brausendes Bierglas ist, hat sicherlich für den einen oder anderen eine rauschhafte Wirkung. Man darf dabei aber nicht vergessen, dass unser ganzes Universum nur eine von unzähligen Blasen wäre, die kommen und dann wieder vergehen.
Vertreter der Multiversumstheorie wie Alan Guth und Andrei Linde reden sogar von ewiger Inflation – ein Gedanke, der für Bundesbanker wahrscheinlich eine Horrorvorstellung wäre. Besonders kräftige Blasen könnten fragmentieren und wiederum viele weitere »universumsbildende« Blasen anstoßen. Diese galoppierende Inflation würde nie aufhören, der Raum sich immer weiter ausdehnen. Darüber hinaus könnten in jeder dieser Blasen andere Gesetze und Naturkonstanten gelten. Jedes neue Universum wäre eben ein neues Casino mit neuen Roulettetischen, auf denen die Kugeln mit den Werten für Naturkonstanten in andere Fächer fallen würden.
Im Sommer 2023 traf ich halbwegs zufällig den britischen Kosmologen John Peacock im beeindruckenden nationalen Rugby-Stadion von Cardiff mit seinem riesigen verschließbaren Dach, unter dem schon viele Megastars aus der Pop- und Rock-Welt ihre Konzerte gefeiert hatten. Jetzt lümmelte sich dort ein wilder Haufen von Astronomen – nicht zum Singen oder Raufen, sondern zur alljährlichen Preisverleihung der Royal Astronomical Society. John und ich sollten an diesem Abend im VIP-Bereich des Stadions eine Medaille für unsere Forschungsarbeiten erhalten. Das ist weniger glamourös, als man denkt. Je wichtiger der Preis, desto später am Abend wird er verliehen, und desto angeheiterter und lautstärker ist der astronomische Nachwuchs, der endlich mal in Ruhe feiern will. John hatte dafür ein paar wunderbar bissige Bemerkungen übrig – nicht weil es um ihn ging, sondern um einige andere verdiente Kollegen und Kolleginnen. Aber das Grummeln der alten Garde hilft da wenig. Wir leben nun mal in dem Universum, in dem wir leben.
Dieser Gedanke lässt allerdings jemanden wie John Peacock ziemlich unberührt. Er untersucht als Kosmologe nicht nur, wie die Galaxien unseres Universums aus den Fluktuationen des Urknalls entstanden sind, sondern berechnet mit seiner Gruppe auch alternative Universen. Sie nennen sie »kontrafaktische Universen« – Universen, die nicht den Fakten unserer heutigen physikalischen Welt entsprechen, aber vielleicht doch existieren könnten: Universen, in denen kosmologische Naturkonstanten einen anderen Wert haben.[9] Tatsächlich entstehen auch dort manchmal Galaxien und Sterne, nur zeigen sie nicht genau die großräumige Verteilung und die Strukturen, die wir heute mit unseren Teleskopen beobachten.
Ob diese kontrafaktischen Universen dann aber auch wohlerzogenere kontrafaktische Nachwuchswissenschaftler hervorbringen, die andächtig der Huldigung ihrer kontrafaktischen Vorgänger lauschen, die wiederum über einen kontrafaktischen Urknall nachdenken und darüber kontrafaktische Bücher schreiben, ist jedoch eine offene Frage, die unsere faktischen Computersimulationen noch nicht beantworten können.
Trotzdem bekommt man auf diese Weise ein Gefühl dafür, wie fein abgestimmt ein Universum wie unseres wirklich sein muss. Und tatsächlich ergeben diverse Berechnungen, dass es durchaus einen breiten Bereich von Parametern gibt, unter denen lebensfähige Universen existieren könnten. Allerdings ist dieser Bereich auch nicht unendlich groß, und angesichts des beinahe unendlichen Zahlenbereichs, den Naturkonstanten haben könnten, müsste man wohl immer noch eine fast unendliche Anzahl von Universen verschwenden, um ein paar lebensfähige herauszubekommen.
So attraktiv das Multiversumsmodell auf den ersten Blick auch klingen mag, um das Ursprungs- und Abstimmungsproblem zu lösen, so ist es doch nicht der Weisheit letzter Schluss.[10] Die neuesten Satellitenmessungen der großskaligen Strukturen des Kosmos legen nahe, dass das Inflatonfeld wohl nicht genau die Eigenschaften hat, die man gerne für einfache Multiversumstheorien hätte.[11] Schlimmer wiegt jedoch, dass es kein einziges Anzeichen dafür gibt, dass andere Universen existieren oder existiert haben.
Wir haben auch keine Vorstellung davon, wie viele Universen man wirklich bräuchte und wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ein Universum wie das unsere eigentlich ist. Hinzu kommt ein anderes Problem: Wenn man zu viele Universen postulieren muss und den Zufall Gott spielen lässt, dann ist es irgendwann wahrscheinlicher, dass sich das Universum spontan aus dem Nichts gebildet hat, als dass es durch Evolution in seinen heutigen Zustand gekommen ist. Nicht nur philosophisch kommt man dann in Teufels Küche.
Zwar ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Wind am Strand einer Nordseeinsel im Wattenmeer aus feuchten Sand eine Skulptur in Gestalt des Louvre formt, extrem gering, aber statistisch ist es vielleicht möglich, wenn man die richtigen Naturgesetze, viel Geduld, Zeit und Wind hat. Wenn es also unendlich oder auch nur unfassbar viel Raum und Zeit gibt, könnte ein Universum wie eine zufällige Windskulptur spontan aus dem Nichts entstanden sein – mit oder ohne Inflation. Der Zufall malt eben manchmal die schönsten Bilder.
Alles nur Einbildung?
Der Gedanke ist nicht komplett verrückt. Eine der merkwürdigsten Eigenschaften der Quantentheorie ist ja, dass jedes Teilchen eigentlich fast jeden Zustand haben könnte. Teilchen sind zwar in unserer alltäglichen Erfahrung immer an einem bestimmten Punkt verortet, aber laut der Quantentheorie halten sie sich nur mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit an einem Ort auf. Theoretisch gibt es daher eine extrem kleine Wahrscheinlichkeit, dass ich gerade auf dem Mond bin. Die Teilchen, aus denen dieses Buch besteht, sind in einem mühsamen Prozess erst zu Papier verarbeitet, dann geschnitten und bedruckt worden. Sie hätten sich aber auch zufällig aus dem Nichts zusammenfinden können. Theoretisch ist das in der Quantenphysik denkbar – nur unseren Verleger hätte es nicht sehr gefreut, wenn Bücher plötzlich irgendwo aus dem Nichts entstehen. Was soll er dann noch verkaufen?
Man kann das Spiel beliebig weitertreiben. Auch der Text in diesem Buch hätte völlig zufällig entstehen können. Wenn man nur genügend viele zufällige Buchstabenreihenfolgen aneinanderfügt, kommt nämlich irgendwann ein Buch von William Shakespeare oder zumindest von Heino Falcke heraus. Beides hängt nur vom Zufall und der Anzahl der Buchstaben, aber nicht der Qualität des Autors ab. Man nennt dies das »Infinite-Monkey-Theorem«:[12] Setzt man einen oder mehrere Affen an eine Schreibmaschine und lässt sie lange genug wahllos tippen, kommt nach sehr langer Zeit eine Sequenz mit etwas Gescheitem heraus.
Statistisch ist das wahr – man kann es mathematisch sehr leicht beweisen. Allerdings hapert es zurzeit noch an der experimentellen Umsetzung und an der Anzahl der zur Verfügung stehenden Affen. Im Jahr 2003 hat man einmal sechs Makaken mit einer Computertastatur in einen Käfig gesperrt. Nicht nur hatten die Affen nach einem Monat gerade mal 5 Seiten produziert, die hauptsächlich aus dem Buchstaben »S« bestanden, sondern der Obermakake hatte auch noch angefangen, mit einem Stein auf die Tastatur zu hauen, während der Rest darauf uriniert und gekötelt hat[13] – um es vornehm auszudrücken. Affen sind halt doch etwas komplexer, als es die reine Mathematik annimmt.
Trotzdem: Spinnen wir den Gedanken einmal weiter. Es muss ja nicht gleich ein ganzes Universum sein. Auch ein funktionsfähiges Gehirn könnte im Prinzip völlig zufällig aus dem Quantenchaos entstanden sein – mit all seinen Erinnerungen und jetzigen Eindrücken. Vielleicht genau unser Gehirn, das sich den ganzen Rest des Universums nur ausdenkt? Man muss theoretisch nur lang genug warten, und dann würde es irgendwo entstehen. Forscher nennen so etwas das »Boltzmann-Gehirn« – nach dem Physiker Ludwig Boltzmann, einem der Väter der Thermodynamik und statistischen Physik.
Was ist nun also wahrscheinlicher: ein perfektes Universum, das in einem Urknall geboren wird, oder ein zufällig entstandenes Hirn, das dies alles nur träumt? Das Problem ist, dass die Phase der Inflation alle möglichen Weltzustände exponentiell aufgeblasen und so unfassbar viele Entwicklungspfade möglich gemacht hat. Dadurch wäre gegebenenfalls ein durch zufällige Fluktuationen generiertes Universum wahrscheinlicher als eins, das durch Urknall und Evolution genau zu unserem heutigen Universum geführt hätte.[14]
Wäre es dann nicht wirklich viel wahrscheinlicher, dass wir einfach ein zufällig aus dem Nichts entstandenes Gehirn sind, als dass wir auf einem sehr schmalen Weg von unendlich vielen möglichen Pfaden durch Urknall, Sternentstehung, biologische Evolution und den ganzen weiteren Quatsch gelangen mussten, um erst zu dem zu werden, was wir heute sind?
Ein zufällig aus dem Nichts entstandenes Gehirn? Man fragt sich, welches Hirn sich so einen Unsinn ausdenkt. Die Tatsache, dass so etwas ernsthaft diskutiert wird, zeigt nur, auf welche Abgründe man zusteuert, wenn man mal so eben mit Multiversen um sich wirft und meint, man hätte das Ursprungsproblem unserer Welt gelöst. So einfach ist es nun mal nicht.
Schlimmer noch, diese Frage rüttelt an den Grundfesten unserer Erkenntnisfähigkeit – eine Frage, die nicht neu ist und schon den Philosophen René Descartes an der Verlässlichkeit der Wirklichkeit hat zweifeln lassen. Besteht die Welt überhaupt? Bestehe ich überhaupt? Descartes hat die Frage mit dem Satz »Cogito, ergo sum« beantwortet – ich denke, also bin ich. Dies ist eine intuitive Wahrheit, die man nicht physikalisch beweisen kann. Es ist ein Glaubenssatz. Könnte es im Gegensatz dazu nicht auch heißen: »Cogito, ergo mundus est« – ich denke, also ist die Welt. Was immer die Welt ist – ob sie real existiert oder nur in unseren Gedanken, es spielt keine Rolle? Oder alternativ: »Creo mundum cogitando« – ich erschaffe die Welt durch Denken?
Einige wenige Forscher untersuchen tatsächlich, ob nicht unser ganzes Universum eine Computersimulation ist – eine digitale Fiktion. Ich vermute, dieser Gedanke ist vom Film »Matrix« inspiriert und drängt sich auf, wenn man sieht, wie viele Teile unserer Welt heute virtuell simuliert werden. Könnte dann nicht ein extrem versierter Programmierer mit der exponentiell wachsenden Rechenleistung von Computern in Tausenden oder vielleicht Millionen Jahren nicht auch eine Computersimulation schaffen, die so perfekt ist, dass wir nur glauben, wir wären echt? Damit hätte man das Abstimmungsproblem elegant gelöst.
Oder doch nicht? Schließlich hat man dann noch nicht erklärt, wie der Programmierer entstanden ist. Und was unterscheidet diesen Programmierer dann von Gott? Der Gedanke ist daher auch nicht wirklich fern von den Überzeugungen von Junge-Erde-Kreationisten, die behaupten, das Universum wäre vor rund 6000 Jahren von einem allmächtigen Schöpfer in genau sechs 24-Stunden-Tagen geschaffen worden, und zwar so, dass es aussähe, als ob es 13,8 Milliarden Jahre alt wäre.
Allen gemeinsam ist der Gedanke, dass uns die Wirklichkeit, Gott oder der Programmierer selbst in die Irre führen. Die Wirklichkeit ist nicht real, denn sie ist zu gut, um wahr zu sein.
Tatsächlich halte ich es mit Descartes. Ich glaube an die Realität der Gegenwart und der Vergangenheit, weil es mein Erleben ist. Zu glauben, alles wäre eine Illusion, würde auch bedeuten, mich selbst als Illusion zu entlarven, wozu ich persönlich keinen Anlass sehe. Ich habe auch nicht vor, Gott der Hochstapelei zu beschuldigen. So glaube ich fröhlich an die Verlässlichkeit der aus der Natur entstandenen Geschichte unserer Welt und an die Verlässlichkeit Gottes.
Man muss sich dabei nur bewusst sein: An die Wirklichkeit der Welt und die Wirklichkeit des Seins zu glauben ist eben dies – ein Glaubenssatz. Wissenschaftlich beweisbar ist sie nicht. Genauso wie es ein Glaubenssatz für einen Gläubigen ist zu sagen, dass der Schöpfergott verlässlich und glaubwürdig ist und kein Halunke, der uns in ein Theater setzt, das uns nur vorgaukelt, wir hätten eine Milliarden Jahre lange Geschichte hinter uns statt nur eine jahrtausendealte.
Ich halte diesen Glauben aber für durchaus vernünftig. Ohne diese Grundüberzeugung macht Wissenschaft keinen Sinn, und man könnte das Buch an dieser Stelle zuklappen und weglegen. Gehen wir also im Folgenden davon aus, dass die Welt real ist, Sinn macht und wir etwas von ihr verstehen können.
Multiversen mögen also bestehen oder auch nicht. Sie helfen uns aber nicht dabei, die tiefreichende Frage nach dem Ursprung der Welt beantworten zu können. Man kann endlos über den Anfang der Welt philosophieren, aber der Physiker braucht messbare Gewissheiten. Im Moment wissen wir noch nicht mal, ob und wie man solche anderen Universen nachweisen könnte.
Hin und wieder taucht eine Pressemitteilung auf, Forscher hätten in den großen Strukturen des Alls Hinweise auf eine Kollision mit einem früheren Universum gefunden, aber das erweist sich im Nachhinein immer als Kaffeesatzleserei, vor der selbst renommierteste Wissenschaftler nicht gefeit sind. Hinzu kommen immer wieder neue Vorschläge, wie zyklische Universen oder oszillierende, universumsgebärende Membranen zu immer neuen Urknallen führen könnten. Die physikalische Fantasie übersteigt die Datenlage um das Vielfache. Einer der Begründer der Multiversumstheorie, Paul Steinhardt, zweifelt daher offen daran, ob diese Theorie noch Wissenschaft oder nicht eher Wunschdenken ist. Und auch ein zyklisches Universum wäre irgendwann einmal ausgepowert, wie ein springender Titschball, der doch irgendwann zum Liegen kommt.[15]
Vielleicht lösen sich manche dieser fundamentalen Probleme irgendwann von selbst, wenn wir besser verstehen, wie wahrscheinlich oder unwahrscheinlich ein Universum mit bestimmten Eigenschaften ist. Allerdings kann ich mir nicht wirklich vorstellen, dass in dieser Welt irgendwann keine Fragen mehr offen sind.
Dunkle Energie – die Hefe des Universums
Nach heutigem Wissen fliegt das Universum sogar immer weiter und schneller auseinander, statt zum Einsturz zu kommen. Genauso, wie es eine der vielleicht gewagtesten Kurven von Georges Lemaître schon vorhergesagt hatte. Es ist eine der Kurven, die zeigt, wie das Universum zunächst größer wird und die Ausdehnung dann immer langsamer vonstattengeht, nur um dann wieder Fahrt aufzunehmen und sich immer schneller auszudehnen. Lemaître nannte diese Variante unseres Alls »das zögerliche Universum«, weil es sich zwischenzeitlich nicht ganz entscheiden kann, ob es wieder in sich zusammenstürzen oder auseinanderfliegen soll. Offensichtlich hat sich das Universum für Letzteres entschieden: Es fliegt weiter auseinander – und das ist eine schlechte Nachricht für zyklische Weltmodelle.
Messungen entfernter Supernovae, deren intrinsische Helligkeit man gut kalibrieren kann, zeigen, dass diese Sternenexplosionen etwas dunkler sind, als man erwarten würde, und daher wohl weiter weg sind, als sie sein sollten. Man interpretiert dies dahingehend, dass das Universum sich schneller ausdehnt als erwartet und dass eine mysteriöse »Dunkle Energie« das All auch heute noch weiter auseinandertreibt. Wie Hefe einen Teig aufgehen lässt, so lässt die Dunkle Energie den Raum auch heute noch aufquellen.
Tatsächlich taucht eine solche auseinandertreibende Kraft im Hinblick auf die Entwicklung des Universums schon in den Gleichungen Albert Einsteins auf. Man nennt sie die »kosmologische Konstante«. Diese beschreibt letztendlich, dass auch der leere Raum, das Vakuum, eine Grundenergie hat, die ihn auseinandertreibt.[16]
Der Raum ist wie ein Hefeteig, der immer weiter aufgeht. Oder so, als würde man einen Zauberballon haben, der sich ausdehnt und innen immer wieder neue Luft erzeugt, ohne dass man ihn aufpumpen müsste. Er würde sich ewig ausdehnen – vorausgesetzt, die Zauberhaut platzt nicht irgendwann.
Was genau diese Dunkle Energie ist, weiß die Forschung bis heute nicht. Einfache quantenphysikalische Abschätzungen liegen da schon mal um den Faktor 10120 – eine Eins mit 120 Nullen – daneben. Das ist auch für Astrophysiker keine kleine Zahl.
Nur meine Studenten in der Einführungsvorlesung Astronomie gehören zu den wenigen Eingeweihten, die erfahren, was es mit dieser Dunklen Energie auf sich hat. Am Ende bekommen sie einen Schokoriegel – als Energieschub für die Klausur. Wenn man zu viel von dieser Dunklen Energie zu sich nimmt, wird man die Expansion am eigenen Leib erleben. Erstaunlich ist nur, dass es trotz all meiner Bemühungen immer noch Studenten gibt, die in der Klausur die Frage nach der Ursache für die beschleunigte Expansion des Weltalls falsch beantworten.
Eine sehr fundamentale Konsequenz hat diese Beobachtung aber. Es ist auf dieser Grundlage schwer zu argumentieren, das Universum würde immer wieder zusammenfallen und von Neuem geboren werden. Dafür müsste man noch ein paar andere geheimnisvolle Kräfte und Effekte postulieren, für die es bis heute keinerlei Hinweise gibt. Das ist zwar nicht verboten, aber hinterlässt doch immer einen schalen Beigeschmack.
Die Dunkle Energie hat man allerdings noch nicht im Labor gefunden, man kann nur ihre Auswirkungen messen. Wenn man sieht, dass Blätter sich an einem Baum bewegen, dann kann man guten Gewissens davon ausgehen, dass der Wind bläst – es sei denn, es gibt gerade ein Erdbeben oder eine Kuh reibt sich am Baumstamm. Aber sich darüber hinaus weitere geheimnisvolle Kräfte auszudenken, kann einen leicht aufs Glatteis und in die reine Spekulation führen – oder zum Nobelpreis, sollte man solche neuen Effekte irgendwann dann doch beobachten. Das passiert aber ausgesprochen selten.
Das Universum birgt darüber hinaus noch weitere Geheimnisse. Zurzeit bewegt die Forschergemeinde die sogenannte »Hubble-Tension«.[17] Kosmologische Messungen sind erstaunlich präzise geworden, und Bestimmungen der kosmischen Ausdehnungsgeschwindigkeit im frühen und späten Universum zeigen, dass es sich heute noch schneller ausdehnt, als man es von Modellen mit einer einfachen kosmischen Konstante erwartet hätte. Sind noch weitere dunkle Kräfte am Werk, verliert die Dunkle Energie an Kraft[18] oder gibt es systematische Messfehler? Die Zukunft wird hier Licht ins Dunkel bringen.
Einen großen Nachteil hat die Dunkle Energie jedoch: Schon heute fliegt das Universum so schnell auseinander, dass wir schneller als das Licht fliegen müssten, um zu den fernsten noch sichtbaren Galaxien zu gelangen.[19] Das Restaurant am Ende des Universums werden wir also niemals erreichen.
2 Ausdehnung des Weltalls als Funktion der Zeit, Zeichnung auf Millimeterpapier von Georges Lemaître, um das Jahr 1928: Die verschiedenen Kurven zeigen mögliche Weltmodelle für verschiedene Ausdehnungsgeschwindigkeiten und kosmologische Konstanten. Alles beginnt links unten zum Zeitpunkt = 0, den wir heute Urknall nennen.
Der erste unbewegte Beweger – die alte Frage nach Gott
Kehren wir zur Anfangsfrage zurück: Woher kommt der Urknall? Multiversen sind eine mögliche, aber keine befriedigende Antwort, wie wir gesehen haben. Selbst wenn die Existenz von Multiversen einmal bewiesen wäre und sie von Spekulation zu messbarer Wissenschaft würden, so bliebe dann die noch größere Frage, wo denn die Multiversen herkommen? Waren sie immer schon dort? Oder woher stammen die Regeln und Naturgesetze, die sie haben entstehen lassen? Was bestimmt ihre Naturkonstanten? Der geheime Code unseres Universums? Welche Naturkonstanten haben über unser Universum hinaus Bestand, und welche sind im und nach dem Urknall spontan festgelegt worden?
Allein schon die Möglichkeit des zufälligen Einstellens seines Codes ist ja schon wieder ein neues Naturgesetz, ein Metagesetz, das neue Naturgesetze und -konstanten gebiert. Vielleicht sollten wir daher am Ende doch wieder über Gott reden. Wenn man immer weiterfragt und nicht haltmacht, kommt man an der Gottesfrage nicht vorbei. Der griechische Philosoph Aristoteles hat im Buch XII der Metaphysik über Gott geschrieben und ihn den »ersten unbewegten Beweger« genannt. Dieser Gedanke scheint mir in jeder Hinsicht zeitlos. Aristoteles benutzte ihn für einen Gottesbeweis, ich sehe den Wert eher in einer Gottesdefinition – wenn auch einer maximal reduzierten.[20]
Denn wo immer man beginnt, braucht man etwas, das schon da ist, das aus dem Unbewegten das Bewegte macht. Ist Gott dann physikalisch greifbar? Ich denke nicht, denn wenn man denkt, dass Gott der Ursprung aller Physik ist, dann ist Gott durch die Physik nicht vollständig beschreibbar. Theologisch würde ich sagen: Gott ist das unverfügbare ursprüngliche Geheimnis der Welt.
Es ist eine der wirklich fundamentalen Errungenschaften der Genesis, das Transzendente vom Immanenten zu trennen, Gott von den Dingen zu unterscheiden. Gott ist kein Planet, kein Baum und kein Stein. Gott ist nicht geschaffen, aber Gott spricht, und aus dem Wort entsteht das, was ist. Wissenschaftler sollten Aristoteles und der alten jüdischen Tradition zutiefst dankbar sein. Denn erst durch diese scharfe Trennung ist heute Naturwissenschaft möglich. Die Welt ist nicht göttlich, und zwischen der Welt und Gott steht am Anfang das Wort. »Gott sprach, es werde Licht«, so heißt es in der Genesis. Auch am Anfang der wissenschaftlichen Schöpfungsgeschichte stehen heute die Naturgesetze, sie sind »gottgegeben«, abstrakt und nicht dinglich. Wer oder was sie gesprochen hat, kann die Wissenschaft nicht wissen.
Trotzdem versuchten Wissenschaftler immer wieder, sich dem ersten Beweger mit Physik und Logik zu nähern. Anselm von Canterbury (1033–1109) hatte argumentiert, man könne die Aussage »Gott existiert nicht« widerlegen, denn wenn Gott das größte Denkbare ist und Gott nicht existiert, könne man immer noch etwas Größeres denken.
Der Mathematiker Kurt Gödel versuchte es mit Mathematik. Er hatte Mitte der 20er-Jahre des letzten Jahrhunderts gezeigt, dass die Mathematik stets wahre Aussagen enthält, die man nicht beweisen kann. Gödel ging dann aber noch einen Schritt weiter und bewies in logischen Schritten, dass Gott existieren muss, wenn Gott jede positive Eigenschaft besitzt und Existenz an sich positiv ist.[21] Die Richtigkeit der Logik des Beweises wurde sogar am Computer bestätigt,[22] aber über diese Definition Gottes lässt sich natürlich streiten.
Leider passiert dieses Streiten heute viel zu wenig. Als ich mit meinem Studium begann, führte noch der eine oder andere ältere Kollege das Wort »Gott« im Mund. Wenn ich heute bei einer Konferenz beim Abendessen mit Kollegen rede, habe ich den Eindruck, dass die theologische Sprachfähigkeit weitestgehend verschwunden ist. Wir reden über das Funktionieren der Welt, aber nicht über ihr Wesen.
Vor einem Jahrhundert, in der Zeit Lemaîtres, war es noch anders. Viele der großen Wissenschaftler dieser Zeit waren religiös geprägt, und so war die Diskussion über den Beginn der Welt immer auch eine Frage nach Gott. Gleichzeitig herrschte – trotz Weltkriegen – ein scheinbar unerschütterlicher Fortschrittsglaube. Die Entzauberung der Welt erschien vielen nur als eine Frage der Zeit. Das Denken war deterministisch. Die Welt war eine Maschine. Irgendwann würde man alles wissen und alles vorhersagen können. Alles war festgelegt – bis dann Relativitätstheorie und Quantentheorie dieses Bild langsam, aber nachhaltig erschüttern sollten.
Die großen Physiker rangen damals in ihren Werken mit Gott und ihrer eigenen Spiritualität: ob Einstein mit seinem jüdischen Hintergrund, der unser Bild von Raum und Zeit revolutionierte; Arthur Eddington, der Quäker, der Einsteins Theorie bewies und die Grundlage für die Sternenstruktur schuf; oder Max Planck, der langjährige evangelische Kirchenvorstand und Begründer der Quantentheorie. Sie alle führten Gott im Munde.
Von Max Planck, nach dem die renommierteste deutsche Forschungsgesellschaft benannt ist, stammt der bekannte Ausspruch: »Für den gläubigen Menschen steht Gott am Anfang, für den Wissenschaftler steht er am Ende aller Überlegungen.« Für ihn war klar, »Materie bestünde ohne den Geist überhaupt nicht«[23] – eine schon fast esoterisch klingende Aussage.
Einstein wiederum, dem die neue Quantenphysik ein Gräuel war, spöttelte in einem Brief an seinen Freund, den Physiker Max Born: »Die Theorie liefert viel, aber dem Geheimnis des Alten bringt sie uns nicht näher. Jedenfalls bin ich überzeugt, dass der nicht würfelt.« Einstein war wahrscheinlich dem Theologen und Philosophen Spinoza nahe, für den Gott und Natur nur verschiedene Begriffe ein- und derselben Sache waren.[24]
In seinem Buch Science and the Unseen World machte Eddington klar, dass es ein Fehler wäre, Beweise für Gott in der Natur zu suchen, und verwies auf die Erfahrungen Elias in der Höhle. Gott fände man nicht in den natürlichen Phänomenen, sondern in der leisen Stimme, die ihnen folgen würde.[25]
Das ist ein Gedanke, der mir persönlich sehr nahe liegt, weil die Geschichte Elias eine meiner Lieblingserzählungen ist. Ich erinnere mich, wie ich mich mal in der Kaffeepause einer hochrangigen wissenschaftlichen Kommission mit einem jüdischen Kollegen fasziniert über ein Wort in dieser Geschichte unterhalten habe: Elia, so erklärte er mir, findet Gott nicht im leisen Windhauch, so wie es in meinen Übersetzungen steht, sondern im »Säuseln der Stille«. Das ist eine sehr poetische Beschreibung, die aber für einen Physiker, der gerne starke, messbare Signale hat, nur schwer zu verdauen ist.
In einer Welt, geprägt von Naturwissenschaft und Berechenbarkeit, rangen diese großen Wissenschaftler des vorigen Jahrhunderts mit ihrem Bild von Gott und letztlich mit dem Ursprung dieser Welt. Ist da noch Platz für einen persönlichen Schöpfergott? Ist es nicht nur eine Frage der Zeit, bis die Wissenschaft auch die letzten Antworten gefunden hat und Gott zu einer reinen mathematischen Definition mutiert, einer Sammlung von Naturgesetzen? Ist Gott also doch berechenbar?
Marie Curie, die erste weibliche Physik-Nobelpreisträgerin, löste sich daher vom Katholizismus und wurde Agnostikerin. Ihr, der unerschütterlichen Vorkämpferin für Frauenrechte in der Wissenschaft, schreibt man gerne den Satz zu: »Nichts im Leben muss man fürchten, man muss es nur verstehen.«[26]
Aber dann kam Lemaître und machte dem Ganzen einen Strich durch die Rechnung. In derselben Ausstellung in Löwen, in der ich staunend vor der ersten Grafik des expandierenden Universums stehe, ist auch ein Manuskript von ihm zu sehen. Eine direkte Replik auf die Angriffe Eddingtons, die als kurzer Brief in der renommierten Zeitschrift Nature erschien.[27] Das Manuskript ist mit Schreibmaschine geschrieben, und Thomas Hertog wies mich auf den letzten Absatz hin. Er ist mit einem dünnen Bleistiftstrich durchgestrichen, und tatsächlich fehlt dieser Absatz in der publizierten Version. Wahrscheinlich hat Lemaître sich nicht getraut, ihn zu veröffentlichen, denn es war eine sehr persönliche und theologische Schlussbemerkung. Dort schreibt der Urknallentdecker:
»Ich denke, dass jeder, der an ein höchstes Wesen glaubt, das jedes Wesen und jedes Handeln trägt, auch daran glaubt, dass Gott im Wesentlichen verborgen ist, und dass er froh sein kann, wenn er sieht, wie die gegenwärtige Physik die Schöpfung mit einem Schleier verdeckt.«[28]
In diesem komplexen Satz spüre ich auf einmal das geradezu körperliche Aufatmen des mit seinem Glauben und seinen Forscheridealen ringenden Lemaître: Sein Gott ist kein Sklave der physikalischen Gesetze mehr. Gott, der Ursprung, ist nicht berechenbar und für die Naturwissenschaft und Naturwissenschaftler nicht verfügbar. Insofern bleibe ich bei meiner schon früher geäußerten Aussage: Es ist keine Frage, ob Gott existiert. Gott existiert. Es ist nur eine Frage, wer oder was Gott ist. Die Antwort darauf ist dann eben immer Glaube.
Bei unserer Suche nach den Anfängen der Welt stoßen wir immer wieder auf fundamentale Grenzen, die wir nicht durchdringen können. Die Chance ist groß, dass wir niemals den engen Schlund des Urknalls bis zum Anfang aller Dinge erforschen können. Wahrscheinlich hat das Feuer des Urknalls nicht nur unser All geboren, sondern dabei auch sämtliche Spuren des ursprünglichen Brandstifters vernichtet.
Was auf den ersten Blick vielleicht schmerzlich klingt, kann auch eine tröstliche Dimension haben, wenn nicht alles wissenschaftlich messbar und begreifbar ist, sondern nur durch reines Staunen wirklich erfasst werden kann. Und dieses Staunen ergreift einen auch, wenn man sich auf die Reise durch die Zeit begibt, die dieser Urknall und dieses erste Wort ausgelöst haben.
Kapitel 2
Materie, Sterne, Galaxien und Schwarze Löcher
»Woher kommt das, woraus ich bin?«, fragte das Kind. »Aus dem Feuer des ersten Lichts«, antwortete der Prophet.
»Nach der Zeit des Lichts war der Himmel durchflutet von brodelnden Wassern. Eng verbunden bewegten sich darin Licht und Materie in einem innigen Tanz. Sie berührten einander, verschmolzen, neue Teilchen entstanden, und neue Elemente wurden geboren. Das weitgespannte Firmament, unter dem sie tanzten, wurde immer größer, und so wurden auch ihre gemeinsamen Kreise immer größer, ihre Berührungen seltener, ihre Liebe kälter, bis sie getrennt ihre eigenen Wege gingen. Die Wasser teilten sich. Das Meer des Lichts flutete den leeren Raum und das Meer der Lüfte zog sich unter dem Einfluss einer geheimnisvollen dunklen Kraft immer weiter zusammen. Aus den Weiten des Meeres erhoben sich Sterneninseln, die immer weiterwuchsen und unter dem Druck ihres eigenen Gewichtes immer heißer wurden. Im Herz der Sterne entfachte die Glut ein Feuer, das Elemente schmieden konnte. In diesem kosmischen Tiegel wurden in Äonen neue Erden gehärtet: Salze, Metalle und neue Lüfte. Doch irgendwann ist auch ein Stern ausgebrannt und sterbensmatt. Die erste Generation schied dahin, doch bevor sie ging, feierte sie den kommenden Tod mit einem leuchtenden Feuerwerk voller Farbe und Energie. Ihre glühenden Hüllen, gewürzt mit den neuen Elementen des Lebens, schleuderte sie in die Kälte des Raumes. Aus der Asche der alten Sterne entstanden neue, trächtige Wolken aus Gas und Staub, die wiederum neue Sterne und Planeten gebaren – die nächste Generation sternener Feueröfen, die wiederum neue Generationen zeugten –, irgendwann auch deine Heimat. Du bist geschmiedet im Feuer des Anfangs und der Glut der Sterne, mein Kind. Wir sind Töchter und Söhne des Alls, gemacht aus dem Staub der Sterne.«
Ein bescheidener Entdecker
Was gibt es Schöneres, als am Lagerfeuer unter dem Sternenhimmel zu sitzen und den Erzählungen und Geschichten der Alten zu lauschen. Man wird mitgenommen in eine andere Zeit, voller Entdeckungen und Abenteuer, von der die nächste Generation lernt, ihre eigenen Abenteuer zu bestehen. So stelle ich mir das abendliche Ritual bei Jäger-und-Sammler-Kulturen in der Steinzeit vor. Wahrscheinlich war es weniger romantisch, als man sich das so denkt, und die jungen Zuhörerinnen und Zuhörer werden vielleicht gähnend am Rande gesessen und gehofft haben, dass der Erzähler mal langsam zum Schluss kommt oder bald jemand das Smartphone erfindet. Als junger Astrophysiker vom Stamm der Radioastronomen war mir dieses Ritual durchaus geläufig. Die Radioastronomie war vor dem Zweiten Weltkrieg mit der Entdeckung kosmischer Radiostrahlung entstanden,[1] blühte nach dem Krieg auf und revolutionierte die Astrophysik. Zum ersten Mal konnte man den Himmel in einem Licht betrachten, das mit bloßem Auge nicht zu sehen war, angetrieben von einer neuen Generation von Astronomen, die Physiker und Ingenieure zugleich waren. Als meine wissenschaftliche Sturm-und-Drang-Zeit begann, ging die Gründergeneration langsam in Rente und erzählte ihre Geschichten von vergangenem Glanz und Gloria am Lagerfeuer. In der Welt der Wissenschaft entspricht das dem Abhalten von Konferenzen und Tagungen. Die Geschichten der Alten sind meistens ein manchmal humoriger, manchmal aber auch ein aus der Zeit gefallener Vortrag.
So auch bei der Konferenz, von der im Folgenden die Rede sein wird. Sie beginnt mit dem Vortrag eines älteren, glatzköpfigen Herrn, der mir nicht bekannt vorkommt. Sein Stil ist nüchtern, bescheiden und fast trocken, aber ein schelmisches Lächeln blitzt aus seinen Augen, wenn er die eine oder andere Anekdote aus seinen Entdeckertagen erzählt – Geschichten, die außerhalb der Fachwelt kaum einer wirklich verstehen würde. Sein Name ist Wilson – ein Allerweltsname.
Ich habe irgendwie den Anfang verpasst, aber anscheinend geht es um Moleküle. Aufgebaut aus oft komplexen Kombinationen aus Atomen des Periodensystems, bilden sie die Grundbausteine allen Lebens. Wilson erzählt, wie er im Frühjahr 1970 mit einem Team zu einem Radioteleskop in Arizona gereist war und mithilfe von Kollegen in Virginia dafür ein provisorisches Empfängersystem zusammengeschraubt hatte. Zur großen Überraschung der Forscher funktioniert das System, und als sie ihr Radioteleskop auf den wunderschönen Orionnebel richten, schlägt ihr Oszilloskop aus – sie haben den Fingerabdruck Kohlenmonoxid gefunden! Wow, denke ich, und bin plötzlich hellwach. Kohlenmonoxid, CO abgekürzt, weil es aus einem Kohlenstoffatom, C (Carbon), und einem Sauerstoffatom, O (Oxygenium), besteht, hat auf der Erde eher einen schlechten Ruf. Geruchs- und geschmacklos wird es bei Verbrennungen produziert und führt immer wieder zu tödlichen Vergiftungen. Aber in der Astronomie ist CO zum wichtigsten Indikator kosmischer Molekülwolken geworden: Orte, an denen Sterne und Planeten geboren werden.
Die Entdeckung von CO war zwar nicht die allererste Entdeckung von Molekülen im Weltall,[2] aber die wichtigste. Mithilfe der Radio-Emission von CO durchmessen wir heute den Kosmos, auf der Suche nach der Geschichte des Materials, aus dem wir alle gemacht sind.
Auf der Folie stehen die Namen der drei Entdecker: Wilson, Jefferts und Penzias. Jetzt fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ist das der Wilson? Der Wilson, den man nicht mit seinem Vornamen kennt, sondern immer nur im Zusammenhang mit seinem Kollegen Arno Penzias. Penzias-Wilson taucht immer im Doppel auf, als ob der Namensträger Penzias Wilson und nicht Robert Woodrow Wilson heißen würde. Der bescheiden lächelnde Herr vor mir ist eine lebende Legende, ein Mythos, und ich höre nur mit halbem Ohr zu? Es ist immer wieder amüsant zu erleben, was passiert, wenn Mythos und Realität plötzlich aufeinandertreffen und sich Ersterer als viel normaler und unaufgeregter entpuppt als die Geschichten, die wir daraus machen.
Der Mann hatte nicht nur einen Physiknobelpreis erhalten, sondern auch Wissenschaftsgeschichte geschrieben. Zusammen mit Arno Penzias hatte Robert Woodrow Wilson (von allen nur kurz Bob genannt) 1964 die kosmische Hintergrundstrahlung