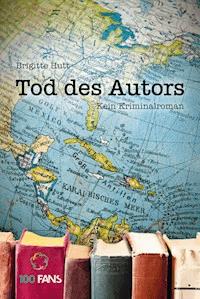Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Leben ist interagieren. Niemand existiert für sich allein. Und wenn man das genauer anschaut, erkennt man eine Unmenge von Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden. Kurzgeschichten sind nicht mehr recht in Mode, bedauerlicherweise. Aber in der Zeit der Kurznachrichten und Abkürzungen passen sie doch eigentlich genau! Tauchen Sie zwischendrin, zum Beispiel zwischen zwei S-Bahn-Stationen, mitten in eine Geschichte hinein. Lesen Sie Geschichten zwischen Menschen, zwischen Mensch und Natur, Mensch und Technik, Gut und Böse, Sollen und Wollen, zwischen realem Leben und Fantasie oder gar Satire - eben Geschichten "zwischen".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Erster Teil: Zwischen Kindern und Menschen, die sich für erwachsen halten
Suleika
Verpasst
Poponeh
Ein ganz normaler Nachmittag
Behütet
Plädoyer für einen braven Jungen
Die Busfahrt
Wie alles ganz anders kam
Die Qual der Wahl
Zweiter Teil: Zwischen Traum und Wirklichkeit
Moose Crossing
In der Kantine
Vollmond
Neunzig Minuten
Chalki
Rhyolite
Dritter Teil: Zwischenmenschliches
Flirtportal
Tagträume
Herr und Frau Schmitz
Durch die Karrierebrille
Taxi zum Bahnhof
Spur des Lebens
Vierter Teil: Zwischen den Türen
Nur Fernsehen ist schöner
Blendende Sicht
Bildungsreisen
Hilfe
Party
Gartenlust
Fünfter Teil: Zwischen den Kulturen
Die guten alten Zeiten
Flucht
Die Dose
Einmal noch
Amelé
Sechster Teil: Zwischen den Welten
Natur Schutz Vision
Waschgänge (Wenn du mal reden willst)
Elefantentrauer
Kollision
Siebter Teil: Zwischen Recht und Gesetz
Integrativ und kooperativ
Das Auge
Schmiede Am Hof
Der Blick
Achter Teil: Zwischen den Jahren – Weihnachtszeit
Advent heißt Ankunft
Ein ganz kleines Weihnachtswunder
Noch eine Weihnachtsgeschichte
Zum Feste das Beste
Letzter Teil: Zwischen allen Stühlen
Utopie Zeltlager
St. Bartl
Eine Abschiedsrede
Vorwort
Leben ist interagieren. Niemand existiert für sich allein. Und wenn man das Leben oder zumindest den Ausschnitt, der dem einzelnen Menschen vergönnt ist, genauer anschaut, erkennt man eine Unmenge von Geschichten, die es wert sind, erzählt zu werden.
Kurzgeschichten sind ein wenig aus der Mode, bedauerlicherweise. Aber in der Zeit der Kurznachrichten und Abkürzungen wäre es vielleicht sinnvoll, sie wieder der Aufmerksamkeit der verbliebenen Leser zu empfehlen, die dann gut zwischendrin, zum Beispiel zwischen zwei S-Bahn-Stationen, mitten in eine Geschichte eintauchen könnten!
Dies sind Geschichten zwischen Menschen, zwischen Mensch und Natur, Mensch und Technik, Gut und Böse, Sollen und Wollen, zwischen realem Leben und Fantasie oder gar Satire – eben Geschichten „zwischen“. Daher dieses Buch, in dem ich von allen „Zwischengeschichten“, die mir in meinem Schreiberleben bisher gelungen sind, diejenigen gesammelt habe, die mir wichtig sind. Wer oder was mir die eine oder andere Inspiration dazu gegeben hat – das wäre ein eigenes Buch wert.
Den Begriff „Zwischengeschichten“ verdanke ich einem Freund, der meine Antwort auf die Frage, was meine Geschichten denn sein sollen, in treffender Weise mit diesem Wort zusammengefasst hat. Ihm sei das Buch gewidmet.
Brigitte Hutt 2019
Erster Teil: Zwischen Kindern und Menschen, die sich für erwachsen halten
Die spannendsten Szenen spielen sich ab zwischen Menschen, die in unterschiedlichen Welten leben, die einander nicht oder nur bis zu einem gewissen Grad verstehen – sich das aber nicht klar machen.
Das erleben wir tagtäglich zwischen Erwachsenen und Kindern. Vieles von dem, was uns an Kindern oft zur Weißglut reizt, erschließt sich, wenn man sich einen Augenblick des Nachdenkens gönnt (den man aber meistens erst später findet), aus ihren abweichenden Bedürfnissen, aus ihrer eigenen Weltsicht, ihrem eigenen Universum, das, je jünger sie sind, noch Traum und Wirklichkeit auf wunderbare Weise miteinander vermischt.
Gönnen wir uns, ihnen zuzuhören, mit dem Respekt, der einem jeden Menschen zusteht.
Suleika
Die Straße war eher heruntergekommen. Ein paar Autos am Straßenrand, Abfälle im Wind, tagsüber kaum einmal jemand unterwegs. Auf meinem Heimweg kam ich oft hier durch, es war eine Abkürzung, wenn auch keine schöne. Rechts Mietskasernen aus den 30er Jahren, dunkelgrau geworden vom Schmutz der Stadtluft, Graffiti an den Sockeln, links noch viel ältere kleine Häuschen, dicht aneinandergedrängt, als ob sie allein nicht aufrecht stehen könnten. Dazwischen hin und wieder ein schmaler Spalt, in dem sich Unkraut und Mülleimer um den wenigen Platz stritten.
An einer dieser Lücken stand ein kleines Mädchen, vielleicht sieben, acht Jahre alt, mit dem Rücken zur Straße, die rechte Hand an einem Mülleimer, die linke am Putz des Hauses, an den sie auch ihren Kopf lehnte, das Gesicht unentwegt in den Spalt gerichtet. Ihre Haare waren lang und ein wenig wild. Sie trug eine gestreifte Kapuzenjacke und geblümte Hosen, dazu rosa Schuhe, mit denen sie sich von Zeit zu Zeit abwechselnd das eine oder andere Bein scheuerte.
Ich hatte sie hier noch nie gesehen, das war keine Gegend für Kinder. Langsam trat ich näher. Sie beachtete mich nicht, wandte mir nach wie vor ihren Rücken zu.
„Wohnst du hier?“, fragte ich freundlich. Sie reagierte nicht.
„Hast du dich verlaufen?“, fragte ich etwas lauter.
Sie wandte den Kopf kurz zu mir, schüttelte ihn energisch und richtete ihn wieder in den Häuserspalt.
„Was tust du denn da?“, fragte ich weiter. Keine Antwort. Ich überlegte, ob ich sie einfach ihrem Schicksal überlassen sollte, aber sie war doch noch so klein!
„Ich passe auf sie auf“, hörte ich sie plötzlich flüstern.
„Was?“
„Ich passe auf sie auf“, kam es etwas lauter, „damit ihr nichts passiert!“
„Wem?“, fragte ich verwirrt.
„Suleika.“
Ich überlegte. Womit beschäftigten sich Mädchen? Wer hieß so?
„Ist das eine Katze?“, fragte ich schließlich.
„Nein!“, kam es sehr empört zurück. „Eine Prinzessin!“
„Ach so“, sagte ich unwillkürlich. Sie spielte. Sie ließ ihrer Fantasie freien Lauf.
Mit dem Instinkt des fantasiebegabten Kindes spürte sie meinen Unglauben und wandte mir zum ersten Mal ganz ihr Gesicht zu. Große braune Augen musterten mich, ihre Stirn war in Falten gelegt.
„Ja!“ sagte sie, sehr bestimmt. „Sie ist wunderschön, aber eben sehr klein. Also muss ich auf sie aufpassen. Sie hat einen langen goldenen Mantel an und ein winziges Krönchen mit zwei“, hier hob sie die Hand und stach mit dem Zeigefinger zweimal in die Luft, „Edelsteinen.“
Schon hatte sie sich wieder umgedreht und starrte konzentriert in den Häuserspalt. Ihre Hand spielte mit dem bröckelnden Verputz, die Finger alles andere als sauber.
Was nun? Ich konnte sie doch hier nicht so stehen lassen. Wer weiß, wohin ihr Spiel sie noch trieb.
„Verrätst du mir deinen Namen?“, bat ich schließlich.
Wieder flog der Kopf kurz herum. „Verrätst du mir deinen Namen?“, war die Antwort, und der Kopf flog zurück.
Ich seufzte. „Ich würde dich auch nach Hause bringen“, bot ich an.
Sie hob abwehrend eine Hand, und ich hörte nur ein aufgeregt geflüstertes: „Jetzt!“
Unwillkürlich sprach ich nicht weiter, hielt fast den Atem an.
Dann sprang sie zurück mit einem Jubelruf: „Gerettet!“
Kurz winkte sie in den Häuserspalt und dann auch zu mir und rannte die Straße entlang. Ich sah ihr nach, bis sie außer Sicht war, dann blickte ich neugierig in den Spalt. An der Hauswand sah ich eine feuchte Spur, und unten, schon fast unter einem Löwenzahnblatt verschwunden, eine braune, nein, goldene Nacktschnecke.
Verpasst
Schule ist öd. Sicher, die Lesebuchgeschichten sind nett, aber wenn man meint, jetzt wird es gleich spannend, dann sind sie schon aus. Gar kein Vergleich zu den Büchern aus der Bibliothek. Leider erlaubt die Mama immer nur eines in der Woche, weil Sarah da mal eines verschusselt hat, was die Mama dann bezahlen musste. Keine Ahnung, wo das hingekommen ist, es ist nie wieder aufgetaucht. War aber auch nicht so spannend. Da ging es auch um Schule, um einen Mathelehrer. Das muss man doch nicht lesen, das hat man ja hier selbst, wenn auch mit einer Lehrerin.
„Sarah! Träumst du wieder?“
Sie schreckte auf und schaute Frau Becker geradewegs an. Die lächelte und fragte: „Also, Sarah, hast du die Aufgabe gelöst?“
Sie nickte.
„Und sagst du uns, was herausgekommen ist?“
„Vier“, sagte Sarah leise.
Die Lehrerin nickte zufrieden und wandte sich wieder der Tafel zu.
Minusrechnen ist öd, dachte Sarah, aber so schwierig doch auch nicht. Über den Zehner, ja, da wird es schwieriger, aber Frau Becker ließ einem doch immer genug Zeit. Niko und Lara hatten es trotzdem meistens nicht raus, und dann erklärte und erklärte Frau Becker, und für Sarah blieb Zeit, an etwas anderes zu denken.
Manchmal fiel ihr dann gar nichts ein, und dann hörte sie Frau Becker zu. Heute musste sie immerfort an Bücher denken, denn heute durfte sie wieder in die Bibliothek. Mit Oma, denn Mama war krank. Warum die Mama wohl krank war? Wenn Sarah krank war, dann hatte sie Schnupfen oder Husten oder Bauchweh. Bei Mama war das anders. Da sah man gar nicht, was sie hatte. Na, vielleicht doch Bauchweh. Die Erwachsenen weinen dann ja nicht.
„Sarah? Meinst du, du musst nicht mitschreiben?“
Sie blickte Frau Becker an. Die wies auf die Tafel. Da stand etwas Neues. Sarah nahm schnell ihr Heft und schrieb es ab. Das waren wohl schon die Hausaufgaben. Komisch, sonst gab es immer welche aus dem Mathebuch. Das Mathebuch war eigentlich das langweiligste überhaupt. Aber in diesem Schuljahr waren ein paar Geschichten drin, nur musste man die selbst zu Ende bringen, und dazu musste man immer rechnen. Das hieß dann Textaufgaben.
Als Sina, ihre Banknachbarin, laut „Ja!“ jubelte, blickte sie auf. Sina und einige andere hatten ein bunt eingewickeltes Schokoladetäfelchen vor sich liegen. Dann waren das nicht die Hausaufgaben gewesen, sondern Wettrechnen. Mist, das hatte sie verpasst.
Poponeh
„Und was wünschst du dir zum Geburtstag, Klara?“
„Ach, am liebsten hätte ich – ein Poponeh.“
„Ein was?“
„Ein Poponeh. Mit Glitzer!“
„Oh. Ja.“ Patentante sein ist nicht immer einfach. Zumindest nicht mehr, wenn die Kinder in ihr ganz eigenes öffentliches Leben hinaustreten und unweigerlich eine Sprache lernen und sprechen, die die Generation davor nicht recht nachvollziehen kann. Aber Corinna war fest entschlossen, sich als modern und aufgeschlossen zu erweisen, koste es, was es wolle.
Poponeh. Das erste war natürlich, im allgegenwärtigen und allwissenden Internet zu suchen. Fehlanzeige. Es gab das italienische popone, das definitiv nicht auf dem abschließenden e betont wurde, und es gab Pooneh, das aus einem sehr fernen Sprachbereich stammte, und das zweite „po“ in Klaras Wunsch war deutlich gewesen. Auch einige weitere Recherchen auf Websites, die etwas mit Kindern zu tun hatten, waren ergebnislos, führten höchstens zu „Popsongs“ oder „Popeye“. Den letzteren kannte Corinna noch aus ihrer eigenen Kindheit, der war damals schon nichts Neues gewesen. Na gut, musste sie sich halt outen. Sie ging tapfer in ein Fachgeschäft mit dem Namen „Alles fürs Kind“ und erkundigte sich.
„Poponeh?“ Die schmucke Verkäuferin schaute sehr ratlos. „Und die Kleine wird sieben? Fragen Sie mal in der Spielwarenabteilung, vielleicht wissen die mehr.“
Corinna fragte sich durch. Nicht nur in der Spielwarenabteilung, auch in einem Sportfachgeschäft, bei Schreibwaren und Schulbedarf, bei Süßigkeiten und in der angesagtesten Boutique der Stadt. Fehlanzeige.
Zuletzt, nur noch eine gute Woche vor Klaras Geburtstag, rief sie Klaras Mutter an. Die wenigstens wirkte immer so, als ob sie die Spezialausdrücke ihrer immerhin drei Kinder perfekt drauf hätte. Aber auf die Frage nach Poponeh kam nur eine lange Pause.
„Was soll das sein?“
„Das frage ich ja dich!“, rief Corinna verzweifelt. „Sie wünscht es sich, und ich kriege nicht heraus, was es ist!“
„Warte, ich frage ihren großen Bruder, das könnte uns weiterbringen. Aber ich sage dir gleich, wenn es was Schweinisches ist, dann verbiete ich es! Ich rufe zurück.“
Was Schweinisches, daran hatte Corinna ja noch gar nicht gedacht. Sollte sie bei … oh nein, doch bitte nicht. Das Kind war doch erst sechs, oder nein, fast sieben. Fast.
Am Abend kam der Rückruf, aber er war enttäuschend. Weder der große Bruder noch das Nachbarskind hatten auf die beiläufige Erwähnung des Begriffs Poponeh etwas beisteuern können.
Corinna gab sich einen Ruck und rief im Internet Webseiten auf, die zumindest sie selbst als „schweinisch“ eingestuft hätte. Doch auch diese Suche brachte sie nicht einen Schritt weiter.
Der Geburtstag kam heran. Es war ein Samstag, und Corinna hatte einen Entschluss gefasst. Sie fuhr zu Klaras Familie, gleich nach dem Frühstück, zog noch schnell Bargeld aus dem Automaten an der Ecke und verkündete ihre Überraschung: „Klara, ich hab mir das Folgende überlegt. Wir beide, nur wir beide, wir gehen jetzt shoppen. Schau, ich habe Geld geholt, und nun kannst du dir selbst was aussuchen. Na, wie ist das? Ein Poponeh, oder was du willst. Wo immer es das gibt.“
Klara antwortete nicht gleich, sondern schaute ihr interessiert zu, wie sie die Scheine, etwas hastig und ungeschickt, in ihrem roten Geldbeutel verstaute.
Dann sagte sie: „Deins ist doch ganz hübsch, wo hast du denn das her?“
Corinna starrte sie verständnislos an. „Mein was?“
„Na ja, Glitzer hat es keins, aber rot ist voll schön!“
Corinna schaute das Kind an, folgte ihren Blicken, sah auf ihren Geldbeutel.
„Portemonnaie?“, fragte sie schließlich langsam und vorsichtig.
„Ja“, rief Klara ungeduldig, „sag ich doch! Poponeh!“
Ein ganz normaler Nachmittag
Hausaufgaben sind wie Medizin. Man muss das schlucken, weil die Eltern sagen, es ist wichtig. Spaß macht es keinen, und manchmal ist es sogar richtig grässlich. Wie heute. In einer halben Stunde käme seine Mutter von der Arbeit, da sollte er eigentlich fertig sein. Martin knabberte am Bleistift und wedelte mit dem Lineal durch die Luft. Dimensionen, Ordnung, Koordinaten, pfff. Er gähnte, nicht zum ersten Mal.
Das Klingeln an der Wohnungstür wirkte wie ein Pausensignal. Martin warf Stift und Lineal auf den Tisch und sauste in den Flur, riss die Tür auf.
„Einen wunderschönen guten Tag, der Herr! Darf ich eintreten? Danke, danke!“
Während Martin verblüfft und wie erstarrt an der Wohnungstür stehen blieb, tänzelte eine seltsame Gestalt an ihm vorbei und marschierte schnurstracks in die Küche.
„Äh – hören Sie, das dürfen Sie nicht!“ Martin war aus der Erstarrung erwacht und lief der Gestalt hinterher. Der Mann – ein Mann schien es zu sein – stand mitten in der Küche, stützte eine Hand auf die Arbeitsfläche, wobei er die Finger so etwas wie ein Liedchen trommeln ließ, und musterte die Küchenschränke.
„So, so. Na, da könnten wir ja auch einmal etwas putzen. Schau hier, diese Flecken, woher sind denn die?“
Er griff nach dem Teebeutel, den Martin in die Spüle geworfen hatte, und tupfte damit an die Schranktüren und auf die Arbeitsfläche. Martin wurde es abwechselnd heiß und kalt. Er griff nach dem Spülschwamm und rubbelte über die Spritzer, während er stammelte: „Hören Sie, aber … Sie können doch nicht einfach …“
Der Fremde ließ den Teebeutel fallen und öffnete den Kühlschrank. Dabei murmelte er: „M-Hm, M-Hm, ja, M-Hm …“
Auf Martins Gestammel schien er nicht zu hören. Der war inzwischen mit dem Rubbeln fertig und holte tief Luft, bevor er sich zu seinem unerwünschten Besucher umdrehte.
„Ich darf niemanden …“ Er hielt inne, denn er fand sich allein in der Küche.
Den Spülschwamm krampfhaft festhaltend lief er den Flur entlang. Geräusche aus dem Wohnzimmer. Richtig, dort war der Fremde inzwischen angelangt und schlenderte summend und murmelnd herum.
„Wer sind Sie? Was wollen Sie? Ich darf niemanden reinlassen!“, rief Martin verzweifelt.
Der Besucher antwortete nicht, stieß nur ein kleines, meckerndes Lachen aus. Martin hatte Zeit, seine eigenartige Kleidung zu mustern. Diese karierte Hose war schon ein Hingucker, und die Jacke erst! Uralt offensichtlich. Nicht einmal der schlechtest gekleidete Lehrer in der Schule würde so etwas anziehen. Und die Haare standen dem Typen büschelweise zu Berge, wie frisch aus dem Bett gestiegen sah er aus.
Nun griff der Mann auch noch nach Mutters Lieblingsvase, die mit halb verwelkten Tulpen auf dem Tisch stand.
„Sollten wir da nicht mal was tun?“, fragte er und fing an, Tulpenblätter abzuzupfen und in die Luft zu werfen.
Martin ließ den Spülschwamm fallen, griff mit einem Hechtsprung nach der kostbaren Vase, trug sie im Laufschritt in die Küche, setzte sie trotz aller Eile vorsichtig in der Spüle ab, zog den Strauß heraus und beförderte ihn mit Schwung in den Biomülleimer. Dann rannte er zurück ins Wohnzimmer, wo der Besucher es sich inzwischen in Vaters Fernsehsessel bequem gemacht hatte, ein Bein über das andere geschlagen, ein Buch in der Hand.
„Mein Buch!“, schrie Martin und sprang auf den Fremden zu. Der zog es knapp vor Martins Fingern weg und schaute ihn mit hochgezogenen Augenbrauen an. Seltsame Augenbrauen waren das, dachte Martin für einen kurzen Moment. Dann fragte der Mann: „Und was tut das Buch hier? Haben wir gelesen statt Hausaufgaben zu machen?“
Martin schluckte und suchte nach Worten. Der Fremde zog einen riesigen Buntstift aus einer seiner ausgebeulten Jackentaschen und fing an, in dem Buch herumzumalen.
„Nein“, schrie Martin, „das ist doch ein Büchereibuch! Das dürfen Sie nicht!“
„Darf ich nicht? Darf ich doch!“, sang der Mann, schaute auf, direkt in Martins Augen, und plötzlich schoss der Stift nach vorn und malte Martin einen Punkt auf die Stirn. Als dessen Hände zur Stirn flogen und darüber rieben, landete der Stift erneut in seinem Gesicht, diesmal mitten auf der Nase.
„Aaah!“, machte Martin und wich drei Schritte zurück.
„Na, was sagst du nun? Ich darf alles, was ich will!“
„Sie dürfen hier gar nicht sein!“ Martin schaute sich verzweifelt um, als ob eine rettende Idee in der Ecke wartete.
„Ich darf, ich darf, ich kann, ich bin.“ Der Mann sang wieder, äußerst vergnügt. Jetzt fing er auch noch an zu pfeifen, warf das Buch auf den Zeitungsständer zurück, stand auf und tänzelte zum Fenster. Hier fing er an, die Philodendronblätter mit seinem Buntstift zu bearbeiten.
Martin sprang ihn an und schrie: „Nein! Mamas Pflanzen!“
Der Besucher schüttelte ihn lässig ab und machte mit dem Geldbaum weiter. Jedes der fleischigen Blätter bekam schwungvoll einen Tupfen in die Mitte.
Martin stand mitten im Zimmer und schluchzte. Albtraum? Wirklichkeit? Was ging hier vor?
Der Fremde hatte wohl genug von den Pflanzen und verließ, immer vergnügt summend, das Wohnzimmer. Martin schreckte auf, schoss an ihm vorbei und stellte sich wie der Engel mit dem Flammenschwert vor das Elternschlafzimmer.
„Nein“, keuchte er, „nein, hier nicht. Schluss. Raus. Gehen Sie. Bitte!“
Der Mann blieb vor ihm stehen, spitzte nachdenklich die Lippen und zog wieder die seltsamen Augenbrauen hoch.
„Junger Mann“, sagte er lächelnd, „solltest dich mal anschauen. Lustig siehst du aus! Waschen wäre vielleicht das Mittel der Wahl?“
Martins Hände fuhren über sein Gesicht und spürten die Tränen. Als der Fremde neckisch mit seinem Stift wedelte, erinnerte er sich an die Punkte, die er vermutlich noch immer auf Stirn und Nase hatte. Er ließ die Schlafzimmertür im Stich und sprintete ins Bad. Dort ließ er sich Wasser übers Gesicht laufen und betete, dass der Albtraum ein Ende nehmen möge.
„Was machst du denn hier?“
Mamas Stimme. Martin stellte das Wasser ab und fuhr hoch. Die Mutter lächelte und strich ihm über die Haare.
„Bist ja ganz nass! Was ist denn los?“
„Der … da … hast du …“ Martin lief an der Mutter vorbei in den Flur, ins Wohnzimmer, in die Küche.
„Was ist nur los mit dir?“
Die Mutter bremste ihn und hielt ihn an beiden Schultern fest. Seine Blicke gingen hin und her, aber die Wohnung schien leer zu sein bis auf sie beide. Die Mutter schaute ihn aufmerksam und fragend an. Martin schüttelte den Kopf, Worte fand er gerade keine.
„Hausaufgaben fertig?“, fragte die Mutter freundlich. Er schüttelte noch einmal den Kopf.
„Na, dann los. Ich koche mal einen Tee, magst du auch einen?“ Sie ging in die Küche. „Oh, du hast die Blumen weggeworfen, danke!“
Also war es doch kein Albtraum gewesen. Aber dann waren ja auch …
Martin stürzte ins Wohnzimmer, zum Fenster. Alle Pflanzen standen an ihrem Platz, die blasse Vorfrühlingssonne malte Tupfen auf die Blätter. Er hechtete zum Zeitungsständer und griff zitternd nach dem Buch, blätterte darin. Sauber. Der Spülschwamm lag einsam auf dem Teppich.
Martin hob ihn auf und drehte ihn in der Hand. Sein Kopf fühlte sich leer an.
Die Mutter kam mit einer Tasse Tee ins Zimmer, schaute ihn besorgt an und sagte: „Du bist ja völlig durch den Wind, mein Junge. Gut, dass bald Faschingsferien sind.“
Behütet
Philippa war sehr behütet aufgewachsen. Ihre Eltern hatten Schrecken und Betrübnisse von ihr ferngehalten und ihr stets erklärt, dass alles, was ihr zugedacht war, Nahrung, Kleidung, Spielzeug, Bildung, sorgfältig ausgewählt und nur zu ihrem Besten war. Die Waldorfschule, die sie besucht hatte, bot dazu die ideale Ergänzung.
Nun war sie alt genug für eine weiterführende Schule, und die Eltern hatten nach langer und intensiver Suche ein Internat herausgefunden, das ideal zu ihren Vorstellungen passte. Es war sehr teuer, aber für Philippa war ihnen keine Anstrengung zu viel. Philippa vertraute ihnen, wie sie immer vertraut hatte, und ließ sich im Mädcheninternat St. Theresia abliefern. Die neuen Mitschülerinnen erwiesen sich als ähnlich behütet wie sie, und Philippa gewöhnte sich, eingedenk der Tatsache, dass alles zu ihrem Wohle war, gut ein.
Eines Nachmittags, nach der letzten Schulstunde, sagte ihre Zimmergenossin Simone zu ihr: „Mir ist langweilig. Lass uns ausgehen.“
„Aber das dürfen wir doch noch gar nicht allein!“
„Und wer fragt danach? Wir nehmen die kleine Pforte, die zum Versorgungshof.“
„Aber – das …“
„… dürfen wir nicht, sagtest du schon. Bist du ein Weichei?“
Philippa überlegte. Weichei war negativ, und sie war dazu erzogen, positiv zu sein. Also gab sie sich einen Ruck und ging mit. Sie kamen auch ungesehen vom Internatsgelände, da Simones große Schwester, die diesen Weg oft genug gemacht hatte, ihr die nötigen Tipps gegeben hatte. Nach 15 Minuten Fußweg waren sie im Zentrum der nächst gelegenen Vorstadt. In den Cafés, Imbissen und der kleinen Boutique kannte man die Internatskundschaft bestens, die im allgemeinen gut betucht war. Man bediente sie nicht nur zuvorkommend, sondern hielt auch dicht gegenüber den offiziellen Aufsichtspersonen.
Philippa kam aus dem Staunen nicht heraus. Als erstes zog Simone sie in die Boutique, wo sie sich Mützen gegen die kalten Herbstwinde aussuchten. Mützen mit Pfiff gab es da, Philippa hatte großen Spaß daran, sie alle anzuprobieren. Simone bezahlte und lieh Philippa großmütig das benötigte Geld. Sie würde es von ihrem nicht besonders reich bemessenen Taschengeld zurückzahlen müssen, aber das Abenteuer begann, ihr zu gefallen. Die neue Mütze war bunt, flauschig und knisterte angenehm, wenn man darüberstrich. So eine hatte sie noch nie gehabt. Dann zog Simone sie ins Café, wo sie Schokolade mit Sahne bestellte, für sie beide, als Einladung, wie sie es nannte, Philippa sei beim nächsten Mal dran.
Die Getränke kamen, dampften, dufteten, und Philippa kostete vorsichtig. So etwas Gutes hatte sie noch nie getrunken, und sie war regelrecht traurig, als die Tasse leer war. Gar kein Vergleich zu dem Tee oder den anderen Getränken, die sie im Internat bekamen, auch kein Vergleich zu allem, was sie je in ihrem Elternhaus getrunken hatte. Und die Sahne! Sie leckte sich die Reste aus den Mundwinkeln.
„Sag bloß, du hast noch nie Sahne geschleckt!“, sagte Simone spöttisch.
Philippa schüttelte den Kopf. Komisch eigentlich, sie hatte doch immer bekommen, was gut für sie war, immer nur das Beste, wie ihre Eltern stets zu sagen pflegten. Wie gern hätte sie noch eine Tasse Schokolade bestellt, aber sie fürchtete um ihre Geldvorräte, hatte sie doch schon Schulden bei Simone. Sie nahm sich vor, ihre Eltern um etwas mehr Geld zu bitten. Das musste einfach sein, das war jetzt wichtig für sie, sie konnte ja nicht zurückstehen hinter den Mitschülerinnen. Ihre Eltern würden das einsehen.
Nachdem Simone bezahlt hatte, wurde es höchste Zeit, zurückzukehren, denn vor dem Abendessen mussten sie unauffällig wieder im Haus angekommen sein.
Kalt war es, Philippa kribbelten die Ohren, obwohl sie ihre neue Mütze tief darüber gezogen hatte. Auch die Stirn kribbelte und die Finger. Sie fing an zu rennen und stellte mit Staunen fest, wie schwer ihr das fiel, obwohl sie doch eigentlich ganz gut in Sport war. An der Pforte zum Versorgungshof angekommen, musste sie sich erst einmal festhalten, so schwindelig war ihr. Simone musterte sie stirnrunzelnd.
„Ist was?“
„Nein, nein, bloß … vielleicht die Aufregung. Das war ja mein erster Ausflug in die Stadt!“
Philippa bemühte sich, langsam und regelmäßig zu atmen. Das war nicht ganz einfach, denn jetzt hatte sie auch noch Magenschmerzen. Sie entschuldigte sich und rannte ins Bad. Gerade noch schaffte sie es, sich über die Schüssel zu beugen, da kam mit einem Schwall die Schokolade wieder heraus, und ein Teil des Mittagessens noch dazu.
Als sie das Gefühl hatte, jetzt sei alles draußen, ließ sie sich zitternd auf den Boden sinken. Die Magenschmerzen hatten nur wenig nachgelassen, das Schwindelgefühl auch nicht. Und seltsamerweise kribbelten Ohren, Stirn und Finger noch immer. Sie riss sich die neue Mütze herunter und betrachtete sie. Ihre Eltern, so fiel ihr ein, hatten ihr behutsam beigebracht, dass Übertretungen von Regeln stets sehr bald zu einer Strafe, zu einem Missgeschick führten, und sie hatte das auch höchst selten ausprobiert. Wieso auch, sie war eigentlich stets unter – liebevoller – Beobachtung, unter Aufsicht von Eltern, Erziehern, Lehrern gewesen. Verdammt, eigentlich hatte sie es satt, beaufsichtigt zu werden, und dieser Ausflug war auf jeden Fall das Beste, was ihr seit langem passiert war. Und nun diese Übelkeit!
Sie stand mühsam auf und hielt sich an der Wand fest. Als sie das Bad verlassen wollte, wallte erneut Übelkeit in ihr auf, und ein Schwall Schleim quoll aus ihrem Mund und auf den sauberen Kachelboden. Sie schwankte und hielt sich krampfhaft am Türstock fest.
Ein paar Mädchen, die auf demselben Flur wohnten, kamen vorbei und starrten sie mit angstvoll aufgerissenen Augen an. Die eine lief zu Philippa und hielt sie fest, die andere rannte davon. Philippa bekam das kaum mit. Dankbar lehnte sie sich an die Wand und an die Mitschülerin und versuchte Atem und Übelkeit in den Griff zu bekommen.
Da kam Frau Klausen um die Ecke, die Leiterin des Hauses.
„Kind, was ist denn los?“
Sie nahm Philippa bei der Hand, fühlte ihre Stirn, schaute sich die Bescherung auf dem Boden an. Dann fragte sie vorsichtig: „Was … hast du gegessen? Etwas … von außerhalb?“
Philippa nickte und schloss die Augen. „Schokolade“, formten ihre Lippen tonlos. Sie wischte sich mit der Mütze, die sie noch in der Hand hielt, über das Gesicht. Die Lehrerin griff nach dem Stoff und sagte: „Polyester. Oder etwas Ähnliches. Und … Schokolade?“
Philippa nickte. Regelverstoß, dachte sie. Strafe. Das war es.
„Kind, du bist eigentlich alt genug, um zu wissen, wovor du dich hüten musst“, sagte Frau Klausen tadelnd.
„Regeln dürfen nicht übertreten werden“, flüsterte Philippa.
Frau Klausen lachte trocken. „Wenn es das nur wäre. Aber du als Allergikerin? Milchprodukte? Kunstfaser? Das musst du, wenn ich deinen Eltern glauben soll, doch schon dein ganzes Leben lang meiden. Was ist nur in dich gefahren?“
Die Worte sickerten nur sehr langsam in Philippas Bewusstsein. Frau Klausen führte sie zu ihrem Zimmer und empfahl ihr, sich hinzulegen. Abendessen sollte sie heute lieber ausfallen lassen, Frau Klausen versprach, ihr noch einen Tee zu bringen. Dann ließ sie sie allein. Simone war nirgends zu sehen. Wohl schon beim Abendessen, dachte Philippa müde, streifte nur die Schuhe ab und legte sich ins Bett.
Sie wachte auf, als sie die Tür hörte. Frau Klausen stand da mit einer Mappe in der einen Hand und einer Tasse in der anderen, aus der es nach Kamille roch. Ein Geruch, den Philippa verabscheute.
„Trink, das ist jetzt das Beste für dich“, meinte Frau Klausen freundlich. „Und hier habe ich noch mal die Liste all der Dinge, die du vermeiden musst. Du solltest die selbst haben, aber deine Mutter meinte, du wüsstest genau, was gut ist für dich. Nun, heute sieht es nicht so aus. Bitte lies das sorgfältig durch und halte dich daran. Dann wird es dir rasch wieder gut gehen.“
Die Frau legte die Mappe auf Philippas Nachttisch und verließ leise das Zimmer.