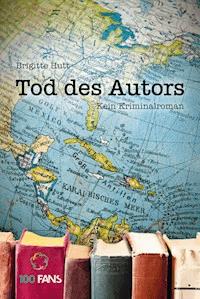Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Jemand strandet in einer deutschen Stadt, muss, um überleben zu können, alles erst lernen: laufen, sprechen, interagieren. Es gelingt, zumindest einigermaßen. Die Person schafft sich eine Art Nischenexistenz, findet Menschen, die sie fördern, ihr zugeneigt sind, allerdings ist diese Existenz sozusagen illegal. Die Person ist diesen Menschen im Grunde fremd, fremder, als wir es uns vorstellen können. Wird die Integration gelingen oder ist der Versuch zum Scheitern verurteilt?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Dieses Buch ist gewidmet
dem Andenken meiner Mutter,
meinem Mann,
meinem Physikerfreund Peter
und allen, von denen ich gelernt habe,
in kosmischen Dimensionen zu denken
Inhalt
Lena
Der Bericht
Lena
Der Bericht
Peter
Der Bericht
Lena
Der Bericht
Lena
Martha
Der Bericht
Lena
Martha
Der Bericht
Lena
Der Bericht
Lena
Der Bericht
Lena
Der Bericht
Martha
Der Bericht
Peter
Martha
Der Bericht
Der Bericht
Lena
Der Bericht
Peter
Der Bericht
Der Bericht
Lena
Der Bericht
Lena
Der Bericht
Peter
Der Bericht
Lena
Der Bericht
Peter
Der Bericht
Lena
Martha
Der Bericht
Lena
Lena
Martha
Lena
Der Bericht
1 Lena
Es sind nun mehr als fünf Jahre vergangen, und man könnte sagen, es ist Gras über die Sache gewachsen. Für viele ist es das sicher auch, aber meine Familie wird vermutlich nie damit fertig. Nichts ist mehr wie vorher. Trauer, Verlust, nie endender Schmerz, aber auch Misstrauen, Menschenfeindlichkeit. Und Schweigen. Wir können nicht darüber reden. Ob ich darüber schreiben kann, weiß ich noch immer nicht, obwohl Schreiben mein Handwerk ist, aber ich will es zumindest versuchen.
Meine Mutter ist daran zerbrochen, die Ehe meines Bruders auch. Und ich? Ich habe zwei Briefe, Papierstapel, geerbt und weiß nichts damit anzufangen. Den einen bekam ich damals schon, mehrere Notizbücher in einem braunen Umschlag, den anderen, kleineren, in einem normalen Briefumschlag, nach Mutters Tod im letzten Jahr.
Vielleicht habe ich damit ja einen Schlüssel zum – wie die Ärzte es genannt haben – geistigen Verfall meiner Mutter in der Hand, ein Verfall, der wohl seelischer Natur war (aber was ist die Seele?), der vor allem eine grenzenlose Traurigkeit war, ein Unverständnis der Dinge, die geschehen waren. Trotzdem – beide Briefe liegen ganz unten, ganz hinten in meinem Schreibtisch und warten darauf, was ich mit ihnen machen werde. Mutters saubere Schulmädchenschrift auf dem einen, eine fahrige, ungeübt wirkende Handschrift auf dem anderen. Oft schon habe ich diese Umschläge herausgezogen, angeschaut und wieder weggelegt. Die Buchstaben verschwimmen vor meinen Augen, und ich sehe alles wieder vor mir, was damals geschehen ist. Könnten diese Papiere etwas klären? Ich kann es mir nicht recht vorstellen.
Vielleicht habe ich Angst, sie zu lesen – nein, sicher habe ich Angst. Angst, alles wieder aufzuwühlen, Angst, nichts klären oder erklären zu können, sondern nur noch mehr Fragen aufzuwerfen. Angst vor meinen eigenen Gefühlen.
Jetzt sitze ich hier und füge diesem Vermächtnis noch einen dritten Papierstapel hinzu, mit dem festen Vorsatz, danach die beiden anderen zu lesen, zu sichten. Und dann? Eine Veröffentlichung könnte meine Karriere wieder aufleben lassen, aber nur, wenn sich etwas Aufregendes ergibt. Und genau davor habe ich Angst.
Die Erinnerung. Damals. Als Mutter so auflebte, wieder Freude am Leben hatte, trotz Gliederschmerzen und Witwenschaft und der mühseligen Arbeit auf dem städtischen Markt mit der meist jüngeren, agileren, werbefreudigeren Konkurrenz.
Ich bin dann mal hinausgefahren, auf den Bauernhof meiner Familie, wo Peter, Sigrid und Johannes mit unserer Mutter unter einem Dach lebten. Ich war schon als junges Mädchen in diese Stadt gezogen, hatte früh geheiratet, früh die Scheidung durchgezogen, mich bei der lokalen Tageszeitung einigermaßen hochgearbeitet und konnte gelegentlich Überstunden abfeiern. Das tat ich lieber am See oder in Kurztrips nach London, aber die Telefonate mit meiner Mutter und ihre gar nicht mehr müde Stimme in den letzten Monaten hatten mich neugierig gemacht.
Landwirtschaft wirft nicht mehr genug ab, doch einen Familienhof gibt man nicht so einfach auf. Nebenerwerbslandwirt, wie das klingt! Als ob Landwirtschaft nicht so oder so ein Vollzeitjob wäre. Peter schreinert und repariert alles Mögliche im Dorf und macht noch einiges mehr, wie viel davon schwarz, wollte ich nie wissen. Den Hof hatte er auf Gemüse- und Obstanbau spezialisiert, biologisch angebaut, also ohne chemische Nachhilfe. Der Boden dort ist prädestiniert dafür. Die paar Kühe und Schweine waren ohnehin schon lange nur noch Dekoration gewesen, damit hatten andere mehr Erfolg.
Als ich ihn dann da stehen sah – es war Herbst, und er grub ein abgeerntetes Gemüsefeld um – dachte ich zuerst nur: Ist das nicht Vaters Arbeitshose? Sie ist ihm zu groß.
Im Herbst ist Großdierdorf immer noch ein bisschen trostloser als sonst, und der Borgerhof steht dem Dorf in nichts nach. Das Wohnhaus, das um neuen Verputz zu betteln scheint, dann der Stall, der nur deswegen so gepflegt ist, weil Peter hier sein Heiligtum, seine Schreinerwerkstatt, eingerichtet hat. Gegenüber die Scheune, die von der sturen Würde des Alters aufrecht gehalten wird, das Glashaus, das der größte Schatz der Borgschen Gemüsezucht ist, dazwischen der gepflasterte Hof. Und um alles herum der Zaun, trotzig und windschief, als müsste er beweisen, dass der Betrieb noch zusammengehalten wird, wenn auch nur von ihm.
Ich parkte mein Auto außerhalb des Zauns und öffnete das Törchen. Da kam er auf mich zu, über den Hof, der für die Jahreszeit der fallenden Blätter erstaunlich sauber war, mit diesem ruhigen Schritt, diesem immer irgendwie verlorenen Blick, ein Mann unbestimmten Alters, mittelgroß, mittelblond, mittel …, na ja, nichts Bemerkenswertes, aber ich begriff instinktiv, warum Mutter einen Narren an ihm gefressen hatte. Er war genau die Mischung aus starkem, zupackendem Mann und zu beschützendem Wesen, auf das sie flog. Und nicht nur sie. Eine – irgendwie geschlechtslose – Kombination aus Mann und Kind. In meinem Kopf schrillte ein Alarmglöckchen, das ich schleunigst abstellte.
Als er vor mir stand, bemerkte ich, dass er eher überdurchschnittlich klein war, kleiner sogar als ich, was mich, die ästhetisch Anspruchsvolle, in diesem Fall eigenartigerweise nicht störte. Er streckte mir zögernd die Hand hin und sagte schlicht: „Tom.“
Zum ersten Mal hörte ich diese Stimme, ruhig, klar und eigenartig fremd, die mich bis in meine Träume verfolgen sollte.
„Lena“, antwortete ich, und er drückte meine Hand behutsam und zugleich fest.
Ich weiß bis heute nicht genau, was mich an ihm anzog, was mich in seinen Bann zog, einen Bann, dessen er sich offensichtlich niemals bewusst wurde, den er auch nicht zu wollen schien. Genau genommen habe ich nie begriffen, was er wirklich wollte. Stark und zugleich schwach, schutzbietend und schutzbedürftig, zupackend und behutsam, selbstbewusst und zugleich vorsichtig, vor allem in der Art, wie er seine Sätze, seine ganz speziellen kleinen Sätze herausbrachte, als forme er jedes einzelne Wort eigens für seinen Zuhörer. Freundlich und doch unterschwellig traurig, präsent und doch verloren, geradezu diffus, unerklärlich – er war alles zugleich und doch eigentlich nichts von allem. War es das, was mich anzog, das Rätselhafte? Was war er, wer war er?
Es oder besser er ließ mich nicht mehr los. Bis heute weiß ich nichts über ihn, trotz aller Rechercheversuche, trotz aller Fragen, die ich ihm stellte, und sein Vermächtnis, diese Papiere in der fahrigen, ungeübten Handschrift – vielleicht sollte ich sie doch lesen. Vielleicht kann ich die Erinnerung dann zu den Akten legen.
Die Erinnerung … was habe ich alles versucht, um ihm näherzukommen …
2 Der Bericht
Alles begann auf diesem öden Platz, in diffusem Licht, zwischen Drahtzäunen und Müll und ein paar Vegetationsflecken. Oder nein – alles begann mit dem Berechnungsfehler meines Navigationsgeräts, ohne den wäre ich ja niemals auf diesem Platz gelandet. Dabei hätte es ein noch verhängnisvollerer Platz sein können – nicht auszudenken.
Einmal dort angekommen, war mir natürlich sofort klar, dass dies nicht das angesteuerte Ziel war. Nur ruhig, sagte ich mir, Berechnungsfehler passieren schon mal, ich kann nicht weit entfernt vom eigentlichen Ziel sein. Ich beobachtete meine Umgebung eine Weile, sowohl mit Hilfe der Instrumente als auch durch das Außenfenster, es war hell genug, und ich wurde von Augenblick zu Augenblick verwirrter, denn diese Art von Gebäuden hatte ich noch nie gesehen. Das Klima, das die Außensensoren meldeten, war nicht übel, aber irgendwie eigenartig, unerwartet. Und dann dieser Müll überall, denn etwas anderes konnte es nicht gut sein. Allerdings ist Müll ein Zivilisationsprodukt dezidiert entwickelter Lebewesen, also musste es solche hier geben. Ich versuchte, mit Hilfe meines Navigationsgeräts nähere Informationen zu beschaffen, aber bei dem ziemlich unsanften Aufsetzen musste wohl eine Schaltung oder Verbindung Schaden genommen haben. Eine ganze Weile beschäftigte ich mich mit den Geräten und ließ die Umgebung aus den Augen.
Plötzlich hörte ich ein „Schwapp“, und es wurde dunkel vor meiner Fensterscheibe. Beunruhigt schaute ich auf. Da waren Brocken auf dem Glas, und etwas Schleimiges lief herab. War das ein Angriff auf mich? Dies war ein Forschungsgefährt, mit Waffen war ich nicht ausgerüstet.
Ich sah niemanden und hörte auch nichts weiter. Nach einer Weile, in der ich unschlüssig abwartete, drang wieder mehr Licht durch das Glas, und ich sah Bewegung. Ich überlegte kurz, ob ich versuchen sollte, mich bemerkbar zu machen, da entdeckte ich, wie seltsam die Wesen da draußen aussahen. Es waren drei zu sehen. Lang, eine Art Kopf oben, aber mit fellartigem Aufsatz, schlaksige und doch fleischige Gliedmaßen, die Mitte umhüllt von Stoffen, an denen der Niederschlag, der inzwischen eingesetzt hatte, abperlte. Sie hatten – ich bemerkte es erstaunt – vier Gliedmaßen, mit denen sie sich mehr oder weniger geschickt auf dem herumliegenden Müll bewegten. Manchmal richteten sie sich auf und ruhten auf nur zwei Gliedmaßen, das sah durchaus gefährlich aus. Mit den anderen zwei fuchtelten sie dann zu allem Überfluss in der Luft herum oder warfen etwas in einen Behälter, der am Rand ihres Müllbergs stand. Solche Wesen hatte ich in meinem ganzen Leben nicht gesehen. Wo war ich?
Vorsichtig schaltete ich die Außenbordkommunikationsanlage an. Sie funktionierte immerhin. Und richtig: Die Wesen schienen miteinander zu kommunizieren, aber in einer Sprache (falls man es denn so nennen konnte), die mir absolut fremd war. Ich verhielt mich ruhig und beobachtete weiter. So allmählich kristallisierte sich heraus, dass die drei Wesen da draußen nach verwertbaren Dingen im Müll zu suchen schienen und dabei die nicht verwertbaren achtlos herumwarfen. Daher auch das „Schwapp“ auf meinem Fenster. Sie waren erheblich größer als ich, geschätzt fast um das Dreifache. Daher hatten sie wohl auch mich und mein Gefährt noch nicht wahrgenommen, schließlich war die Außenhülle grau wie der Platz ringsum und nun auch mit Müll oder Schlamm versehen. Was sollte ich tun, wenn sie mich oder mein Gefährt für „verwertbar“ hielten?
Nach einer Weile wurde der Niederschlag deutlich stärker. Da schienen die Gestalten genug zu haben, packten mit einer der schmaleren Gliedmaßen ihre Behälter, richteten sich auf und bewegten sich auf den festeren hinteren Gliedmaßen davon. Den Lauten nach, die sie von sich gaben, eher unzufrieden.
Ich stellte fest, dass ich die ganze Zeit die Luft angehalten hatte, und atmete erst einmal tief durch. Atmen – wo war ich, und konnte ich mich hier auch außerhalb meines Gefährts ohne Schutzkleidung bewegen und die Luft atmen? Wie war ich hierhergekommen? Wie kam ich hier wieder weg, ohne funktionsfähiges Navigationsgerät?
Allmählich war es dunkel geworden draußen. Ich schaltete meinerseits die Sichtfenster auf undurchlässig und die Innenbeleuchtung ein und versuchte, dem Bordcomputer sinnvolle Informationen zu entlocken. Auch mein Fernkommunikationsgerät schaltete ich ein und arbeitete daran, Kontakt zur Flugbasis zu bekommen: Es reagierte nicht. Nach einigen Initialisierungsläufen und Reparaturroutinen meldete sich zumindest der Steuerungscomputer endlich wieder mit dem gewohnten Bediensignal. Ein Stück Normalität in dieser seltsamen Welt. Nun wollte ich ihm eine Positionsbestimmung entlocken und suchte noch einmal nach Anhaltspunkten in meiner Umgebung. Innenbeleuchtung aus, Fenster auf durchlässig schalten. Nacht war es geworden. In einiger Entfernung rechteckige helle Flecken, wohl künstliche Beleuchtung, vielleicht Fenster. Es schien in dieser Welt technische Errungenschaften zu geben. Über mir Bewegung am Himmel, Wolken, vermutete ich. So konnte ich nicht einmal mit Sternen eine Positionsbestimmung machen. Ein Blick durch das andere Fenster zeigte mir, dass die Wolken dort vor einem großen hellen Fleck vorbeizogen. Ein Himmelskörper, ein Satellit? Ein Stern konnte es nicht sein, dann hätte es ringsum hell sein müssen.
Ich gab die wenigen Informationen, die ich meiner Umgebung entnehmen konnte, in den Computer ein und ließ ihn nach dazu passenden Orten suchen. Das dauerte eine Weile, und ich merkte, dass ich Hunger bekam. Meine Nahrungsvorräte waren beschränkt – so lange sollte die Reise ja gar nicht dauern, also begann ich, sie mir sorgfältig einzuteilen. Dann endlich kam die Antwort des Computers in Form einer relativ langen Liste von Planeten und sonstigen Himmelskörpern. Bei genauerer Betrachtung konnte ich viele sofort verwerfen. Ich fügte für eine weitere Analyse die Beschreibung der Wesen im Müll hinzu, und die Ergebnisliste wurde deutlich kürzer. Aber nicht hilfreicher.
Inzwischen war ich einfach erschöpft. Lange unterwegs gewesen, der unsanfte Aufprall auf diesem Platz, wenig Nahrung, die Aufregung – ich schlief ein. Als ich wieder erwachte, war es draußen hell. Es regnete nicht mehr, und die Wolken waren aufgelockert. Meine Umgebung war deshalb weder aufschlussreicher noch schöner geworden; öde war das passende Wort (ein Wort, das ich später gelernt habe, so wie alle anderen, die ich hier benutze). Noch einmal versuchte ich mit der Basis in Kontakt zu treten – vergebens. Noch einmal versuchte ich die Fundliste des Computers mit weiteren Informationen zu verbessern: Ich konnte hinter den Wolken immerhin einen blassen Stern ausmachen.
Sieben mögliche Landeorte blieben übrig. Nach mehrfacher Prüfung der Liste fand ich zumindest ein übereinstimmendes Merkmal aller sieben: Die Atmosphäre war nicht giftig für mich. Das war eine große Erleichterung, denn die Atemluft im Gefährt wurde allmählich knapp. Offensichtlich funktionierte im Luftkreislauf auch nicht mehr alles. Behutsam (dies ist ein Wort, das ich sehr gern benutze) bediente ich einen Testschlitz in der Tür. Es gab einen kleinen Luftzug, einen Austausch zwischen meiner und der Außenatmosphäre, der absolut angenehm war. Nur der Geruch war – gelinde gesagt – befremdlich. Was nun? Ich konnte nicht gut hinausspazieren und mich diesen vierbeinigen Lebewesen nähern. Immerhin hatte ich zwar einen Kopf ähnlich wie sie, wenn auch glatter, aber einen erheblich kleineren, runderen Körper mit den acht anmutigen, beweglichen, dünnen und doch so belastbaren Gliedmaßen, die für dezidiert entwickelte Lebewesen so typisch sind.
Ich grübelte eine Weile, prüfte erneut alle meine Geräte und Instrumente, registrierte die erheblichen Fehlfunktionen, wog in Gedanken die Möglichkeiten ab, die mir blieben, dann startete ich im Computer das Assimilationsprogramm. In dieser Welt gibt es das nicht, das weiß ich inzwischen, aber ich denke, diese Bezeichnung trifft seine Funktion am ehesten; ich war jedenfalls sehr froh, dass ich es wie auf allen meinen Reisen dabei hatte. Dann gab ich die Merkmale der Wesen ein, die ich noch im Gedächtnis hatte. Glücklicherweise kam in diesem Moment wieder eines davon. Es ging auf der anderen Seite des Drahtzauns entlang, wieder erstaunlich sicher auf den hinteren Gliedmaßen balancierend. Dieses Wesen war augenscheinlich kleiner als die zuerst gesichteten, trug auch andere Kleidung und ein buntes Tuch zwischen Kopf und Rumpf. In der einen Hand (inzwischen weiß ich ja, dass sie das Ende ihrer Gliedmaßen so nennen: Hand an den dünneren, oberen, Fuß an den kräftigen unteren, auf denen sie sich gewöhnlich fortbewegen) trug es einen Sack, den es dann mit Schwung über den Drahtzaun warf. Er platzte auf, und wieder kam allerhand Müll heraus. Dreckig und stinkend – so viel war mir klar, dank meines Luftschlitzes, den ich in Abständen zu Testzwecken öffnete.
Nun gab ich dem Computer noch einmal meine Beobachtungen der Wesen ein, sowohl für das Programm der Ortsbestimmung als auch für das Assimilationsprogramm. Das Ortsbestimmungsprogramm reduzierte dadurch die möglichen Planeten beziehungsweise Landeorte auf vier, das Assimilationsprogramm meldete, dass es meine Gestalt auf die der hier ansässigen Spezies anpassen könnte, allerdings nicht die Größe. Ich ließ eine Kurzbeschreibung der vier möglichen Planeten auf ein Mikroplättchen ausgeben, schob es in eine Ablage und schloss mich dann an den Assimilator an. Andere Möglichkeiten sah ich nicht, mir war klar, ich musste irgendwie Kontakt aufnehmen, sonst war ich voraussichtlich verloren. Und darauf hatte ich nicht die geringste Lust.
Für diejenigen, die das hier lesen werden: Der Assimilator ist eine segensreiche Erfindung für alle Reisen durch die Galaxis, aber der Assimilationsprozess ist schrecklich. Man hat das Gefühl, mit Gewalt in Atome zerlegt und neu erfunden zu werden. Und so ist es ja auch eigentlich, die eigene Gestalt wird den Assimilationsdaten soweit angepasst wie möglich. Das Schlimmste ist die Ungewissheit, ob man jemals die ursprüngliche Gestalt zurückerhalten kann. Keine Assimilation ist völlig verlustfrei, und daher gibt es keine Garantie auf Umkehrbarkeit. Nun ja, wenn man nichts mehr zu verlieren hat, muss man nach vorn schauen und sich der Situation bestmöglich anpassen. Das Gute an den modernen Assimilatoren ist, dass auch Sprachsensoren mit angepasst werden. So konnte ich mir Hoffnung machen, dass ich mit einigem Training eine Verständigung mit den hiesigen Lebewesen erreichen würde. Wenn sie nur nicht so stinken würden – aber vielleicht wäre auch mein Geruchssinn angepasster.
Noch einmal tief durchatmen, dann den Starter drücken. Dunkel wurde es vor meinen vier Augen, ich fühlte Schmerzen in jeder Körperzelle, meine Gliedmaßen zuckten wie verrückt. Dann die gnädige Bewusstlosigkeit.
Als ich erwachte, lag ich auf dem Boden meines Gefährts und berührte mit den Enden meines Körpers auf allen Seiten Geräte oder Außenhaut. Schmaler war ich gebaut, trotz der neuen Größe, zwei Arme, zwei Füße, nur noch zwei Augen. Das war erst einmal sehr gewöhnungsbedürftig. Ich kam mir halb blind vor, oder besser, mein Gesichtsfeld war enorm eingeschränkt. Vorsichtig richtete ich mich auf, stellte mich auf meine vier Gliedmaßen. Die rutschten mir jedoch immer wieder unter dem Körper weg. Nach einiger Anstrengung, verbunden mit Schweißproduktion – was die Frage aufwarf, ob dieser Körper jetzt auch schon zu stinken begann – hatte ich sie halbwegs unter Kontrolle. Alle vier ließen sich auf halber Strecke durchbiegen, wenn auch in recht eigenartigen Winkeln. Auf den unteren durchgebogenen ruhend (jetzt weiß ich, dass sie Knie heißen), konnte ich meinen neuen Körper aufrichten, was meinen Kopf in Berührung mit der oberen Abdeckung brachte, und die anderen zwei Gliedmaßen vom Boden lösen. Ich versuchte mit ihnen meine Instrumente zu bedienen – was fast unmöglich war. Die schmalen Enden (sie heißen hier Finger) waren deutlich zu grob für Tasten, Schalter und berührungssensitive Flächen. Das würde noch interessant werden.
Ich betrachtete diesen Körper, soweit es die Beweglichkeit des Halses und das Anstoßen des Kopfes an die Decke des Raumes zuließen. Einiges an Rundungen, fast Beulen, dunklere und hellere Flecken, Spuren von Fell. Nicht alles kam, so schien mir, aus den von mir erfassten Daten; das Assimilationsprogramm schien durchaus bereits über Daten ähnlicher Lebewesen wie der von mir beschriebenen verfügt zu haben. Mit den neuen Fingern betastete ich meinen Kopf. Auch hier Aus- und Einbuchtungen, die Augen relativ tiefliegend. Das Atemorgan – atmen funktionierte instinktiv, ich spürte den Luftaustausch – in der Mitte darunter, eine Öffnung, wohl zum Essen, als Abschluss der Kopfvorderseite. Auf der Rückseite etwas Bewegliches, Raues spürend, zuckte ich zurück. Was war da auf meinen Kopf geraten? Ach ja, die Wesen hier hatten so etwas (Haare, wie ich jetzt weiß). Struppig und irgendwie unsauber. Daran, dass hier wohl nichts wirklich sauber war, würde ich mich sehr gewöhnen müssen. Na gut, irgendwann musste es ja losgehen. Raus hier und Kontakt aufnehmen. Da kamen wieder Wesen am Zaun entlang! Ebenfalls auf zwei Gliedmaßen gehend (und das recht schnell, so dass ich mich neugierig fragte, wie sie das wohl schafften) und in lebhaftem Gespräch miteinander. Der Außenkommunikator unterschied deutlich eine tiefere und eine höhere Stimme, und jetzt, mit dem assimilierten Körper, kamen mir die Laute gar nicht mehr so eigenartig vor. Verstehen, Wörter erkennen, das konnte ich noch nicht, aber es war eindeutig Sprache, dezidierte, entwickelte Sprache. Sie schienen die unteren Öffnungen des Kopfes (Mund) zum Sprechen zu benutzen, hatten eine Mimik, verzogen beim Sprechen ihre Gesichter. Plötzlich blieben sie stehen, und das größere Wesen strich dem anderen über die Haare. Darauf legte das kleinere seinen Kopf an das größere. Erstaunlich rührend, die Szene. Das kleinere Wesen schüttelte sich, darauf streifte das größere ein Bekleidungsstück (Mantel) ab und legte es um das kleinere.
Ein Schreck durchfuhr mich. Alle hier trugen Kleidung. Und mein Körper war zwar recht gut assimiliert, aber eben nur – ein Körper. So würde ich definitiv auffallen. Kleidung nach Art der Wesen hier – wie sollte ich die auftreiben? Noch dazu, ohne mich unter ihnen sehen zu lassen? Ich blickte mich um auf meinem öden Landeplatz. Die zwei waren inzwischen nicht mehr zu sehen. In einiger Entfernung jenseits des Zaunes waren hohe, eckige, graue Gebäude zu sehen, dort waren wohl in der Nacht die Lichtrechtecke entstanden. Direkt um mich herum waren nur die stinkenden Abfälle. Ein wenig entfernter sah ich Steine, Balken, Metallteile, Gefäße, auch Säcke – und ich bemerkte, wenn ich meine neuen Augen anstrengte, etwas wie Gewebe. Das dort drüben – könnte das so eine Art Mantel sein, wie sie das Wesen vorhin gehabt hatte? Konnte ich mich trauen, auszusteigen und nachzuschauen? Viel Leben schien hier ja nicht zu sein, zumindest diesseits des Zaunes nicht, und die Wesen, die jenseits vorbei kamen, schauten so gut wie nie herüber. Ich ließ die Außenkamera einmal im Kreis prüfen, ohne irgendeine Bewegung zu bemerken. Jetzt oder nie. Ich öffnete umständlich (seltsame, fremde Finger!) die Tür und zwängte mich rasch hinaus. Wollte rasch hinaus, aber stolperte erst einmal über meine unteren Gliedmaßen, die mir viel zu lang vorkamen. Nun lag ich draußen, und wer auch immer jetzt vorbeikommen mochte, würde mich hier sehen, nackt, wie mich der Assimilator geformt hatte.
Zumindest die Luft war problemlos atembar, wenn ich auch immer noch den Gestank wahrnahm. Mit Hilfe der vorderen Gliedmaßen (Arme) richtete ich mich an meinem Gefährt auf, was mich große Überwindung kostete, da es außen inzwischen glitschig geworden war. Vorsichtig stellte ich mich auf die Füße, und ganz langsam ließ ich eine Hand nach der anderen los. Es ging, wenn mir auch unwohl war. Aber von „schnellen“ Bewegungen konnte keine Rede sein. Ich tastete mich auf das Häufchen Gewebe zu, das ich vom Fenster aus wahrgenommen hatte. Zufrieden stellte ich fest, dass es tatsächlich Kleidung war. Ich raffte alles zusammen, was meine Hände greifen konnten, und bewegte mich – nun doch schon geschmeidiger – zurück zum Gefährt. Natürlich stank auch die Kleidung. Ich steckte sie in meinen kleinen eingebauten Chemoreiniger und betätigte die Turbotaste, die wenigstens groß genug für meine Finger war. Die Wartezeit nutzte ich, um eine Ration Nahrung zu mir zu nehmen, was auch diesem neuen Körper gut tat. Die Körperöffnung zur Nahrungsaufnahme, der Mund, öffnete sich, als hätte er nie etwas anderes getan. Danach fühlte ich mich den Umständen wieder einigermaßen gewachsen. Ich zog die gereinigte Kleidung aus dem Chemokabinett und versuchte sie mir anzuziehen, vor Augen die Wesen, die ich schon gesehen hatte. Das war leichter geplant als durchgeführt. Die Sachen waren definitiv nicht für diesen meinen Körper oder besser, für dessen Größe gemacht, und was an den ganzen Dingen nun für welche Körperteile gedacht war, konnte ich nur raten. Als ich lautes Rufen draußen hörte, schaute ich wieder durchs Fenster. Eine ganze Gruppe von Wesen kam am Zaun entlang, diesmal ziemlich kleine, angeführt von zwei großen. Nachwuchs? Ich nutzte die Gelegenheit, um mir ganz genau die Kleidung anzuschauen, was mit den assimilierten Augen schwieriger war als mit meinen ursprünglichen. Die Kleidung der Kleinen war erheblich bunter, die, die ich gefunden hatte, ähnelte mehr der Kleidung der großen Wesen. Nun, ich war ja auch aus dem Nachwuchsalter heraus – wenn auch vielleicht nicht wirklich aus deren Größe.
Als die Gruppe aus meinem Blickfeld verschwunden war, widmete ich mich wieder meiner Kleidung. Jetzt schien sie mir schon vertrauter. Nach einigen weiteren Fehlversuchen war ich bekleidet und nach meinem Empfinden einigermaßen unauffällig. Die ganze Zeit stieß ich immer wieder mit meinen neuen Gliedmaßen oder mit dem Kopf an die Begrenzungen meines Gefährts, das war eine völlig neue Erfahrung. Offenbar war ich deutlich größer als in meinem Originalkörper. Das machte mir Mut, und erneut verließ ich das Gefährt. Die elektronische Verriegelung und den Chip mit den Planetendaten schob ich in mein schmales Notfalletui und dieses wiederum in eine Falte meines Beinkleidungsstücks. Das war instinktiv richtig, denn heute weiß ich, dass diese Falten Taschen heißen und genau für solche Zwecke in die Kleidung, Hosen genannt, eingebaut werden.
Langsam ging ich über den Platz, vorsichtig atmend, um dem Gestank nicht allzu ausgeliefert zu sein. Kleine, tastende Schritte, denn ich wollte nicht wieder in den Müll fallen. Am Zaun angekommen, schaute ich zum Gefährt zurück. Es stand recht unauffällig zwischen all den Dingen unterschiedlichster Art und Bauweise, die herumlagen, und ich hatte genug Anlass zu der Hoffnung, es würde tatsächlich niemandem auffallen.
Wie nun über den Zaun kommen? Wohin waren meine ersten Besucher am Vorabend verschwunden? Mit einer Hand den Zaun vorsichtig betastend, gelegentlich auch als Stütze nutzend, bewegte ich mich an ihm entlang und fand schließlich einen Durchgang. Nun auf die hohen Gebäude zu. Das hieß aber, sich nirgends mehr festhalten zu können. Mir brach wieder der Schweiß aus (auch das etwas völlig Ungewohntes: Wir sondern normalerweise nur bei körperlicher Vereinigung so etwas wie Schweiß ab). Ich dankte dem Umstand, dass diese Gegend so verlassen war. Langsam bewegte ich mich vorwärts, und es ging tatsächlich immer besser. Die Beine gehorchten mir. Die Arme hatte ich anfangs ausgebreitet, um das Gleichgewicht zu halten, an der nächsten Wegbiegung konnte ich sie jedoch schon sinken lassen. Beim zunächst stehenden Gebäude – alle waren fleckig grau mit abbröckelnder Außenverschalung – angekommen, hörte ich Geräusche. Vorsichtig bewegte ich mich auf die Gebäudeecke zu und schaute um sie herum. Da standen zwei dieser Wesen, redeten und gestikulierten, und aus einer Nische kam ein Gefährt heraus, laut brummend, auch stinkend, auf vier Rädern. Es bewegte sich in der Richtung, in die eines der Wesen gestikulierte. Ich blieb stehen und beobachtete. Ich verstand immer noch nichts von ihrer Sprache, aber sie benutzten einige Wörter immer wieder, was ich allmählich zu unterscheiden wusste, „ich“ zum Beispiel, und einer machte eine fast vertraute Geste des Trinkens. Sie gingen an dem Gebäude entlang, und ich folgte ihnen in vorsichtiger Entfernung. Eine Straße weiter – diverse dieser brummenden Gefährte, vermutlich völlig veralteter Verbrennungsantrieb, begegneten mir unterwegs – war es belebter, nun würden sie mich nicht mehr übersehen können. Und richtig: Etliche Wesen warfen mir Blicke zu und legten dabei ihre Gesichter in Falten. Ich fragte mich, ob ich das mit meinem Gesicht auch tun konnte.
In jedem Fall waren sie alle größer als ich, und ihre Kleidungsstücke warfen nicht so viele Falten wie meine. Aber die beste Entdeckung war: Sie stanken nicht, zumindest die meisten, und bis auf diese brummenden Gefährte stank es auch in dieser Straße nicht! Also war der Gestank wohl doch nicht die typische Eigenschaft dieser Gesellschaft.
Auch wenn mir einige der Entgegenkommenden Blicke zuwarfen, so ignorierten sie mich eigentlich alle, denn niemand nahm Kontakt auf. Was mir ganz recht war, denn ich verstand bisher nur wenige ihrer Wörter und auch von denen nicht den Sinn. Nach vielen weiteren Straßenecken – ich versuchte mir den Weg genau einzuprägen – kam ich auf einen größeren Platz, der von Häusern und einigen Bepflanzungen eingerahmt war. Überall standen kleine, leicht gebaute Hütten, dazwischen lange Tische mit diversen Dingen darauf, und eine Vielzahl an Personen ging dazwischen umher. Vor den Bepflanzungen sah ich einige Konstruktionen, die sich zum Sitzen eigneten, Bänke, wie ich jetzt weiß, und vorsichtig – so ganz war ich mir meiner Gliedmaßen immer noch nicht sicher – ließ ich mich auf einer nieder, in einer Haltung, die ich anderen abschaute. Eine gute Ausgangsposition zum Beobachten. Ich weiß nicht, wie lange ich da gesessen habe und geschaut und gelauscht. So allmählich begriff ich einiges: Eine ganze Reihe von Wörtern und deren Zusammensetzungen konnte ich allmählich unterscheiden und speicherte sie in meinem Gehirn, das trotz der Assimilation gut funktionierte, und das Treiben auf dem Platz war offensichtlich ein Tauschen von Waren gegen Geld, Münzen und Scheine, Kaufen, wie ich heute weiß. Die meisten der Waren hier schienen essbar zu sein, und ich verspürte wieder Hunger und Durst. Aber wie sollte ich zu Geld kommen?
Viele der vorbeikommenden Wesen drückten ein nur etwa handgroßes Etwas an ihren Kopf und redeten, obwohl sie keine Begleiter hatten. Ich vermutete daher, dass diese Gegenstände Kommunikationsgeräte waren und fasste Hoffnung, ohne eine Ahnung zu haben, wie ich in den Besitz eines solchen Geräts kommen könnte.
Der Stern am Himmel sank langsam zur Horizontlinie. Viele Hütten leerten sich und wurden versperrt, Tische wurden zerlegt, Waren zusammengepackt, einiges davon wurde in große Drahtkörbe geworfen. Nachdem der Platz schon ziemlich leer war, erhob ich mich vorsichtig und näherte mich einem der Drahtkörbe. Was darin lag, sah genauso aus wie die Früchte, die noch vor kurzem dort ver- und gekauft worden waren, und die auch vor meinen Augen schon verzehrt worden waren. Nach kurzem Zögern griff ich mit meinen neuen Händen in den Korb und holte mir eine Frucht heraus, die sogar recht gut roch. Vorsichtig öffnete ich meinen Mund und schob die Frucht hinein. Wie automatisch schloss sich mein Mund über einem Teil der Frucht und schlug ein Stück heraus. Mein Kopf bewegte sich und zermalmte das Fruchtteil, es überkam mich ein gutes Gefühl, und mein Hals schluckte. Ich wiederholte das gierig – ich kannte mich selbst kaum wieder – und griff im Korb schon nach einer weiteren Frucht. Eine Person – ich denke, sie war schon in hohem Alter – blieb stehen und beobachtete mich, mit vielen Falten im Gesicht und in die Breite gezogenem Mund. Das schien ein freundlicher Gesichtsausdruck zu sein. Ich hatte ihn schon einige Male beobachtet, wenn auch nicht oft, eher bei den Personen, die Waren abgaben als bei denen, die sie kauften. Ich versuchte, meinen Mund auch so zu verziehen, ohne die geringste Ahnung, ob es mir gelang, da das in meiner Welt nicht üblich ist. Abschreckend habe ich wohl nicht geschaut, denn die Person kam näher, gab mir etwas in die Hand, nickte mir zu und ging weg. Neugierig beschaute ich die neue Errungenschaft: keine Frucht, aber wohlriechend, braun, mittelfest. Ich schob auch das in den Mund, und es schmeckte dem assimilierten Körper köstlich. Heute weiß ich, dass es Brot war.
Was für Lernerfolge! Ich konnte mit meinem neuen Körper umgehen (einigermaßen zumindest), hatte mich bekleidet (verbesserungsbedürftig), hatte gegessen und zumindest mit dem Gesicht eine erste Kommunikation hergestellt. Dummerweise empfand ich nun deutlichen Durst. Alles schien mir in diesem Körper, in dieser Welt intensiver zu sein als in meinem bisherigen Leben, sowohl die Bedürfnisse als auch die Gefühle. Das irritierte mich nicht wenig – wobei auch diese Irritation unerwartet heftig war. Als ich mich umsah, entdeckte ich in der Mitte des Platzes ein sehr kleines, rundes Gebäude, oben offen, in dem eine Flüssigkeit spritzte, die möglicherweise Wasser war. Ein paar sehr kleine Lebewesen mit nur zwei Gliedmaßen und fedrigem Bewuchs am Körper tranken davon. Nun, wenn es für die hiesigen Lebewesen genießbar war, dann doch auch für meinen assimilierten Körper! Ich ging hin und versuchte, etwas von dem Wasser mit meinen Händen zu greifen und mir zum Mund zu führen. Es war mühsam, ich beherrschte meine Hände noch nicht vollständig, aber irgendwie kam ich zurecht. Den kleinen Lebewesen hatte meine Gegenwart wohl eher nicht zugesagt, sie waren verschwunden, ehe ich versuchen konnte, sie zu belauschen und zu beobachten. Heute weiß ich natürlich, dass es Vögel waren und ich als Mensch assimiliert, eine der dezidierter entwickelten Spezies dieses Planeten, den diese Menschen Erde nennen.
Wieder kam jemand vorbei, der mich mit sehr gefurchtem Gesicht anschaute, sorgfältig von oben bis unten. Das war immer umso unangenehmer, als alle Vorbeikommenden mindestens einen Kopf größer waren als ich, meistens sogar mehr. Ich wischte mir die Wasserspritzer von Gesicht und Kleidern und versuchte, normal auszusehen, was auch immer das hier war. Dabei fiel mein Blick – der sehr eingeschränkte Blick aus zwei Augen, die nicht einmal unabhängig voneinander zu bewegen waren – in das runde Gebäude, aus dem das Wasser spritzte. Erstaunlicherweise lagen Münzen darin! Ich griff hinein und sammelte einige ein. Neugierig betrachtete ich sie. Mein Beobachter war stehen geblieben und kam nun näher. Dummerweise sagte er etwas zu mir – leider verstand ich nur „ich“ und „kauf“ – und drückte mir einige weitere Münzen in die Hand, größere als die, die ich aus dem Wasser gezogen hatte. Ich blickte ihn erstaunt an, wollte mich gern bedanken, glaubte auch, das Wort schon zu kennen und öffnete den Mund, der ja offensichtlich auch zum Sprechen diente. „…aunga…,“ kam mühsam heraus. Der Beobachter zuckte mit den Mundwinkeln, winkte ab und eilte davon. Wie sie nur so schnell laufen konnten!
Meine erste sprachliche Kommunikation. Nicht wirklich gelungen, aber selten war ich so ausnehmend zufrieden, die Menschen würden es glücklich nennen. Selten auch war Glücksgefühl so wichtig gewesen, musste ich zugeben. Noch nie war ich auf meinen Raumreisen auf einen derart fremden Planeten gelangt, noch dazu völlig unvorbereitet. Und nun waren die Wesen hier so friedlich, und ich kam schon nach so kurzer Zeit ganz gut mit ihnen zurecht. Das half, die latent in meinem Kopf schlummernde Panik – auch das ein Wort, das ich damals noch gar nicht nennen konnte, aber trotzdem ein Gefühl, das ich im Prinzip kannte und fürchtete – im Zaum zu halten. Es konnte nur besser werden.
Ich fand sogar den Weg zurück zu meinem Müllplatz, und mein Gefährt stand noch am alten Platz. Ich war müde, erschöpft, zufrieden, gesättigt, und nicht einmal der Gestank störte mich mehr. Ich kroch in mein Gefährt, legte mich auf den Boden und schlief bald ein.
Die nächsten Tage verbrachte ich ähnlich, erkundete Straßen, beobachtete, lernte Wörter, sprach sie dann auch leise und mühsam für mich nach, und wenn ich Hunger hatte, suchte ich nach Früchten in den Drahtkörben auf dem Platz, der Markt hieß, wie ich nun wusste. Trinken konnte ich ja aus den zahlreichen Brunnen, die ich fand. Die Begegnungen mit Menschen, die mir freundlich gegenüberstanden, die mir nützliche Dinge gaben, wiederholten sich allerdings kaum, eher erfuhr ich, das wurde mir deutlich, da ich lernte, die Gesichtsausdrücke zu entziffern, ablehnende und, wie ich es heute nennen würde, misstrauische Blicke.
Die besten Resultate erzielte ich an Spielplätzen, wo ich Kinder beobachtete, deren Gespräche gut zu verfolgen waren und meinen Wortschatz enorm bereicherten, und deren Größe der meinen ähnlich war, zumindest sie nie überstieg. Sie gingen mir allerdings aus dem Weg, mit ihnen konnte ich nicht üben, selbst zu sprechen. Und genau danach verlangte es mich immer mehr: ein Gespräch zu führen, die Menschen zu befragen, direkt von ihnen zu lernen.
Wenn mich jemand beobachtete, wie ich Früchte aus den Drahtkörben holte oder Münzen aus Brunnen, gab es – außer kompletter Nichtachtung – zwei Arten von Reaktionen. Die einen furchten ihr Gesicht, schüttelten den Kopf und eilten davon, andere, allerdings wenige, drückten mir Nahrung oder eine Münze in die Hand. Inzwischen hatte ich eine ganze Menge dieser Münzen, die ich sorgfältig in meinen Hosentaschen aufbewahrte. Also plante ich, damit etwas zu kaufen. Am dringendsten brauchte ich angemessene Kleidung, aber was und woher?
Einige Gebäude hatten große Fenster, hinter denen man ebenfalls Waren sah, unter anderem auch Kleidung. An den ausgestellten Waren sah ich Schilder – mit Aufschriften, die ich nicht zu lesen verstand. Waren das Beschreibungen zu den Waren, vielleicht Preisangaben? Ich musste diese Schrift lernen. Wieder halfen mir Kinder auf einem Spielplatz. Ich saß auf einer Bank nicht weit entfernt von zwei Kindern mit einem bunten Gegenstand in der Hand, offensichtlich einem Buch, mit Bildern und Schrift. Das eine Kind las dem anderen daraus vor und fuhr dabei mit dem Finger an der Schrift entlang. Um besser sehen und lernen zu können, ging ich näher an die Bank der Kinder heran. Sie waren hoch konzentriert und bemerkten mich nicht. Das war eine höchst effiziente Lehrstunde. Ich hörte die gesprochenen Wörter und konnte die Schrift dazu verfolgen. Sie benutzen hier eine recht einfache Buchstabenschrift, das erleichterte die Sache. Ich hatte zwar noch keine Ahnung, was „Maus“, „Katze“, „Hexe“, „Tom“ und ähnliches bedeuten sollte, aber ich konnte endlich Laute und Schrift zusammenbringen. Plötzlich erhob sich Geschrei. Ich verstand nur „… Kinder… weg …“ und sah Menschen die Arme schwingend und mit unfreundlich verzerrtem Gesicht auf mich zu kommen. Schnell – das ging inzwischen – drehte ich mich weg und ging meiner Wege.
Mir war nicht klar, was da falsch gelaufen war, aber je mehr ich die Menschen um mich herum mit meinem Aussehen verglich, umso mehr hatte ich das Gefühl, dass ich nicht „gut“, nicht „normal“ aussah. Meine Kleidung war, obwohl sauber, fleckig sowie teils zerrissen und hing viel zu faltig und schief an meinem auch noch auffällig kleinen Körper. Ich gefiel ihnen nicht, ich war ihnen vielleicht unheimlich, zumindest aber unangenehm. Folglich war es ein vordringliches Problem, neue Kleidung zu beschaffen. Aber noch war meine Kommunikation dafür zu eingeschränkt. Während ich wieder zum Markt ging, meinem derzeitigen Lebensmittelpunkt, dachte ich über eine mögliche Lösung nach. Als ich vor einem dieser Drahtkörbe mit Früchten stand – inzwischen hatte ich begriffen, dass auch das Abfall war, aber außer ein paar dunkleren Stellen im Fruchtfleisch waren diese Früchte ganz in Ordnung, und die dunklen Stellen deuteten nur einen Reifegrad an – bemerkte ich zum ersten Mal bewusst, dass in dem Drahtkorb auch Beschriebenes lag. Zeitungsblätter, wie ich jetzt weiß. Tägliche Neuigkeiten, nach dem Lesen weggeworfen. Vergeudung von Ressourcen natürlich, aber selten war ich über etwas eigentlich so Dummes so erfreut. Was für ein Fund!
Wieder vergingen Tage, mit Erkunden, Essen und nun auch Lesen. Ich saugte all das Wissen mit unendlichem Eifer in mich auf. Allmählich begann ich auch zu verstehen, was Wörter bedeuteten, die offensichtlich nichts Greifbares beschrieben. Ich lernte Wörter wie Freundschaft, Lust, Liebe, Hass oder glaubte zumindest, sie zu begreifen. Ich näherte mich Begriffen wie Spannung und Entspannung, Drohung und Bedrohung, Gemeinschaft und Feindschaft. Begriff Stück für Stück das – unsystematische – System von Vor- und Nachsilben, die unglaubliche Bandbreite von Bedeutungen oder besser Vieldeutigkeiten dieser Wörter. Wörter, Worte? Schwer, schwierig? Gewöhnt, gewohnt? Nicht alles habe ich begriffen. Aber ich lernte den Grundstock dazu, meine Erinnerungen – auch so ein Wort – später in der hier vorliegenden Form aufschreiben zu können.
Natürlich versuchte ich zwischendrin auch immer einmal, mit meiner eigenen Welt, meinem Planeten in Kommunikation zu treten, aber immer vergebens. Über die mobilen Telefone, die die Menschen benutzten, hatte ich inzwischen auch einiges gelesen, und mir war klar, dass ihre Reichweite nur mäßig war und mit Sicherheit lokal begrenzt, sie würden mir also nicht helfen, Kontakt mit meiner Basis aufzunehmen. Und nun musste ich auch noch befürchten, dass meinem Fluggefährt die Energie allmählich ausging; dann wäre ich ganz auf mich gestellt und hätte nicht einmal mehr einen Schlafplatz. Ich versuchte, diesen Gedanken vorerst zu verdrängen und mein Wissen zu erweitern, mit jedem Stück Buchstabenschrift, das ich auftreiben konnte. Allmählich lernte ich auch zu unterscheiden, was davon Fakten, was Meinungen, was Versprechungen waren – letztere oft auf großen Tafeln am Straßenrand, und oft irrational anmutend.
Wesen meiner Art haben ein sehr effizientes Lernzentrum im Gehirn, das bei der Assimilation auch gut integriert worden war, und so führte mein intensives Studium sehr bald zu einem umfassenden Verständnis der Sprache hier. Mich selbst zu artikulieren war deutlich schwieriger, da ich meine neuen Sprachwerkzeuge nur mühsam zu kontrollieren lernte. Ich übte, indem ich Passanten nach Straßen oder Bauwerken fragte, deren Namen ich gelesen hatte. Da es auf diesem Planeten offenbar zahlreiche Sprachen gab und auch hier in dieser Stadt Personen mit ortsfremder Sprache nicht selten waren, fielen meine eher ungeschickten Bemühungen nicht weiter auf. Trotzdem erlebte ich oft genug Stirnrunzeln, Kopfschütteln oder stummes Weggehen – Gesten der Ablehnung, das war mir klar. Aber anderen Personen fremder Sprache ging es offenbar genauso, insofern war ich einer von ihnen.
3 Lena
Zurück in meiner Wohnung in der Stadt kam mir die Begegnung mit „Tom“ schon beinahe irreal vor. Ein kleiner Mann, der große Kraft ausströmte, nun ja, aber auch ein heruntergekommener Streuner in sauberen, wenn auch viel zu großen Klamotten. Ein Mann ohne Papiere, wie meine Mutter mir im Vertrauen erzählt hatte, und mit irgendeiner nicht näher bezeichneten Krankheit, die sein Sprechvermögen einschränkte.
Seltsam, er sprach langsam, vorsichtig, so, als legte er Wert auf jedes Wort, sprach auch deutlich, schien aber immer froh zu sein, wenn er einen Satz heil herausgebracht hatte. Was für eine Art Sprachstörung war das? Und wieso eigentlich keine Papiere? Er musste doch irgendwoher gekommen sein, auch wenn er nicht wusste, wohin. Ob er, mal angenommen, straffällig geworden war und das mit den Papieren nur eine Vortäuschung? Mutter war mit so etwas zu ködern, und Großdierdorf war ein ideales Versteck, dort am Ende der zivilisierten Welt.
Aber ich, ich wollte nicht zu ködern sein, beschloss ich. Wenn er wirklich straffällig geworden war, so war die Situation auf dem Hof nicht ganz ungefährlich für meine Familie. Schließlich war es gerade der Junge, Johannes, mit dem er sich viel abgab. Da musste ich einfach etwas unternehmen.
Hier in der Stadt schien seine eigenartige Ausstrahlung und Anziehung nur noch ein Traum zu sein, diffus, verschwimmend. Mach dich nicht lächerlich, Lena, dachte ich, du hast einfach Sehnsucht nach einem Mann. Einem behutsamen Mann, genau genommen, einem Mann, der mich behandelte wie Tom die Wörter, die er formte.
Ein Mensch ohne Papiere. Ein Mensch ohne Papiere, der nicht alles tut, um sich neue zu besorgen. Das war der Gedanke, der Zweifel, der mich nicht losließ. Das und die Erinnerung an behutsame Worte, ein fast androgynes Gesicht, einen Händedruck.
Mutter hatte ihn in der Nachbarstadt aufgelesen, in der sie ihr Gemüse auf dem Markt verkaufte. Also suchte ich im Internet das Telefonverzeichnis dieser Stadt. Tom. Paul? Pauli? Irgend so etwas war es. Aber unter diesen Namensvarianten war kein Tom oder Thomas zu finden. War er nicht von dort – oder war der Name falsch?
Richtig, Mutter hatte am Telefon etwas von Berlin erwähnt. Oder nur Großraum Berlin? Das „Örtliche“ von Berlin war natürlich entmutigend. Paul, Pauls, Pauli gab es in Massen. Lustlos ging ich die Einträge durch, schon fast überzeugt, dass Tom Pauli nicht sein richtiger Name war – da hatte ich ihn. Möglicherweise. Pauli, Tomas und Ivana. Neuköllner Adresse, soweit ich mich auskannte. Vornamen, die nach Ausland klangen, das erklärte einiges. Langsam, Lena, bremste ich mich, das konnte eine zufällige Übereinstimmung sein.