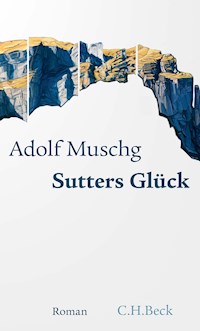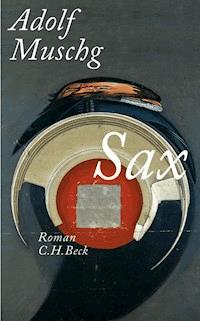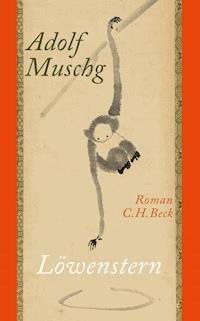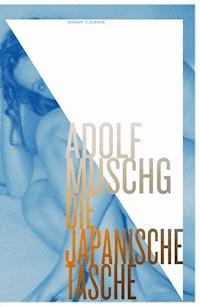19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Um in Berlin ein neues Buch zu schreiben, verlässt der Schriftsteller A. die Schweiz – und seine Ehe. Er setzt seine Krebsbehandlung ab, beschließt dafür aber einer Figur, die er in seinem letzten Roman sterben ließ, ein zweites Leben zu bescheren. Dabei erfährt er, dass er über Figuren seiner Erfindung so wenig allein verfügen kann wie über andere Menschen, denen er begegnet. Eine Wette zwischen Kunst und Leben, die auf überraschende Weise an einem Ort zwischen Ozean und Wüste eigentlich entschieden scheint, als sich eine neue, dramatische Bedrohungslage entwickelt...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Adolf Muschg
Aberleben
Roman
C.H.Beck
Zum Buch
Um in Berlin ein neues Buch zu schreiben, verlässt A., ein Schriftsteller von siebzig Jahren, die Schweiz – und seine Ehe. Er hat beschlossen, seine Krebsbehandlung abzusetzen, dafür aber einer Figur, die er in seinem letzten Roman sterben ließ, ein zweites Leben zu bescheren.
Man kann in A.s Vorsatz die Wette zwischen Kunst und Leben wiederfinden, die in der westlichen Literatur Tradition hat. Dabei stößt sie mit einer frohen Botschaft zusammen, welche die Frage durch einen Erlöser für entschieden hält, dem man nur noch glauben muss. Indem A. der Einladung folgt, in Ostdeutschland eine Weihnachtspredigt zu halten, setzt er sich dieser Versuchung aus – aber erlebt auch andere, mit denen er nicht gewettet hat. Er erfährt, dass er über Figuren seiner Erfindung so wenig allein verfügen kann wie über andere Menschen, denen er begegnet. Dafür, dass es am Ende der ursprünglichen Wette fast nur Gewinner gibt, ist allerdings eine List der Kunst nötig: die Aufführung der Tragikomödie «Amphitryon» an einem Ort zwischen Ozean und Wüste, der selbst etwas Märchenhaftes hat. Dabei macht sich hinter der Szene schon ein Spielverderber bemerkbar: ein viraler Parasit, der die Errungenschaften des Homo sapiens als Selbstbetrug zu entlarven droht.
Über den Autor
Adolf Muschg war u.a. von 1970–1999 Professor für deutsche Sprache und Literatur an der ETH in Zürich und von 2003–2006 Präsident der Akademie der Künste Berlin. Sein umfangreiches Werk, darunter die Romane «Sutters Glück» (2004), «Eikan, du bist spät» (2005) und «Kinderhochzeit» (2008) wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Hermann-Hesse-Preis, der Georg-Büchner-Preis, der Grimmelshausen-Preis und zuletzt der «Grand Prix de Littérature» der Schweiz. Im Verlag C.H.Beck erschienen Muschgs Reden «Was ist europäisch?» (2005), die Romane «Sax» (2010), «Löwenstern» (2012), «Die Japanische Tasche» (2015) und «Heimkehr nach Fukushima» (2018).
Inhalt
1. Buch: AKADEMIE
2. Buch: SCHANGPAULE
3. Buch: MADO
4. Buch: IN DIE MÜHLE
5. Buch: ESSAOUIRA
6. Buch: THEATER
7. Buch: ABSPANN
Gewidmet dem Andenken meiner Mutter meinen Enkelinnen Aiko und Matilda und der alten Räuberbraut EUROPAimmer noch guter Hoffnung
Ohne Poesie läßt sich nichts in der Welt wirken; Poesie aber ist Märchen.
Goethe zu F. v. Müller, 15.5.1822
So lebte Pygmalion einsam
ohne Gemahl und entbehrte gar lange der Lagergenossin. Weißes Elfenbein schnitzte er indes mit glücklicher Kunst und gab ihm eine Gestalt, wie sie nie ein geborenes Weib kann haben, und ward von Liebe zum eigenen Werke ergriffen. Wie eine wirkliche Jungfrau ihr Antlitz, du glaubtest, sie lebe, wolle sich regen, wenn die Scham es nicht ihr verböte. So verbarg sein Können die Kunst. Pygmalion staunt und faßt in der Tiefe der Brust die Glut für das Bild eines Leibes.
Ovid, Metamorphosen, Buch X
1. Buch:
AKADEMIE
1Es war ein milder Aprilabend, nach acht Uhr, aber noch hell, als A., zwei lärmende Rollkoffer an der Hand, sein Studio im weitläufigen Gebäude der Akademie gefunden hatte. Brauchen Sie WLAN? hatte die Dame am Tresen gefragt. – Nein, danke. Aber hätten Sie noch Briefmarken?
Inland oder Ausland?
Schweiz.
Er steckte die Marke – sie zeigte ein Nachtpfauenauge – in den Geldbeutel.
Studio 3, sagte sie, finden Sie den Weg?
Er war lange nicht mehr in der Akademie gewesen, in die er vor dreißig Jahren gewählt worden war, nach seinem zweiten Roman. Um so bemerkenswerter, daß die Sekretärin der Sektion seine wohl überraschende Anmeldung mit einem handschriftlichen Zettel quittiert hatte: es sei möglich, ihn für die Dauer der Mitgliederversammlung in der alten Akademie am Hanseatenweg einzuquartieren, wenn er keine anderen Pläne habe.
Das Café neben dem Eingang war belebt, aber A. ging rasch vorbei. Er sah nur unbekannte Gesichter. Für den Verkehr mit Menschen, denen er sich erst vorstellen mußte, war es morgen früh genug. Er ging durch den langen Korridor ins Hinterhaus weiter und benützte den Lift in den zweiten Stock.
Das Studio mit strengem grauen Mobiliar und Blick auf die Bäume des Tiergartens wirkte aufgeräumt und anonym. Dieser Eindruck wurde durch die Broschüren auf dem Bücherbrett noch verstärkt, eine Schriftenreihe der Akademie über ihre Jahrestätigkeit, und daneben lag ein Laptop mit aufgewickeltem Kabel. Entweder gehörte er zum Service, oder ein Vorgänger hatte ihn vergessen.
Schon auf der langen Fahrt hatte er die Sätze memoriert, mit denen er seiner Frau die plötzliche Abreise erklären wollte. Dabei blieb ihm bewußt, daß es viel eher darum ging, seinen Schritt für sich selbst zu begründen.
Seit seinem letzten Buch, das vor einem Jahrzehnt erschienen und zwar gelobt, doch nur mäßig verkauft worden war, hatte sich bei ihm eine Art stiller Verzweiflung eingeschlichen, die sich auch auf seine Ehe niederschlug. Er schrieb jeden Tag, besessen sogar, in seinem Dachzimmerchen, aber es blieb Sisyphusarbeit. Sie genügte ihm nicht; er war sich selbst nicht mehr gut genug. Es war darum kein heiterer Himmel, aus dem ihn vor vier Jahren die Diagnose traf. Der Befund kam nicht als Schock bei ihm an, eher wie ein Aha-Erlebnis. Wer keine Bahn mehr hat, kann auch aus keiner geworfen werden.
Fest stand nur: er war sich noch ein Buch schuldig, in dem er die Hauptfigur seines letzten, den Gerichtsreporter Sutter, ins Leben zurückholte. Zwar hatte er seinen Tod durch Ertrinken bereits ausgeführt, als Sutter, bürgerlich: Emil Gygax, die Urne seiner im Vorjahr verstorbenen Frau Ruth im Wasser des Silser Sees hatte bestatten wollen. Doch an seinem plötzlichen Entschluß, ihr nachzufolgen, blieb ein Rest von Zweifel haften, ob es sich nicht um einen Ausrutscher mehr in seinem Leben gehandelt habe und ob der Kampf um seinen Tod nicht vielmehr ein Kampf gegen die junge Wassersportlerin gewesen war, die ihn hatte retten wollen – ein absurder Reflex der Selbstbestimmung, die er sich um keinen Preis hatte nehmen lassen wollen, auch nicht denjenigen des Lebens. Die Grenzerfahrung war jedenfalls so plastisch geraten, daß sie die Kritik als Treffer bezeichnete. Warum sollte es nicht gelingen, die Szene ebenso überzeugend rückgängig zu machen, das Ende zurückzubuchstabieren – zum Anfang eines anderen Lebens?
Die Studios der Akademie waren eigentlich für prominente Mitglieder reserviert. Er hatte sich telefonisch bedankt; dabei waren seine Blicke vom Pult, an dem er sich Notizen für den Abschiedsbrief an seine Frau machte, über den vertrauten See gewandert, den er nicht wiedersehen würde. Kürzlich hatte er noch mit Henny seinen siebzigsten Geburtstag gefeiert; zu zweit in der «Kronenhalle». Daran hatte sie immerhin gedacht und nach seinen Plänen gefragt; es war diese Frage, die seinen Entschluß unumstößlich gemacht hatte. Aber davon reden konnte er damals noch nicht. Also mußte er sich erklären, jetzt, nachdem der Schritt schon getan war.
Er packte die Notizen aus dem Rucksack und setzte sich an den Schreibtisch, auf dem einige Bögen Papier mit dem Kopf der Akademie lagen, auch Umschläge und ein Kugelschreiber, als habe jemand auf seinen Vorsatz gewartet. Dieser Brief wollte von Hand geschrieben sein, wie ein gültiges Testament. Doch seine Hand zitterte, und er versuchte sie erst mit Krakeln auf dem leeren Blatt zu beruhigen. Henny hatte ihn immer «schwer zu lesen» gefunden.
Liebe Henny,
Zyt zum Ga, so haben wir uns das Produkt gemerkt, das mein bösartiges Wachstum zu hemmen versprach. Und so manches andere Wachstum verhinderte es auch. Nicht überraschend, daß Krebs und Sinnlichkeit auf demselben Boden gedeihen, beiläufig: Schreiben auch. «Zeit zu gehen», habe ich gestern zu der sündenteuren Medizin gesagt. Ich brauche keine Medizin, von der ihr Hersteller so viel besser lebt als ich.
Ich habe sie gestern abgesetzt, oder mich von ihr. Mag jetzt wachsen, was will und muß. Du habest mich nicht geheiratet, um Pflegerin zu werden, das hast Du mir, angesichts unseres Altersunterschieds, schon vor unserer Heirat gesagt, und ich schätzte deine Offenheit. Und nun ist die Pflegerin doch nicht mehr weit. Ich werde neutralisiert – um zu leben, soll ich nicht mehr zu lebendig sein. Ne-uter heißt: keins von beiden, und nichts recht. Also nicht mehr so, wie es die Götter ihren Lieblingen angeblich gegeben haben: «die Freuden, die Schmerzen, die unendlichen – ganz.» Inzwischen sind mir Brüste gewachsen, aber die Warzen schmerzen nur. Du müßtest Dir Gewalt tun, um mir ein halbbatziges Leben zu verlängern, und das bekäme uns beiden nicht. Mann und Frau sind nicht zur Unterdrückung geschaffen – auch nicht ihrer Hormone. Mit dem Fluch des Geschlechts verschwindet auch sein Glück und Unglück, das wir früher geteilt haben. Time to go für den Suppressor, auch für mich.
Oder blieb doch etwas zu wünschen übrig?
Du bist jetzt tagelang bei Mia, oft auch über Nacht, und jetzt, wo ich dies schreibe, schon eine volle Woche. Wir haben die Regel: kein Netzverkehr, also Mails auf keinen Fall (ich hätte auch keine Adresse dafür), und Telefonieren nur, wenn Not am Mann ist; dagegen hast Du vorgesorgt. Nie verläßt Du das Haus, ohne etwas vorzukochen und meine Medizin bereitzulegen. Die Tiefkühltruhe ist die verläßlichste Dritte in unserer Ehe – Deine Mia habe ich nie kennengelernt. Sie hat nur einen Webstuhl hinterlassen, als Denkmal ihrer älteren Rechte, die ich, glaube ich, ebenso respektiert habe wie Du meinen Anspruch auf Arbeitsruhe. Da sie mir nichts mehr bringt, wird das Geständnis unvermeidlich, daß mir so viel Respekt über den Kopf gewachsen ist. Ich muß mich verändern, wie man früher zu sagen pflegte, und in diesem Haus und zu seinen Bedingungen – auch wenn sie gewohnt, insofern bequem sind – gelingt mir das nicht mehr. So kann ich meinen klinisch toten Sutter nicht wiederbeleben. Ich vergesse die Teilnahme nicht, mit der Du sein Schicksal begleitet hast, ohne das Buch zu lesen.
Aber bis ich ihm ein zweites Leben verschafft habe, muß mir mein einziges teuer bleiben. Dafür suche ich jetzt einen neuen Arbeitsplatz, in Berlin. Ich kann nur wünschen, daß Mia wieder bei uns einzieht, um Dir das Hin und Her über den See zu ersparen. Von der Stille, die Du mir gönntest, habe ich inzwischen mehr als genug. Was kannst Du dafür, daß ich diesen Krebs eingefangen habe? Ich saß an meinem Arbeitsplatz mit Aussicht und starrte über den See. Ich sehnte mich nach Deiner Rückkehr, und ich fürchtete mich davor.
Gestern war mir klar, das muß ein Ende haben, und ich packte meine Sachen. Ich legte den ganzen Vorrat an Medikamenten auf Deinen Tisch, mit den Papieren und Schlüsseln, die Du nötig haben wirst. Ich hätte diesen Brief dazulegen sollen; das wäre nur fair gewesen. Aber ich wollte nicht fair sein. Ich nahm mir vor, die Notizen in Berlin ins reine zu schreiben: vielleicht gab es ja noch etwas zu bedenken. Dann konnte ich ihn auch mit der alten Post senden. Natürlich war dieser Vorsatz nicht sauber. Ich wollte, daß Du die Leere spürst, wünschte mir Dein Erschrecken; daß Du mir nachfragst, mich vermißt meldest, vielleicht gar bei der Polizei. Ich hätte mir ja auch etwas antun können.
Nun, es ist kein Lebenszeichen gekommen, kein Alarm, nichts. Ich kam ungehindert im Nachtzug nach Berlin zur Mitgliederversammlung.
Nun hoffe ich, in der Akademie unterzukommen, bis ich eine Wohnung gefunden habe. Ich erwarte von Dir keine Antwort mehr, fühle mich leer und frei – wenigstens von den sog. Nebenwirkungen einer Medizin, die mein Leben nur um den Preis verlängern kann, daß es nicht mehr stimmt. Ich bin gespannt, ob es mir gelingt, ohne Dich diesem Sutter ein zweites Leben zu erschleichen. Dafür muß ich selbst wieder zum Mann werden. Wir müssen uns dies und das von den Frauen erzählen, die wir am liebsten gehabt haben.
Also bitte, sorge Dich nicht weiter um Deinen –
Er zögerte; sie hatte ihn immer «Liebster» genannt.
Er ließ die Unterschrift weg. Der Brief war schon handschriftlich genug,
PS 1: Einen Briefkastenschlüssel habe ich versehentlich eingesteckt und lege ihn bei.
PS 2: Der Vollständigkeit halber teile ich noch mit, daß ich mich von unserer Minou verabschieden mußte. Sie war durch kein Futter mehr zu locken und schleppte sich zum Erbarmen. Wenn ich sie streichelte, war die Geschwulst an ihrem Bauch fühlbar. Ich brachte sie zu Dr. Weiß, der den Befund durch Röntgenbild nur bestätigen konnte. So wurden wir einig, sie einzuschläfern, auf meinem Schoß, und das letzte Zucken ihrer Pfote erinnerte mich daran, wie sie als junge Katze in Deinem Arm geträumt hatte. Zitterten ihre Kiefer, sagtest Du: sie sieht die Meisen fortfliegen. Wir haben gelacht, wenn sie durch Glas lechzend auf das Futterhäuschen starrte. Sie ist achtzehn Jahre alt geworden, und ich habe ihre Urne unter dem Ginkgo-Baum begraben.
PS 3: Den Renault habe ich in der Garage deponiert und Hauser gesagt, Du würdest entscheiden, was mit ihm zu geschehen hat.
PS 4: Ich danke Dir für die gemeinsamen Jahre und bin froh, daß Dich die Danksagung in diesem Fall noch vor der Todesanzeige erreicht. An unserer Ehe war vielleicht alles verkehrt, aber auch nichts, das uns jemand nehmen könnte.
Darum kein letztes Wort
von Deinem Peter
So viele PS, um am Ende doch noch seinen Namen darunter zu setzen.
Er faltete den Brief zusammen, steckte ihn in den Umschlag mit dem Absender der Akademie, schrieb die Adresse Meyerskappel darauf, bis gestern die seine, und frankierte ihn mit dem Pfauenauge. Dazu summte er eine Melodie.
On the waters of Babylon. Henny hatte von ihrer frommen Tante Kirchenlieder singen gelernt. Auch A.s Ziehvater war ein frommer Mann gewesen. Er hatte einen hohen Herrn gekannt, der ihn für seine Kümmerexistenz schadlos hielt. Und doch verdankte ihm A., daß er ohne Geldsorgen leben konnte. Das schuldenfreie Briefträgerhäuschen, mit großem Gemüsegarten, in dem er auch in der Freizeit noch rackerte, hatte sich als Schatz gezeigt, als es der Bauboom in eine bevorzugte Lage schob. Sein Verschwinden wurde dem einzigen Erben mit einer siebenstelligen Zahl vergolten. Davon deckte er nicht nur die Ausfälle seiner Schriftstellerei: er konnte auch eine Krankenkasse bezahlen, die ihre Leistungen auf das übrige Europa ausdehnte. Als seine Mutter ins Wasser ging, hatte sie einen kostengünstigen Tod gewählt; ihr Sohn konnte sich seinen Krebs leisten, auch in Berlin. Mit Henny hatte er, auf seinen Wunsch, in Gütertrennung gelebt. Nach dem Tod ihrer Mutter hatte das Einzelkind ihr Elternhaus, das früher als Villa gegolten hätte, mit Hilfe von Tante Lydias Erbschaft zum Atelier für sich und ihre Freundin Mia eingerichtet, wo sie brauchen konnten, was sie an der Kunstgewerbeschule gelernt hatten – Mia mit solchem Erfolg, daß sie auf der andern Seeseite ein technisch nachgerüstetes Atelier eröffnen konnte. Doch war ihr alter Webstuhl in Meyerskappel stehengeblieben, wie als Pfand einer wunderbaren Freundschaft. A. war sich lange als Eindringling vorgekommen. Insofern war sein Auszug eine späte Richtigstellung. In diesem Haus hatte er nicht gesät, er sollte darin auch nicht ernten.
Er grinste, als er Vaters Familienbibel aus dem offenen Rucksack lugen sah. Aber dann nahm er sie heraus und stellte sie neben die Jahresberichte der Akademie, Ja, er mußte auspacken und hatte noch nicht einmal die Lederjacke abgelegt, die ihm Henny geschenkt hatte, auf ihrer Ägyptenreise vor zehn Jahren; sie war eng geworden und immer noch kaum abgewetzt. Er nahm sich vor, sie in Berlin regelmäßig zu tragen. Doch als er sie aufs Bett ablegte, hörte er es darin knistern; es war ein ungeöffneter Brief, den er jetzt aus der Brusttasche zog.
Der Brief war an die Adresse in Meyerskappel adressiert und zeigte den Absender der Sparkasse Mannsfeld-Südharz, Filiale Bebenroda, ihm ganz unbekannt. Der Brief war mit Klebeband verschlossen; A. kramte seinen Pfeifenstopfer hervor, um ihn aufzureißen. Als erstes sah er nach dem Datum. Es war der 13. März 2018. Dann war der Brief über zwei Wochen liegengeblieben. Wer anders konnte ihn in die Tasche gesteckt haben als Henny? Hatte sie ihn auch schon geöffnet und wieder verschlossen? Aber wie konnte sie wissen, daß er mit dieser Lederjacke fliehen würde, die er eigentlich gar nicht mehr trug?
Verehrter Herr,
die Kulturstiftung meiner Bank veranstaltet jedes Jahr im Dezember eine «Laienpredigt» im Schloß Bebenroda, für die ich Sie dieses Jahr als Redner gewinnen möchte. Derjenige des Vorjahrs, ebenfalls Schweizer, hat mich auf Sie aufmerksam gemacht, worauf ich mich in Ihren Büchern umgesehen und festgestellt habe, daß Religion Sie ebenso beschäftigt wie mich, auch wenn Sie sich vom Glauben an eine Frohe Botschaft weit entfernt haben. Diese würde bei unserem Publikum auch auf steinigen Boden fallen, während es Fragen nach dem Sinn der Existenz keineswegs entwachsen ist, wie sein bisheriger Zuspruch beweist. Seien Sie gewiß, daß Sie nicht vor leeren Bänken reden müßten; es sind diejenigen der Schloßkirche, in der Thomas Müntzer seine Predigt gegen die Fürsten gehalten hat. Aber Sie brauchen dafür keine lebensgefährlichen Folgen zu fürchten. Nötig ist uns aber, daß das Salz nicht dumm werde, um bei Luthers Sprache zu bleiben.
Das diesjährige Datum wäre der 16. Dezember. Als Honorar kann ich Ihnen 1001 Euro anbieten. Wenn Sie aus der Schweiz anreisen, ist ein umweltverträglicher Besuch allerdings mit einer Tagereise verbunden; selbstredend kämen wir auch für die Bahnfahrt erster Klasse auf. Es wäre mir ein Vergnügen, Sie bei mir unterzubringen, auch wenn Sie sich mit einem Junggesellenhaushalt abfinden müßten. Ich kann Ihnen aber auch eine Unterkunft in der alten Mühle Aberleben besorgen, die übrigens ein Landsmann von Ihnen restauriert hat. Seine Kolonie war nach der Wende eine «Szene», wie man heute sagt. Davon ist nur noch eine spezielle Pension übriggeblieben, die freilich im Winter etwas einsam werden könnte.
Auf eine baldige Antwort freut sich
Ihr Jonas Deterra
Ihr Deterra. Gegen das besitzanzeigende Fürwort war A. immer allergisch gewesen. Er hatte es sogar in Liebesbriefen vermieden, wie schon in den pflichtschuldigen an seine Eltern. Nur kein «dein», schon gar nicht groß geschrieben. Ich weiß, du willst nur mein Bestes, und gerade das gebe ich dir nicht! Und nun genügte eben diese Formalität, ihn weichzustimmen. Und wie durch Tränen sah er seiner Empfindlichkeit auf den Grund. Sie war angenommen, ein Schutz gegen das Zuviel enttäuschter Liebe.
Und so nahm er gleich einen Briefbogen und schrieb darauf, ohne Scham für seine zittrige Schrift:
Lieber Herr Deterra,
ich bin umgezogen, darum erreicht Sie die Antwort auf Ihre freundliche Anfrage so spät. Ja, ich komme gerne, auch wenn ich noch nie im Leben gepredigt habe. Mit Ihren Bedingungen bin ich einverstanden. Bitte logieren Sie mich in der Mühle ein. Sie wird unserem Gespräch, auf das ich mich freue, gewiß nicht im Wege stehen, und Alleinsein bin ich gewohnt.
Diesen Satz strich er wieder durch, die Antwort sollte keine Lüge enthalten. Lesbar blieb er immer noch.
Ich schreibe diesen Brief unter provisorischen Umständen und bitte, für weitere Korrespondenz die Adresse der Akademie zu verwenden, bis ich eine definitive gefunden habe.
Mit guten Wünschen: Ihr Peter Albisser.
Er faltete das Papier und klebte den Umschlag zu. Jetzt würde er eine zweite Briefmarke benötigen. Er wog die beiden Briefe und vergrößerte den Abstand zwischen seinen zwei Händen. Sie bildeten eine Hängebrücke, über die er auf einen festen Punkt zugehen konnte, den 16. Dezember.
Bebenroda, Aberleben. Plötzlich sah A. Szenerien der verschwundenen DDR vor sich, die er vor bald vierzig Jahren, als vielversprechender Autor aus der Schweiz, bereist hatte, mit dem Lektor seines Verlags «Volk und Welt», den es auch nicht mehr gab. Gera, Jena, Mondlicht, das auf der Rückfahrt von Rudolstadt «das liebe Tal/still mit Nebelglanz gefüllt» hatte. Damit sie Alkohol trinken konnten, fuhr sie ein Chauffeur, aber daß der ein Mann der Staatssicherheit war, hatte ihm der Lektor gleich geflüstert, also redeten sie unterwegs nur über Literatur oder lieber gar nicht. Aber das Schweigen galt nicht nur der Thüringer Waldlandschaft, sondern auch den Früchten der Erkenntnis, die A. in Hotelbetten gesammelt hatte und deren Genuß nicht verboten war, aber auch nicht erlaubt. Wenn ihn eine begeisterte Leserin auf sein Hotelzimmer begleitete, nahmen sie die Gewißheit in Kauf, daß die Wanzen in der Wand sich keinen Ton entgehen ließen.
Aber auch die Schweizer Bundespolizei hatte mitgehört, jedenfalls zeigte sich, daß sie seine DDR-Reise mit Wegen und Abwegen haarklein registriert hatte. Diese Spitzelarbeit im Kalten Krieg flog noch vor seinem Ende auf, in der Fichen-Affäre, als die geheimen Einträge den Betroffenen offengelegt werden mußten. Die Namen der Bekanntschaften waren geschwärzt, dafür erschien eine andere Liebe im Klartext, über die er sich mit einer Buchhändlerin unterhalten hatte: diejenige des jungen Schiller zu den Schwestern Lengefeld – mit dem geheimdienstlichen Kommentar: er habe dann die jüngere geheiratet, «weil er mit ihr alles machen konnte». Später war A., als er Schillers Briefe wieder las, tatsächlich auf die Stelle gestoßen: «Was Caroline vor dir voraus hat, mußt du von mir empfangen: Deine Seele muß sich in meiner Liebe entfalten, und mein Geschöpf mußt du sein.» Ganz falsch hatte der Lauscher also nicht gehört. Schwere See, wind und weh, reimte es in A.s Kopf, er nannte solche Anfälle seine «Aftermuse». Aber auch Schiller hatten faule Äpfel in der Schublade gute Dienste getan.
Gab es 2018 noch einen Geheimdienst der Welt, der die früher «schön» genannte Literatur ernst genug nahm, um ihrer Spur im Leben etwas nachzufragen? Tempi passati: auch die Spur des eigenen Körpers war vom Doppelschlag von Krebs und Krebsblocker unlesbar gemacht worden: was hatte er noch zu erinnern? Wozu seinen Sutter nochmals aus dem Wasser ziehen, für welches Leben?
Auf der langen Fahrt nach Berlin war ihm ein Wortspiel eingefallen, nur ein Kalauer, doch A. war desperat genug, ihn für eine Inspiration zu nützen. Ruth-less. Schonungslos. Wie, wenn er aus dem Gerichtsreporter jetzt einen Verbrecher machte, einen Täter, der nicht nur ohne Rücksicht auf andere, sondern auch gegen sich selbst handelte, gegen seine Zweifel und Finessen, seine immer fluchtbereite Phantasie? A. fragte sich die Zehn Gebote ab, nach denen sein Vater, der fromme Briefträger, zu leben geglaubt hatte, und fand keines, gegen das er selbst nicht gesündigt hätte – tapfer gesündigt, auch wenn es etwas kostete. Den Gott seines Vaters nicht zu ehren, war ein bitternötiger Beweis eigener Freiheit gewesen, und geradezu Programm, andere Götter neben ihm zu haben. Sich Bilder von ihnen zu machen – und keine Peinture naïve –, sollte gar Teil seines Berufs werden. Die Frauen anderer zu begehren, wurde Ehrensache, als er so weit war, auch wenn es nur selten gelang. Dabei war er mit zehn Jahren noch Gründungsmitglied eines Frauenmörderklubs gewesen! Am Gymnasium hatte er als «Waräger» auf ein Viertes Reich geschworen und war als Student pflichtschuldig zu der Menschheit froher Linken abgeschwenkt. Gelogen hatte er, soweit seine Phantasie reichte, notorisch, womöglich für eine gute Sache, getötet hatte er auch, aber nur in Gedanken. Das einzige, was ihm nicht einfiel, war zu stehlen. Das war unter seiner Würde, auch wenn das Vermögen, das ihm der Verkauf des elterlichen Grundstücks eintrug, gänzlich unverdient war. La proprieté, c’est le vol, aber er ließ sich den Glückstreffer gefallen, die ihn für die gefühlte Armut seiner Jugend entschädigte. Kurzum, er war beim Sündigen brav, manchmal auch tapfer gewesen; denn diese Sünden waren der Nährstoff für seine Schriftstellerei. Sie brauchte Kunst, denn eigentlich paßte in seinem Leben nichts richtig zusammen. Und jetzt, mit siebzig Jahren, war mehr als Bravheit nötig, der Drohung im eigenen Leib zu begegnen. Glück.
Samothrake, das ägäische Meer, die Heimat der Siegesgöttin Nike: da hatte er mit Henny den letzten Urlaub verbracht; seither war es der vorgemerkte Ort für Sutters Ende. Jetzt brauchte er nur noch einen guten Anfang. Und A., allein an einem leeren Schreibtisch, grinste wider Willen.
War er noch ein Schriftsteller? Jedenfalls hatte er Hunger. Und es graute ihm davor, unter fremde Leute zu gehen.
Er ordnete seine fremdgebügelten Hemden, seine Wäsche und Toilettenwässerchen in Regale und Schubladen ein und kam sich wie ein Rekrut vor, der vor einem halben Jahrhundert am ersten Tag in der Kaserne auf einem «Planke» genannten Kopfbrett seinen Kram zentimetergenau rangiert hatte, zur Prüfung durch den Feldwebel. Ja, ein Soldat und brav war er fünf Jahre lang auch gewesen, seiner Mutter zu Gefallen, bis er einen militärischen Grad erreicht hatte, in dem man sich sehen lassen und die Kaserne, einen ehemaligen Pferdestall, mit einer Offiziersunterkunft vertauschen durfte. Sie hatte den Komfort eines mittleren Vertreterhotels, doch mit unbeschränktem nächtlichen Ein- und Ausgang. Wie er diesen feldgrauen Dienst mit einem großen Akt für eine linke Lehrlingsgruppe beendet und ihm auch seine feste Stelle als Gymnasiallehrer nachgeworfen hatte, war – stark frisiert – in dem Roman geschildert, mit dem er zum Mitglied dieser Akademie geworden war. Er wäre kaum gewählt worden, hätte er diesen Acte gratuit nicht zugleich als Hochstapelei und Selbstbetrug entlarvt – als hinreichendes Motiv, auf den Analytiker zu schießen, der ihm die Demontage einer mangelhaften Persönlichkeit nicht erspart hatte. Dieser Eklat mit der Waffe war erfunden – aber gut genug, daß er als Literatur durchging. Tatsache blieb, daß ihn der reale Bruch mit bürgerlichen Erwartungen für weitere Romane qualifiziert hatte. Der letzte war sein Sutter-Roman, in dem er einem Gerichtsreporter dieses Namens seinerseits eine Schusswunde zugefügt hatte. Und als dieser sie überlebte, hatte er ihm eine Art Liebestod im Wasser des Silser Sees verschrieben, in dem er die Urne seiner aparten, doch fremd gebliebenen Frau Ruth hatte beisetzen wollen.
Dieses Ende war damals gut angekommen – offenbar auch bei einem Sparkassenverwalter im Südharz. Warum konnte A. diesen Sutter nicht gut sein lassen, gut und tot? Die Gründe für diese Revision waren ihm noch schleierhaft, aber so viel wußte er schon: sie ließen sich nur durch Schreiben selbst herausfinden – und erst, wenn es gelang, wurden sie angemessen gleichgültig. Nur fehlte ihm jetzt die wahre Märchensprache, die seine Ruth gekonnt hatte; dafür hatte er die Figur erfunden, mit allem, was ihm lieb und teuer war. Am Ende schenkte sie ihm gar einen eindringlichen Tod, für den er sich nochmals ihre Sprache leihen durfte.
Damals hatte er diese Sprache noch – oder sie hatte ihn. Mußte er diesem Sutter die Uhr nochmals zurückstellen, wo A.s eigene schon so deutlich abzulaufen begann – ein Wettlauf, der nicht zu gewinnen ist, so oder so? Die Frage war nur, ob zwischen so und so noch Raum blieb für eine lebensrettende Phantasie. Und ausgerechnet jetzt empfing die Akademie ihre Gäste mit einer Ausstellung «Der gute Tod». Zufall, Ironie, oder war A. vor die rechte Schmiede gekommen? Er wird sie nicht besuchen; jeder Bindestrich zwischen Leben und Tod war Wunschdenken – an seine Stelle setzte die Kunst ihre Fiktion unerschöpflicher Gegenwart. Komm zu Potte/Mit dem Totte! Die Aftermuse war A.s Mäuschen der Einsamkeit, sein Haustier FÜR ALLES.
Als das Ergebnis der Prostata-Biopsie «positiv» war, stand zuerst ein radikaler Eingriff zur Debatte. Henny forderte ihn mit ungewohnter Dringlichkeit; A. verlangte Bedenkzeit, im Jargon: Watchful waiting. Aber als die Frist abgelaufen war, beschloß er, lieber gar nichts mehr an sich machen zu lassen. Er vertagte den Eingriff von Woche zu Woche. Und da es ganze Zeitstrecken gab, wo er nicht mehr daran dachte, konnte es scheinen, der Krebs habe sich von selbst erledigt. Statt Bestrahlung Liebe, seine Potenz hatte nicht gelitten, nur war sie, im Verhältnis zu Henny, immer weniger gefragt. Dennoch weigerte er sich, verstümmelt zu werden, auch wenn der Urologe versichert hatte, die Erektion werde überschätzt. Mit der erfinderischen Zärtlichkeit, die ihre Stelle nicht nur «wohl oder übel» einnehme, sei sogar die Frau «gut bedient». Sie bleibe ja auch nicht die Jüngste.
Als A. entschlossen war, nichts und niemanden mehr zu bedienen, war es wieder Henny, die nicht geruht hatte, bis er sich die Gutartigkeit seines «Herds» durch ein MRI bestätigen ließ. Und an einem schönen Septembertag 2016 brachte die Röhre das brutale Gegenteil ans Licht. Der Krebs hatte in den Lymphbahnen Ableger gebildet – schon zu viele, um ihnen mit Stahl oder Strahl beizukommen. Es blieb nur die palliative Hormontherapie, von der A. ahnte und dann auch erlebte, was sie bedeutete: anhaltende Fatigue und Unlust und Stillstand seiner Produktivität. Libido, das sprunghafte Biest, hatte sich zur Ruhe gelegt. Und das Beste, was er von ihrem Unterdrücker erwarten konnte, war eine triste Verlängerung seiner Galgenfrist.
Sogar die Versuchung, sich selbst zu befriedigen, war im Keim erstickt. Als er ihr dennoch einmal gefolgt war, schwebte ihm eine Jugendliebe vor, mit der er über intime Tastversuche nie hinausgekommen war. In der leeren Wohnung vermochte sich seine Phantasie nicht einmal mehr dafür zu erwärmen. Und ein spöttischer Zufall wollte es, daß er dem Phantom beim nächsten Gang in die Stadt leibhaft begegnete, und auch noch im Theater, zu dessen Besuch er sich aufgerafft hatte. Doch das einzige, was ihn juckte, war der Vorname, mit dem sich die rundliche Matrone vorgestellt hatte. Er hätte sie nicht erkannt, aber sie war stolz darauf, ihn «regelmäßig» zu lesen. Bist du auch verwitwet? hatte sie gefragt. Nur Strohwitwer, entgegnete er, und ihr Auflachen verriet, daß es keine allzu große Mühe gekostet hätte, die Pause zu überbrücken.
Noch nie hatte sich A. durch eine Krankheit so verhöhnt gefühlt.
Allmählich hatte sich sogar die Eifersucht verloren, welche die leere Stelle einmal besetzt hatte. Er konnte sich fast gelassen einreden, daß er Henny einen anderen Partner aufrichtig gönnte. Bei einer Partnerin hatte er ohnehin nicht mitzureden. Die fortgesetzte Gewohnheit hatte sogar den Geschmack von Treue angenommen. Eigentlich hätte es jetzt eine Ehe wie so viele andere sein können. Was fehlte, war kein Stoff für Demonstrationen mehr. Dabei hatte er, wenn sie unter Freunden saßen, immer noch den Reiz ihrer Exklusivität empfunden. Sie teilten das Geheimnis einer guten Ehe, verbargen nur, daß sie körperlich nicht mehr stattfand.
Er trat ans Fenster und starrte in die Bäume hinaus. Die Dämmerung schritt fort, die Stadt verbreitete ihr eigenes Licht, light pollution wie überall: wurde der Himmel davon hell oder dunkel? Lucus a non lucendo, hatte er als Lateinschüler gelernt. Das Wort für «Hain» kommt davon, daß das «licht» Genannte nicht leuchtet. Scriptor a non scribendo. Ein Schriftsteller kommt davon, daß er nicht schreiben kann und die Aftermuse einspringen muß, in der von einer Sprache nur Witze bleiben.
Gab es eine Geschichte der Sprachwitze? Sie wäre selbst ein Witz, aber niemand fände ihn lustig. Niemand – auch eine Figur, die der Schriftsteller A. nicht losgeworden ist. Immer wieder schleicht sich dieser Niemand als Hauptfigur ein oder springt aus einem Text wie ein Schachtelteufel: ich bin schon da! Ick bün all doar, wie es auf Platt heißt, auf der Weide für Hasen-und-Igel-Spiele, deren auch böse Ziegen nicht satt werden: Wie soll ich satt sein, ich fand kein einzig Blättelein. Und handkehrum: Ich bin so satt, ich mag kein Blatt. Wer zweimal lügt, dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Aber er spricht doch zweimal die Wahrheit, nichts als die Wahrheit, nur nicht die ganze. Wie soll Niemand sie kennen!
Ja, als er noch Odysseus hieß! Da hat ihm die wahre Lüge das Leben gerettet, vor dem geblendeten Riesen Polyphem. Die Lüge war so stark, daß sie auch noch seine Gefährten rettete, sie brauchten sich nur fest genug an die Bäuche der Schafe zu klammern, wenn der Riese ihnen prüfend über den Rücken strich. Und A.? Als er noch glaubte, Jemand zu sein – an wie viele Bäuche hat er sich geklammert! Einmal hat sie ihm Henny vorgezählt: dreizehn Frauen! Er lachte. Er hatte ihr ja nicht alle gebeichtet. War er der rechte Mann für eine Weihnachtspredigt?
Wem nichts mehr einfällt, spielt am Computer. A. hatte aus Meyerskappel einen Memory-Stick mitgebracht, der gespeichert hatte, was für Sutters Auferstehung schon geleistet worden war. Die Schweizer Tastatur hätte ihm in Berlin ohnehin nicht gedient. Es fehlte das «ß», an dem Niemand hing, jeder Orthographiereform zum Trotz. Er holte den schmalen Rechner samt Kabelzubehör vom Regal und stellte ihn auf den Schreibtisch, erkannte die Steckdose und schloß das Kabelzeug an. Als er den Bildschirm aufgeklappt hatte, zeigte sich auf der Tabulatur ein Papier, von Frauenhand beschrieben: Paßwort – und es folgte ein achtstelliger Code, aus Zahlen und Lettern zusammengestückt, eine Karikatur des Zufalls. Niemand tippte sie nach, und – o Wunder! – der Rechner sprang an.
Und jetzt? – Nein.
Er begann die Koffer auszupacken, Kleider in den Doppelschrank, Wäsche in die Kommode. Fast zärtlich stellte er seine paar Bücher aufs Regal, wo sie gleich zu fremdeln begannen. Sie vermißten ihre Nachbarschaften in der zurückgelassenen Bibliothek, «Die Verlobten» von Manzoni, Benjamin Constants «Adolphe», die zweisprachige Sammlung griechischer Tragiker, Goethes «Faust». Seine Schreibsachen, nur das Nötigste; die teure Füllfeder war bereits tätig geworden. Sie war ein Geschenk von Lukas Sigg, dessen Familie ihn, nach dem Tod seiner Mutter, in ihr Haus aufgenommen hatte. Zum Dank hatte er ihm später als Ghost die Dissertation geschrieben, über den ewigen Bund der Stadt Rottweil mit der Eidgenossenschaft, aus dem Sigg, als europapolitischer Staatsrechtler, später die juristische Zugehörigkeit der Schweiz zur EU entwickelt hatte. Das war A.s anonymer Beitrag zu einer fiktiven Geschichtsrevision gewesen, bevor er – nach einem Zwischenspiel als Gymnasiallehrer (Deutsch) – als Schriftsteller eigene Fiktionen entwickelte. Inzwischen hatte die Familie Sigg den ehemaligen Nationalrat in ein psychiatrisches Heim abgeschoben, ein standesgemäßes Niemandsland. Sein Füller aber hielt, wie die Werbung versprochen hatte, hundert Jahre. In vierzig davon war es A. immerhin gelungen, ihn nicht zu verlieren. Seit er die eigene Handschrift kaum noch lesen konnte, brauchte er ihn immer weniger. Aber in Berlin war die Prachtfeder wieder dabei, die einen akademischen Betrug veredelt hatte.
Die Pfeifen, nur drei von vielen, aber die kostbaren mit dem weißen Punkt. Sie lagen etwas verloren auf dem Schreibtisch, hier konnte man nicht mehr rauchen. Das tat er ohnehin nur noch sparsam, und zum Schreiben gar nicht mehr, Henny zuliebe. Sie hatte ihm keinen Mundkrebs gewünscht. Würde er damit in Berlin wieder anfangen? Kam mit dem Rauch auch der gute Geist zurück? Oder war es tapferer, entwöhnt zu bleiben, wie die Anonymen Alkoholiker?
Inzwischen war alles ein- und aufgeräumt. Aber wo blieb der Stick?
Dieser Stick entschlüpfte ihm fast gewohnheitsmäßig. Verlieren ist dein Hobby, pflegte Henny zu sagen und weigerte sich, ihm beim Suchen zu helfen. Seinen Spruch: Wer findet, hat nicht richtig gesucht, fand sie nicht lustig. Aber diesmal war A.s Schreck ehrlich: er hatte den Stick doch mit aller Umsicht an einem bestimmten Platz seines Gepäcks versteckt – nur: an welchem?
Es war die Geheimfalte im Inneren seines Rucksacks, in die sich der Wicht noch tiefer verkrochen hatte, und A. war gleich doppelt erlöst. Er hatte immer noch was zu verlieren. Und dement war er noch nicht.
Der Rechner hatte sich wieder verdunkelt, um Strom zu sparen. Doch er sprang sogleich an, als A. den Stick mit zitternder Hand in die Buchse steckte, und nach ein paar Klicks stand die Schrift auf dem Schirm wie gedruckt. Wir brauchen noch Katzenfutter.
2Wir brauchen noch Katzenfutter, sagte sie mit rauher Stimme.
Die Ausfahrt zum Einkaufszentrum war schon fast überfahren. Sutter stellte den Blinker, sah in den Rückspiegel, trat auf die Bremse und riß den Wagen aus der Bahn des Rasers, der, ohne Geschwindigkeit wegzunehmen, vorbeiheulte, wobei der Dopplereffekt von Hupe und Motor kaum zu unterscheiden war. Erst als Sutter über eingezäunte Wiesen auf die beleuchtete Gebäudegruppe zusteuerte, schoß der Schreck in seine klammen Finger nach. Wir brauchen noch Katzenfutter. Es war erst Ruths dritter Satz auf der Fahrt von L. nach Hause.
Das war die letzte Kontrolle, war das erste gewesen, als sie ins Restaurant zurückgekommen war, wo er das Ende ihrer Konsultation abgewartet hatte. Ruth trat durch die Tür, ging geradewegs zu seinem Tisch und blieb davor stehen. Er war aufgestanden. Nicht ablegen, keinen Kaffee. Nach Hause. Sie zog den offenen Mantel um sich, ihre Hände wußten nicht mehr, wie ein Mantel zuzuknöpfen ist. Schließlich strichen sie nur über den Saum und fanden an dem schweren Wollstoff immer noch etwas zu glätten.
Möchtest du Schnippenkötter heißen? fragte sie.
Er lächelte ratlos.
Die letzte Kontrolle.
Er hatte nach der Bedienung gerufen und dabei den lokalen Anzeiger um die Holzstange geschleudert, in die er festgeklemmt war. Kaum beherrschte er die Wut über die lehrhafte Säumigkeit, mit der sich die junge Frau herbeiließ, nachdem sie zuerst den Nebentisch umständlich abgeräumt hatte. Er hörte die Zurechtweisung, mit der sie das Herausgeld unter ihrem Spitzenschürzchen hervorkramte, nicht, ohne ihm – die Frau im Mantel übersehend – am Ende «ein gutes Täglein» zu wünschen.
Sutter hatte mit einer Stunde Konsultation gerechnet, wie frühere Male. Er übereilt sich mit keinem Wort, hatte Ruth Dr. Clemens gelobt, den ältlichen Oberarzt des großen Krankenhauses, in das Ruth vor einem Jahr eingewiesen worden war. Der Chefarzt hatte den Befund der Biopsie «leider nicht ganz gut» nennen müssen und die fällig gewordenen Strategien erläutert. Danach hatte Ruth das Sprechzimmer ohne ein Wort verlassen. Aus einer Nische des Korridors trat der Oberarzt auf sie zu, der die Darmspiegelung durchgeführt hatte. Er begleitete das Paar zum Ausgang, und erst vor der Drehtür sprach er einen Satz, der an Sutter gleich abgelaufen war. Mitten in der Nacht war er ihm wieder zugefallen, und er hatte ihn lautlos nachgesprochen: «Krebs ist nie gleich Krebs.»
Am folgenden Tag war Ruth heiter und blieb es mit so viel Festigkeit, daß er darin eine Warnung vernahm. Es gebührte ihm nicht, sich ihre Gedanken zu machen, auch nicht im Schutz der Behauptung, es geschehe zu ihrem Besten. Sie hatte vor dreißig Jahren ein Medizinstudium angefangen; warum sie es abgebrochen hatte, wußte er nicht, ahnte nur so viel: wie sie damals keine Ärztin geworden war, wurde sie jetzt keine Patientin. Ruth hatte in Indien und Arizona gelebt, bevor sie sich, schon Mitte dreißig, zur Niederlassung entschlossen hatte; so drückte sie sich aus, als wäre sie ein Wandervolk. Als älterer Gerichtsberichterstatter, der, außer im Kopf, nicht viele Grenzen überschritten hatte, konnte er sich nie recht vorstellen, was die Vielgereiste bei ihm suchte. Für Ruhe war es zu früh, am Gemeinschaftsleben beteiligte sie sich kaum, das die vor zwanzig Jahren noch junge Siedlung verheißen hatte. Inzwischen waren die Zukunftsbauer weitergezogen und Unternehmer in eigener Sache geworden. Ruths und Sutters Ehe hatte kein «Projekt» werden wollen, aber auch unhinterfragt bestand sie noch, und mit den Jahren als einzige am alten Ort. Kinder bekamen sie keine. Einmal im Jahr machten sie Urlaub im Oberengadin.
Ruth beschäftigte sich mit einer indianischen Sprache und saß oft stundenlang am Computer, ohne die Tastatur zu berühren. Über ihre Arbeit, die sie «das Buch» nannte, redete sie nur mit ihrer Katze. Auf das Kochen verwendete sie viel Zeit und fuhr lange Wege, um Zutaten und Gewürze einzukaufen. Standen die Speisen aber auf dem mit Sorgfalt gedeckten Tisch, nahm sie nur versuchsweise davon und unterhielt ihn, während er aß, mit merkwürdigen Beobachtungen, die sie tagsüber gemacht haben wollte und die, wenn man ihr glauben durfte, auf die wahre Geschichte deuteten, die sich ganz unbemerkt vom allgemeinen Nachrichtenwesen ereigne. Sie bestand aus Zeichen, die andere Lebewesen – zu denen sie auch die Steine zählte – untereinander austauschten. Wenn Ruth recht sah, so bereiteten die übersehenen Dinge eine neue geräuschlose Schöpfung vor, welche die Eigenschaft besaß, sich von derjenigen des Menschengeschlechts, die Ruth den «blinden Fleck» oder auch den «toten Winkel» nannte, nicht länger stören zu lassen. Dabei wollten die Dinge aber keine Zuschauer. Es mußte gelingen, sich unbemerkt unter sie zu schleichen und ihresgleichen zu werden. Dann verflüchtigte sich der Anstoß, den sie nahmen, und man konnte zusehen, wie sie damit beschäftigt waren, aus immer weniger immer mehr zu machen. Es geschehe nämlich, so Ruth, alles, auch das Kleinste, zum ersten Mal, und zwar in jedem Augenblick. Es komme nur darauf an, diesen Augenblick abzuwarten. Nichts daran sei geheimnisvoll. Nur dem Schein müsse man trauen, und je weniger Zeit man zu haben glaube, desto mehr werde Dasein zu einer Sache der Geduld.
Ich weiß, daß du in einem Geheimdienst tätig bist, sagte Sutter, und sie antwortete: aber erst, seit ich dich kenne. Vorher habe ich nur so getan. Du weißt gar nicht, was ich dir hinter deinem Rücken alles in den Mund lege. Iß, Sutter, überlaß das Reden mir. Du hast ja nie richtig essen gelernt. Findest kein einzig Blättelein.
Es schien ihr zu gefallen, wenn sein Appetit stärker wurde als seine Scham; es kam auch vor, daß er vor Lachen nicht weiteressen konnte. Ist es recht? pflegte sie zu fragen, im Stil einer ländlichen Saaltochter. Darf es noch etwas mehr sein vom Linsengericht? von der Blutsuppe? vom Bienenbock?
Für sich selbst kochte sie aus den sogenannten «Care-Paketen», welche die Post mit einem belgischen Absender ins Haus brachte, einen grauen Brei, den er «dein Katzenfutter» nannte. Du hast recht, sagte sie, ich muß es vor ihr verstecken, sonst ließe sie mir gar nichts übrig. Doch machte Ruth ein Geheimnis aus der Zubereitung und verlegte diese immer mehr in die späte Nachtzeit, so daß ihr Bett im gemeinsamen Schlafzimmer unberührt blieb. Er lag wach und dachte, daß sie ihm ihre Schmerzen verberge. Mit der Zeit ergab es sich, daß Sutter für den Einkauf des eigentlichen Katzenfutters zuständig wurde, und er begann, darin eine Absicht zu wittern. Sollte sich die Katze an den neuen Ernährer gewöhnen?
«Krebs ist nicht gleich Krebs.» Diesem Satz war Ruth, fast ein Jahr nach der Entdeckung ihres Befunds, nachgereist und hatte Dr. Clemens wieder aufgesucht, als dieser, zur Beförderung nicht mehr fähig oder willens, aus der Universitätsklinik ausgeschieden war, um in seiner kleinen Geburtsstadt L. fünfzig Kilometer entfernt eine Allgemeinpraxis zu eröffnen. Sie war von spartanischer Einfachheit, wie Sutter bemerkt hatte, als er seine Frau noch ins Wartezimmer begleitete; das tat er inzwischen nicht mehr. Er lernte damit leben, daß seine Frau die Sprechstunde jedenfalls nicht zum Sprechen mit ihm benützte; um so mehr den gemeinsamen Tisch, den sie für ihn allein gedeckt hatte. Als es Frühling geworden war, erzählte sie ihm das Neueste von den Knospen, die draußen im Garten gerade hätten aufbrechen wollen, aber angesichts ihres forschenden Blicks darauf verzichtet hätten; «sonst hätten sie mir verraten müssen, wohin.» Die Steingruppe am Teich dagegen habe sie noch nie so stillstehen sehen wie heute. Doch als sie ein Sonnenfleck getroffen habe, seien sie einen Augenblick ins Wanken geraten, leider genau in demjenigen, in dem Ruth habe zwinkern müssen. So sei aus dem Bild nichts geworden. Danach aber hätten sich die Steine eine Spur zu unauffällig gemacht, auch dunkler ausgesehen, untrügliche Zeichen der Scham, beim Wanken ertappt worden zu sein. Ist das kein Indizienbeweis, Gerichtsreporter? Jetzt müsse Ruth fürchten, daß sich die Steine die Steinwidrigkeit, die sie sich hätten entschlüpfen lassen, zu Herzen nähmen, und dies könne nicht gesund sein, auch wenn es über das Herz der Steine erst Vermutungen gebe. Gut erforscht sei erst ihr Geschrei.
Es kam vor, daß ihn Ruths Possen hilflos machten, auch wütend; dann war sie imstande, ihn ernsthaft anzusehen: Sutter, deine Verbrecher haben doch immer Geliebte gehabt. Oder immer wieder. Du siehst aus, als brauchtest du auch einmal eine. Warum machst du mich nicht dazu? Du hast es bei unserer Hochzeit versprochen, in guten und schlechten Tagen.
Krebs ist nicht gleich Krebs.
Nach seiner Entdeckung hatte sie gesagt: Daß es gerade hier sein mußte. Aber das ist schon meine blöde Stelle gewesen, als ich noch einen Schwanz hatte. Schuppen trug ich auch vorher keine. Die haben nur gemeine Wasserfrauen. Glatte Haut hatte ich, wie ein Mensch, und zur Zeit, wo der Eisvogel brütet, zeigte sie den gewissen Silberton. Auf den bildete ich mir etwas ein. Und die Schwanzflosse hättest du sehen müssen, schlagkräftig wie ein doppelter Flügel und fast so breit wie beim Tümmler. Jetzt weißt du, warum ich große Füße habe. Die blieben mir, nachdem ich mich von unten auftrennen mußte. Nicht ganz durch, bis hierher und nicht weiter. Aber fängst du erst zu reißen an, so will das immer weitergehen, bis zum Schädel hinauf. Die Schlußnaht ist ein Problem, das Verstäten. Wenn du ein Mensch wirst, mußt du die Beine aufmachen. Vorn hab ich das einigermaßen hingekriegt. Aber wer denkt an hinten? Da blieb diese blöde Stelle. So etwas machen sich niedere Tiere zunutze und schlüpfen ein. Im Wasser wäre es bei einem Polypen geblieben, aber an Land, wo alles gröber ist, wurde ein Krebs daraus.
Er selbst hatte einst damit angefangen, sie «Seejungfrau» zu nennen, und sie hatte ihn prüfend angesehen. Ich habe keine Seele, willst du sagen. Eigentlich hatte er alles andere sagen wollen. – Du hast ganz recht, antwortete sie sich selbst, und ich will auch keine, damit macht man einander bloß Umstände. Ohne Seele kannst du mich besser aushalten. Ich hoffe, du vermißt nicht zu viel. Etwas bleibt ja immer noch übrig. Ich wußte nicht einmal, daß es so viel werden könnte. Im Wasser finden sie kein Wort für Liebe. Beim Schwimmen hatte ich etwas zu bieten, aber da fand niemand viel dabei. Das störte mich eines Tags. Ich wollte mit einem Menschen schwimmen, und du hast dich darauf eingelassen. Das hast du jetzt davon.
«Die blöde Stelle». «Blöd» hieß in Sutters Mundart ein Tuch, das, dünn gewetzt, nächstens durchscheuern wird. Und was die «Seejungfrau» betrifft, so wäre sie ihm ohne den Besuch von Lortzings «Undine» nicht in den Sinn gekommen. Das war am Abend nach der ersten «Spiegelung» – sie war, trotz aller Vorsicht des Oberarztes, peinlich und schmerzhaft gewesen. Doch wenn der Befund schon klar war, blieb er verschwiegen. Angesichts von Ruths Erschöpfung hatte Sutter die Karten für die Oper zurückgeben wollen. Sie protestierte: Da wollen wir hin! Im Stillen erleichtert, daß sie den Abend nicht allein verbringen mußten, hatte er neben ihr in der Loge gesessen, auf die sie ein von ihrer Tante geerbtes Abonnement besaß. Vornehm geht die Welt zugrunde! Aber das hatte sie früher auch gesagt, als das Mittagessen noch aus Pellkartoffeln bestand, oder wenn sie im Zugabteil zweiter Klasse deutlich hörbar die «gediegenen» oder auch «erfahrenen» Holzbänke vermißte, die es früher in der – längst verschwundenen – dritten Klasse gegeben hatte.
Sutter, im etwas zurückgezogenen Samtsessel, hatte seine Frau betrachtet, die ihm, in Lortzings treuherzigen Klang vertieft, nur die Andeutung ihres Profils zuwandte. Die Zerbrechlichkeit ihres Halses unter dem schweren schwarzen Haar ließ seinen Atem stocken. «Dein eitel Sehnen/Ist nun gestillt, o kehr zurück!» Sie saß regungslos, als Kühleborn, ein dicklicher Baß, das verlorene Kind der Tiefe zur Absage an ihre unselige Menschenliebe aufrief.
Kaum waren sie zu Hause, forderte er, wie ein Wegelagerer, noch in Kleidern den Zoll dieser Liebe ein, und so entfesselt war sie ihm noch nie entgegengekommen. Doch als er im Schutz des Rausches an die «blöde Stelle» rührte, hielt sie ihn zurück. Nachdem sie sich wieder angekleidet hatten, blieben Ruths Augen naß, wie in der ersten Zeit ihrer noch ganz fremden Liebe, als Ruth im Glück der Vereinigung nie hatte lachen können, ohne daß ihr die Tränen kamen.
Laß dich nicht stören, hatte sie das erste Mal gesagt, als er sie hatte trösten wollen, wenn er auch nicht wußte, worüber: Ich weine aus Stolz. Das hat Cäsar auch getan.
Ich habe doch keinen Frauenkrebs, Sutter, sagte sie später, ich muß einen Menschenkrebs haben. Aber ich glaube, der wird nie reif. Er ist so kindisch. Nicht einmal vom Tod will er etwas wissen. Er ist im Trotzalter, vielleicht möchte er mir weh tun. Wir müssen ihm viel nachsehen.
Natürlich hatte der Chefarzt gleich von einer Operation gesprochen, dafür sei es nicht zu früh. Doch erst als es dafür wahrscheinlich zu spät war, wußte Sutter: Ruth hatte die Operation nie auch nur in Betracht gezogen. Am ersten Schnitt, Sutter, war es genug. Die Meerjungfrau hat es für dich getan, aber sie wollte ohnehin gehen lernen, und das will ich immer noch. Was kannst du dafür, daß es mir nicht bekommt.
Wie antwortet ein Partner auf solche Sätze?
Du bist kein Partner, Sutter, mach dich nicht klein. Mit einem Partner hätte ich vielleicht ein Geschäft aufgemacht, aber das Wasser nie verlassen. Du bist mein Liebster, und wenn du nicht aufpaßt, wirst du noch mein eigen. Ich hätte dich auch für ein Kind nicht hergegeben. Die Seejungfrau ist schon Kind genug. Glaubst du, du kannst sie wie einen Menschen behandeln?
Das war kein Vorwurf und kein Hilferuf, es war eine Frage.
Das war die letzte Kontrolle.
Auf der Rückfahrt, der Januartag begann schon einzunachten, saß sie stumm auf dem Vordersitz. Sie und Dr. Clemens, der Hüter der blöden Stelle, hatten einander aufgegeben – warum?
Auf der Hinfahrt war sie heiter gewesen, mitgetragen von einer Nocturne Chopins, welche die Kabine schweben ließ. Heute abend mußt du mir vorlesen, hatte sie beim Einlegen der CD gesagt. Maushärchen. Und dann jeden Abend, von heute an.
Maushärchen?
Der Brüder Grimm.
Hausmärchen also.
Die Kindermärchen läßt du aus. Nur Maushärchen. Dann hat auch die Katze etwas davon, und wir bleiben im Haus.
Praktischere Versuche, Ruth zur Hand zu gehen und Sorge zu tragen, ließ sie nicht zu. Übernimm dich nicht, Sutter. Du hast eine Bandscheibe, und ich werde eine Last, das paßt nicht zusammen. So wenig wie wir, das verbindet uns. Denn zu allen andern Leuten würden wir doch sehr ungern passen. Wenn du mich verwöhnst, kommst du außer Atem. Spar dir was auf. Eines Tages brauchst du Atem für zwei.
Solange sie auf der Landstraße fuhren, war er jedem Stück Gegenverkehr so weit nach rechts ausgewichen, daß Ruth fragte:
Soll ich fahren?
Das war ihr zweites Wort auf dieser Fahrt.
Er schüttelte den Kopf. Auf einmal beschlich ihn der Verdacht, Dr. Clemens habe Ruth ein zuverlässig wirkendes Gift mitgegeben.
Sie war sechs Jahre alt gewesen, als ihre Eltern im Privatflugzeug («Phoenix III»), das ihr Vater gesteuert hatte, auf dem Flug nach Kreta in einen Sturm geraten und über der Ägäis «überfällig geworden» waren. – Sie sind einerseits abgeflogen, anderseits nicht angekommen, sagte sie, das ist alles, was man darüber weiß. – Danach war sie bei einer unverheirateten, sehr vermögenden Verwandten als Einzelkind aufgewachsen und streng gehalten worden. Nach dem Tod der Tante hatte sie ihr Medizinstudium abgebrochen, um, nach ihren Worten, wie Hänschen klein in die weite Welt zu laufen, nach Indien zuerst. Das war einmal ein bevorzugtes Ziel von Pilgerreisen. Sie habe sich an einen Ort gewünscht, wo alles aufhöre, aber so viel war das bei mir gar nicht. Hänschen hat seinen Lohn gekriegt, und dann wurde er alles wieder los, Pferd, Kuh, Schaf und Gans, und am Ende sogar den Schleifstein. Der ist ihm in den Brunnen gefallen, er brauchte keine Messer mehr zu wetzen und hat einen Luftsprung getan: ich muß in einer rechten Glückshaut geboren sein! So ist er Hans im Glück geworden und heimgesprungen zu seiner Mutter.
Zur Ehe hatte sich Ruth schon nach zwei Spaziergängen entschlossen gezeigt: Möchten wir heiraten? Vollkommen verblüfft hatte er zuerst gar nichts gesagt, dann: Ja; und dann wieder lange nichts. Dann müssen wir uns verkündigen lassen, erklärte sie ernsthaft, es könnte doch jemand Einspruch erheben. – Es klang fast so, als warte sie nur darauf. Bevor sie ihr Jawort auch einem Beamten gaben, wollte es Sutter, als der Ältere, doch einmal ausgesprochen haben: Ich passe gar nicht zu dir. – Das macht nichts, erklärte sie heiter, ich passe zu keinem, aber ich kann mit jedem. – Da sie gerade nackt nebeneinander lagen, war dies ein starker Satz, und er mußte zusammengezuckt sein. Er war damals auch der einzige Mensch, der von ihrem ererbten Vermögen nichts zu wissen schien, bevor seine Redaktionskollegen ihn aufklärten: märchenhaft! In ihrer Gratulation hörte er Argwohn, schon fast eine Spur Empörung: als hätte er ihnen an seiner Ehe die Hauptsache unterschlagen und vorsätzlich verschwiegen, welcher Kriegslist er fähig war.
Zwei Sätze auf dreißig Kilometer sind nicht viel. Einmal hatte sie mit einem Knopfdruck die Nocturne zum Schweigen gebracht, die er wieder angespielt hatte. Danach zischte nur Wind um ihr Gehäuse. Die Gegend hatte sich zur Agglomeration verdichtet, Fensterlicht brannte über abgezäunte Felder in fahlen Zeilen und ließ die Häuserblocks nur durchlöchert erscheinen, nicht bewohnt. Die Hügel dahinter wurden unscharf, die Landschaft trat zurück, während bunte Lichter durch die Dämmerung zappelten, die ersten Verkehrsampeln, Reklameschriften, orange verstrahlte Kreuzungen, reflektierende Pfützen. Von links näherte sich, mit stetem Dröhnen, die Schneise der Autobahn, ein Strahl, der die Leuchtmunition fortstiebender Partikel verschoß. Dahin wollte jetzt auch ihr Sträßchen, und die Tafeln am Rand gaben die Geschwindigkeit an, die man aufzunehmen hatte, um sich in die Massenflucht einzuordnen. Die Vorsicht, mit der dies zu tun war, entlastete Sutter von der Aufmerksamkeit für das Gesicht an seiner Seite. Entweder wurden sie zur Strecke gebracht, oder sie konnten in zwanzig Minuten zu Hause sein. Bald war Sutter das Rasen so weit in Fleisch und Blut übergegangen, daß es sich fast wie Stillstand anfühlte. Sein Griff am Lenkrad hatte sich gelockert, als Ruth die Hand hob und auf eine Flucht durchsichtiger Kuben deutete.
Wir brauchen noch Katzenfutter.
Der Volvo stand schon auf der Parkfläche still, als Sutter begriff: Ruth, die er keuchen hörte, hätte die Autobahn keine Sekunde länger ausgehalten. Sie saß mit offenem Mund, und ihr Gesicht trug den Ausdruck des Schwachsinns.
Möchtest du Schnippenkötter heißen, fragte sie.
Dann noch lieber Sutter, sagte er.
Schnippenkötter stand in der Zeitung, die du gelesen hast. Eine Todesanzeige, gleich dreimal. Wie kommt ein Schnippenkötter nach L., um da dreimal zu sterben?
Katzenfutter, sagte Sutter nach einer Weile.
Viel, sagte sie. Nimm eine Tüte aus dem Kofferraum.
Warum gehen wir nicht zusammen, hatte er sagen wollen, aber er traute seiner Stimme nicht. Er öffnete die Tür auf seiner Seite und blieb abgewendet noch etwas sitzen.
Und das tat A. jetzt auch. Er sah den Rechner nicht mehr an, blieb abgewendet sitzen und weinte bitterlich.
Er wollte gar nicht mehr schreiben, und was er durch die nassen Augen sah, war sonnenklar. Er weinte über sich, Ruth war die Stimme seiner armen Seele. Der Tod der Mutter im Wasser hatte ihn erstarren lassen. Nach ihrem Begräbnis, unter lauter fremden Leuten, hatte er, zu ihrem Befremden, gefressen wie ein Wolf. Nur Vater Sigg, der Nachbar und Oberrichter, hatte sich neben ihn gesetzt und gesagt: Jetzt kommst du zu uns. Peter war wieder erstarrt, diesmal in Dankbarkeit. Auch wenn er sechzehn war, fühlte er sich wieder als Kind. Und war froh, am Gymnasium zu bleiben, statt ins Waisenhaus zu gehen und Schneider zu lernen. Jetzt kamen ihm die Tränen, die damals eingefroren waren, und es waren Tränen des Zorns. Er hatte das Liebste, das er sich ausdenken konnte, sterben lassen, und nur, weil er Schriftsteller war, kam niemand auf den Verdacht, er habe sie selbst getötet, aus verzweifelter Liebe. Ein halbes Jahrhundert später war ihm klar: er hatte seine Mutter getötet, um sie zu erlösen, und sich selbst von ihrem Leid, das nicht reden konnte. Er hatte Ruth erfunden, um seiner Mutter eine Sprache zu geben; dafür war er Schriftsteller geworden. Es hatte zu weh getan. Das wollte er nicht wissen.
Aber was man nicht wissen darf, wird auch nie vergessen.
Deine arme Seele ist dich leid, Peterchen. Sie ist es sterbenssatt, dich zur Kunst zu beglückwünschen, mit der du dein Liebstes und Teuerstes verkleiden mußtest, um es unbemerkt aus der Welt zu schaffen. Der Krebs, den du deiner Ruth verschrieben hast: du mußtest ihn endlich selbst haben. Aber etwas dagegen tun, das wolltest du nicht.
Mußtest du aus dem schrecklichen Ernst ein Spiel machen, um ihn zu ertragen? Wolltest du dazu beglückwünscht werden? Dich damit wichtig machen, dafür berühmt werden? Jetzt hast du das Spiel erkannt, Peterchen, und es ist aus.
Wofür bist du nach Berlin gegangen?
Ein bißchen spät. Das Leben ist gemessen. Aber wenn der Tod nah genug ist, mißt er die Zeit nicht mehr. Er wägt sie. Dann kommt es auf jeden Augenblick an. Und dabei spielt das Gewicht keine Rolle, nur das Gleichgewicht.
Plötzlich fiel ihm eine Deutschstunde ein, vor hundert Jahren, da hatte er mit seiner Klasse die «Penthesilea» behandelt. Er hatte den Jungen und Mädchen erzählt, wie der Dichter Kleist mitten in der Nacht ins Zimmer seines Freundes eingebrochen war, mit gesträubtem Haar und glühendem Gesicht. «Sie ist tot!» hatte er geflüstert. Und die Klasse hatte sich geduckt, nur ein Mädchen hatte gelacht. Was ist lustig daran? hatte A. gefragt, und sie sagte: Er war sie doch los! – Jetzt lachte die Klasse mit, dafür verstummte das Mädchen und war rot geworden, A. aber sagte: Daran habe ich gar nicht gedacht.
Warum hatte sich Kleist dann das Leben nehmen müssen? Weil ihn Henriette Vogel, eine Frau mit «Mutterkrebs», gebeten hatte, sie zu erlösen? Aus Gefälligkeit? Weil er, wäre er nicht mitgegangen, ein Mörder gewesen wäre? Das übermütige Paar zog es vor, mit dem Tod Hochzeit zu feiern, und überließ es dem hinterbliebenen Ehemann, sich darauf einen Vers zu machen, der seiner würdig war. Derjenige Kleists aber lautete: «Nun, o Unsterblichkeit, bist zu ganz mein.»
Das hatte A. seither auf keiner anderen Todesanzeige gelesen. Kleist hatte es auch nicht in Person gesprochen, sondern in den Mund seines letzten Bühnenhelden gelegt, des Prinzen von Homburg. A. hatte damals darauf verzichtet, seinen Schülern den ekstatischen Briefwechsel der Todeslustigen vorzulegen, mit seinem schwindligen Wettbewerb besitzanzeigender Fürwörter. Die Teenager hätten ihn womöglich «geil» gefunden. Das Wort, für das Vater A. seinen Sohn geohrfeigt hätte, begann damals zur Duftmarke einer neuen Generation zu werden, die in seiner eigenen noch «toll» oder «tschent» gesagt hätte und in der übernächsten «super» und «mega». – Signale, die keinen Sinn hatten, als jeden über Dreißig alt aussehen zu lassen. Dafür hatte man, als A. noch sehr jung war, immerhin politische Gründe vorgeschützt. Mit Siebzig hatte er das Gefühl, mit jeder Sprache allein zu sein.
Er weckte den energiesparenden Rechner wieder auf und begann weiterzulesen.
Das Innenlicht des Kofferraums zeigte ihm einen Stapel sorgfältig in die Knicke gelegter Papiertüten. Als er die oberste an den Griffen schüttelte, entfaltete sie ein Alpenpanorama und inmitten baumhoher Enziane den Schriftzug eines Käsegeschäfts. Er drückte die Heckklappe nieder und ging mit angezogener Schulter über die leeren Parkfelder, die ihn an einen Soldatenfriedhof erinnerten. Der Beutel schlenkerte an seiner Hand. Dabei strömte ihm ein gleichmäßig kühler Luftstrom entgegen, ins Gesicht und durch die dünnen Kleider. Er war froh, die Deckung der zwei Dutzend Wagen zu erreichen, die sich vor dem offenen Portal des Einkaufszentrums zusammendrängten.
Aus dem Inneren zirpte tändelnde Streichermusik, ein unaufhörlicher Gehöraufstrich, in den sich eine italienische Tenorstimme mischte, die nicht dazu paßte und keinerlei Takt hielt. Sie ging von einem einzelnen Mann aus, der auf dem marmorbelegten Podest mit starken Schritten auf und ab ging, ganz für sich allein in eine heftige Unterhaltung vertieft. Dabei klemmte er ein winziges Gerät zwischen Schulter und Kinn, um zum Gestikulieren beide Arme frei zu haben. Jedesmal, wenn er die Einkaufswagen erreicht hatte, packte er die Griffstange des vordersten, riß daran und stieß ihn dann ebenso gewalttätig zurück.
Wider Willen fasziniert sah Sutter dem Mann zu. Er war korrekt gekleidet und trug schwarze Nappalederhandschuhe; aus dem Halsausschnitt des kurzen Kamelhaarmantels blickte ein silberfarbener Seidenschal, aus diesem ein Schlips in hellem Grün. Er redete italienisch, und der schwarze Borsalino machte ihn zum Schwerenöter aus einem Mafiafilm. Obwohl er wie ein Raubtier an den angeketteten Gitterwagen rüttelte, trat er fürsorglich beiseite, wenn einer leer zurückgebracht oder neu abgeholt werden sollte. Dann war er der Kundschaft, besonders Damen, behilflich, ihn flottzumachen, und dienerte noch einen Schritt hinterher, während sein Mundwerk keinen Augenblick ausgesetzt hatte. Die teilnahmslosen Blicke schweiften nach allen Seiten und fixierten sich jetzt auf Sutter, dazu wiegte er einen Wagen, als läge ein Kind darin.
Plötzlich kam Sutter Ruths Lage im erkaltenden Volvo ganz unerträglich vor. Er hastete durch den Wärmevorhang, der ihn wie Spülicht überlief. Von allen Seiten drängten Regale heran, auf denen sich bunt verpackte Genußmittel stapelten. Sutter versuchte sich an den im Ladenhimmel schwebenden Transparenten zu orientieren. Zu spät kam ihm in den Sinn, daß auch er dem Tenor vor der Tür einen Wagen hätte abnehmen sollen. Im Inneren des Supermarkts gab es nur noch Körbe aus gelochtem Plastik, die für genügend Tierfutter nicht ausreichen würden. Er riß zwei davon heraus und kam sich augenblicklich so knäbisch vor, daß er sie gleich wieder zurücksteckte. Ratlos empfing er die Botschaften der Ware, die, wie Spielzeug auf Glanzkarton geheftet und mit Klarsichtfolie verblendet, nach immer weiterer Verpackung zu schreien schien, und war schon daran verzweifelt, das Gesuchte je zu finden, als ihm das Bild einer lippenleckenden Katze gleich reihenweise entgegenstarrte. Die violette Dose hatte das von der Katze bevorzugte «Kalb mit feinen Nüdelchen» zu bieten, und Sutter brauchte nur noch abzuräumen.
Beim Füllen der Papiertüte fühlte er sich beobachtet. Eine ältere Dame mit magerem Hals und geröteten Augen musterte ihn hinter der Warenfuhre hervor, die sie in der Nähe zum Stillstand gebracht hatte.
Sie haben keinen Korb, sagte sie.
Das sehen Sie richtig.
Was Sie da kaufen, ist ein Risiko für Ihr Tier, sagte sie. – Ihr Kinn bebte.
Ich weiß, sagte Sutter, darum brauchen wir es nur für uns selbst.
Das Fleisch ist nicht geprüft, sagte sie.
Wenn Sie mir verraten, wo ich geprüftes Menschenfleisch finde?
Die alte Dame begann widersinnig zu lächeln. Dann verschwand sie hinter dem nächsten Regal, und ihre Rädchen, von denen eines quietschte, entfernten sich hastig.
Sutter hörte schon die Kassen piepsen, aber die Tierfutternische war als Sackgasse angelegt. Der Fluchtweg führte in die Gegenrichtung, zurück in die Reizflut. Von schlafwandlerischem Gedränge zum Hindernis reduziert, fühlte Sutter Panik in sich aufkommen. Hinter der letzten Befestigungsanlage – Werkzeug und Gartengerät – schoben sich Menschen in langen Reihen der Kassenschleuse entgegen. Sutter zog eine Axt mit blaugestrichener Schärfe aus der Halterung und ordnete sich ein.