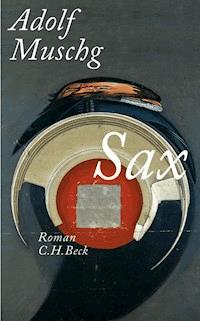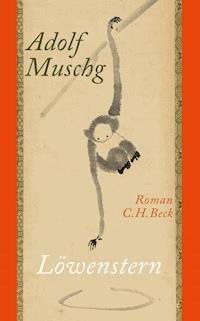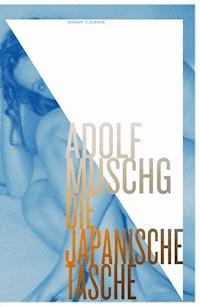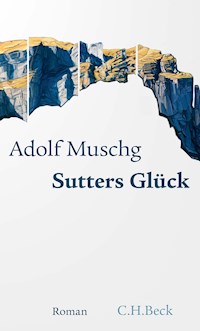
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Um in Berlin ein neues Buch zu schreiben, verlässt A., ein Schriftsteller von siebzig Jahren, die Schweiz – und seine Ehe. Er hat beschlossen, seine Krebsbehandlung abzusetzen, dafür aber einer Figur, die er in seinem letzten Roman sterben ließ, ein zweites Leben zu bescheren. Man kann in A.s Vorsatz die Wette zwischen Kunst und Leben wiederfinden, die in der westlichen Literatur Tradition hat. Dabei stößt sie mit einer frohen Botschaft zusammen, welche die Frage durch einen Erlöser für entschieden hält, dem man nur noch glauben muss. Indem A. der Einladung folgt, in Ostdeutschland eine Weihnachtspredigt zu halten, setzt er sich dieser Versuchung aus – aber erlebt auch andere, mit denen er nicht gewettet hat. Er erfährt, dass er über Figuren seiner Erfindung so wenig allein verfügen kann wie über andere Menschen, denen er begegnet. Dafür, dass es am Ende der ursprünglichen Wette fast nur Gewinner gibt, ist allerdings eine List der Kunst nötig: die Aufführung der Tragikomödie «Amphitryon» an einem Ort zwischen Ozean und Wüste, der selbst etwas Märchenhaftes hat. Dabei macht sich hinter der Szene schon ein Spielverderber bemerkbar: ein viraler Parasit, der die Errungenschaften des Homo sapiens als Selbstbetrug zu entlarven droht.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Adolf Muschg
Sutters Glück
Roman
C.H.Beck
Auf den erfolgreichen Gerichtsreporter Emil Gygax, genannt Sutter, wird geschossen und er muss sich fragen, wer ihm wohl nach dem Leben trachtet? Die Suche nach dem Schützen führt ihn zu einem alten Gerichtsprozess, in dem es um Tod und Leben gegangen war. Auch der Verlust seiner Frau Ruth macht ihm zu schaffen. In seiner Umgebung, die sich fortschrittlich wähnt und freundlich gibt, stößt Sutter auf lauter Fallen, in die er zeitlebens immer wieder getappt war ... In diesem schönen und kunstvoll gebauten, dialog- und episodenreichen Roman gerät die Suche Sutters nach seinem Attentäter zu einer folgenreichen Selbsterforschung und zur Konfrontation mit Selbsttäuschungen und Geheimnissen.
»›Sutters Glück‹ stellt letzte Fragen, die im Jetzt spielen. Dieses Gefühl der Verantwortlichkeit macht ihn zum Teil einer großen Literaturtradition. Das Unaufgeregte seiner Form ist Bedingung für die ertragene Gegenwart, nur sie sichert ihm die Denkfreiheit vor den Tagesereignissen zu.«
Thomas Wirtz, Frankfurter Allgemeine Zeitung
Adolf Muschg war u. a. von 1970–1999 Professor für deutsche Sprache und Literatur an der ETH in Zürich und von 2003–2006 Präsident der Akademie der Künste Berlin. Sein umfangreiches Werk, darunter die Romane »Albissers Grund« (1977), »Der Rote Ritter« (1993), »Sutters Glück« und »Kinderhochzeit« (2008) wurde mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, darunter der Hermann-Hesse-Preis, der Georg-Büchner-Preis, der Grimmelshausen-Preis und der »Grand Prix de Littérature« der Schweiz. Im Verlag C.H.Beck erschienen Muschgs Reden »Was ist europäisch?« (2005), die Romane »Sax« (2010), »Löwenstern« (2012), »Die Japanische Tasche« (2015) und »Heimkehr nach Fukushima« (2018), die Erzählung »Der weiße Freitag« (2017) sowie die Essays und Reden »Im Erlebensfall« (2014).
Inhalt
Widmung
Motto
I Die Warnung
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
II Gespenster
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
III Im Hochtal
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
I
1
Der erste Anruf kam am 2. November, auf den Tag genau fünf Wochen nach dem Tod seiner Frau. Zwischen beiden Ereignissen hatte Sutter keinen Zusammenhang hergestellt. Doch die Uhrzeit – 23 Uhr 17 – blieb haften, denn der Anruf wiederholte sich in der folgenden Nacht auf die Minute genau, und seither hätte Sutter die Uhr danach richten können.
Das war im Wohnzimmer nicht nötig, denn die Uhr an der Wand, auf die er das erste Mal erstaunt, dann ärgerlich geblickt hatte, richtete ihren Gang sekundengenau nach einem Impuls, den sie, laut Gebrauchsanweisung, aus der Gegend von Frankfurt empfing, also über eine Entfernung von 500 Kilometern. Ruth hatte, gegen alle Gewohnheit, das Spielzeug von einem Versandhaus bestellt, vielleicht weil die zuverlässige Pedanterie seiner Zeitmessung angesichts der Frist, die ihr blieb, etwas Belustigendes hatte.
Als es läutete, saß Sutter im Märchensessel. Das Erbstück von Ruths Tante hatte seinen Namen, weil sich die Kranke auf ihm einrichtete, wenn er Märchen vorlas, Abend für Abend, um ihr die Angst vor der Nacht zu nehmen. Oft konnte er dafür sorgen, daß sie schon in diesem Sessel ein leichter Schlaf überraschte, der mit keinem Medikament herbeizulocken war. Die massiven, die ihr der Arzt verschrieben hatte, lehnte sie ab: Ich will keinen Todesschlaf, bevor ich tot bin.
Im Märchensessel hockte er nun selbst und las, ertappte sich dabei, daß er Ruths Stellung einzunehmen versuchte, nur brachte er seine langen Beine, wenn er sie anzog, zwischen den hohen Armstützen nicht unter.
Er las Kriminalromane, von denen er einen Stapel im Keller gefunden hatte. Dort gilbten sie seit seiner Studentenzeit vor sich hin. Er hatte sie vor dem juristischen Lizentiatsexamen gekauft, alle zwei Tage einen neuen, obwohl er sich bei jedem Gang in die englische Buchhandlung geschworen hatte, es müsse der letzte sein. Danach würde er arbeiten, nichts mehr als arbeiten. Statt dessen verkroch er sich mit der grün gestreiften Beute auf seine Bude und las die Bändchen weg, wie man eine Zigarette an der nächsten ansteckt. Das Rauchen hatte er vor zehn Jahren aufgegeben. Plötzlich hatte er sich eines Morgens geweigert, all das zu versäumen, wovon ihn die Zigarette zu entlasten schien. Er fühlte sich schuldig, wieder zu spüren, was ihm fehlte, aber noch mehr, was er tat. Tatsächlich blieb nichts mehr vom Genuß an den französischen Zigaretten übrig, nachdem es eine Woche lang gelungen war, die Sucht davon abzuziehen.
Aber auf das zwanghafte Lesen fiel er nach Ruths Trauerfeier zurück. Statt, wie es seine Absicht gewesen war, das Haus Zimmer für Zimmer zu räumen, hatte er sich schon im Keller von einem Stapel Penguin-Bänden einfangen lassen. Ihre Stories hatte er vergessen, ohne daß sie davon wieder frisch geworden wären. Beim Wiederkäuen schmeckte er nur noch das Abgelebte der mordbezüglichen Veranstaltungen und konnte eben darum mit Lesen nicht aufhören. Er redete sich ein, was ihn süchtig mache, seien nicht diese Geschichten selbst, sondern die darin mitgespeicherten Lebensumstände, unter denen er die Bändchen als junger Mann verschlungen habe. So fahnde er eigentlich nach der eigenen Zeit. Aber die hatte er ja schon bei der Lektüre vor vier Jahrzehnten verloren. Damals hatte er ebenso bewußtlos gelesen wie heute – und für den gleichen Zweck: eine Prüfung, die ihm widerstand, hinauszuschieben, um sie schließlich ganz zu unterlassen. Aber sich selbst zu vergessen, war mit 66 Jahren nicht mehr so leicht. Darum hielt er sich ein Buch vors Gesicht.
Für Ruth hatte der Sessel in der Dämmerung stehen müssen. Er hatte ihr gegenüber gesessen, auf einem Stück Bauhaus-Mobiliar, zwischen Ruth und sich die Leselampe, deren Licht nur auf die Buchseiten fallen sollte. Es mußte hell genug sein, damit er dem Fluß der Zeilen auch bei geschwächtem Augenlicht folgen konnte. Dafür lag der Lehnsessel im um so tieferen Dunkel, und es kam vor, daß er leer aussah. Ruths Morgenrock hatte ein großblumiges Muster, das dem des Jugendstilsessels verwandt schien; bei Licht wäre der Kleiderstoff ocker- und olivfarben gewesen, der Möbelstoff lila und violett. Aber Ruth wußte auch am Tag dafür zu sorgen, daß sie bei Licht nicht zu sehen war. Wenn er vorlas, barg sie das dünn gewordene Gesicht hinter einer Falte des Morgenrocks, so daß man denken konnte, ihr Kopf mit dem immer noch starken schwarzen Haar, das ihr keine Chemotherapie genommen hatte, tauche zwischen den Kelchen eines gewebten Treibhauses unter.
Das ist Safran, erklärte sie, wo er von Krokus geredet hätte, aber den Namen hatte sie eigensinnig für die Herbstzeitlosen auf dem Tantensessel bestimmt. Wer einer Kranken Märchen vorliest, braucht mit ihr nicht über Botanik zu streiten. Sie nannte den Sessel so, wie ihre Tante einmal ihr ganzes Haus genannt hatte: einen Sitz. Der Sitz ist ein Trümmer, Sutter. – Ein Trümmer, Ruth? hatte er gefragt, das gibt es nur in der Mehrzahl. – Willst du ihn Trumm nennen, nur weil er ein Einzelstück ist?
In ihrem Einzelstück war sie »immer weniger« geworden, das war eine ihrer festen, mit fortschreitendem Sterben fester gewordenen Redensarten. Ich werde immer weniger, Sutter, du brauchst nicht hinzusehen. Schau in dein Buch, lies weiter im Guevara.
Zu dieser Redensart besaß er lange keinen Schlüssel.
Nun saß er selbst in diesem Sessel und las seinen mordlustigen Kram immer weiter. Dazu hatte er das Leselicht auf Ruths Seite ziehen müssen, fast die einzige Veränderung, die er seit fünf Wochen im Haus vorgenommen hatte. Er brachte es nicht über sich, mit Aufräumen fortzufahren, darum fing er damit gar nicht mehr an. Es war schon eine Leistung, wenn er das Geschirr nach pflichtschuldiger Selbstfütterung wieder in die Küche zurücktrug, um, wenn sein Auge von der Seite abirrte, nicht schon auf den ersten Blick demjenigen drohender Verwahrlosung zu begegnen. Lesen, als läse man nicht; nicht lesen, als läse man: eigentlich starrte er diese Zeilen nur noch blind an, während sie im Buch vorbeizogen wie flüchtige Wirbel im Wasser.
Es kam vor, daß ihn, beim Scheinlesen im Lampenschein, ein Grauen vor nichts und allem packte. Dann stemmte er sich aus dem Sessel und fing an, in den erblindeten und verstummten Räumen auf und ab zu gehen; als käme, hätte er nur einen Augenblick länger ins Buch gestarrt, die übrige Welt lautlos zum Stillstand. Unverhofft fand er sich in der Küche wieder, dankbar für das schmutzige Geschirr, das ihm vorausgegangen war. Er wusch es unter dem fließenden Hahn so gründlich ab, als hätte er damit etwas für seine Anwesenheit getan. Und wenn ihm das brühheiße Wasser über die Hände lief, zuckte er fast mit Vergnügen zurück. Das Wasser war noch lebendig und hatte nicht vergessen, ihm Schmerz zuzufügen.
Grund- und maßlos aber fuhr er am 2. November zusammen, als ihn das Telefon aus seiner Zeitvergessenheit riß. Es mußte spät sein, das bemerkte er an seiner augenblicklichen Empörung. 23 Uhr 17 – wem fiel es ein, jetzt noch anzurufen? Er nahm kein Telefon ab, seine nähere Bekanntschaft wußte das. Die Leute, die sich als seine Freunde betrachteten – meist waren sie Ruths Freunde gewesen –, hatten gelernt, seine Kontaktscheu zu respektieren, auch wenn es ihnen nicht leicht fiel, wie er ihren Mienen entnahm. Sie durften ihn nicht in die Depression fallen lassen, die sie ihm fürsorglich unterschoben. Ebenso natürlich waren sie schuldig, seinen Rückzug gelten zu lassen. Er hatte sie, kaum noch höflich, von jeder Pflicht entbunden, auf ihren Wegen dahin und dorthin, nur weil er eben an einem dieser Wege lag, »schnell hereinzusehen«. Sicher, Fritz, ich komme zurecht. Aber ja, liebe Monika, sei so lieb, dir nicht meinen Kopf zu zerbrechen.
Die Siedlung »im Hummel« war einmal für den Gedanken einer weitreichenden Gemeinschaft mündiger Menschen entworfen und von Architekt Schlaginhauf, einem Linken, auch wirklich gebaut worden, für 99 Jahre, daher kostengünstig. Schon nach zehn Jahren blieben Sutter und Ruth, für die Utopie des Gemeinsamen Lebens am wenigsten geeignet, die einzigen, die immer noch darauf saßen. Die Mitgenossenschafter waren getrennt, geschieden, arriviert, jedenfalls aus- und umgezogen. Immerhin war bei vielen der alte Geist rege geblieben, etwa in Gestalt von Schuldigkeitsgefühlen, und so klopften sie jetzt als gute Geister bei dem alleinlebenden Sutter an.
Du stellst dich tot, Emil, daß du damit in Ruths Sinn handelst, glaubst du doch selber nicht. Du weißt am besten, wie gern sie es lebendig hatte. – Dein Rückzug in Ehren, Emil, aber könnte es sein, daß du Konflikte vermeidest? Zu dumm, daß ich dir gerade einen zu bieten hätte – ich brauche Hilfe, Emil, und brauche sie von dir. – Emil, wenn ich ehrlich sein soll, das sieht mir nicht mehr nach Winterschlaf aus, das ist eine ausgewachsene Depression, und dazu gehört natürlich, daß du sie verleugnest.
Wenn du’s wissen willst, Fritz: ich verleugne nur mich, und keine Depression.
Wenn dir nicht nach Reden ums Maul ist, Emil, wir können auch miteinander schweigen.
Danke, Fritz, im Moment wäre mir auch das Schweigen mit dir zu viel. Ich weiß, Monika, ihr habt euch gerade ein Cheminée eingebaut, ich glaube gern, daß es sich davor wunderbar schweigen läßt. Jeder wäre recht, in dieses Feuer hineinzuschweigen, warum grade ich?
O Emil, Depression ist eine Krankheit, und eine Krankheit ist kein Schicksal, Emil, diese nicht, Depression ist heilbar, man kann sie stützen, auch chemisch, es braucht nur Zeit und Geduld.
Ich habe keine Zeit für Depression, Fritz, aber noch weniger Geduld, mit dir über Depression zu reden.
Was tust du denn den ganzen Tag, fragen wird ein Freund ja noch dürfen, du verläßt das Haus ja nicht mehr. Trauerarbeit geht natürlich in Ordnung.
Danke, Fritz.
Aber das weißt du hoffentlich, vereinsamen solltest du nicht. Sprich nur ein Wort.
Ja, Fritz, meine Seele ist gesund. Ist das ein Wort?
Du erlaubst uns, wieder anzuklopfen.
Klopfet an, es wird euch aufgetan, wenn ihr’s kurz macht und keine Bewirtung erwartet, sonst bleibt ihr zu lange. Aber tut mir einen Gefallen: verschont mich mit dem Telefon. Anrufe machen mich wirklich depressiv. Da ist mir ein Einbruch noch lieber.
So kamen sie denn als Einbrecher wieder, und wenn ihnen nicht aufgetan wurde, ließen sie eine Flasche Wein vor der Tür liegen, einen Rosenstrauß oder einen von Monikas selbstgebackenen Hefekränzen. Aber zum Hörer griffen sie nicht mehr, und so brauchte er nicht mehr aufzustehen, wenn das Telefon läutete, nicht mehr hinzugehen, wenn es ihn herschrie, nebenan aus der Küche und oben aus dem Schlafzimmer gleichzeitig. Wer immer noch anrief, war kein Freund.
Warum stellst du es dann nicht ab?
Du bleibst ein Mann guter Fragen, Fritz. Ich will es ignorieren. Es gehört zu meinen Errungenschaften, nicht hinzugehen. Ich lasse es läuten. Dafür muß es läuten können.
Aber nicht um 23 Uhr 17.
Auch für Regelverstöße gibt es mögliche Zeiten und unmögliche. Sutter rappelte sich halb auf, um das Telefon, eben dieses, abzunehmen und ihm alle Schande zu sagen. Einen Augenblick lang dachte er an einen Notruf. Aber wer hatte ihm um diese Stunde mit seiner Not zu kommen!
Doch dann blieb er sitzen. Er wollte hören, wie weit man die Unverschämtheit trieb. Zehnmal schon hatte es geläutet. Damit genug! Der Impuls richtete ihn auf, warme Wut schoß in seine klammen Beine. Sie trugen ihn in die Küche. Doch bevor er den Hörer hatte packen können, war der Apparat still.
Auch gut.
Grimmig humpelte er zurück, bei jedem Schritt darauf gefaßt, daß sich der Anschlag wiederholte. Nichts.
Schwerer atmend, als ihm natürlich schien, wollte er seine Lektüre wiederaufnehmen, wußte nur nicht, wo er stehengeblieben war. Was er jetzt zu lesen anfing, kam ihm ausgelesen vor. Aber so erging es ihm auch mit frischen Sätzen.
Die Bauhaus-Sitzgruppe wäre leer gewesen ohne die Katze, die, im Schlaf eingerollt, eben da lag, wo er gesessen hatte, wenn er Ruth Märchen vorlas. In dieser Stellung war sie schwarz, bis auf einen weißen Streifen, der die Linie des Hinterbeinschenkels zeichnete. Die weißen Haare der Katze waren flaumiger, das wußte er vom Bürsten, sie sträubten sich zarter, wie ein erhalten gebliebenes, jetzt auf kalligraphische Spuren begrenztes Jugendkleid. Ohne sie wäre die Katze auf dem schwarzen Leder verschwunden. Den weißen Teil ihrer Halbmaske hielt sie mit der schwarzen Vorderpfote bedeckt; die drei übrigen Stiefel trug sie weiß.
Nach dem Telefonschreck wurde ihm die Gegenwart der Katze tröstlich bewußt, und auch der Blick des Raums hatte etwas von seiner Hohlheit verloren. Die Außenwelt schlich sich zurück. Draußen war es kalt. Das Radio – er hörte nur noch Nachrichten, als gingen sie ihn etwas an – hatte Frost angekündigt, die Katze brauchte nicht munter zu sein. Sie zog das ungastliche Leder zum Schlafen jedem gepolsterten Kissen vor. Sie liegt am liebsten da, wo für Menschen nicht gut sein ist, hatte Ruth gesagt. Dabei hatte die Katze auf Ruths geschwollenem Bauch gelegen. Auf Sutters Schoß hatte sie sich nur für Sekunden niedergelassen, Sutter aber fand auf Ruths geblümtem Sitz: hier war gut sein. Hier fühlte er sich geborgen, wenn das Haus verödete.
Von der telefonischen Attacke munter geworden, blickte er der Wohnung ins Gesicht, und dabei schien sie es zusammenzunehmen. Auch die Katze hatte sich belebt. Sie erhob sich auf alle vier Beine, die sie paarweise streckte; erst die vorderen zum Kotau, dann die hinteren zum Bild des verwundeten Löwen. Dazu entfaltete sie das sparsame Weiß auf ihrem schwarzen Fell zu einer beinahe zusammenhängenden Zeichnung. Wenn ich sie lesen kann, hatte Ruth gesagt, tut mir nichts mehr weh.
Die Katze blickte ihm mit gelb geränderten Pupillen ins Gesicht und gähnte. Dem Gebiß, das sie entblößte, fehlte der rechte Fang. Er mußte ihr, wohl durch den Fußtritt eines Menschen, abgeschlagen worden sein, als sie eine Woche abgeblieben war. Die Katze war noch ein Kater gewesen, und sie hatten ihn, zu seinem eigenen Schutz, kastrieren lassen. Danach waren sie beide, Ruth und die Katze, nicht mehr dieselben. Beide waren häuslich geworden, nicht aus eigener Wahl. Die Katze hatte es überlebt. Sie hielt, auch wenn sie Hunger zu melden hatte, Abstand gegen Sutter.
Ja, Katze, sagte er, wir futtern. Pardon für den Anruf. Es soll nicht mehr vorkommen.
Der Anruf wiederholte sich am folgenden Tag, und als Sutter auf die Uhr sah, zeigte sie 23 Uhr 17. Diesmal verlor er mit Ärgern keine Zeit und war in ein paar Schritten beim Apparat. Aber bevor er ihn anrühren konnte, war er verstummt.
Am nächsten Tag stand er nach den 23-Uhr-Nachrichten in der Küche beim Telefon und blickte auf die Armbanduhr, die er nach der unfehlbaren im Wohnzimmer gestellt hatte. 23 Uhr 17. Nichts. Er wartete noch drei Minuten, bereit, den Hörer zu überraschen. Umsonst.
Nun gut, sagte er laut, der Kerl hat aufgegeben. Zweimal die gleiche Uhrzeit: auch der Zufall darf des Zufalls spotten.
Am nächsten Abend – er hatte gerade einen neuen Krimi angefangen – klingelte es wieder: 23 Uhr 17. Also doch, dachte er. Und war diesmal entschlossen, es läuten zu lassen. Er wollte wissen, wie lange es der Anrufer trieb.
Um 23 Uhr 19 läutete es immer noch.
Er hatte die Klingelzeichen gezählt. Bei 37 gab der Apparat auf – für zehn Sekunden. Dann fing er wieder an. Sutter stand auf. Nur mit einem Gang zur Küche war dieses Läuten abzustellen. Und verstummte schon, als er die Schwelle erreicht hatte.
2
Von diesem Abend an hatte er etwas Lebendiges in der Wohnung. Und bald stellte er fest, daß sich damit experimentieren ließ. Verließ er das Zimmer um 23 Uhr 09, trat er auf den Gartenvorplatz hinaus, in den Wind und das rasch fallende Laub, um zu lauschen, so meldete sich der Apparat nicht, nicht um 23 Uhr 17, und ebenso wenig, wenn er, fröstelnd und durchnäßt, wieder hereingekommen war.
Der Anrufer mußte Sutter beobachten, und dies aus eigentlich nicht vorstellbarer Nähe. Immer um dieselbe Nachtzeit gab es eine Person, die sich Sutters Verfolgung widmete. Versicherte sich ein Einbrecher seiner Abwesenheit? Er – oder wer immer – schien ja aber seine Anwesenheit zu prüfen, um nicht zu sagen: mit ihr zu spielen. Wenn das eine Form von Terror sein sollte – was sollte sie?
Ganz gewiß erreichte der Agent so viel, daß sich Sutter mit der Störung beschäftigte, und bald nur noch mit ihr. War der Schlüssel hier zu suchen? Gab es einen sonderbaren Wohltäter, der Sutter eine Beschäftigungstherapie aufzwang, die er den Bekannten verweigert hatte? Er begann sie im Kopf an sich vorbeiziehen zu lassen und überlegte sich, Anwesenheitsproben anzustellen. Geradezu befragen mochte er sie nicht. Sie hätten ihn für vollends gestört halten können oder – schlimmer – für wieder ansprechbar, sogar Hilfe suchend, und das gegen eine am Ende doch läppische Not. Ihren Rat konnte er sich denken: warum läßt du keine Fangschaltung legen! Und ertappte sich dabei, daß er diesem Vorschlag bereits mit Einwänden begegnete. So viel wußte er selbst: die Überwachung eines Handys bot kein unlösbares Problem.
War Sutter selbst hinreichend gestört, so konnte es auch sein, daß er sich seine Anrufe einbildete. Vielleicht entsprangen sie – allein, wie er war, einsam, wie er nicht sein wollte – einem pathologischen Wunschdenken, das sich seiner Kontrolle entzog. Fehlte noch, daß er sich Zeugen dafür in die Wohnung geholt hätte!
Ja, die fehlten noch. Unter dem Vorwand einer Bitte, von der er wußte, daß ihr Fritz und Monika nicht widerstehen konnten, lockte er sie um zehn Uhr abends aus einer »Psychodrama-Sitzung« in den »Hummel« zurück. Er hatte sie dann nicht festzuhalten brauchen: sie waren nur zu freudig geblieben, um ihre Beziehungskiste auszukramen. Sie hatten ihn durchaus mißverstanden, als er nach elf Uhr mehrfach auf die Uhr sah: nein, seinetwegen brauchten sie nicht zu gehen. Du bist ja wieder voll da, Emil! hatte ihm Fritz ins Gesicht gesagt, als er ihn vor Mitternacht unter der Tür an sich preßte. Und Monika, obwohl immer noch unverstanden, hatte sich ein Lächeln der Kumpanei abgerungen. Der Apparat aber hatte nicht geklingelt – er wollte keine Zeugen. Und Sutter war froh, über ihn nicht geredet zu haben. Schon lieber über Loslassen, Aufjemandenzugehen, Vonjemandemabgeholtwerden.
Als Störer in Betracht kam auch das Personal der wohl hundert Gerichtsverhandlungen, in denen Sutter sein Brot als Berichterstatter verdient und dabei sein Salz nicht immer gespart hatte. Leute vor Gericht sind Bloßgestellte, da kommt es vor, daß sie auch einen Bericht, der ihnen Gerechtigkeit widerfahren läßt, als Indiskretion erleben, als fortgesetzte Kränkung. Sutter konnte beim besten Willen diesem und jener zu nahe getreten sein. Und auch wenn sie ihm zu danken hatten: Sutter wußte, daß nichts so rachsüchtig macht wie die Zumutung von Dankbarkeit. Doch abgesehen davon, daß es der Kandidaten zu viele gab: wer sagte denn, daß es sich bei den Anrufen um eine Strafaktion handelte? Vielleicht wollte ihn jemand auf andere Gedanken bringen – aber welche?
Sutter, der sich selbst gleichgültig geworden war, interessierte sich jetzt für sein Telefon, den Anruf um 23 Uhr 17. Denn schon am nächsten Tag, als er allein war, läutete es wieder. Er hatte nervös darauf gewartet, doch diesmal nahm der Ruf eine neue Wendung. Es klingelte einmal, noch einmal – und nicht mehr. Wo immer Sutter Posten gefaßt hatte: er mußte sich nur außer Reichweite des Hörers befinden, damit es läutete, einmal, zweimal, und damit genug. War er einem Apparat aber so nahe, daß er gleich zum Hörer greifen konnte, so klang ihm daraus, nach kurzem Zögern, nichts weiter als der Summton entgegen. Das Gerät war nicht zu überlisten, weder im Erdgeschoß noch im Oberstock.
Ich bekomme anonyme Anrufe, hatte er Besuchern erzählt, und mit dieser Bemerkung eine Sturzflut mitteilungsbedürftiger Erfahrungen ausgelöst. Keiner und keine, die nicht von Belästigungen zu singen und zu sagen gewußt hätten. Da schnaufte es in den Hörer und begann zu keuchen und zu stöhnen. Da drohte einem eine Stimme unter Verwendung einschlägigen Jargons ihr baldiges Kommen an und erwartete von den Objekten seiner Belästigung ein gleiches, bestand auf Superlativen des Kommens oder Kommenlassens. Da forderten die Bedränger ihre Bedrängten in den abscheulichsten, dazu immer gleichen Formeln auf, ihre Brunst mit ihnen zu teilen.
Immerhin hatten diese Zeugen ihre Peiniger vernommen, sogar ausreden lassen. Bei Sutter schnaufte und keuchte keine Stimme, sie antwortete nie, kam sogar der Frage zuvor. So zuverlässig der Anruf, so unfaßbar die Anrufende – denn Sutter begann sich die Phantasie zu erlauben, die Stimme, die er nie hörte, die er mit keinem Trick zu überraschen vermochte, gehöre einer Frau.
Zum Spiritismus neigte er nicht. Er glaubte nicht, daß Ruth ein Telefon dazu verwendete, sich zu »künden«, wie Sutters bäuerliche Vorfahren Botschaften aus einer andern Welt genannt hatten. Dennoch fing er an, die Katze zu beobachten, wenn die 23-Uhr-17-Nachricht kam. Aber es war viel, wenn ihr das Tier einen Rand des Ohres zudrehte, und wenn es schlief, rührte es sich überhaupt nicht.
Sutter erkundete, mehr als einmal, um elf Uhr nachts so lautlos wie möglich die Umgebung des Hauses, Ruths Taschenlampe im Griff, immer bereit, den scharfen Lichtstrahl auf die geringste verdächtige Form oder Bewegung springen zu lassen. Er beschränkte sich auf den Umkreis, von dem aus die Beobachtung der im Haus anwesenden Person möglich gewesen wäre – überaus theoretisch, denn wenn er nachts im Wohnzimmer bei Licht saß, zog er die Vorhänge zu; er war ja kein Holländer, auch kein Aquariumfisch. Er führte Buch über sein ereignishaft gewordenes Höhlenleben. In einem Journal hielt er fest, bei welcher Beschäftigung, in welcher Telefonnähe ihn das Läuten angetroffen hatte und wie oft es sich hatte vernehmen lassen. In dieser letzten Rubrik genügten Gänsefüßchen, denn seit Dienstag, dem 23. November, behielt das Ereignis seine Gewohnheit bei, zweimal einzutreten. Er wunderte sich nur über ein technisches Detail. Wer anruft, hat es nicht in der Hand, wie oft er beim Empfänger läuten läßt; das Signal in seinem Ohr entspricht nicht demjenigen des Läutwerks auf der anderen Seite. Sutters Unbekannte rief ihn aber nicht nur pünktlich, sondern auch sauber an, zweimal, wie mit dem Messer abgeschnitten, nie mehr, nie weniger.
Wer nicht an Spuk glauben wollte, mußte an ein Überwachungssystem phantastischen Umfangs denken, mit Abhörmikrophonen, Wärmesensoren und Bewegungsmeldern, die noch dazu auf ihn allein, Sutter, geeicht waren. Wenn es irgendwo einen Narren gab, der Sutters wegen solchen Aufwand trieb: warum ließ er sich nur durch einen einfältigen Doppelklang vernehmen? Und wenn er sich selbst nicht verraten wollte – wen oder was sonst?
Anfang Dezember hatte Sutter die gröbste Menschenscheu abgelegt und widerstand nicht mehr jeder Einladung zum Kaminfeuer Fritzens und Monikas, um ihnen nach vollbrachter Gruppentat beim Ein- und Ausräumen ihrer Spielkiste teilnehmende Beobachtung zu leisten. Doch jedes Mal kehrte er in den »Hummel« zurück, um für den Ruf um 23 Uhr 17 bereit zu sein. Er nannte ihn »das Zeichen« und mußte nicht mehr wissen, was es sollte. Aber es wäre ihm unrecht vorgekommen, es zu enttäuschen. Zu verpassen war es nicht, denn es war nur mit ihm zusammen im Raum, verhielt sich also dem Tod, wie ihn Sokrates beschrieben hat, entgegengesetzt: solange der Mensch da sei, könne es der Tod nicht sein; sei er aber ein-, so sei der Mensch zuverlässig abgetreten. So war es für Sutter nicht nur gefahrlos, der Glocke zu begegnen, es wurde auch eine Sache der Lebensart.
Das Zeichen bewies ja auch seinerseits dergleichen. Es war noch auf den Tagesablauf eingestimmt, der sich zu Ruths Lebzeiten ergeben hatte. Dabei hielt es die Termine mit einer Strenge ein, die ihn inzwischen erheiterte und rührte, wie die unausbleibliche, dabei überflüssige Mahnung einer Mutter an ihren erwachsenen Sohn. Die Ruferin betrat sein Haus, um ihm Gewohnheiten einzuschärfen, bei denen es offenbar auf die Minute ankam. Sie zeigte ihm an, wann sein Tag zu Ende sein durfte. Sie disziplinierte seine Ruhezeit und war ihm behilflich, seine am Ende doch depressiv gewesene Schlaf- und Lesesucht zu zügeln. Das Zeichen erinnerte an die Zeit, da die Märchen ihren Dienst getan hatten; als er jeweils zu hoffen anfing, daß die Ruhe, die Ruth an Schmerzenstagen umsonst suchte, sie gefunden habe, von ihr unbemerkt. Dann durfte seine Stimme leiser werden, bevor sie ganz verstummte und der Vorleser, einer Verabredung getreu, ins Schlafzimmer fortschlich, nicht ohne die Frau im Sessel mit einer Kamelhaardecke zugedeckt zu haben.
Nach diesen anspruchs- und leidvollen Zeiten war die einmalige, zweimal anklopfende Erinnerung um 23 Uhr 17 gar keine Störung mehr, sondern ein sanftes Memento. Es kam vor, daß er schon im Halbschlaf, nachdem er das Licht gelöscht und die Vorhänge geöffnet hatte, unter dem hereinzwinkernden Firmament seltsame Rechnungen anstellte. Las er die Anrufsminute zweistellig, so bestand sie aus zwei Primzahlen, 23 und 17. Die Quersumme ergab wieder eine Primzahl, die 13, und wenn er sie, nach dem einfachen Zifferblatt, 11 Uhr 17 schrieb, so war 11 die erste Primzahl mit zwei Stellen, und die Quersumme ergab diesmal 10, die Grundlage des Dezimalsystems. Zählte er zwei Rufzeichen dazu, so kam er auf die Zwölf, die Zahl der Monate, Sternzeichen und Apostel. Da das Zeichen auf Bedeutung zu verzichten schien, konnte er ihm ebenso gut jede beilegen. In einem Jahr 2117 konnte noch nichts geschehen sein; dann würde die Welt, wie wir sie zu kennen glauben – und ohne tiefergehende Kenntnisse unserer selbst verändern –, untergegangen sein. Aber was hatte sich 2317 vor unserer Zeitrechnung ereignet? In China, Mesopotamien, Ägypten? Oder rechnete hier jemand nach anderem Maß?
Seit er sich tagsüber wieder müde arbeitete, brauchte er nicht mehr endlos zu schlafen. Er hatte die Kriminalromane in einen der Müllsäcke geworfen, die seinen Willen zum Aufräumen schon im Dutzend bezeugten. Auch der Keller, den er während Ruths Krankheit nur noch betreten hatte, um dies oder jenes aus den Augen zu tun, mußte endlich »weniger werden«. Sutter überwand sich, den Überfluß seines Hauses nicht mehr als Andenken in der Hand zu behalten und einzeln zu mustern, sondern als Abfall zu behandeln. So brachte er Stunde um Stunde im Keller zu. Vor der elften blickte er auf die Uhr, die ihm sagte, es müsse genug sein. Dann wusch er sich die Hände, um das Zeichen in aufgeräumtem Zustand zu erwarten. War es gekommen, so wurde es Zeit, die Katze zu füttern und sich selbst eine Mahlzeit zu bereiten, für die er den Herd wieder in Betrieb nahm und sich den Küchentisch deckte, als gehe es jetzt nicht mehr bloß darum, den Hunger zu stillen, sondern als habe er auf Gesellschaft zu achten.
Um die Festtage veranstaltete das Reformierte Zentrum eine »Heidenweihnacht«, zu der ihn Fritz herzlich eingeladen hatte. Es gehe darum, das christliche Fest wieder da zu »erden«, wo es vor Christus angesiedelt gewesen sei, am Tiefpunkt des Sonnenjahres, wo die Nacht am dunkelsten, der Morgen scheinbar am fernsten sei: und doch bewege sich nun jeder neu geschenkte Tag wieder auf ihn zu. Man wolle auch die Finsternis wieder erleben, ohne die das Kerzenleuchten nichts weiter sei als eine Schaufensterdekoration. Dafür müsse man die Geister der Wintersonnenwende erwecken, und damit feiere man auch die Zwölf Rauhen Nächte mit, in denen die Tiere sprächen; das gelte auch für das Tier in Sutter, Monika und Fritz.
Sutter leugnete höflich, daß er diese Tiere vernehmen müsse und daß ein solches Fest für ihn gerade jetzt passend sei. Er gedenke Weihnachten und den Jahreswechsel mit dem ihm schon bekannten Tier, einer Katze, zu verbringen, ferner müsse er ans Briefeschreiben denken und Dank sagen für die allzu viele Post, die ihn nach Ruths Tod erreicht habe. OFritz – von Ruth so genannt wegen seiner Ansprachen, die immer leicht klagend das Leid der Welt einforderten – OFritz also sagte auch in diesem Fall: O Emil, ich bin ja so froh, daß du irgendwie wieder die Kraft zu einem klaren Ja gefunden hast, auch wenn es leider irgendwo mit einem schmerzhaften Nein verbunden ist. Was er eigentlich hatte sagen wollen, war seinem kleingefältelten Theologenantlitz anzusehen: So, fauler Bub, du hast Onkel und Tante noch nicht einmal für die Bescherung gedankt?
Drei Monate lag der Haufen ungeöffneter Kondolenzpost schon in einem radgroßen Zinnteller auf dem Schuhschrank im Vestibül. Am Heiligen Abend hatte Sutter sich aufgerafft, die Umschläge nach Absendern zu sichten und zu entscheiden, welche zu öffnen und welche gleich in den Müll weiterzuspedieren waren. Doch schon beim ersten Brief blieb sein Vorsatz stecken. Denn die Adresse war aufgesetzt in der krakeligen, doch gewissenhaften Handschrift der Gastwirtin Seraina Bazzell aus Sils.
Die Achtzigjährige bedankte sich für die trostreiche Feierstunde, an der sie habe teilnehmen dürfen. Sie müsse Herrn Emil G. noch einmal sagen, wie viel ihr seine lb. unvergessene Frau sel. gewesen sei. Ferner möchte sie ihn davon in Kenntnis setzen, daß die Steine, mit denen sich seine lb. Frau die Taschen beschwert habe, auf Frl. Bazzells Wunsch von der Polizei zurückgekommen seien. Und da sie einen ganzen Sack füllten, habe sie diesen ihrem Großneffen mitgegeben, der am nächsten Samstag geschäftlich nach Zürich fahre und dem Witwer das Andenken direkt einhändigen würde. Des weiteren bestätige sie ihm die Reservation des gewohnten Zimmers für das kommende Jahr. Sie könne sich vorstellen, daß er am ersten Todestag seiner lb. Frau gerade in Sils an sie denken möchte, wo sie so manches Jahr glücklich gewesen seien.
Sutter saß betroffen: die angekündigte Lieferung war nie bei ihm angekommen. Allerdings hatte er in den ersten Tagen weder auf Klingel- noch auf Klopfzeichen geantwortet, noch weniger ein Telefon abgenommen. Der Großneffe war entweder wieder umgekehrt, oder er hatte den Sack vor der Haustür deponiert, und dann mußte ihn ein städtischer Dienst längst abgeholt haben. Dennoch stürzte Sutter vor die Haustür in die frühe Dunkelheit hinaus und sah nicht nur, wie schon seit Wochen, die elektrischen Weihnachtsbäume vor den Häusern brennen, sondern jetzt auch die Originale hinter den Fenstern. Unter dem großen Rhododendron vor dem vorderen Eingang, der seine Blätter im Frost faltete, lag halb versteckt eine Art Niklaussack, zusammengebunden mit einer schwarzen Samtschleife, wie sie Fräulein Bazzell zur Bändigung ihres noch immer starken Haars verwendete. Sutter wollte ihn heben und brauchte einige Kraft, um ihn vom gefrorenen Torfboden abzureißen. Öffnen ließ er sich eben noch, aber sein Inhalt, der wie ein Findling herauskollerte, war zu einem Klotz bereifter Nagelfluh verwachsen, von dem einzelne Splitter absprangen.
Sutter lief mit schon klammen Fingern in den Oberstock, zum Wintergarten auf dem Vorplatz des Schlafzimmers, leerte die beiden Gießkannen, die dort standen, ins Bad und füllte sie mit heißem Wasser nach. Dann ging er mit zwanzig Litern an den Armen die Treppe hinunter und zu seinem vereisten Brocken zurück. Als er ihn übergoß, war es nicht allein das nachlassende Gewicht der Kannen, was ihn zittern machte. Der Klotz dampfte, als wäre er glühend gewesen, und knisterte und knackte bei der ersten Leerung. Bei der zweiten fiel er auseinander wie ein Häufchen Bauschutt. Die Kiesel glänzten regenfrisch im Natriumlicht. Obwohl es sie verfärbte, erkannte Sutter einige Stücke an ihrer Form wieder; sie hatten lange genug auf der Leiste hinter dem Ehebett gelegen. Und doch hatte er nicht bemerkt, daß sie Ruth, vor ihrer letzten Fahrt ins Engadin, abgeräumt und in den Kofferraum geladen hatte.
Bei der Vorstellung, wie sie sich schon im eigenen Haus, bevor sie es für immer verließ, mit diesen Steinen abgeschleppt hatte, geriet Sutter ins Schwitzen. Er spürte die Finger immer weniger, mit denen er das Gestein in den Sack zurückfüllte, um ihn hinter die verschlossene Tür zu tragen. Er legte die Kamelhaardecke auf den Fußboden und leerte den Kartoffelsack ein zweites Mal aus.
Mit dem grüngrauen Geröll hatte sich Ruth erst für den Gang ins Wasser beschwert. Aber dazwischen lagen Steine, die Ruth von anderen Enden der Welt in die ihr eigene zurückgebracht hatte. Sutter erkannte den lehmfarbigen Sandstein aus einer chinesischen Lößprovinz, den löchrig gelben Kiesel vom Ufer des Sees Genezareth, den eckigen Splitter, schwarz und weiß, aus dem Geleiseschotter von Birkenau, die kleinen Steinpyramiden vom »Turm des Schweigens«, den persische Sonnenanbeter ihren Toten errichtet hatten. Scharfkantige Brocken aus der Zinne von Massada, bunt gebänderte aus den Wüsten Arizonas, ein Stück meteoritische Eisenschmelze, vom Himmel auf einen Strand Namibias gestürzt. Und das wie ein Bootsleib geformte schwarzgrüne Steingewicht, das Ruth aus Indien mitgebracht und sich, wenn die Qual unerträglich wurde, auf den Leib gelegt hatte.
Was hatten dagegen die Frostbeulen zu sagen, die ihn, wenn er die Steine in die Finger nahm, in aller Stille heulen ließen. Die Bescherung zum Heiligen Abend hatte ihn die Zeit, also auch die Zeichengeberin vergessen lassen, und er brütete über seinen Steinen, als sie sich meldete. Ja, ja, sagte Sutter tonlos. Vielen Dank.
Die Katze hatte sich herbeigeschlichen und neben Sutter vor die Steine gesetzt, ohne die Kamelhaardecke zu betreten. Ja, wiederholte er lauter, was fangen wir damit an? Die Katze begann sich, unter Aufwerfen des Kopfes, die Brust zu lekken, über der zwei ungleiche Ströme Weiß von beiden Seiten des Halses zusammenliefen, wie die verrutschte Krawatte eines Festbruders.
Einen der Steine hatte er von Ruth bei der sogenannten Verlobung – in Wirklichkeit hatte es eine solche Zeremonie nie gegeben – geschenkt bekommen: »für ein gutes Leben«. Er war bläulich, feinkantig, zum Kristall unterwegs. Daß er Ruth und ihn »zusammengeführt« habe, wäre viel gesagt gewesen. Aber er stammte aus der indischen Provinz, wo sie ein paar Monate in einer Religionsgemeinschaft zugebracht hatte, die ihr viel bedeutete. Von dieser Lehrzeit hatte Ruth Fotos mitgebracht. Sutter erinnerte nackte oder nur mit einer Windel bekleidete Männergespenster mit furchterregend vergeistigten Gesichtern unter wüsten Haarbüschen. Dazu hatte sie einen Text geschrieben, den einzigen dieser Sorte, den er von der naturwissenschaftlich ausgebildeten Ruth kannte, in einer Sprache disziplinierter, dabei ungelenker Einfachheit, angestrengt entfernt von aller Poesie.
Sutter, dem das Jurastudium endgültig unter den Händen zerronnen war, hatte damals für die Wochenend-Beilage des BLATTES hospitiert, die Raum bot für Bildreportagen. Und so wurde ihm aufgegeben, einer Autorin, die ihren Text samt Fotos eingereicht hatte, mit allem Takt zu vermitteln, daß ihre nackten Männer leider nicht in Betracht kämen. Das tat ihm weh, da ihn Arbeit und Sprache der Frau berührt hatten, aber Ruth machte ihm die Absage leicht. Der leiseste Argwohn, daß sie die Zeitung von Erfahrungen, die nur sie allein angingen, überzeugen müsse, genügte ihr zum Rückzug des Materials. Sie bat Sutter darum, sich jedes weitere Wort zu sparen, weigerte sich aber nicht, ihn bei Gelegenheit wiederzusehen. Und aus diesen Gelegenheiten, die Sutter für einmal nicht versäumte, wurde eine Verbindung, die, zu beider Überraschung, in die Ehe mündete. Ich glaube, ich kann dich gut aushalten, war ihr Jawort, oder das nächste dazu – es konnte ihm immer noch den Atem verschlagen.
Bevor sie zu der standesamtlichen – unter sich nannten sie es: »standrechtlichen« – Begebenheit schritten, hatte sie ihm diesen indischen Stein geschenkt, zur Bewahrung oder Bewährung, denn sie tat noch einmal eine Reise, diesmal zu einem indianischen Wüstenvolk, Native Americans. Als Erbin der wohlhabenden Tante war sie »ohne Sorgen«, wie man sich im »Hummel« ausdrückte. Wer sich dort ansiedelte, wie das Ehepaar Ruth und Emil – bürgerlich: Rohner und Gygax –, übernahm allerdings mit dem genossenschaftlichen Baurecht die Verpflichtung, sich dafür die Sorgen der weniger Begünstigten, namentlich in der Dritten Welt, zu machen. Diejenigen, die Ruth und Sutter miteinander teilten, schickten sich – wie auch ihre Freuden – von Anfang an nie so recht zur Stimmung des Großen Aufbruchs. Dafür waren sie nach zehn Jahren nicht nur die einzigen, die noch im »Hummel« ausharrten, sondern auch fast die einzigen, deren Ehe vorgehalten hatte, länger, als sie es einem geistlichen Herrn versprochen hätten: bis daß der Tod sie scheide.
Jener Bildbericht Ruths verschwand, und Sutter hätte jetzt Zeit gehabt, danach zu suchen, denn wegwerfen konnte Ruth nichts, trotz aller guten Vorsätze, »weniger zu werden«.
Katze, sagte er, aber die Katze wußte auch nicht, was er mit den Steinen sollte.
So legte er sie einzeln in den Sack zurück und schleppte ihn über die Treppe in den Oberstock. Hinter der »Frauenpalme«, die Ruth aus Taiwan als Schößling zwischen ihrer Wäsche geschmuggelt hatte, gab es einen Winkel, den die Sonne zu keiner Tageszeit erreichte. Dort stand eine Kiste aus hellem Holz, ein roher Kubus, nicht viel größer als eine Hutschachtel, verschnürt mit weißem Seidenband. Diese Kiste enthielt, was von Ruth übriggeblieben war.
Die Katze haschte nicht nach Fräulein Bazzells schwarzem Samtband, als er es mit dem weißen zusammenknüpfte. Die Eiseskälte war aus den Steinen noch nicht gewichen. Er baute eine Pyramide daraus. Einen nach dem andern lehnte er an die Kiste, bis diese darunter verschwand. Von der Turmuhr schlug es ein Uhr, einmal hoch, einmal tief. Jetzt war er nicht mehr sicher, ob das Telefon geklingelt hatte.
Im Januar fiel Schnee, und Sutter fing wieder an, das Haus zu verlassen, nicht nur für hastige Runden durch das Einkaufszentrum. Das Auto ließ er eingeschneit stehen und spazierte mit der gebotenen Vorsicht auf glatten Wegen durch eine erfrischte und wohltuend gedämpfte Wintergegend zum Bio-Laden. Den gab es ebenfalls seit den Pionierzeiten des »Hummel«, nur war er nicht mehr selbstverwaltet, dafür hinreichend assortiert, um die provenzalischen, chinesischen, libanesischen oder malaiischen Ansprüche der neuen Bewohnerschaft zu befriedigen. Warum sollte man im eigenen Land auf den Geschmack fremder Welten verzichten, nur weil dort immer noch gehungert wurde?
Sutter – außerhalb seiner Wände: Herr Gygax – wurde noch gegrüßt. Kennst du den nicht mehr? Der war doch einmal ein bekannter Gerichtsreporter. Sieht zehn Jahre älter aus. Kunststück, er hat seine Frau verloren, und weißt du, wie? Sie hatte Darmkrebs und verweigerte die Behandlung. Dafür ist sie ins Wasser gegangen, bei St. Moritz, auf jeden Fall hat sie sich selbst mit Steinen beschwert, sonst wäre sie nicht untergegangen. Sie war eine gute Schwimmerin. Glücklich kann die Ehe nicht gewesen sein. Aber der Mann kommt zurecht. Sie hatte Geld. Die beiden logierten im »Palace«, wie der Schah von Persien.
So kam die Fastnacht, es wurde März, Anfang April heizte, statt des Ofens, der Föhn ein, und über Nacht brach der Frühling aus, Ruth hätte gesagt: wie ein Krieg. Sutter bekam sein Zeichen, Abend für Abend, regelmäßig um 23 Uhr 17. Er schenkte ihm kaum noch Beachtung. Öfter lag er schon im Bett und sah, wenn es sich meldete, nicht einmal auf. Die Lektüre war wieder anspruchsvoll und machte um so zuverlässiger müde.
So verstand er auch am 12. April das Telefonläuten als Mahnung, das Licht zu löschen. Da läutete es ein drittes Mal. Vielleicht wäre er nicht aufgeschreckt, doch die Katze sprang augenblicklich von Ruths Bett und verkroch sich unter ihm. Die Bewegung suggerierte so zweifellos das Eintreten einer fremden Gegenwart, daß Sutter sich aufrichtete und lauschte. Ist jemand da? fragte er halblaut.
Er bekam keine Antwort. Doch am nächsten Tag wurde auf ihn geschossen.
3
Hat es nicht geschossen, Franz? habe sie ihren Mann gefragt. Es schießt ja die ganze Zeit, Irene, habe er geantwortet, da hinten ist der Schießstand, wo wir eben vorbeigegangen sind. Aber es hat anders geschossen, habe sie geantwortet. Du hast etwas gehört, habe ihr Mann gesagt, und das sage er immer, wenn er sagen wolle, sie bilde sich etwas nur ein. Dabei sei er es, der nicht mehr gut höre, und von seinen Augen wolle sie gar nicht reden.
Bei dieser Unterhaltung seien sie durch einen Spaziergänger unterbrochen worden, der auf sie zugekommen sei, dort, zwischen den Bäumen hervor. Der sei gekommen, aber wie sei er denn gegangen. Er habe gar nicht gerade gehen können, und auch nicht mehr geradeaus. Hin und her geschlenkert sei er auf dem Weg, wenig hätte gefehlt, und er hätte sie gerempelt, gar nicht recht gesehen habe er sie. Noch nicht halb drei, und schon sturzbetrunken, es ist eine Schande in dem Alter, habe sie gedacht, dabei habe der Mann noch ganz proper ausgesehen und einen Kammgarnanzug getragen wie ein Herr. Aufgefallen sei ihr nur, wie er an der Weste gefingert habe, als suche er seine Brieftasche, und unverständlich vor sich hingeredet habe er auch.
Sie seien stehengeblieben und hätten dem Mann nachgesehen, und dann hätten sie gleich gemerkt, daß mit ihm etwas nicht richtig war, ganz und gar nicht richtig. Auf dem Rükken habe er einen dunklen Fleck gehabt, der mit jedem Schritt größer geworden sei. Franz, habe sie gerufen, der blutet ja! Da habe der Mann sich umgedreht, und jetzt hätten sie das Blut auch von vorne gesehen. Er habe mit beiden Händen in die Luft gegriffen, als ob er sich dort oben festhalten wolle, und habe zu taumeln angefangen. Und dann sei er gestürzt, noch keine zehn Schritte von ihnen entfernt, aufs Gesicht sei er gefallen. Und nun habe sie, Irene Kienast, ganz deutlich das Loch in seinem Rücken gesehen. Von vorne habe er aber noch stärker geblutet, aus der Nase, und sogar aus dem Mund.
Vor Schreck wie gelähmt sei sie gewesen. Dann habe sie zu ihrem Mann gesagt: Franz, es ist ja doch geschossen worden! Auf den Herrn dort ist geschossen worden! Aber von wem denn? habe ihr Mann gefragt, wir haben doch gar niemanden schießen sehen! Franz, habe sie gesagt, das kommt jetzt nicht drauf an. Er ist getroffen, du mußt Hilfe holen, sofort! Aber wo? habe ihr Mann gefragt und sei ganz durcheinander gewesen. Da vorn, Franz, habe sie gesagt, lauf zum Schießstand, da müssen ja Leute sein und ein Telefon, lauf, Franz! Und du? habe ihr Mann gefragt, komm Irene, wir gehen zusammen! Du gehst, und ich bleibe bei dem Opfer! habe sie gesagt, wir können den Mann nicht einfach allein da liegenlassen. Und nachher habe er noch eine volle halbe Stunde so liegen müssen. Verbluten hätte er können!
Der junge Mann, der ihr, fortgesetzt nickend, sein Diktiergerät mit gestrecktem Arm vor die noch immer schreckensbleichen Lippen gehalten hatte, nickte jetzt noch stärker: Frau Kienast, Herr Kienast, sagte er zu dem Ehepaar, Sie haben den Täter gesehen. Sie sind die einzigen, die ihn gesehen haben. Beschreiben Sie ihn.
Nein, sagte Herr Kienast.
Sie wollen ihn nicht beschreiben?
Wir haben ihn nicht gesehen, sagte der ältere Mann.
Aber Sie haben ihn gehört, Frau Kienast, sagte der Reporter und schwenkte das Gerät vor ihrem Mund. Er trug auch eine Pistolentasche.
Ich habe den Schuß gehört, sagte sie, nur den Schuß.
Sie haben gesehen, wie sich das Gebüsch bewegt hat, sagte der Reporter streng, und dann haben Sie Schritte gehört, die sich rasch entfernten. Herausfordernd hielt er sein Gerät bald vor das eine, bald vor das andere Gesicht.
Ich habe nur die Schützen im Pistolenstand gehört, sagte die Frau, und die haben noch lange weitergeschossen. Ich dachte, sie kommen überhaupt nicht mehr!
Sie haben den Täter fliehen sehen, stellte der Reporter fest, flüchtig haben Sie ihn gesehen, war er alt oder jung? in meinem Alter ungefähr? trug er Jeans?
Hören Sie, sagte Herr Kienast, was wir wissen, haben wir der Polizei gesagt, und mehr wissen wir nicht.
In welcher Welt leben wir?
Das war die erste Frage der alten Frau, als die Helfer endlich eintrafen. Es war nicht die Ambulanz. Auch nicht die Polizei. Es waren die Männer einer Pistolenschützen-Vereinigung, die im nahen Schießstand ihr monatliches Training absolvierte. Zur Selbstverteidigung! Denn es waren Journalisten.