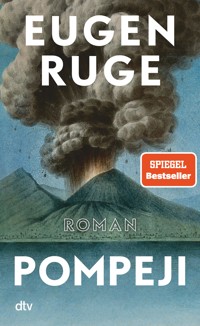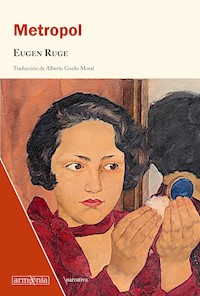9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2015
«Wunderland – das war China für mich, als mein Vater 1960 von dort zurückkam und seine farbigen Dias zeigte: vergoldete Drachen. Fahrradarmeen. Menschen, die in drei Minuten irrwitzige Scherenschnitte herstellen oder aus einem Stück Seife und nur mit Hilfe eines Kamms ein wunderbares, feingliedriges Püppchen. Dass China nicht mehr dasselbe ist, das mein Vater vor einem halben Jahrhundert bereiste, ist mir bewusst. Dennoch erwarte ich so etwas wie einen Kulturschock, der dann auch eintritt, allerdings umgekehrt. Das Schockierende an Schanghai ist, wie wenig sich China hier vom Westen, genauer: von Amerika unterscheidet.» Ob im Baltikum, auf Kuba, in Griechenland, Ungarn oder - ein halbes Jahrhundert nach dem eigenen Vater - auf dem Weg von Nanking nach Schanghai: Eugen Ruge ist um kein klares Wort verlegen, aber immer bereit, Erwartungen mit Erfahrungen zu vertauschen. Er bereist Russland, die USA, Mexiko, zunächst auf den Spuren der eigenen Familiengeschichte, im Rahmen seiner Recherchen für den noch im Entstehen begriffenen ersten Roman. Mit dem literarischen Durchbruch und dem internationalen Interesse beginnt ein neues Kapitel. Und doch bleibt der Reisende sich treu, betrachtet Menschen, Sitten, Landschaften mit unabhängiger Anteilnahme und kritischem Humor. Seine Reisen sind, was sie waren: Annäherungen. Erkundungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 216
Ähnliche
Eugen Ruge
Annäherung
Notizen aus 14 Ländern
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
«Wunderland – das war China für mich, als mein Vater 1960 von dort zurückkam und seine farbigen Dias zeigte: vergoldete Drachen. Fahrradarmeen. Menschen, die in drei Minuten irrwitzige Scherenschnitte herstellen oder aus einem Stück Seife und nur mit Hilfe eines Kamms ein wunderbares, feingliedriges Püppchen.
Dass China nicht mehr dasselbe ist, das mein Vater vor einem halben Jahrhundert bereiste, ist mir bewusst. dennoch erwarte ich so etwas wie einen Kulturschock, der dann auch eintritt, allerdings umgekehrt. Das Schockierende an Schanghai ist, wie wenig sich China hier vom Westen, genauer: von Amerika unterscheidet.»
Ob im Baltikum, auf Kuba, in Griechenland, Ungarn oder – ein halbes Jahrhundert nach dem eigenen Vater – auf dem Weg von Nanking nach Schanghai: Eugen Ruge ist um kein klares Wort verlegen, aber immer bereit, Erwartungen mit Erfahrungen zu vertauschen.
Er bereist Russland, die USA
Über Eugen Ruge
Eugen Ruge, 1954 in Soswa (Ural) geboren, studierte Mathematik an der Humboldt-Universität und wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Physik der Erde. Seit er 1988 aus der DDR in den Westen ging, ist er hauptberuflich fürs Theater und für den Rundfunk als Autor und Übersetzer tätig.
Für seine dramatischen Arbeiten erhielt Eugen Ruge den Schiller-Förderpreis des Landes Baden-Württemberg. Sein erstes Prosamanuskript In Zeiten des abnehmenden Lichts wurde mit dem Alfred-Döblin-Preis ausgezeichnet; für den daraus entstandenen Roman erhielt er den Aspekte-Literaturpreis und den Deutschen Buchpreis 2011. Zuletzt erschien sein Roman «Cabo de Gata».
Inhaltsübersicht
Russland
Juli 2005
Kommen mittags in Domodedovo an. Keine Zollkontrollen, wie befürchtet (wir haben zwei Dauerwürste dabei). Nur die Passkontrolle zäh. Die Beamten mit unbewegten Gesichtern.
Ist es wirklich dreißig Jahre her, dass ich das letzte Mal hier war?
Der Flughafen: groß, hell, westlich. Der Aeroexpress nach Moskau-City kostet hundertzwanzig Rubel – dreieinhalb Euro. Ein klappriger Zug, wie es ihn auch in London oder Boston geben könnte. Neu: Menschen verkaufen im Zug Zeitungen, Erfrischungsgetränke, irgendwas.
Vierzig Minuten Fahrt. Draußen Russland. Das Land, aus dem ich komme. Vororteindrücke, nichts Überraschendes. Dreck, Baustellen, Ruinen, Unkraut. Ich lese Zeitung: Kasachstan strebt offenbar wieder eine Union mit Russland an. Wie auch Belorussland. Anscheinend schon seit langem, ich habe nur nicht davon gehört. Doch noch einmal eine Art Neuauflage der Sowjetunion?
Pawelezkij-Bahnhof. Wir treten auf die Straße hinaus: Moskau. Hohe Häuser. Matte, rötliche Farben. Die breiten Straßen. Der chaotische Verkehr. Nur der Geruch ist anders. Vor dreißig Jahren roch es nach «Russenauto». Damals waren fast ausschließlich Taxis unterwegs: billig, fast so billig wie die Straßenbahn. Das ist vorbei. Das Taxi vom Flughafen hätte vierzig Euro gekostet, wie man uns gesagt hat. Wir haben darauf verzichtet.
Mit der Straßenbahn bis zur Proletarskaja. Heißt also immer noch so. Auch die Metro heißt noch Wladimir Iljitsch Lenin. Selbst die Schaffnerin in der alten Straßenbahn scheint einer früheren Epoche zu entstammen.
Ein weißes Neubauhaus, Stroikovskaja Uliza Nummer sowieso. Die untere Etage ist komplett von den einzelnen Bewohnern vergittert worden. Skurril: Die seltsamen rostigen Eisenkästen, die verstreut zwischen den Häusern herumstehen, sind, wie sich herausstellen wird, Garagen!
Aufgang 1, Wohnung 4. Tanja empfängt uns. Tanja ist die Tochter der besten Freundin meiner Schwester, eigentlich Halbschwester, die heute in Boston lebt. Soll ich jetzt die Geschichte meiner Schwester erzählen?
Was ist das? Was schreibe ich hier? Für wen? Eigentlich sollten es ein paar Notizen werden, Gedächtnishilfen für meine Familiengeschichte. Aber jetzt denke ich plötzlich daran, dass die Reise eine Rahmenhandlung für den Roman abgeben könnte. Oder ist eine Zehn-Tages-Reise als Rahmenhandlung zu klein? Was heißt überhaupt Handlung? Ist das, was hier passiert, Handlung? Und: Werde ich, wenn ich eine authentische Reise zum Ausgangspunkt wähle, nicht unwillkürlich in eine Art Wahrheitsfindungsgeschichte hineinrutschen? Werde ich mich plötzlich an Fakten halten müssen, statt meiner Phantasie freien Lauf zu lassen?
Keine Lust auf Fakten. Keine Lust auf Wahrheitsfindungsliteratur, welche ja von der Existenz einer Wahrheit ausgeht, einer Wahrheit, die wie ein Edelmetall irgendwo in der Tiefe verborgen liegt und die man nur ans Licht zu holen braucht, um sie allen zu zeigen.
Tanja, so hieß es, komme gerade aus Paris. Meine Vorstellung: Nur reiche (und infolgedessen unangenehme) Russen fahren nach Paris. Bin erleichtert, dass Tanja sich als ganz normale Russin erweist. Die kleine Eigentumswohnung, in der sie irgendwie noch mit den Eltern zusammenwohnt, ist vielleicht sechzig Quadratmeter groß, drei sozialistische Neubauzimmer, eine winzige Küche.
Da sitzen wir und trinken, weil es heiß ist, Wasser aus der Leitung, das fürchterlich nach Chlor stinkt. Tanja findet das Moskauer Wasser anscheinend okay. Sie findet auch, ich sähe jung aus für mein Alter. Merkwürdig. In Deutschland sagt man mir stets das Gegenteil. Aber das russische Leben schafft offenbar andere Maßstäbe.
Spaziergang durch Moskau am nächsten Morgen. Die neurussischen Worte, die ich dreimal lesen muss, um zu begreifen, was da in kyrillischen Buchstaben geschrieben steht: джекпóт (Jackpot!), хит (Hit!).
Ein riesiges Plakat über der Straße: Wann fahren Sie endlich Ihren Bentley? Das ist sie – die neue Zeit.
Wir gehen zuerst zum Roten Platz. Die Kremlmauer, die ewige Flamme, die Gedenksteine für die «Heldenstädte». Ich kann nicht leugnen, dass mich das berührt, auch wenn der Kreml ein Ort der Macht ist, auch wenn es mich befremdet, wie stark diese Nation ihr Selbstbewusstsein noch immer aus jenem gewonnenen Krieg bezieht, dem sie den schrecklichen Namen «Großer Vaterländischer» gegeben haben.
Andererseits ist dieser Ort von trotzigem Pathos umweht, scheinen sich diese roten Mauern gegen alles Zeitliche zu stemmen, gegen alle Moden, alles Geschwätz, alle Politik. Mich rührt der Ernst, mit dem der blutjunge, picklige Soldat die ewige Flamme bewacht. Ich weiß, dass ein großer Teil der Opfer dieses Krieges der Unfähigkeit, der Selbstherrlichkeit und der Menschenverachtung Stalins zu verdanken ist, und dennoch werde ich an den Gedenksteinen für die «Heldenstädte» starr vor Ehrfurcht und Trauer.
Irgendwo vor den Toren Moskaus lag übrigens meine Mutter vier Jahre lang in einem feuchten Erdbunker, vier Stunden Wache, vier Stunden Schlaf, und hat, sozusagen als lebende Zielscheibe, die Scheinwerfer bedient, mit denen deutsche Flieger, die Moskau angriffen, geblendet wurden.
Ich esse ein Eskimo-Eis – in Amerika würde es jetzt vielleicht «Little Inuit» heißen. Hier heißt es immer noch «Eskimo», aber es schmeckt nicht mehr so. Liegt es an mir, am Eis? Wie gern habe ich als Kind Eskimo-Eis auf dem Roten Platz gegessen.
Dann zum Hotel Metropol, unserem ersten Ziel. Ein riesiges, prächtiges Jugendstilhotel, das vor der Renovierung noch prächtiger gewesen sein soll. Ich wusste nicht, dass es so prächtig ist, und ich wusste nicht einmal, dass es so zentral liegt – nur einen Steinwurf vom Kreml entfernt. Hier also hat meine Großmutter ein Jahr lang auf ihre Verhaftung, und das heißt: auf ihre Erschießung, gewartet, zusammen mit dem größten Teil der sogenannten OMS, des legendären Geheimdienstes der KOMINTERN. Aber während die anderen tatsächlich fast alle erschossen wurden, ist meine Großmutter zusammen mit Stiefgroßvater Hans nach Paris ausgereist.
Ich weiß sogar, in welchem Zimmer meine Großmutter und Hans gewohnt haben, aber die Zimmer sind neu nummeriert, und das Personal an der Rezeption des Nobelhotels (das billigste Zimmer kostet 700 Euro) ist nicht aufgelegt, mit einem dahergelaufenen Deutschen über irgendwelche Geschichten aus den dreißiger Jahren zu reden. Wenigstens den gewaltigen, altmodischen Fahrstuhl schauen wir uns noch an, auf dessen Anfahrgeräusch meine Großmutter hier vermutlich jeden Morgen gegen vier Uhr gewartet hat: die Zeit, um die «abgeholt» wurde.
Dann suchen wir das KOMINTERN-Gebäude. Es muss in der Maneschnaja Uliza sein. Wir suchen eine Weile vergeblich. Ich erwarte ein Schild an dem Gebäude – nichts zu sehen. Ich frage einen Polizisten danach. Der Polizist, so wird sich zwei Tage später herausstellen, steht direkt vor dem Gebäude. Der Mann macht ein nachdenkliches Gesicht: Mhm, ja, KOMINTERN, das habe er schon mal gehört …
Ich frage Passanten auf der Straße, die aussehen, als wären sie gebildet: Keiner weiß was. Die KOMINTERN! Die ruhmreiche Kommunistische Internationale, Vereinigung aller Kommunistischen Parteien, Herz und der Kopf der Weltrevolution!
Auf der Suche nach dem Gebäude gehen wir die Maneschnaja abwärts, fast bis zur neu aufgebauten Christ-Erlöser-Kathedrale, die 1931 gesprengt und zu einem offenen, beheizten (!) Schwimmbad umgebaut worden war: eine Riesenattraktion für mich als Kind. Ich erinnere mich, wie ich einmal zusammen mit Jakow Samuelowitsch Drabkin, dem Historiker, in dem warmen Wasser geschwommen bin, und frage mich jetzt, ob ich mich unwissentlich der Gotteslästerung schuldig gemacht habe.
Zum Schluss noch zur Lubjanka, dem KGB-Gefängnis, in dem Onkel Walter verhört worden ist, bevor er für zehn Jahre ins Arbeitslager geschickt wurde. Ich fotografiere es heimlich, aus der Hüfte. Aber was sieht man schon auf dem Foto? Einfach ein großes Haus. Übrigens werden, so hat Walter berichtet, die Zugänge durch den Hintereingang ins Gebäude gebracht. Diesen getraue ich mich nicht zu fotografieren.
Am nächsten Tag unterwegs mit der Moskauer Metro. Damals, vor dreißig Jahren, für mich ein Wunder – und heute noch immer beeindruckend, obwohl die Züge laut und altmodisch sind. Sie verkehren alle zwei Minuten, und anstelle von komplizierter Anzeigenelektronik, wie man sie in Berlin findet, beginnt hier, sobald ein Zug abgefahren ist, eine Zwei-Minuten-Uhr rückwärts zu laufen: russische Methode, aber es funktioniert. Ich ertappe mich dabei, vor Martina einen seltsamen Stolz zu empfinden.
Die Metro ist tief, es dauert ewig, ehe einen die Rolltreppe auf das Niveau der Gleise befördert. Überhaupt sind die Wege in Moskau lang. Die Straßen, die mir in der Kindheit riesig vorkamen, sind immer noch riesig. Man geht nicht über Ampelkreuzungen, man wandert.
Menschen als Litfaßsäulen – Werbung. Sind Menschen hier inzwischen billiger als Plakatflächen?
Wir schauen uns die Lomonossow-Universität an – allerdings wird mir bald klar, dass mein Vater nicht hier studiert haben kann. Das berühmte Gebäude im Stalin’schen Zuckerbäckerstil ist erst später errichtet worden.
Wir essen in einem Jolki-Palki, einer neurussischen Restaurant-Kette. Der Name eine Verballhornung des russischen Mutterfluchs, eine an sich sinnlose Wortkombination – «Tannen-Stöcke» –, die lediglich durch den Anlaut «J» auf das russische Wort юбjub anspielt (Befehlsform des f-Wortes …).
Abends durch den alten Arbat, das einstige Künstler- und Intellektuellenviertel. Heute eine Geschäftsstraße, ein Touristenboulevard, auf dem am Abend weiße Kaninchen und Blumen feilgeboten werden, sogar einen zahmen Raben kann man kaufen. Vor dem Geburts- oder Wohnhaus des berühmten russisch-georgischen Liedermachers Bulat Okudschawa fragt uns ein alter Mann auf Deutsch, ob er uns einen Vortrag über Okudschawa anbieten darf. Wir lassen uns darauf ein, und sei es nur, um zur Aufbesserung seiner wahrscheinlich erbärmlichen Rente beizutragen. Was er über Okudschawa zu berichten hat, ist keineswegs uninteressant und vermutlich zutreffend (Vater als Volksfeind erschossen, Mutter im Lager, als Kind bei der Großmutter überlebt). Trotzdem fühle ich mich, wie immer in solchen Situationen, unwohl. Zum einen ist es, glaube ich, die Unklarheit des «Geschäfts» (weil ja nie klar vereinbart wird, ob und wie viel es kostet). Zum anderen ist es aber auch die Rolle des Almosengebers, die ich vor diesem alten russischen Intellektuellen nicht spielen möchte und die mir nicht zusteht: eine Art Fremdschämen dafür, dass dieser Mann auf seine alten Tage noch betteln gehen muss.
Auf dem Heimweg: unterirdische Clubs, vor denen scharf angezogene Moskauerinnen umherstreunen, unverhohlen auf Beutezug.
Am nächsten Tag nach Podmoskowje. Dazu muss man sagen: Jeder Moskauer, der irgendwie kann, nimmt die größten Unbequemlichkeiten und längsten Fahrzeiten in Kauf, um im Sommer auf seiner Datsche zu leben, draußen im Moskauer Umland. Auch Ira und Wolodja, die Eltern von Tanja, leben zurzeit auf der Datsche (und das ist auch der Grund, weshalb in der Wohnung Platz ist). Nun sind wir dorthin, nach Podmoskowje, eingeladen.
Wir erreichen unser Ziel mit dem Vorortzug recht bequem. Die Datschengegend sieht auf den ersten Blick allerdings nicht sehr verlockend aus: Ein Asphaltstreifen für Autos, den man Straße nennen könnte, links und rechts hohe Bretterzäune, Brennnesseln wuchern davor, schiefe Strommasten. Aber kaum öffnet sich das Tor zum Grundstück, wird es licht. Ein schönes, rosa angestrichenes Holzhaus mit geräumiger Veranda, ein weiter Garten, zum großen Teil mit Gemüse bebaut. Ira begrüßt uns so herzlich, als wäre sie nicht nur mit meiner Schwester, sondern auch mit uns innig befreundet, sie weint sogar.
Siebzehn Personen sitzen am Tisch. Große Tafel, Trinksprüche, üppige Speisen. Schon fühlt man sich ein bisschen wie in einem russischen Film, beinahe wie im alten Russland, aber dann, anstelle von Gesang zu Gitarre oder Akkordeon – Karaoke!
Am Abend noch ins Taganka-Theater: eine Studentenaufführung von Nabokovs Märchen. Sehr artistisch, guter Gesang, große, schöne, talentierte, junge Frauen, aber das Ganze ohne Atmosphäre, ohne den Geruch irgendeiner «Wirklichkeit», eine kalte, gut einstudierte Veranstaltung.
Wir treffen Erik, ebenfalls ein alter Freund meiner Schwester. Erik ist Rentner, früher war er bei der Eisenbahn. Da er ein bisschen Deutsch spricht, soll er die Russland-Erinnerungen meines Vaters im Auftrag meiner Schwester (die kein Deutsch kann) ins Russische übersetzen.
Mit Erik nun noch mal zum Roten Platz, weil ich sicher sein will, welches das KOMINTERN-Gebäude ist. Tatsächlich stellt sich heraus, dass es ausgerechnet das Haus ist, vor dem der Polizist gestanden hatte. An der Seitenwand gibt es eine kleine Gedenktafel für Béla Kun, einen jüdisch-ungarischen KOMINTERN-Funktionär, den sie 1938 erschossen haben – warum ausgerechnet für ihn, warum nicht für die vielen anderen?
Das Haus ist der Roten Mauer zugewandt, ein hübscher Gründerzeitbau, wenn man in Moskau so sagen darf, mit vier Stockwerken. Der «fünfte Stock der KOMINTERN» – so nannte man, wie mir mein Vater erzählt hat, unter Eingeweihten die OMS. Angeblich wagte niemand, den tatsächlichen Namen des KOMINTERN-Geheimdienstes öffentlich auszusprechen. Mein Vater behauptete sogar, dass diese «Abteilung für internationale Verbindungen» (otdel meschdunarodnych svjasei) so geheim war, dass die westlichen Geheimdienste nicht einmal von ihrer Existenz wussten.
Weiter auf den Spuren meines Vaters. Wir besuchen die alte Moskauer Universität. Hier hat er als Zeichner gearbeitet und die ersten Semester seines Fernstudiums absolviert. Aber vor allem will ich den Vorhof der Uni sehen, wo sich einer der vielen Zufälle ereignete, die sein (und damit ja auch mein) Schicksal entschieden.
Als mein Vater sich nämlich 1936 zum ersten Mal bewarb, wurde er abgelehnt (die Stimmung wendete sich gerade gegen Ausländer). Noch mit der Ablehnung in der Hand, traf er hier, im Hof der alten Universität, zufällig einen alten Bekannten aus Berlin, Moise Lurje alias Alexander Emel, der, wie sich herausstellte, Professor an der historischen Fakultät war. Er bot meinem Vater seine Hilfe an. Sie verabredeten sich für den nächsten Tag im Universitätshof. Aber Emel erschien nicht. Eine fehlende Münze (eine Kopeke!), gab den Ausschlag, dass mein Vater sich letztlich entschied, Emel nicht von der Telefonzelle im Hof der Universität aus hinterherzutelefonieren, sondern auf dessen Protektion zu verzichten und es stattdessen im nächsten Jahr erneut zu versuchen.
Kurze Zeit später setzte der Terror ein, und Alexander Emel wurde im ersten öffentlichen Moskauer Schauprozess zum Tode verurteilt, weil er angeblich Studenten zu irgendwelchen Schandtaten angestiftet hatte. Ein von ihm protegierter, obendrein deutscher Student hätte die Jahre des Terrors kaum überstanden.
Übrigens war es die Bekanntschaft zu eben diesem Alexander Emel, die als Vorwand diente, meine Großeltern vom Dienst bei der OMS zu suspendieren und – sozusagen als Volksfeinde in der Warteschleife – im Luxusgefängnis Hotel Metropol einzuquartieren.
Kurz schauen wir bei Jelissejew rein, dem Delikatessengeschäft, um die Kaviarpreise zu erkunden (für uns unbezahlbar). Am benachbarten Hotel Lux latschen wir fahrlässigerweise einfach vorbei. Immerhin hat mein Vater hier die ersten Moskauer Wochen verbracht und ist hier kommunistischen Größen wie Walter Ulbricht oder Friedrich Wolf samt beiden – noch sehr kleinen – Söhnen Konrad und Markus begegnet.
Seltsam: dass ein Russe (Erik) Tschechow nicht mag.
Lustig: dass die alten Damen im Tschechow-Museum sein Erbe bewachen wie verflossene Geliebte – in jedem Zimmer eine.
Am folgenden Tag ein Ausflug mit dem O-Bus zum Serebrjanny Bor, dem Naherholungsgebiet im Westen von Moskau. Hier ist mein Vater zu Anfang des Krieges beinahe standrechtlich erschossen worden, weil er sich – weder wurde er als Deutscher einberufen noch für Zivilschutzaufgaben eingeteilt – mit seinen Studienbüchern versehentlich neben einem getarnten Flugabwehrgeschütz niedergelassen hatte. Witzige Idee, dass es die Einheit meiner Mutter gewesen sein könnte.
Das Naherholungsgebiet selbst: Wald und Wiese, Badestrände an den Nebenarmen des Moskau-Flusses. Die Brücken und Brückchen würden in Deutschland vom TÜV gesperrt werden.
Noch ein Freund meiner Schwester: Mark, der wahrscheinlich ebenso wenig Mark heißt wie Erik Erik (man versucht, seine Namen zu verwestlichen). Mark ist sozusagen ein Buddelkastenfreund meiner Schwester. Als mein Vater mit seiner ersten Ehefrau an der Moskauer Peripherie, in Perlovka, ein kleines Haus kaufte, spielten die beiden dort draußen zusammen.
Mark ist Wissenschaftler, anscheinend ein regelrechter Experte, irgendwas mit Chemie, aber damit verdient man in Russland heutzutage kein Geld. Nebenbei macht er in Immobilien, und es liegt wahrscheinlich nicht nur an meinem mangelhaften Russisch, dass ich nicht ganz verstehe, was er da eigentlich tut. Fest steht aber, dass der schöne, rote VW Passat nicht von seinem Gehalt finanziert ist – das Gefährt, mit dem wir nach Perlovka fahren.
Leider existiert das Haus meines Vaters und seiner ersten Frau, also das Haus, in dem meine Schwester ihre Kindheit und Jugend verbrachte, nicht mehr, es ist einer Autobahn zum Opfer gefallen. Und überhaupt erweist sich, was immer ich mir unter Perlovka vorgestellt haben mag – als falsch.
Zwar weiß ich von meinem Vater, dass Moskau, als er 1933 ankam, noch vorwiegend aus hölzernen Blockhäusern bestand, trotzdem bin ich überrascht, als ich etwas vorfinde, das eher einem russischen Dorf gleicht. Nur dass sich das neue Moskau allmählich in die dörfliche Peripherie frisst. Nicht nur die Autobahn führt knapp an Perlovka vorbei. Die Stadt, man sieht es überall, kommt näher, gräbt das Gelände um, betoniert sich vorwärts. Die Hochhäuser stehen schon in Sichtweite. In zehn Jahren wird es hier keine Holzhäuser mehr geben. Gut, dass ich da war.
Bevor wir in Perlovka waren, sind wir mit Mark noch in Podlipki gewesen. Der legendäre «Punkt 2»! Meine Großmutter hatte die OMS-Geschichte nie erwähnt, als unterliege das alles immer noch der Geheimhaltungspflicht (und irgendwie stimmt das sogar: Die Akten der OMS sind bis heute unter Verschluss).
Das Einzige, was meine Großmutter je von dieser Zeit berichtet hat, erst im hohen Alter und recht zusammenhanglos, war, dass sie auf dem Bahnsteig einen Nervenzusammenbruch gehabt habe, als sie zusammen mit Hans auf irgendeine offenbar gefährliche Tour geschickt werden sollte. Sie fuhren damals als sogenannte geheime Emissäre der KOMINTERN mit gefälschten Pässen in Europa herum und lieferten irgendwelches Material in irgendwelchen schwarzen Koffern. Später hat mir ihr Neffe Klaus erzählt, Hans sei einmal auf eine solche Tour geschickt worden mit einem Ausweis, bei dem im Visa-Stempel des Deutschen Reichs ein «c» fehlte: Deutshes Reich. – Hans sei trotzdem gefahren.
Zurück zum «Punkt 2». Hier nämlich residierte die OMS in Wirklichkeit. Hier war der «Fünfte Stock der KOMINTERN». Wie es drinnen aussah, weiß wahrscheinlich kein lebender Mensch. Auch mein Vater kannte den Ort nur von außen: ein hoher Bretterzaun, Wachtürme, Stacheldraht. Nach der Liquidierung der OMS wurde der «Punkt 2» von Stalin in eine sogenannte Scharaschka verwandelt, das heißt in ein Gefängnis für solche «Volksfeinde», die Stalin durch ihre besonderen Fähigkeiten nützlich sein konnten. So konstruierte der berühmte Ingenieur Andrei Nikolajewitsch Tupolew hier sein zweimotoriges, vermutlich mit kriegsentscheidendes Kampfflugzeug Tu-2.
So weit kenne ich die Geschichte von meinem Vater. Die Überraschung: dass sich heute an dieser Stelle die sogenannte Koroljow-Stadt befindet – das nach dem Vater der sowjetischen Raumfahrt benannte Raketenzentrum. Aus dem Grund weigert Mark sich beinahe, mit uns dorthin zu fahren. Nicht aus Angst, sondern weil man «sowieso nichts sieht». Tatsächlich ist das riesige Gelände von hohen Mauern umgeben. Und doch muss ich den Ort unbedingt sehen.
Noch eine verrückte Geschichte: Zum Schluss trinken wir in Perlovka Tee bei Marks Bruder. Ich erzähle von meinem Vater, der im Lager war, von der Lagerhauptstadt Soswa, meinem Geburtsort. Da stellt sich heraus, dass Marks Bruder vor nicht allzu langer Zeit in Soswa gewesen ist! Auf einer Paddeltour seien sie dort vorbeigekommen, und da es dort natürlich kein Quartier und keinen Zeltplatz gibt, hat ihnen der Lagerkommandant angeboten, ihre Zelte innerhalb des – heute noch existierenden – Lagers aufzubauen: Das sei am sichersten.
Letzter Teil der Reise: Susdal, Moskaus goldener Ring. Eine Bekannte von Martina lebt hier, eine Deutschlehrerin, zu der sie schon lange Kontakt hält.
Das Neubaugebiet, in dem sie mit der Familie wohnt, sieht aus wie nicht fertig gebaut – und ist es auch nicht. Alles irgendwie roh, kahl. Soweit ich weiß, hat sie für die kleine Zweieinhalb-Zimmer-Wohnung viel Geld bezahlt, mit Hilfe deutscher Freunde.
Im Zentrum ist Susdal sehr schön, Häuschen wie aus dem Bilderbuch, hölzern, bunt, mit Schnitzereien. Natürlich besuchen wir auch die berühmten Kirchen mit ihren Goldkuppeln, lauschen einem slawischen Kirchenchor und einem kleinen, sozusagen handgespielten Glockenkonzert.
Aber das Interessanteste bleiben doch die Menschen und ihre Geschichten. Aljoscha, der Mann von Martinas Freundin, war Soldat in Afghanistan. Genauer gesagt: Offizier. Jetzt ist er arbeitslos, säuft, so wie alle, hängt herum, während seine Frau das Leben meistert. Über seine Zeit in Afghanistan spricht er nie, sagt seine Frau, außer gelegentlich mit den anderen «Afghanzen», seinen ehemaligen Mitkämpfern.
Aber als ich ihn gezielt frage, kommt doch einiges. Er spricht vom Töten. Er zeigt keine Emotionen, versucht aber mit Worten auszudrücken, wie man sich fühlt, wenn man in einem Hinterhalt liegt und den Trupp anrücken sieht: Menschen, von denen man weiß, dass man sie in wenigen Sekunden auslöschen wird.
Ich frage ihn, ob und wie man ihnen den Einsatz in Afghanistan begründet hat. Aljoschas Antwort:
«Man hat uns gesagt, wo wir nicht sind, da sind die Amerikaner.»
Und tatsächlich: 1989 verließen die Russen Afghanistan, zwölf Jahre später marschierten die Amerikaner ein, aus welchen Gründen auch immer.
Mexiko
Dezember 2007/Januar 2008
Wie war das, 1941 von Veracruz, von der Seeseite her, einzureisen? Eine flache Stadt, vom Faro überragt. Palmen. Kleine, pastellfarbene Häuser. Die breite Hafenpromenade, einladend, offen – ja, so empfängt einen diese Stadt. Trotz der schwerbewaffneten Polizei-Patrouille, die am Hafen herumlungert wie eine Jugendbande. Das Land ist flach, der Himmel riesig.
Aber der Reihe nach.
Vorspann: Transit USA, Houston. Fingerabdrücke, Kamera vors Gesicht. Frage: Was wollen Sie in Mexiko? Unglücklicherweise gehen Martina und Luise durch einen anderen Eingang, sodass mich die Beamtin allein vor sich hat. Meine Antwort: Tourismus. Wohin wollen Sie? Antwort: Zuerst nach Mexico-Stadt, dann wahrscheinlich nach Palenque, dann weiß ich noch nicht genau. Misstrauischer Blick: Sie wissen nicht genau? Sie sollten wissen, wo Sie hinfahren. Ich: Entschuldigen Sie, aber warum wollen Sie das wissen? Die Beamtin: Hier stellen wir die Fragen, Sie antworten. Und dann kommt mein Satz, der das Problem auslöst:
«As far as I know, Mexico is not part of the United States of America.»
Ich werde abgeholt, komme in eine Art Warteraum, werde dann, nachdem man mich demonstrativ eine Weile ignoriert, von irgendeinem Officer verhört, jetzt fragt er mich sogar, was ich vor zwei Jahren in Moskau gemacht habe (Passstempel). Da Martina und Luise draußen warten (irgendein Uniformierter sagt zu Martina, man warte auf einen Anruf aus Washington) und der Anschlussflug schon in Gefahr ist, reiße ich mich zusammen und versuche, den Mann nicht noch weiter zu provozieren. Sie lassen mich gerade noch rechtzeitig gehen.
México D.F. Wir kommen abends gegen acht an. Laues Lüftchen. Der Taxifahrer fährt wie ein Irrer. Die Fenster offen, es zieht. Brüllender Verkehr. Nadelöhre, mehrspurige Avenidas, keine Orientierung. Irgendwo biegt der Fahrer ein: Häuserblöcke, grau, heruntergekommen, nichts Besonderes: Das ist schon das «historische Zentrum». Zócalo ist gesperrt wegen Weihnachten. Wir sehen riesige bunte Leuchtengel. Später, beim Abendspaziergang, entdecken wir, dass sie eine große Eisbahn auf dem Zócalo aufgebaut haben, offenbar ist der Betrieb kostenlos, die Menschen stehen an wie am Lenin-Mausoleum in Moskau.
Das Hotel ist okay. Alte Möbel, mit der Spritzpistole auf ein angenehmes Bordeauxrot umgespritzt. Einfachverglaste Gewächshausfenster zum Hinterhof. Auf dem Dach gegenüber haben sie zur Bewachung von irgendwas zwei Hunde stationiert, arme Viecher, die ihr Leben auf zwanzig Quadratmetern Beton verbringen und die halbe Nacht bellen.
Wir werden viel zu früh wach und gehen schon um sieben oder halb acht in das Bäckerei-Café gegenüber, es ist groß, schlicht, mit weißen Energiesparlampen beleuchtet, viele Kellner. Das Publikum besteht aus Mexikanern, der Kaffee ist phantastisch, ein großes Glas, zuerst starker Kaffeesud, dann warme Milch drüber (es wird der beste Kaffee gewesen sein, den wir in Mexiko bekommen). Ich esse ein «mexikanisches Frühstück», irgendwelche Tortillas mit scharfer grüner Soße drüber, alles leicht pampig.
Am ersten Tag schauen wir uns im centro historico um, die große Basilika ist im Inneren so, wie man sich mexikanischen Barock vorstellt: golden und verschnörkelt. Mich hat so was noch nie beeindruckt. Ganz anders: der Templo Mayor der Azteken direkt daneben. Ausgrabung mitten im Stadtzentrum, eine schöne Idee. Aufgrund des schlammigen Inselbodens, auf dem die Mexica, der Hauptstamm der Azteken, im 14. Jahrhundert ihre Stadt Tenochtitlán errichtet haben, ist der Tempel immer wieder abgesunken, bis heute ist alles schief. Zu besichtigen sind eigentlich nur Teile des inneren Tempels. Alle zweiundfünfzig Jahre, wenn jeweils eine Zeitrechnung der Azteken zu Ende ging, haben sie auf dem alten Tempel einen neuen errichtet. Die oberen sind von den Spaniern abgetragen worden. Wo die Basilika unverputzt ist, sieht man, dass sie aus den Steinen des früheren Tempels besteht.
Kurz auf den Aussichtsturm. Ringsum der Moloch. Man kann wunderbar den Stau in der Innenstadt besichtigen.
Im Westen des Zentrums der kleine Parque da Alameda: Die «Grünflächen» sind braun, von einem kleinen Geländer eingezäunt, nicht zu betreten. Berittene Polizei mit gewaltigen Sombreros. Die Bäume spenden schwachen, durchlässigen Schatten. Schwarze, dohlenartige Vögel fiepen durchdringend. Unzählige Buden mit Plunder und Essen, irgendwelche Tacos, Tortillas (kann ich bis heute nicht unterscheiden), Mais, alle möglichen Sorten Fleisch zusammen in einem großen Tiegel, etwas Seltsames, Frittiertes (das sich später als Schweinehaut herausstellen wird), Süßigkeiten, Obst.
Gesamteindruck: vor allem viele Menschen. Besonders