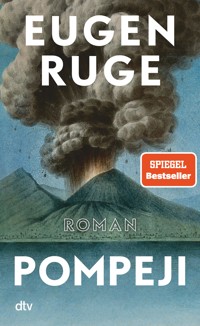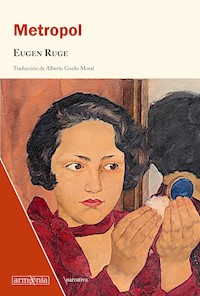9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2011
International gefeiert, ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis - ein halbes Jahrhundert gelebter Geschichte, ein Familienroman voller überraschender Wendungen: groß durch seine Reife, seinen Humor, seine Menschlichkeit. Die Großeltern haben noch für den Kommunismus gebrannt, als sie aus dem mexikanischen Exil kamen, um ein neues Deutschland aufzubauen. Der Sohn kehrte aus der Sowjetunion heim: mit einer russischen Frau, der Erinnerung ans Lager und doch in dem Glauben an die politische Idee. Dem Enkel bleibt nur ein Platz in der Realität der DDR, und er flieht - an eben dem Tag, an dem sich Familie, Freunde und Feinde versammeln, um den neunzigsten Geburtstag des Patriarchen zu begehen. Von den Jahren des Exils bis ins Wendejahr 1989 und darüber hinaus reicht diese wechselvolle Geschichte einer deutschen Familie. Sie führt von Mexiko über Sibirien bis in die neu gegründete DDR, führt über die Gipfel und durch die Abgründe des 20. Jahrhunderts. So entsteht ein weites Panorama, ein großer Deutschlandroman, der, ungeheuer menschlich und komisch, Geschichte als Familiengeschichte erlebbar macht. 2009 erhielt Eugen Ruge für In Zeiten des abnehmenden Lichts den Alfred-Döblin-Preis. 2011 wurde der Roman mit dem Aspekte-Literaturpreis und mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet. Er verkaufte sich bisher in 28 Länder, stand mehr als 40 Wochen auf der Bestsellerliste und wurde von Matti Geschonneck nach einem Drehbuch von Wolfgang Kohlhaase fürs Kino verfilmt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 587
Ähnliche
Eugen Ruge
In Zeiten des abnehmenden Lichts
Roman einer Familie
Über dieses Buch
Von den fünfziger Jahren über das Wendejahr 89 bis zum Beginn des neuen Jahrtausends reicht dieser Roman einer Familie. Im Mittelpunkt drei Generationen: Die Großeltern, noch überzeugte Kommunisten, kehren aus dem mexikanischen Exil in die junge DDR heim, um dort ihren Anteil am Aufbau der neuen Republik zu leisten. Ihr Sohn, als junger Mann nach Moskau emigriert und später in ein sibirisches Lager verschleppt, tritt die Reise vom anderen Ende der Welt, dem Ural, an. Er kehrt mit seiner russischen Frau zurück in eine Kleinbürgerrepublik, an deren Veränderbarkeit er weiterhin glauben will. Dem Enkel wird die Wahlheimat von Eltern und Großeltern indes zusehends zu eng – bis er, ausgerechnet am neunzigsten Geburtstag des Patriarchen, in den Westen geht. Die Strahlkraft der politischen Utopie scheint sich von Generation zu Generation zu verdunkeln: Es ist die Zeit des abnehmenden Lichts.
Ein halbes Jahrhundert gelebter Geschichte, ein Deutschlandroman voll überraschender Wendungen und Details: groß durch seine menschliche Reife, seine Genauigkeit, seinen Humor.
«Überragend … eine faszinierende Innensicht der DDR.» Felicitas von Lovenberg, FRANKFURTERALLGEMEINEZEITUNG
Eugen Ruge «glänzt durch einen szenisch zugespitzten und ausgereiften literarischen Stil, orchestriert von zahlreichen, den Erzählfluss kunstvoll ausbremsenden energischen Doppelpunkten und Parenthesen … ein lebenskluger Roman». Iris Radisch, DIEZEIT
«Seine Figuren haben Bestand jenseits der Zeiten. Und vielleicht erzählt er gerade deshalb mehr von der DDR und den Nöten des Lebens als all die Bücher, die sich an den Ideologien und an der harten Wirklichkeit abarbeiten. Die Zeit ist reif für diesen unverstellten, humorvollen und einfühlsamen Blick.» Jörg Magenau, SÜDDEUTSCHEZEITUNG
«Eugen Ruge ist ein Erzähler von einer Virtuosität, von einer sprachlichen Finesse, von einer erzähltechnischen Genauigkeit, wie man sie nicht alle Tage antrifft … Meisterlich.» Andreas Isenschmid, 3SAT-KULTURZEIT
«Weder mit einer Nach-Wende-Ironie noch mit einem dissidentischen Furor erzählt, sondern gelassen, umsichtig, souverän … Ein Roman, der die DDR wirklich hinter sich lässt.» Dirk Knipphals, DIETAGESZEITUNG
«Das eigentliche Wunder dieses Romans besteht aber darin, wie er jeder seiner Figuren Gerechtigkeit widerfahren lässt, in einer präzisen, unprätentiösen Sprache, die ganz auf Beobachtung setzt, die Bedeutung der Dinge, auf Gerüche, Gesten. (…) Es gibt nicht den geringsten Grund, der DDR als Staat hinterherzutrauern, aber es gibt eine Menge Gründe, das gelebte, das geglückte oder vergeudete Leben mit feinem schwarzem Humor zu erzählen.» Michael Kumpfmüller, DIEWELT
«Im Hintergrund schwingt die Weltgeschichte mit: Mauerbau, Restalinisierung, Perestroika, Wende. Wilde Zeiten. Eugen Ruge geht in seinem Roman nicht in die Breite, er geht in die Tiefe.» Sophia Ebert, KULTURSPIEGEL
Ausgezeichnet mit dem Deutschen Buchpreis 2011.
Vita
Eugen Ruge, 1954 in Soswa (Ural) geboren, studierte Mathematik an der Humboldt-Universität und wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Physik der Erde. Bevor er 1988 aus der DDR in den Westen ging, arbeitete er beim DEFA-Studio für Dokumentarfilm. Seit 1989 ist er hauptberuflich fürs Theater und für den Rundfunk als Autor und Übersetzer tätig. Seine Arbeiten wurden u.a. mit dem Schiller-Förderpreis des Landes Baden-Württemberg ausgezeichnet.
2009 erhielt Eugen Ruge für sein erstes Prosamanuskript «In Zeiten des abnehmenden Lichts» den Alfred-Döblin-Preis; 2011 wurde der daraus entstandene Roman mit dem Aspekte-Literaturpreis und mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet.
Widmung
für euch
2001
Zwei Tage lang hatte er wie tot auf seinem Büffelledersofa gelegen. Dann stand er auf, duschte ausgiebig, um auch den letzten Partikel Krankenhausluft von sich abzuwaschen, und fuhr nach Neuendorf.
Er fuhr die A 115, wie immer. Schaute hinaus in die Welt. Prüfte, ob sie sich verändert hatte. Und – hatte sie?
Die Autos kamen ihm sauberer vor. Sauberer? Irgendwie bunter. Idiotischer.
Der Himmel war blau, was sonst.
Der Herbst hatte sich eingeschlichen, hinterrücks. Tupfte kleine gelbe Markierungen in die Bäume. Es war inzwischen September geworden. Und wenn er am Samstag entlassen worden war, musste heut Dienstag sein. Das Datum hatte er während der letzten Tage verloren.
Neuendorf besaß neuerdings eine eigene Autobahnabfahrt – «neuerdings» hieß für Alexander immer noch: nach der Wende. Man kam direkt auf die Thälmannstraße (hieß immer noch so). Die Straße war glatt asphaltiert, rote Fahrradstreifen zu beiden Seiten. Frisch renovierte Häuser, wärmegedämmt nach irgendeiner EU-Norm. Neubauten, die aussahen wie Schwimmhallen: Stadtvillen nannte man das.
Aber man brauchte nur einmal links abzubiegen und ein paar hundert Meter dem krummen Steinweg zu folgen, dann noch einmal links – hier schien die Zeit stillzustehen: eine schmale Straße mit Linden. Kopfsteingepflasterte Bürgersteige, von Wurzeln verbeult. Morsche Zäune und Feuerwanzen. Tief in den Gärten, hinter hohem Gras, die toten Fenster von Villen, über deren Rückübertragung in fernen Anwaltskanzleien gestritten wurde.
Eins der wenigen Häuser hier, die noch bewohnt waren: Am Fuchsbau sieben. Moos auf dem Dach. Risse in der Fassade. Die Holunderbüsche berührten schon die Veranda. Und der Apfelbaum, den Kurt immer eigenhändig beschnitten hatte, wuchs kreuz und quer in den Himmel, ein einziges Gewirr.
Das «Essen auf Rädern» stand schon in der ISO-Verpackung auf dem Zaunpfeiler. Dienstag, fand er auf der Packung bestätigt. Alexander nahm die Packung und ging hinein.
Obwohl er einen Schlüssel hatte, klingelte er. Testen, ob Kurt aufmachte – sinnlos. Ohnehin wusste er, dass Kurt nicht aufmachen würde. Aber dann hörte er das vertraute Quietschen der Flurtür, und als er durch das Fensterchen schaute, erschien Kurt – wie ein Geist – im Halbdunkel des Vorraums.
– Mach auf, rief Alexander.
Kurt kam näher, glotzte.
– Mach auf!
Aber Kurt rührte sich nicht.
Alexander schloss auf, umarmte seinen Vater, obwohl ihm die Umarmung seit langem unangenehm war. Kurt roch. Es war der Geruch des Alters. Er saß tief in den Zellen. Kurt roch auch gewaschen und zähnegeputzt.
– Erkennst du mich, fragte Alexander.
– Ja, sagte Kurt.
Sein Mund war mit Pflaumenmus verschmiert, der Morgendienst hatte es wieder mal eilig gehabt. Seine Strickjacke war schief geknöpft, er trug nur einen Hausschuh.
Alexander machte Kurts Essen warm. Mikrowelle, Sicherung einschalten. Kurt stand interessiert daneben.
– Hast du Hunger, fragte Alexander.
– Ja, sagte Kurt.
– Du hast immer Hunger.
– Ja, sagte Kurt.
Es gab Gulasch mit Rotkohl (seit Kurt sich an einem Stück Rindfleisch einmal fast tödlich verschluckt hatte, wurde nur noch Kleinteiliges bestellt). Alexander brühte sich einen Kaffee. Dann nahm er Kurts Gulasch aus der Mikrowelle, stellte es auf die Igelit-Decke.
– Guten Appetit, sagte er.
– Ja, sagte Kurt.
Begann zu essen. Eine Weile war nur Kurts konzentriertes Schniefen zu hören. Alexander nippte an seinem noch viel zu heißen Kaffee. Sah zu, wie Kurt aß.
– Du hast die Gabel falsch herum, sagte er nach einer Weile.
Kurt hielt einen Augenblick inne, schien nachzudenken. Aß dann aber weiter: Versuchte, das Stück Gulasch mit dem Gabelstiel auf die Messerspitze zu schieben.
– Du hast die Gabel falsch herum, wiederholte Alexander.
Er sprach ohne Betonung, ohne mahnenden Unterton, um die Wirkung der reinen Begriffe auf Kurt zu testen. Keine Wirkung. Null. Was ging in diesem Kopf vor? In diesem immer noch durch einen Schädel von der Welt abgegrenzten Raum, der immer noch irgendeine Art Ich enthielt. Was fühlte, was dachte Kurt, wenn er im Zimmer umhertapste? Wenn er vormittags an seinem Schreibtisch saß und, wie die Pflegerinnen berichteten, stundenlang in die Zeitung starrte. Was dachte er? Dachte er überhaupt? Wie dachte man ohne Worte?
Kurt hatte endlich das Gulaschstück auf die Messerspitze geladen, balancierte es jetzt, schon zitternd vor Gier, zum Mund. Absturz. Zweiter Versuch.
Eigentlich ein Witz, dachte Alexander, dass Kurts Verfall ausgerechnet mit der Sprache begonnen hatte. Kurt, der Redner. Der große Erzähler. Wie er dagesessen hatte in seinem berühmten Sessel – Kurts Sessel! Wie alle an seinen Lippen hingen, wenn er seine Geschichtchen erzählte, der Herr Professor. Seine Anekdoten. Komisch aber auch: In Kurts Mund verwandelte sich alles in eine Anekdote. Egal, was Kurt erzählte – selbst wenn er davon erzählte, wie er im Lager beinahe krepiert wäre –, immer hatte es eine Pointe, immer hatte es Witz. Hatte gehabt. Fernste Vergangenheit. Der letzte Satz, den Kurt zusammenhängend hatte sagen können, war: Ich habe die Sprache verloren. Auch nicht schlecht. Verglichen mit seinem heutigen Repertoire eine Glanznummer. Doch das war zwei Jahre her: Ich habe die Sprache verloren. Und die Leute hatten wirklich gedacht, sieh mal an, er hat die Sprache verloren, aber sonst … Sonst schien er noch einigermaßen beisammen zu sein. Lächelte, nickte. Zog Grimassen, die irgendwie passten. Verstellte sich schlau. Nur hin und wieder unterlief ihm Sonderbares: dass er den Rotwein in seine Kaffeetasse goss. Oder auf einmal ratlos mit einem Korken dastand – und ihn schließlich ins Bücherregal steckte.
Miserable Quote: Ein Stückchen Gulasch hatte Kurt bisher geschafft. Jetzt griff er zu: mit den Fingern. Schaute schräg von unten zu Alexander herauf, wie ein Kind, das die Reaktion seiner Eltern prüft. Stopfte das Stück in den Mund. Und noch eins. Und kaute.
Und während er kaute, hielt er seine beschmierten Finger hoch wie zum Schwur.
– Wenn du wüsstest, sagte Alexander.
Kurt reagierte nicht. Hatte endlich eine Methode gefunden: die Lösung des Gulaschproblems. Stopfte, kaute. Die Soße rann in einer schmalen Spur über sein Kinn.
Ein dicker Soßetropfen bildete sich an Kurts Kinn. Alexander überkam der starke Drang, Kurt wehzutun: ein Stück Küchenkrepp abzureißen und ihm die Soße grob aus dem Gesicht zu wischen.
Der Tropfen zitterte, stürzte ab.
War es gestern gewesen? Oder heute? Irgendwann während dieser zwei Tage, als er auf dem Büffelledersofa lag (reglos und aus irgendeinem Grunde immer bemüht, nicht mit der bloßen Haut an das Leder zu kommen), irgendwann war ihm der Gedanke gekommen: Kurt umzubringen. Mehr als nur der Gedanke. Er hatte Varianten durchgespielt: Kurt mit dem Kissen ersticken oder – der perfekte Mord – Kurt ein zähes Rindersteak servieren. So wie das Steak, an dem er beinahe erstickt war. Und hätte Alexander ihn, als er schon blau anlief und auf die Straße taumelte und dort bewusstlos umfiel – hätte Alexander ihn damals nicht instinktiv in die stabile Seitenlage gedreht und wäre nicht infolgedessen, zusammen mit Kurts Gebiss, auch der beinahe kugelrunde, durch endloses Kauen zusammengepappte Fleischkloß aus Kurts Rachen gerollt, dann wäre Kurt vermutlich schon nicht mehr am Leben, und diese Niederlage (wenigstens diese) wäre Alexander erspart geblieben.
– Hast du bemerkt, dass ich eine Weile nicht da war?
Kurt war jetzt beim Rotkohl – seit einiger Zeit hatte er die infantile Angewohnheit angenommen, die Abteilungen nacheinander zu leeren: zuerst das Fleisch, dann das Gemüse, dann die Kartoffeln. Erstaunlicherweise hatte er jetzt die Gabel wieder in der Hand – sogar richtig herum. Schaufelte Rotkohl.
Alexander wiederholte seine Frage:
– Hast du bemerkt, dass ich eine Weile nicht hier war?
– Ja, sagte Kurt.
– Das hast du also bemerkt. Wie lange denn: eine Woche oder ein Jahr?
– Ja, sagte Kurt.
Oder sagte er: Jahr?
– Ein Jahr also, fragte Alexander.
– Ja, sagte Kurt.
Alexander lachte. Dabei kam es ihm tatsächlich vor wie ein Jahr. Wie ein anderes Leben – nachdem das Leben davor mit einem einzigen, mit einem banalen Satz beendet worden war:
– Ich schicke Sie mal in die Fröbelstraße.
So hieß der Satz.
– Fröbelstraße?
– Klinikum.
Erst draußen war er auf die Idee gekommen, die Schwester zu fragen: ob das heiße, dass er Schlafanzug und Zahnbürste mitnehmen solle. Und die Schwester war nochmal ins Sprechzimmer gegangen und hatte gefragt, ob das heiße, dass der Patient Schlafanzug und Zahnbürste mitnehmen solle. Und der Arzt hatte gesagt, der Patient solle Schlafanzug und Zahnbürste mitnehmen. Und das war’s.
Vier Wochen. Siebenundzwanzig Ärzte (er hatte nachgezählt). Moderne Medizin.
Der Assistenzarzt, der wie ein Abiturient aussah und ihm – in einem irrwitzigen Aufnahmesaal, wo hinter Paravents irgendwelche Schwerkranken stöhnten – die Grundsätze der Diagnostik erklärt hatte. Der Pferdeschwanz-Arzt, der gesagt hatte: Marathonläufer haben keine gefährlichen Krankheiten (sehr sympathischer Mann). Die Radiologin, die ihn gefragt hatte, ob er in seinem Alter etwa noch Kinder zeugen wolle. Der Chirurg mit dem Namen Fleischhauer. Und natürlich der pockennarbige Karajan: Oberarzt Dr. Koch.
Und noch zweiundzwanzig andere.
Und wahrscheinlich noch zwei Dutzend Laboranten, die das ihm abgezapfte Blut in Reagenzgläser gefüllt, seinen Urin durchleuchtet, sein Gewebe unter irgendwelchen Mikroskopen betrachtet oder in irgendwelche Zentrifugen gesteckt hatten. Und das alles mit dem erbärmlichen, mit dem geradezu unverschämten Ergebnis, das Dr. Koch in zwei Worte gefasst hatte:
– Nicht operabel.
Hatte Dr. Koch gesagt. Mit seiner knarzigen Stimme. Mit seinen Pockennarben. Seiner Karajan-Frisur. Nicht operabel, hatte er gesagt und sich auf seinem Drehstuhl hin und her gewiegt, und die Gläser seiner Brille hatten geblitzt im Rhythmus seiner Bewegung.
Kurt hatte jetzt auch das Rotkohlfach geleert. Machte sich an die Kartoffeln: trocken. Alexander wusste schon, was jetzt kam (falls er Kurt nicht sofort ein Glas Wasser hinstellte). Nämlich dass die trockenen Kartoffeln Kurt im Hals stecken blieben, dass er einen brüllenden Schluckauf bekam, sodass man glaubte, der Magen würde gleich mit herauskommen. Wahrscheinlich konnte man Kurt auch mit trockenen Kartoffeln ersticken.
Alexander stand auf und füllte ein Glas mit Wasser.
Kurt, komischerweise, war operabel: Kurt hatte man drei Viertel des Magens herausoperiert. Und er aß mit seinem Rest Magen, als hätte man ihm noch drei Viertel Magen dazugegeben. Egal, was es gab: Kurt aß immer den Teller leer. Er hatte auch früher immer den Teller leer gegessen, dachte Alexander. Egal, was Irina ihm vorgesetzt hatte. Er hatte es aufgegessen und gelobt – ausgezeichnet! Immer dasselbe Lob, immer dasselbe «Danke» und «Ausgezeichnet», und erst Jahre später, nach Irinas Tod, als es gelegentlich dazu kam, dass Alexander kochte – erst da hatte Alexander begriffen, wie zermürbend, wie demütigend dieses ewige «Danke!» und «Ausgezeichnet!» für seine Mutter gewesen sein mussten. Man konnte Kurt nichts vorwerfen. Tatsächlich hatte er nie etwas verlangt, noch nicht einmal von Irina. Wenn keiner kochte, ging er ins Restaurant oder aß eine Butterstulle. Und wenn jemand für ihn kochte, bedankte er sich artig. Dann machte er seinen Mittagsschlaf. Dann seinen Spaziergang. Dann erledigte er seine Post. Was war dagegen zu sagen? Nichts. Das war es ja gerade.
Kurt tupfte mit den Fingerspitzen die letzten Kartoffelkrümel auf. Alexander reichte ihm eine Serviette. Kurt wischte sich tatsächlich den Mund, faltete die Serviette wieder ordentlich zusammen und legte sie neben den Teller.
– Hör zu, Vater, sagte Alexander. Ich war im Krankenhaus.
Kurt schüttelte den Kopf. Alexander fasste ihn am Unterarm und versuchte es noch einmal mit Nachdruck.
– Ich – er zeigte auf sich – war im Kran-ken-haus! Verstehst du?
– Ja, sagte Kurt und stand auf.
– Ich bin noch nicht fertig, sagte Alexander.
Aber Kurt reagierte nicht. Tapste ins Schlafzimmer, noch immer mit nur einem Hausschuh, zog seine Hosen aus. Sah Alexander erwartungsvoll an.
– Mittagsschlaf?
– Ja, sagte Kurt.
– Na, dann wechseln wir mal die Windel.
Kurt tapste ins Bad, Alexander glaubte schon, dass er verstanden hätte, aber im Bad zog Kurt die Windelhose ein Stück herunter und pisste in hohem Bogen auf den Fußboden.
– Was machst du denn da!
Kurt sah erschrocken auf. Konnte aber nicht mehr aufhören zu pissen.
Nachdem Alexander seinen Vater geduscht, ins Bett gebracht und den Badfußboden gewischt hatte, war sein Kaffee kalt. Er schaute auf die Uhr: um zwei. Der Abenddienst würde frühestens um sieben kommen. Kurz überlegte er, ob er jetzt die siebenundzwanzigtausend Mark aus dem Wandsafe nehmen und einfach verschwinden sollte. Beschloss aber zu warten. Er wollte es vor den Augen seines Vaters tun. Wollte ihm die Sache erklären, auch wenn es sinnlos war. Wollte, dass Kurt Ja dazu sagte – auch wenn Ja das einzige Wort war, das er noch beherrschte.
Alexander ging mit seinem Kaffee ins Wohnzimmer. Was nun? Was anfangen mit der verlorenen Zeit? Wieder ärgerte er sich darüber, dass er sich Kurts Rhythmus unterworfen hatte, und der Ärger darüber verband sich unwillkürlich mit dem schon notorisch gewordenen Ärger über das Zimmer. Nur dass es ihm jetzt, nachdem er vier Wochen nicht hier gewesen war, noch schlimmer vorkam: blaue Gardinen, blaue Tapeten, alles blau. Weil Blau die Lieblingsfarbe seiner letzten Angebeteten gewesen war … Idiotisch, mit achtundsiebzig. Kaum dass Irina ein halbes Jahr unter der Erde gelegen hatte … Sogar die Servietten, die Kerzen: blau!
Ein Jahr lang hatten die beiden sich aufgeführt wie Pennäler. Hatten einander Herzchenpostkarten geschickt und ihre gegenseitigen Liebesgeschenke in blaues Papier eingewickelt, dann hatte die Angebetete wohl bemerkt, dass Kurt zu verblöden begann – und war verschwunden. Zurück blieb der blaue Sarg, so nannte es Alexander. Eine kalte blaue Welt, die nun von niemandem mehr bewohnt wurde.
Nur die Essecke war noch wie früher. Obwohl, auch das nicht … Kurt hatte zwar die Furniertapete nicht angerührt – Irinas Stolz: echte Furniertapete! Sogar das sogenannte Sammelsirium (Irina-Deutsch) war noch da – aber wie! Kurt hatte diese wildgewachsene Sammlung abstrusester Mitbringsel und Erinnerungsstücke, die die Furniertapete mit den Jahren überwuchert hatte, im Zuge seiner Renovierung komplett abgenommen, entstaubt, das «Wichtigste» (oder was Kurt dafür hielt) ausgewählt und in «lockerer Ordnung» (oder was Kurt dafür hielt) wieder an der Furniertapete platziert. Wobei er versucht hatte, schon vorhandene Nagellöcher «zweckmäßigerweise» zu nutzen. Kurts Kompromissästhetik. So sah es auch aus.
Wo war der kleine Krummdolch, den der Schauspieler Gojkovic – Häuptling aller DEFA-Indianerfilme, immerhin! – Irina einmal geschenkt hatte. Und wo war der Kuba-Teller, den die Genossen aus dem Karl-Marx-Werk Wilhelm zum neunzigsten Geburtstag überreicht hatten, und Wilhelm, so wurde erzählt, hatte die Brieftasche gezückt und einen Hunderter auf den Teller geknallt – weil er glaubte, er werde um eine Spende für die Volkssolidarität gebeten …
Egal. Gegenstände, dachte Alexander … Einfach bloß Gegenstände. Für den, der nach ihm kam, ohnehin bloß ein Haufen Sperrmüll.
Er ging hinüber in Kurts Arbeitszimmer, das auf der anderen (wie Alexander fand: schöneren) Seite lag.
Ganz im Gegensatz zum Wohnzimmer, wo Kurt alles umgekrempelt hatte – auch Irinas Möbel hatte er ausgetauscht, die schöne alte Vitrine gegen irgendein grässliches Möbel aus MDF-Platten; selbst Irinas wunderbares, zeitlebens wackliges Telefontischchen hatte Kurt abgeschafft; und, was Alexander ihm besonders übelgenommen hatte, sogar die Wanduhr: die freundliche alte Uhr, deren Mechanik zu jeder halben und vollen Stunde zu schnurren pflegte, zum Zeichen, dass sie noch immer ihren Dienst versah, obwohl das Gehäuse für den Gong fehlte, ursprünglich war es nämlich eine Standuhr gewesen, Irina hatte sie, einer Mode folgend, aus dem Kasten genommen und an die Wand gehängt, und Alexander konnte sich bis heute daran erinnern, wie Irina und er die Uhr geholt hatten und dass Irina es nicht fertiggebracht hatte, der alten Dame, die sich von der Uhr trennte, mitzuteilen, dass der Uhrkasten eigentlich überflüssig war; wie sie extra einen Nachbarn hatten bitten müssen, beim Verladen des kompletten Uhrkastens zu helfen, und wie der riesige Kasten, den sie nur zum Schein abtransportierten, aus dem Kofferraum des kleinen Trabbi herausgeragt hatte, sodass das Auto vorn fast die Bodenhaftung verlor – im Gegensatz zum totalrenovierten Wohnzimmer war in Kurts Zimmer noch alles, und zwar auf gespenstische Weise, beim Alten:
Der Schreibtisch stand schräg vor dem Fenster – vierzig Jahre lang war er nach jeder Renovierung wieder genau in die Druckstellen im Teppich gestellt worden. Ebenso die Sitzecke mit Kurts großem Sessel, in dem er mit krummem Rücken und gefalteten Händen gesessen und seine Anekdoten erzählt hatte. Und auch die große schwedische Wand (wieso eigentlich schwedische Wand?) stand wie eh und je. Die Bretter bogen sich unter der Last der Bücher; hier und da hatte Kurt ein zusätzliches, farblich nicht ganz passendes Brett eingezogen, aber die kosmische Ordnung war unverändert – eine Art letztes Back-up von Kurts Gehirn: Dort standen die Nachschlagewerke, die auch Alexander mitunter benutzt hatte (Aber zurückstellen!), dort die Bücher zur russischen Revolution, da in langer Reihe die rostbraunen Lenin-Bände, und links neben Lenin, in der letzten Abteilung, unter dem Ordner mit der strengen Aufschrift PERSÖNLICH, stand noch immer – Alexander hätte es blindlings herausgreifen können – das aufklappbare, ramponierte Schachbrett mit den Figuren, die irgendein namenloser Gulag-Häftling irgendwann einmal geschnitzt hatte.
Das Einzige, was – abgesehen von neuen Büchern – in vierzig Jahren hinzugekommen war, waren ein paar der ursprünglich zahlreichen Erinnerungsstücke, die die Großeltern aus Mexiko mitgebracht hatten; das meiste war nach ihrem Tod in einer überstürzten Aktion verschenkt und verscherbelt worden, und auch die wenigen Dinge, von denen sich Kurt merkwürdigerweise nicht hatte trennen wollen, hatten es nicht geschafft, ins «Sammelsirium» aufgenommen zu werden – angeblich aus Platzmangel, in Wirklichkeit aber, weil Irina ihren Hass auf alles, was aus dem Hause der Schwiegereltern kam, nie hatte überwinden können. Also hatte Kurt sie «provisorisch» in seine schwedische Wand eingefügt, und dort waren sie «provisorisch» geblieben, bis heute: Das ausgestopfte Haifischbaby, von dessen rauer Haut Alexander als Kind beeindruckt gewesen war, hatte Kurt mit Geschenkband an einer Regalsprosse aufgehängt; die furchteinflößende aztekische Maske lag noch immer mit dem Gesicht nach oben im Vitrinenfach mit den unzähligen kleinen Schnapsfläschchen; und die große, gewundene, rosafarbene Muschel, in die Wilhelm – keiner wusste, wie – eine Glühbirne eingebaut hatte, stand noch immer ohne Elektroanschluss auf einem der Unterschränke.
Wieder musste er an Markus denken: an seinen Sohn. Musste sich vorstellen, wie Markus hier umging, mit Kapuze und Kopfhörern in den Ohren – so hatte er ihn das letzte Mal, vor zwei Jahren, gesehen –, musste sich vorstellen, wie Markus vor Kurts Bücherwand stand und die Regalbretter mit den Stiefelspitzen anstupste; wie er die Dinge, die sich in vierzig Jahren hier angesammelt hatten, durch seine Hände gehen ließ und auf Gebrauchswert oder Verkäuflichkeit prüfte: Kaum jemand würde ihm den Lenin abkaufen; für das klappbare Schachbrett bekam er womöglich noch ein paar Mark. Einzig das ausgestopfte Haifischbaby und die große rosa Muschel würden ihn vermutlich interessieren, und er würde sie in seiner Bude aufstellen, ohne sich über ihre Herkunft Gedanken zu machen.
Für eine Sekunde tauchte der Gedanke auf, die Muschel mitzunehmen, um sie dort, wo sie herkam, ins Meer zu werfen – aber dann kam es ihm vor wie eine Szene aus einer Fernsehschmonzette, und er verwarf den Gedanken wieder.
Er setzte sich an den Schreibtisch und öffnete die linke Tür. Im mittleren Schubfach ganz hinten, in der uralten ORWO-Fotopapierschachtel, lag, versteckt unter Klebstofftuben, seit vierzig Jahren der Schlüssel zum Wandsafe – und er lag immer noch da (plötzlich hatte Alexander die blödsinnige Vorstellung angefallen, der Schlüssel könnte verschwunden sein und seine Pläne wären im Eimer).
Er steckte den Schlüssel vorsichtshalber ein – als ob ihn jetzt noch jemand wegnehmen könnte. Trank einen Schluck kalten Kaffee.
Seltsam, wie winzig Kurts Schreibtisch war. An diesem Tischlein hatte Kurt sein Werk verfasst. Hier hatte er gesessen, in einer medizinisch schwer bedenklichen Sitzhaltung, auf einem Stuhl, der eine ergonomische Katastrophe war, hatte seine Pfeifen geraucht, seinen sauren Filterkaffee getrunken und im Viereinhalb-Finger-System auf seiner Schreibmaschine herumgehämmert, tack-tack-tack-tack, Papa arbeitet! Sieben Seiten täglich, das war seine «Norm», aber es kam auch vor, dass er zum Mittagessen verkündete: Zwölf Seiten heute! Oder: Fünfzehn! Eine komplette Spalte seiner schwedischen Wand hatte er auf diese Weise zusammengehämmert, ein Meter mal drei Meter fünfzig, alles voll mit dem Zeug, «einer der produktivsten Historiker der DDR», hatte es geheißen, und selbst wenn man die Artikel aus den Zeitschriften, in die sie eingebunden waren, und die Beiträge aus den Sammelbänden herausnahm und sie – zusammen mit den zehn oder zwölf oder vierzehn Büchern, die Kurt verfasst hatte – in eine Reihe stellte, hatte sein Werk noch immer eine Gesamtregalbreite, die fast mit der des Lenin’schen Werks konkurrieren konnte: ein Meter Wissenschaft. Für diesen Meter Wissenschaft hatte Kurt dreißig Jahre geschuftet, dreißig Jahre lang die Familie terrorisiert. Für diesen Meter hatte Irina gekocht und Wäsche gewaschen. Für diesen Meter hatte Kurt Orden und Auszeichnungen, aber auch Rüffel und einmal sogar eine Rüge von der Partei erhalten, hatte mit den vom ewigen Papiermangel gebeutelten Verlagen um Auflagenhöhen gefeilscht, hatte einen Kleinkrieg um Formulierungen und Titel geführt, hatte aufgeben müssen oder hatte mit List und Zähigkeit Teilerfolge erzielt – und nun war alles, alles Makulatur.
So hatte Alexander gedacht. Wenigstens diesen Triumph hatte er nach der Wende geglaubt verbuchen zu können: Alles das, so hatte er geglaubt, habe sich nun erledigt. Diese angebliche Forschung, dieses ganze halbwahre und halbherzige Zeug, das Kurt da über die Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung zusammengehämmert hatte – das alles, so hatte Alexander geglaubt, würde mit der Wende hinweggespült, und nichts von Kurts sogenanntem Werk würde bleiben.
Aber dann hatte sich Kurt noch einmal auf seinen katastrophalen Stuhl gesetzt, mit schon fast achtzig, und hatte klammheimlich sein letztes Buch zusammengehämmert. Und obwohl dieses Buch kein Welterfolg geworden war – ja, zwanzig Jahre früher wäre ein Buch, in dem ein deutscher Kommunist seine Jahre im Gulag beschrieb, möglicherweise ein Welterfolg geworden (nur war Kurt zu feige gewesen, es zu schreiben!) –, aber auch wenn es kein Welterfolg geworden war, so war es doch, ob man wollte oder nicht, ein wichtiges, ein einzigartiges, ein «bleibendes» Buch – ein Buch, wie es Alexander nicht geschrieben hatte und nun wohl auch nicht mehr schreiben würde.
Wollte er das? Hatte er nicht immer davon geredet, dass er sich zum Theater hingezogen fühlte, gerade weil Theater etwas Vergängliches war? Vergänglich – klang gut. Solange man keinen Krebs hatte.
Die Mücken tanzten im Sonnenlicht, Kurt schlief noch immer – dabei hieß es doch, alte Leute schliefen nicht mehr so viel. Alexander beschloss, sich ebenfalls ein wenig hinzulegen.
Als er schon im Begriff war, das Zimmer zu verlassen, fiel sein Blick auf den Ordner mit der Aufschrift PERSÖNLICH, der ihn schon immer angezogen, den zu öffnen er aber nie gewagt hatte – obwohl er als Jugendlicher nicht einmal vor der erotischen Fotosammlung seines Vaters zurückgeschreckt war. Bis Kurt ein Sicherheitsschloss in die Schranktür einbauen ließ.
Er nahm den Ordner heraus: Zettel, Notizen. Kopien von Dokumenten. Obenauf mehrere Briefe, mit violetter Tinte geschrieben, wie es vor vielen Jahren in Russland üblich gewesen war:
«Liebste Ira!» (1954)
Alexander blätterte … Typisch Kurt. Selbst seine Liebesbriefe hatte er akkurat zweiseitig beschrieben, in gestochener Schrift, alle Seiten bis zum Letzten gefüllt, und zwar in gleichmäßigem Zeilenabstand, ohne dass die Zeilen am Ende eines Briefes auseinanderrückten oder sich drängten oder dass irgendwo der Rand einer Seite zusätzlich beschrieben war … Wie hatte der Kerl das gemacht? Und bei alldem die irritierend überschwänglichen Anreden, mit denen er Irina überschüttete:
«Liebe, liebste Irina!» (1959)
«Meine Sonne, mein Leben!» (1961)
«Meine geliebte Frau, mein Freund, meine Gefährtin!» (1973)
Alexander stellte den Ordner zurück und stieg die Treppen hinauf zu Irinas Zimmer. Er ließ sich auf das große, mit einer Art Teddybärfell bezogene Sofa fallen, versuchte ein bisschen zu schlafen. Stattdessen sah er wieder den pockennarbigen Karajan, der sich, wie aufgezogen, in seinem Drehsessel hin und her wiegte. Die Gläser seiner Brille blitzten, die Stimme wiederholte immer wieder denselben Satz … Schluss damit. Er musste an etwas anderes denken. Er hatte einen Entschluss gefasst, es gab nichts mehr zu denken, nichts zu beschließen.
Er öffnete die Augen. Betrachtete Irinas Kuscheltiere, die auf der Lehne saßen, ordentlich nebeneinander – so wie die Putzfrau sie aufgereiht hatte: der Hund, der Igel, der Hase mit seinem angekokelten Ohr …
Und was, wenn sie sich geirrt hatten?
Absurd, dachte er, dass Irina bis zum Schluss dein Zimmer gesagt hatte. Ihr schlaft oben in deinem Zimmer, der Satz klang ihm plötzlich im Ohr. Dabei konnte man sich wohl kaum ein Zimmer vorstellen, das mehr als dieses die perfekte, wenn auch späte Verwirklichung eines Mädchentraums darstellte: rosa Wände. Ein Rokokospiegel, beschädigt, aber echt. Am Fenster stand ein weiß angestrichener Sekretär, an dem Irina sich gern in nachdenklicher Pose hatte fotografieren lassen. Und die zerbrechlichen Vermutlich-auch-Rokoko-Stühlchen posierten so anmutig im Raum, dass man sich nicht daraufsetzen mochte.
Und tatsächlich, sobald er sich Irina hier vorzustellen versuchte, sah er sie auf dem Fußboden sitzen, bei ihren einsamen Orgien, wenn sie ihre krächzenden Wyssozki-Kassetten hörte und sich allmählich betrank.
Und dort das Telefon, noch der DDR-Apparat, der früher unten gestanden hatte. Noch derselbe Apparat, in den sie mit tonloser Stimme diese vier Worte gesprochen hatte:
– Saschenka. Du. Musst. Kommen.
Vier Worte aus dem Mund einer russischen Mutter, deren ganzer Stolz es gewesen war, ihren Sohn niemals im Leben um irgendetwas gebeten zu haben:
– Saschenka. Du. Musst. Kommen.
Und nach jedem Wort ein langes, atmosphärisches Knistern, sodass man versucht war aufzulegen, weil man glaubte, die Leitung sei unterbrochen.
Und er? Was hatte er gesagt?
– Ich komme, wenn du aufgehört hast zu trinken.
Er stand auf, ging zu dem weiß angestrichenen Sekretär, in dessen unübersichtlichen Geheimfächern sie nach Irinas Tod ihre Alkoholvorräte gefunden hatten. Öffnete ihn, begann wie ein Süchtiger ihn zu durchsuchen. Ließ sich wieder aufs Sofa fallen. Es gab hier keinen Alkohol mehr.
Oder hatte er «saufen» gesagt? Ich komme, wenn du aufgehört hast zu saufen?
Vierzehn Tage später war er zum Beerdigungsinstitut gefahren, um seine Mutter wieder zum Leben zu erwecken … Nein, er war hingefahren, weil es noch irgendwelche Formalitäten zu erledigen gab. Aber dann, schon auf der Straße, hatte ihn die fixe Idee überkommen, er könnte seine Mutter wiedererwecken, wenn er nur zu ihr sprach. Und nachdem er zweimal um den Block marschiert war und sich die Sache auszureden versucht hatte, war er schließlich hineingegangen und hatte seine Mutter zu sehen verlangt und hatte sich auch nicht davon abbringen lassen, als man ihm fachkundig riet, sie doch lieber so in Erinnerung zu behalten, wie sie «im Leben» gewesen war.
Dann hatte man sie hereingerollt. Ein Vorhang ging zu. Er stand neben einer nachlässig zurechtgemachten Leiche, die, zugegeben, seiner Mutter nicht unähnlich sah (abgesehen von dem zu kleinen Gesicht und den ziehharmonikaartigen Fältchen auf der Oberlippe), stand neben ihr und wagte nicht, sie anzusprechen vor den beiden Mitarbeitern des Beerdigungsinstituts, die hinter dem Vorhang lauerten, so dicht, dass man ihre Schuhe am unteren Rand des Vorhangs sah. Nur um überhaupt etwas versucht zu haben, berührte er ihre Hand – und stellte fest, dass sie kalt war: kalt wie ein Stück Huhn, das man aus dem Kühlschrank nimmt.
Nein, sie hatten sich nicht geirrt. Es gab ein Röntgenbild. Es gab ein CT. Es gab Laborwerte. Es war klar: Non-Hodgkin-Lymphom, langsam wachsender Typ. Gegen das es – wie taktvoll ausgedrückt! – bis heute keine wirksame Therapie gebe.
– Und was heißt das, in Jahren ausgedrückt?
Und dann drehte sich dieser Mensch eine Ewigkeit auf seinem Stuhl hin und her, mit einem Gesicht, als sei es eine Zumutung, eine solche Frage beantworten zu müssen, und sagte:
– Eine Prognose werden Sie von mir nicht hören.
Und seine Stimme schnarrte – wie der Sauerstoffapparat des alten Mannes in seinem Zimmer.
Zeitmaße. Zwölf Jahre: die Wende. Unerreichbare Zeit. Trotzdem versuchte er nachzuspüren: Was wogen zwölf Jahre?
Klar, dass die zwölf Jahre vor der Wende ihm unverhältnismäßig länger erschienen als die zwölf Jahre danach. 1977 – das war eine Ewigkeit! 1989 dagegen – ein Rutsch, eine Straßenbahnfahrt. Dabei war doch einiges passiert, oder?
Er war abgehauen und wieder zurückgekehrt (wenn auch das Land, in das er zurückkehrte, verschwunden war). Er hatte einen ordentlich bezahlten Job bei einem Kampfkunst-Magazin angenommen (und wieder gekündigt). Hatte Schulden gemacht (und wieder zurückgezahlt). Hatte ein Filmprojekt angezettelt (vergiss es).
Irina war gestorben: sechs Jahre.
Er hatte zehn oder zwölf oder fünfzehn Theaterstücke inszeniert (an immer unbedeutenderen Theatern). War in Spanien, Italien, Holland, Amerika, Schweden, Ägypten gewesen (aber nicht in Mexiko). Hatte eine unbestimmte Anzahl Frauen gevögelt (deren Namen er nicht mehr zusammenbrachte). Hatte sich – nach einer Zeit des Umherstreunens – wieder auf so etwas wie eine feste Beziehung eingelassen …
Marion kennengelernt: drei Jahre.
Kam ihm aber jetzt gar nicht so kurz vor.
Ihm fiel ein, dass er ihr hatte Bescheid sagen wollen. Immerhin war sie die Einzige, die ihn besucht hatte – obwohl er sich auch ihren Besuch ausdrücklich verbeten hatte. Allerdings musste er zugeben, dass es dann gar nicht so schlimm gewesen war. Nein, sie war nicht, wie er befürchtet hatte, übertrieben fürsorglich gewesen. Hatte ihn nicht mit irgendwelchen Sprüchen aufzuheitern versucht. Hatte ihm keine Blumen mitgebracht. Sondern Tomatensalat. Woher wusste sie, worauf er gerade Appetit hatte? Woher wusste sie, dass er geradezu panische Angst davor gehabt hatte, im Krankenhaus Blumen geschenkt zu bekommen?
Anders gefragt: Warum war er eigentlich nicht imstande, Marion zu lieben? War sie zu alt? So alt wie er selbst. Lag es an den zwei oder drei blauen Äderchen, die an ihren Oberschenkeln durchschimmerten? Lag es an ihm?
«Liebste, allerliebste Irina! … Meine Sonne, mein Leben!»
Nie hatte er einer Frau je so geschrieben. War das altmodisch? Oder hatte Kurt Irina geliebt? Hatte dieser alte, pedantische Hund, hatte diese Maschine Kurt Umnitzer es fertiggebracht zu lieben?
Bei diesem Verdacht wurde Alexander so übel, dass er aufstehen musste.
Es war kurz nach halb drei, als er die Treppe hinabstieg. Kurt schlief noch. Marion, wusste er, war in der Gärtnerei: zu früh, um sie anzurufen. Stattdessen rief er die Auskunft an. Eigentlich hatte er direkt zum Flughafen fahren wollen. Aber jetzt rief er an, ließ sich gleich von der Auskunft verbinden, wurde weiterverbunden, landete schließlich an der richtigen Stelle und zögerte doch, als sich herausstellte, dass die Buchung eines Fluges ohne weiteres für morgen möglich war. Vorausgesetzt, er besaß eine Kreditkarte.
Besaß er.
– Also, soll ich nun buchen oder nicht, fragte die Dame am anderen Ende, nicht unhöflich, aber doch in einem Ton, der ausdrückte, dass sie sich nicht ewig mit dieser Lappalie aufhalten wollte.
– Ja, sagte er und gab seine Kreditkartennummer durch.
Als er den Hörer auflegte, war es 14:46 Uhr. Er blieb einen Augenblick im Halbdunkeln stehen, wartete darauf, dass ein Gefühl hinterherkam – kam aber nicht. Nur die Melodie fiel ihm ein – von Oma Charlottes uralter Schellackplatte, die ihm beim Umzug auf den Gehweg gefallen und in tausend Stücke zersprungen war:
Mexico lindo y querido
si muero lejos de ti …
Die «Goldene Gräte». Wie ging es weiter? Wusste er nicht mehr. Ob man so was in Mexiko noch bekam? Nach einem halben Jahrhundert?
Er ging in den «blauen Sarg», sammelte seine Kaffeetasse ein, brachte sie in die Küche. Blieb kurz am Küchenfenster stehen, warf einen Blick in den Garten. Suchte, als sei er ihr wenigstens diese Sekunde des Andenkens schuldig, im hohen, goldenen Gras die Stelle, wo Baba Nadja einst stundenlang in gebückter Haltung gestanden und ihre Gurkenbeete besorgt hatte … Sah aber nichts. Baba Nadja blieb spurlos verschwunden.
Er holte den Werkzeugkasten aus der Kammer und ging in Kurts Zimmer.
Zuerst nahm er das alte Schachbrett heraus, das links neben Lenin stand, klappte es auf. Öffnete den Ordner mit der Aufschrift PERSÖNLICH. Griff einen Packen Papiere, gerade so viel, wie in das aufklappbare Schachbrett passte. Legte ihn hinein. Holte eine große weiße Plastiktüte aus der Küche. Steckte das Schachbrett hinein. Ganz automatisch. Ruhig, sicher, als hätte er das lange geplant.
Das Geld, dachte er, würde er nachher auch in die Tüte stecken.
Dann wühlte er den breiten, oft schon missbrauchten Stechbeitel aus dem Werkzeugkasten, schlug ihn in den Türspalt des mit dem Sicherheitsschloss versperrten Unterschranks. Es krachte, Holz splitterte ab. Schwieriger als gedacht. Er musste sämtliche Schubfächer aus der anderen Hälfte des Unterschranks ziehen, bis die Zwischenwand so weit nachgab, dass die Tür aufsprang: Fotos. Ein erotisches Kartenspiel. Videos. Ein paar einschlägige Magazine … Und da war sie, er hatte sich nicht geirrt: die lange rote Plastikschachtel mit Dias. Nur ein einziges Mal hatte er die Schachtel geöffnet, hatte das erstbeste Dia gegen das Licht gehalten, seine Mutter erkannt, halb nackt, in eindeutiger Pose – und das Dia eilends zurück in die Schachtel gesteckt.
Er holte den Wäschekorb aus dem Bad und packte alles hinein.
Der einzige Ofen, der in der Wohnung verblieben war, stand im großen Zimmer. Er war jahrelang nicht mehr geheizt worden. Alexander holte Zeitungspapier, zwei hölzerne Buchstützen aus Kurts schwedischer Wand, es waren die Eulen, und das Bratöl aus der Küche. Tränkte das Zeitungspapier darin. Zündete das Ganze an …
Plötzlich stand Kurt in der Tür. Freundlich, ausgeschlafen. Die dünnen Beinchen ragten aus seinen Windelhosen heraus. Seine Haare standen kreuz und quer wie die Äste des Apfelbaums draußen. Neugierig tapste Kurt näher.
– Ich verbrenne deine Fotos, sagte Alexander.
– Ja, sagte Kurt.
– Hör zu, Vater, ich werde wegfahren. Verstehst du? Ich fahre weg, und ich weiß noch nicht, für wie lange. Verstehst du?
– Ja, sagte Kurt.
– Deswegen verbrenne ich das. Damit es niemand hier findet.
Kurt schien nichts ungewöhnlich zu finden. Er hockte sich zu Alexander neben den Korb, schaute hinein. Das Feuer kam jetzt in Gang, und Alexander begann, die Spielkarten einzeln hineinzuwerfen. Dann die Fotos, die Magazine … Die Videos, dachte er, würde er nachher in die Mülltonne werfen, aber die Dias mussten verbrannt werden. Nur, wo war die Schachtel?
Er sah auf: Kurt hielt die Schachtel in den Händen. Reichte sie ihm.
– Und? Was soll ich damit, fragte Alexander.
– Ja, sagte Kurt.
– Weißt du, was das ist, fragte Alexander.
Kurt überlegte angestrengt, rieb sich die Schläfe, wie früher, wenn er nach Worten gesucht hatte. Als würde er durch die Reibung elektrische Energie in seinem Gehirn erzeugen wollen, einen letzten Impuls.
Dann sagte er plötzlich:
– Irina.
Alexander sah Kurt an, sah ihm in die Augen. Er hatte blaue Augen. Hellblau. Und jung. Viel zu jung für das zerfurchte Gesicht.
Er nahm ihm die Schachtel ab, klopfte die Dias heraus. Warf sie, jeweils eine Handvoll, ins Feuer. Sie verbrannten geräuschlos und rasch.
Er zog Kurt an, kämmte ihn, rasierte noch rasch die Stellen nach, wo die Pflegerin Stoppeln gelassen hatte. Dann machte er Kaffee (für Kurt, aus der Kaffeemaschine). Fragte nicht erst, ob Kurt Kaffee trinken wollte. Dann war der Spaziergang dran, Kurt rannte schon zur Tür wie ein Hund, der die Regeln kennt und sein Recht fordert.
Sie gingen Kurts Runde: zur Post, wie es früher hieß, obwohl der Weg zur Post nur ein Bruchteil von Kurts täglicher Strecke war; dennoch hatte Kurt sich stets mit den Worten Ich geh mal zur Post zu seinem Spaziergang abgemeldet – und auch als er längst nichts mehr zur Post zu bringen hatte, fuhr er fort, zur Post zu gehen, und dieser Kurt’schen Pedanterie, immerhin, verdankten sich die siebenundzwanzigtausend Mark im Wandsafe. Denn eine Zeitlang hatte Kurt noch seine Geheimzahl gekannt und war in der Lage gewesen, Geld aus dem Automaten zu ziehen, und da er sonst nichts auf der Post zu erledigen hatte, zog er eben Geld. Immer tausendmarkweise. Einmal hatte er achttausend Mark in der Brieftasche gehabt. Alexander hatte das Geld genommen und in den Safe gelegt. Und so war er der Einzige, der von dem Geld wusste.
Sie gingen den Fuchsbau entlang, vorbei an den Nachbarhäusern, deren Bewohner Alexander einmal alle persönlich gekannt hatte: Hier hatte Horst Mählich gewohnt, der Wilhelm zeitlebens für einen sowjetischen Meisterspion gehalten und bis zum Schluss zu den Verfechtern der Theorie von Wilhelms Ermordung gehört hatte; dort war das Haus von Stasi-Bunke, der nach der Wende noch ein paar Jahre im Garten Gemüse gezüchtet und immer freundlich über den Zaun gegrüßt hatte, bevor er geräuschlos verschwand; dort hatte Sportlehrer Schröter gewohnt; dort der aus dem Westen gekommene Arzt; und da, schließlich, am Ende der Straße, war das Haus seiner Großeltern. Es war bereits «rückübertragen». Jetzt wurde es von den Enkeln des ehemaligen Besitzers bewohnt, eines mittleren Nazis, der mit der Fabrikation von Scherenfernrohren für die Wehrmacht reich geworden war. Die Erben hatten das Haus renoviert und neu angestrichen. Die prächtige Natursteinterrasse, die Wilhelm durch übermäßiges Betonieren zum Einsturz gebracht hatte, war wieder instand gesetzt. Und der neu verglaste und mit allerlei Fensterschmuck ausgestattete Wintergarten sah so fremd aus, dass es Alexander schwerfiel zu glauben, dass er wirklich mit seiner Großmutter Charlotte dort gesessen und ihren mexikanischen Geschichten gelauscht hatte.
Dann bogen sie in den Steinweg ein, Kurt schniefend, nach vorn gebeugt, aber Schritt haltend. Hier, auf dem glatten Asphalt, waren sie früher Rollschuh gelaufen und hatten mit Kreide auf der Straße gemalt. Dort war der Fleischer gewesen, wo Irina blindlings die schon im Hinterzimmer gepackten Pakete gekauft hatte. Dort die «Volksbuchhandlung», jetzt Reisebüro. Und dort der Konsum, Betonung auf der ersten Silbe (und tatsächlich hatte es mit Konsum wenig zu tun), wo es vor sehr langer Zeit – Alexander konnte sich gerade noch daran erinnern – Milch auf Marken gegeben hatte.
Und da war die Post.
– Die Post, sagte Alexander.
– Ja, sagte Kurt.
Dann sagten sie nichts mehr.
Sie stiegen den Hügel zum alten Wasserturm hoch. Von hier aus hatte man einen schönen Blick auf die Havel. Sie setzten sich auf die Bank und schauten lange in den allmählich sich rötenden Himmel.
1952
Über Neujahr waren sie ein paar Tage an der Pazifikküste gewesen. Ein Kaffeelaster brachte sie von dem kleinen Flugplatz nach Puerto Ángel. Ein Bekannter hatte den Ort empfohlen: romantisches Dorf, malerische Bucht mit Felsen und Fischerbooten.
Tatsächlich war die Bucht malerisch. Abgesehen von der betonierten Kaffeeverladerampe.
Der Ort selbst: zwanzig oder fünfundzwanzig Häuschen, eine verschlafene Poststelle und ein Kiosk, an dem es alkoholische Getränke gab.
Das einzige zu mietende Objekt war eine winzige, immerhin mit Ziegeln gedeckte Hütte (die die spanischstämmige Vermieterin «Bungalow» nannte). Darin stand, unter einem von der Decke herabhängenden Moskitonetz (das die Vermieterin «Pavillon» nannte), ein Eisenbett. Daneben zwei Nachttischchen. An ein paar hier und da in die Pfosten eingeschlagenen Nägeln hingen Kleiderbügel.
Vor dem «Bungalow» gab es eine überdachte Terrasse mit zwei wackligen Liegestühlen und einem Tisch.
– Ach, wie schön, sagte Charlotte.
Sie ignorierte die Fledermäuse, die kopfüber unter dem Dachvorsprung hingen, also im Grunde mitten im Zimmer, da, wie hier üblich, zwischen Wand und Dach ein handbreiter Spalt klaffte. Sie übersah das große, scheckige Schwein, das durch den Garten streunte und rings um den Verschlag, den die Vermieterin Bad nannte, die Erde aufwühlte.
– Ach, wie schön, sagte sie. Hier werden wir uns erholen.
Wilhelm nickte und ließ sich erschöpft im Liegestuhl nieder. Seine Hosenbeine rutschten hoch und gaben ein Stück seiner dürren, blassen Waden frei. Ohnehin mager, hatte er in den letzten Wochen noch einmal fünf Kilo abgenommen. Seine eckigen Gliedmaßen sahen aus wie der Liegestuhl, in dem er saß.
– Wir machen ein paar schöne Ausflüge in die Umgebung, versprach Charlotte.
Allerdings stellte sich heraus, dass es so gut wie keine «Umgebung» gab.
Einmal fuhren sie – mit einem Kaffeelaster – ins nahegelegene Pochutla und besuchten den chinesischen Kolonialwarenladen. Wilhelm stakste abwesend durch das über und über vollgestopfte Geschäft und blieb vor einer großen, polierten Schneckenmuschel stehen.
– Fünfundzwanzig Pesos, sagte der Chinese.
Das war allerhand.
– So eine wolltest du doch, sagte Charlotte.
Wilhelm zuckte mit den Schultern.
– Wir kaufen sie, sagte Charlotte.
Sie bezahlte, ohne über den Preis zu verhandeln.
Ein anderes Mal gingen sie zu Fuß bis Mazunte. Die Strände waren mehr oder weniger alle gleich, mit dem Unterschied, dass der Strand in Mazunte von dunklen Flecken übersät war. Den Grund dafür erkannten sie bald, nämlich als sie sahen, wie die Fischer eine gewaltige Wasserschildkröte bei lebendigem Leibe aus ihrem Panzer lösten.
Nach Mazunte gingen sie nicht wieder. Auch aßen sie keine Schildkrötensuppe mehr.
Dann war endlich Silvester. Die Männer des Dorfes hatten tagelang und unter großem Geschrei Kaffee verladen. Jetzt hatte man ihnen ihren Lohn ausgezahlt. Gegen drei Uhr waren alle betrunken und gegen sechs bewusstlos. Es wurde still im Dorf. Nichts rührte sich, niemand war zu sehen. Wie jeden Abend hatten Charlotte und Wilhelm sich ein kleines Feuer gemacht, von dem Holz, das der mozo ihnen für ein paar Pesos sammelte.
Es wurde früh dunkel, die Abende waren lang.
Wilhelm rauchte.
Das Feuer knisterte.
Charlotte tat so, als interessiere sie sich für die Fledermäuse, die lautlos wie Sternschnuppen im Schein des Feuers vorbeihuschten.
Um zwölf Uhr tranken sie Champagner aus Wassergläsern, und jeder aß seine Weinbeeren auf: ein hiesiger Brauch, zum Jahreswechsel zwölf Weinbeeren zu essen. Zwölf Wünsche – einer für jeden Monat.
Wilhelm aß alle Beeren auf einmal.
Charlotte wünschte sich zuallererst, dass Werner am Leben sei. Dafür verbrauchte sie gleich drei Beeren. Kurt lebte, von ihm hatte sie inzwischen Post. Er war, aus Gründen, die er im Brief nicht erwähnte, irgendwo im Ural gelandet, inzwischen verheiratet dort. Nur von Werner – nichts. Trotz der Bemühungen Dretzkys. Trotz der Suchanfrage beim Roten Kreuz. Trotz der Anträge, die sie beim sowjetischen Konsulat gestellt hatte – den ersten schon vor sechs Jahren:
– Bewahren Sie Ruhe, Bürgerin. Alles geht seinen Gang.
– Genosse, ich bin Mitglied der Kommunistischen Partei, und das Einzige, worum ich bitte, ist zu erfahren, ob mein Sohn lebt.
– Dass Sie Mitglied der Kommunistischen Partei sind, heißt nicht, dass Sie Sonderrechte genießen.
Das Schweinsgesicht. Erschießen sollen sie dich. Da hatte sie die Beere zerbissen.
Dann schon lieber Ewert und Radovan: je eine Beere.
Eine Beere, um die Strafe in Typhus umzuwandeln. In heilbaren Typhus. Eine, um die Typhusepidemie auf Ewerts Frau Inge auszudehnen, die neuerdings Chefredakteur war.
Auf einmal waren es nur noch drei Beeren. Jetzt hieß es haushalten.
Die zehnte: Gesundheit für all ihre Freunde – wer war das?
Die elfte: für alle Verschollenen. Wie jedes Jahr.
Und die zwölfte Beere … zerbiss sie einfach. Ohne sich etwas zu wünschen. Plötzlich war es geschehen.
Im Übrigen war es zwecklos. Fünf Mal schon hatte sie sich gewünscht, dass sie im kommenden Jahr nach Deutschland zurückkehrten. Genützt hatte es nichts, sie saßen immer noch hier.
Sie saßen hier – während drüben, im neuen Staat, die Posten verteilt wurden.
Zwei Tage später flogen sie zurück nach Mexiko-Stadt. Am Mittwoch war Redaktionssitzung, wie immer. Wilhelm war zwar aus der Leitung der Gruppe abgewählt, hatte aber seine bisherigen Funktionen bei der Demokratischen Post behalten: Er machte die Abrechnung, verwaltete die Kasse, half beim Umbruch und bei der Verteilung der auf ein paar hundert Exemplare geschrumpften Auflage.
Aber auch Charlotte fühlte sich zur Teilnahme verpflichtet. Die Redaktionssitzung war einmal die Woche, und man wusste nicht recht, ob sie nicht gleichzeitig auch Parteiversammlung war. Je kleiner die Gruppe wurde, desto mehr vermischte sich alles: Parteizelle, Redaktionskomitee, Geschäftsführung.
Sieben waren noch übrig. Drei davon waren die «Leitung». Das heißt: zwei – seit Wilhelm abgewählt worden war.
Charlotte hatte Mühe, die Sitzung durchzuhalten, saß gekrümmt am Ende des Tisches und war kaum in der Lage, Radovan in die Augen zu schauen. Inge Ewert redete dummes Zeug, kannte nicht mal die Breite des Satzspiegels, verwechselte Kolumne und Signatur, aber Charlotte unterdrückte jeden Impuls, sich einzumischen oder einen Vorschlag zu machen, und in dem Artikel, den man ihr zum Korrekturlesen gab, übersah sie absichtlich Druckfehler, damit die Genossen in Berlin auch wahrnahmen, auf welches Niveau die Zeitschrift gesunken war, seit man sie als Chefredakteur abgelöst hatte.
Wegen «Verstoßes gegen die Parteidisziplin». Sodass Charlotte keinen anderen Weg gesehen hatte, als ihrerseits einen Bericht an Dretzky zu schicken. Ihr «Verstoß gegen die Parteidisziplin» hatte nämlich hauptsächlich darin bestanden, dass sie am 8. März, am Frauentag, eine Würdigung des neuen Gleichberechtigungsgesetzes der DDR gebracht hatte, obwohl der Vorschlag mehrheitlich als «uninteressant» abgelehnt worden war. Das war der eigentliche Skandal.
Sie fügte hinzu, dass Ewert in der Friedensfrage eine «defätistische Haltung» einnahm und dass Radovan in der für die politische Arbeit in Mexiko besonders sensiblen Judenfrage (die Demokratische Post hatte noch immer viele bürgerliche, jüdische Leser) gegen die Linie verstieß, die Dretzky, als er noch in Mexiko war, begründet hatte.
Das war unfair, sie wusste es. Aber war es fair, ihr einen «Verstoß gegen die Parteidisziplin» vorzuwerfen?
– Kannst du bis Anfang Februar etwas für die Kulturseite liefern?
Radovans Stimme.
– Eineinhalb Normseiten, regionaler Bezug.
Charlotte nickte und kritzelte etwas in ihren Kalender. Hieß das, sie war für den politischen Teil nicht mehr zuverlässig genug?
Abends badete sie – fast schon eine Gewohnheit am Tag der Redaktionssitzung.
Am Donnerstag und am Freitag gab sie Nachhilfeunterricht, Englisch und Französisch, jeweils drei Stunden (und verdiente an zwei Tagen mehr als Wilhelm in einer Woche bei der Demokratischen Post).
In der übrigen Zeit, bevor Wilhelm nach Hause kam, baumelte sie auf dem Dachgarten in der Hängematte, ließ sich vom Hausmädchen Nüsse und Mangosaft bringen und schmökerte in Büchern über präkolumbianische Geschichte: wegen des Artikels für die Kulturseite, so hieß die Ausrede, die ihr niemand abverlangte.
Am Wochenende las Wilhelm, wie stets, das Neue Deutschland, das immer im Packen und mit vierzehntägiger Verspätung aus Deutschland kam. Da er weder Spanisch noch Englisch konnte, war das NDsein einziger Lesestoff. Er las jede Zeile und war, mit Ausnahme von zweimal einer halben Stunde, die er mit dem Hund spazieren ging, bis zum späten Abend beschäftigt.
Charlotte kümmerte sich um den Haushalt: Sie besprach mit Gloria, dem Hausmädchen, den Speiseplan für die kommende Woche, sah Rechnungen durch und goss ihre Blumen. Seit langem züchtete sie auf der Dachterrasse eine Königin der Nacht. Sie hatte sie vor Jahren gekauft, in der zwiespältigen Hoffnung, dass sie nie sehen würde, wie sie blühte.
Am Montag rannte Wilhelm gleich früh in die Druckerei, und Charlotte rief Adrian an und verabredete sich mit ihm gegen Mittag.
Schon lange hatte Adrian ihr die Kolossalstatue der Coatlicue zeigen wollen. Er hatte ihr oft von der aztekischen Erdgöttin erzählt, und sie kannte bereits ein Foto: eine grausige Figur. Ihr Gesicht war auf merkwürdige Weise aus zwei im Profil zu sehenden Schlangenköpfen zusammengesetzt, sodass je ein Auge und zwei Zähne einer der Schlangen gehörten. Aus ihrem Schoß schaute der totenschädelartige Kopf ihres Sohnes Huitzilopochtli hervor. Um den Hals trug sie eine Kette aus abgehauenen Händen und herausgerissenen Herzen: Symbol der Opferriten der alten Azteken.
Man habe sie vor mehr als hundertfünfzig Jahren unter dem Pflaster des Zócalo gefunden, sagte Adrian, während er an seinem Kaffee nippte und Charlotte ansah wie vor einer Prüfung.
Sie war zum ersten Mal in der Universität. Alles, selbst die Kaffeetassen in Adrians Büro, erschienen ihr heilig. Und Adrian selbst schien ihr noch imposanter, seine Stirn vergeistigt, seine Hände noch feiner als sonst.
– 1790 hat man sie ausgegraben und in die Universität gebracht, sagte Adrian. Aber der damalige Rektor entschied, sie wieder am Zócalo vergraben zu lassen. Drei Mal hat man sie wieder vergraben – so unerträglich fand man ihr Antlitz. Und auch danach stand sie noch jahrzehntelang hinter einer Leinwand und wurde Besuchern nur als eine Art Abstrusum gezeigt.
Sie folgte Adrian durch ein Labyrinth von Gängen und Treppen, dann standen sie im Innenhof, Adrian drehte Charlotte sanft um – und sie sah auf die Füße von Coatlicue. Sie hatte eine mannshohe Statue erwartet. Vorsichtig wanderte ihr Blick hinauf bis in vier Meter Höhe. Sie schloss die Augen, wandte sich ab.
– Ihre Schönheit, sagte Adrian, besteht darin, dass das Grauen in der ästhetischen Form gebannt ist.
Im Januar schrieb sie zwei Normseiten über die Dialektik des Schönheitsbegriffs in der Kunst des aztekischen Volkes.
Im Februar wurde ihr Artikel vom gesamten Redaktionskomitee einschließlich Wilhelms als zu theoretisch abgelehnt.
Im März begann es völlig unplanmäßig zu regnen, und Adrian machte ihr einen Heiratsantrag.
Sie hatte nichts mit Adrian. Allerdings hatte sie auch nichts mit Wilhelm, der seit seiner Abwahl aus der Parteileitung sexuell inaktiv war.
Sie saßen auf den Treppenstufen der Sonnenpyramide von Teotihuacán, wohin sie, nicht zum ersten Mal, mit Adrian gefahren war. Charlotte blickte über die tote Stadt hinweg auf die weite, hüglige Landschaft, die sich Tal von Mexiko nannte, obwohl sie in Wirklichkeit zweitausend Meter hoch lag, und glaubte plötzlich, dass sie in der Lage sei, den ganzen Dreck hinzuschmeißen.
Stattdessen: einmal im Leben die Königin der Nacht blühen sehen.
Aber als sie an diesem Abend nach Hause kam und Wilhelm neben dem Hund auf dem Fußboden sitzen sah, wusste sie, dass es unmöglich war.
Und davon abgesehen: Würde sie je ihre Söhne wiedersehen, wenn sie in Mexiko blieb?
Und davon abgesehen: Hatte sie wirklich vor, den Rest ihres Lebens Kinder reicher Leute zu unterrichten? Oder die Hausangestellten eines verwitweten Universitätsprofessors zu kommandieren?
Und davon abgesehen: mit neunundvierzig!
Im April kam ein Brief von Dretzky, komischerweise datiert auf den ersten April. Wie sie dem Briefkopf entnahm, war Dretzky inzwischen Staatssekretär im Bildungsministerium. Er ging mit keiner Silbe auf Charlottes Bericht ein. Vielmehr teilte er mit, dass zwei Einreisevisa im sowjetischen Konsulat für sie bereitlägen, und bat sie, umgehend die Rückreise anzutreten, um für ihre neuen Aufgaben zur Verfügung zu stehen: Charlotte sollte als Direktorin das Institut für Literatur und Sprachen an der demnächst zu gründenden Akademie für Staats- und Rechtswissenschaft übernehmen, und Wilhelm, welcher, wie Dretzky schrieb, als sogenannter Westemigrant nicht, wie es sein Wunsch gewesen wäre, in den neuen Geheimdienst übernommen werden durfte – Wilhelm sollte Verwaltungsdirektor der Akademie werden.
An diesem Abend gingen sie durch den Almeda-Park, ließen sich im Strom der Menschen treiben. Von fern tönte eine Mariachi-Kapelle herüber, und sie aßen Tortillas mit Kürbisblüten wie früher.
Aber es war nicht wie früher.
Drei berittene Polizisten bewegten sich langsam, wie in Zeitlupe, durch die Menge. Alle hatten große, schwere Sombreros auf, so groß und schwer, dass sie sie eher balancierten als trugen, was den drei Reitern ein würdiges und zugleich lächerliches Aussehen gab. Die Repräsentanten der Staatsmacht, die ihnen vor zwölf Jahren das Leben gerettet hatte … Abwegige Idee: dass alles bloß ein Aprilscherz war. Aber war es nicht auch abwegig, dachte Charlotte, dass Dretzky Wilhelm zum Verwaltungsdirektor einer Akademie machen wollte? Wilhelm hatte nicht die geringste Ahnung von Verwaltung. Wilhelm hatte, im Grunde genommen, von nichts eine Ahnung. Wilhelm war Schlosser, sonst gar nichts.
Zwar war er tatsächlich einmal – auf dem Papier – Co-Direktor der Lüddecke & Co. Import Export gewesen. Aber erstens hatte er dies – aufgrund einer lebenslänglichen Geheimhaltungsverpflichtung – nicht einmal in seinem von der Partei verlangten Lebenslauf angegeben. Und zweitens war Lüddecke Import Export nicht mehr als eine von den Russen finanzierte Scheinfirma gewesen, die dem Geheimdienst der KOMINTERN zum Schmuggel von Menschen und Material diente.
In Mexiko hatte Wilhelm ewig gebraucht, um eine Arbeit zu finden, und was er schließlich fand, war eine – wenngleich gutbezahlte – Anstellung als Leibwächter eines Diamantenhändlers, die, abgesehen davon, dass es gegen Wilhelms proletarische Ehre verstieß, Leben und Eigentum eines Millionärs zu bewachen, vor allem deswegen deprimierend war, weil Wilhelm stets das Gefühl hatte, dass er für seine Dummheit bezahlt wurde. Mendel Eder hatte ihn angestellt, nicht obwohl, sondern weil er kein Spanisch sprach und es dem Händler durchaus gelegen kam, wenn ein Taubstummer neben ihm saß, während er seine Verhandlungen führte.
Erst spät, als die meisten Exilanten schon wieder in Deutschland waren, hatte Wilhelm begonnen, für die Demokratische Post zu arbeiten, aber auch wenn er in seinem Lebenslauf «Geschäftsführer der Demokratischen Post» als letzte Arbeitsstelle angegeben (und die Anstellung bei Eder zu «Frachtdienst Firma Eder» herunterstilisiert) hatte, musste Dretzky doch wissen, dass die Erstellung der Spendenabrechnung für die Demokratische Post nicht im Entferntesten mit der Verwaltung einer ganzen Akademie zu vergleichen war.
– Dann bin ich jetzt ja gewissermaßen dein Vorgesetzter, sagte Wilhelm und klopfte eine Zigarette aus seiner Schachtel.
– Wohl kaum, sagte Charlotte.
Was ging in diesem Kopf vor?
Schon mehrmals war ihnen die Rückkehr in Aussicht gestellt worden, aber immer war am Ende etwas dazwischengekommen. Zuerst war es am Durchreisevisum für die USA gescheitert. Dann war kein Geld mehr in der Reisekasse, weil andere Genossen wichtiger gewesen waren. Dann behauptete das sowjetische Konsulat, dass keine Papiere für sie vorlägen. Und schließlich hieß es, sie hätten die Erlaubnis zur Einreise wiederholt nicht genutzt, sodass sie sich nun gedulden müssten.
Aber dieses Mal schien es anders zu laufen. Tatsächlich wurden ihnen auf dem Konsulat Einreisevisa ausgehändigt. Sie bekamen eine direkte Schiffspassage, sogar mit Rabatt. Obendrein wurde Wilhelms Billett (warum ausgerechnet Wilhelms?) aus der Parteikasse erstattet – obgleich sie inzwischen genug Geld gehabt hätten, um die Überfahrt selbst zu bezahlen.
Charlotte begann sich um die Auflösung des Haushalts zu kümmern, kündigte Verträge und verkaufte die Königin der Nacht mit Verlust zurück an den Blumenladen. Es war erstaunlich viel zu erledigen, und erst jetzt merkte sie, wie sehr sie in das hiesige Leben verstrickt war; jedes Buch, dessen Mitnahme sie erwog, jede Muschel, jedes Figürchen, das sie vorsichtig in Zeitungspapier wickelte oder wegzuwerfen sich entschloss – alles war mit Erinnerungen an ein Stück Leben verbunden, das nun zu Ende ging. Aber gleichzeitig, während sie alles und jedes auf seine Brauchbarkeit im neuen Leben prüfte, begann auch ein Bild dieses neuen Lebens in ihr zu entstehen.
Sie erwarben fünf große Schrankkoffer, setzten einen Teil ihres kleinen Vermögens in Silberschmuck um und kauften von dem Rest verschiedene Dinge, von denen sie annahmen, dass sie im Nachkriegsdeutschland schwer zu bekommen waren, so beispielsweise eine Schweizer Reiseschreibmaschine (allerdings ohne «ß»), zwei Garnituren ausgesprochen praktischen Hartplastikgeschirrs, einen Toaster, zahlreiche Baumwolldecken mit indianischen Mustern, fünfzig Dosen des ebenfalls sehr praktischen Nescafés, fünfhundert Zigaretten, außerdem in reichlichem Umfang Kleidung, von der sie glaubten, dass sie sowohl dem Klima als auch ihrem neuen gesellschaftlichen Status entsprach. Statt heller, luftiger Sommersachen probierte Charlotte nun hochgeschlossene Blusen und dezente Kostüme in verschiedenen Grautönen an; sie ließ sich eine Dauerwelle machen und besorgte sich eine schlichte, aber elegante Brille, deren schmales schwarzes Gestell ihrem Gesicht eine glaubwürdige Strenge verlieh, wenn sie vor dem Spiegel den Blick einer Institutsdirektorin probierte.
So, zwar in alter Kleidung, aber mit neuer Brille und neuer Frisur, traf sie sich noch einmal, ein letztes Mal, mit Adrian. Sie gingen, wie schon oft, in ein kleines Restaurant in Tacubaya, dessen einziger Nachteil darin bestand, dass das sowjetische Konsulat in der Nähe war. Adrian bestellte zwei Gläser Weißwein und chiles en nogada, und noch bevor das Essen kam, fragte er Charlotte, ob sie wisse, dass man Slánský zum Tode verurteilt habe.
– Warum sagst du das, wollte sie wissen.
Anstatt zu antworten, ergänzte Adrian:
– Und zehn andere auch – wegen zionistischer Verschwörung.
Adrian legte eine Herald Tribune auf den Tisch.
– Lies, sagte er.
Aber Charlotte wollte nicht lesen.
– Hier wird doch gerade bewiesen, sagte Adrian, während er mit dem Zeigefinger auf die Zeitung pochte, dass sich nicht das Geringste geändert hat.
– Kannst du bitte mal leiser sprechen, sagte Charlotte.
– Na bitte, sagte Adrian, du hast jetzt schon Angst. Wie soll das dort drüben werden?
Das Essen kam, aber Charlotte wollte nichts essen. Eine Weile saßen beide vor ihren gefüllten Chilis. Dann sagte Adrian:
– Der Kommunismus, Charlotte, ist wie der Glaube der alten Azteken: Er frisst Blut.
Charlotte nahm ihre Handtasche und rannte hinaus auf die Straße.
Fünf Tage später bestiegen sie das Schiff, das sie nach Europa bringen sollte. In dem Moment, da die Leinen gelöst wurden und der Boden unter ihren Füßen ein wenig, vielleicht nur um Millimeter nachgab, wurden ihre Knie weich, und sie musste sich mit äußerster Anstrengung an der Reling festhalten. Der Anfall verging, von Wilhelm unbemerkt, nach einer Minute.
Die Küste verschwand im Dunst, das Schiff wandte sich dem Ozean zu und begann, eine schnurgerade Spur Kielwassers hinterlassend, seine Fahrt. Der Wind frischte auf, an Deck surrten die Wanten, und bald waren sie umgeben vom endlosen Grau, das in jeder Richtung bis zum Horizont reichte.
Die Tage wurden lang, die Nächte noch länger. Charlotte schlief schlecht, träumte immer denselben Traum, in dem Adrian sie durch eine Art unterirdisches Museum führte, und wenn sie erwachte, fand sie nicht wieder zurück in den Schlaf. Stundenlang lag sie im Dunkeln, spürte das Stampfen und Schlingern des Schiffs, spürte, wie sein Rumpf im Ansturm der Böen erzitterte. Und zehn andere auch, hatte Adrian gesagt. Warum hatte sie nicht wenigstens die Namen gelesen? Fragen. Was machte Kurt im Ural? Warum gelang es dem Roten Kreuz auch nach Jahren nicht, Werner zu finden? Sie war eine schlechte Genossin. Ihr Kopf, wenn sie ehrlich war, verstieß ständig gegen die Parteidisziplin. Und fast hätte auch ihr Körper dagegen verstoßen.