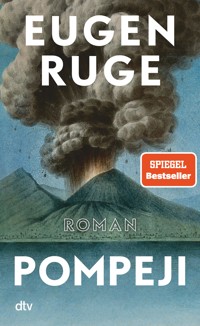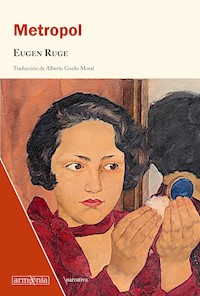9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2013
Ein Mann lässt alles hinter sich: seine Stadt, sein Land, sein bisheriges Leben. Mit nicht viel mehr als einer Hängematte und ein paar Schreibheften im Gepäck steigt er in einen Zug Richtung Süden: Andalusien. Der Name zieht ihn an. Der Zufall bringt ihn nach Cabo de Gata, ein Fischerdorf an der Mittelmeerküste. Die Landschaft ist öde; ein kalter Wind weht. Kein Ort zum Bleiben. Und doch bleibt er, als einziger Gast in der Pension der alten Wirtin, die ihm unerklärlich feindselig erscheint, so abweisend wie alles hier. Es ist, als hätten sie etwas zu verbergen: die Frau mit dem Gipsbein, der Fischer, der ständig sein Boot repariert, die beiden alten Männer im Pyjama, die sich jeden Morgen auf der Promenade anschreien. Das einzige Wesen, zu dem der Reisende schließlich Kontakt findet, ist – eine Katze. Und plötzlich glaubt er zu begreifen, dass sie ihm etwas sagen will. Eugen Ruge erzählt vom Scheitern einer Sehnsucht und von dem Glück, sich dem Unbekannten zu überlassen; er erzählt von Flucht, aber auch vom Ankommen. Cabo de Gata ist ein Glanzstück novellistischer Prosa. Im Wechselspiel von Erfindung und Erfahrung liegt seine Wahrhaftigkeit – und auch seine Kunst. Manche Geschichten muss man erfinden, um zu erzählen, wie es war.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Ähnliche
Eugen Ruge
Cabo de Gata
Roman
Ihr Verlagsname
Über dieses Buch
Ein Mann lässt alles hinter sich: seine Stadt, sein Land, sein bisheriges Leben. Mit nicht viel mehr als einer Hängematte und ein paar Schreibheften im Gepäck steigt er in einen Zug Richtung Süden: Andalusien. Der Name zieht ihn an.
Der Zufall bringt ihn nach Cabo de Gata, ein Fischerdorf an der Mittelmeerküste. Die Landschaft ist öde; ein kalter Wind weht. Kein Ort zum Bleiben. Und doch bleibt er, als einziger Gast in der Pension der alten Wirtin, die ihm unerklärlich feindselig erscheint, so abweisend wie alles hier.
Es ist, als hätten sie etwas zu verbergen: die Frau mit dem Gipsbein, der Fischer, der ständig sein Boot repariert, die beiden alten Männer im Pyjama, die sich jeden Morgen auf der Promenade anschreien. Das einzige Wesen, zu dem der Reisende schließlich Kontakt findet, ist – eine Katze. Und plötzlich glaubt er zu begreifen, dass sie ihm etwas sagen will.
Über Eugen Ruge
Eugen Ruge, 1954 in Soswa (Ural) geboren, studierte Mathematik an der Humboldt-Universität und wurde wissenschaftlicher Mitarbeiter am Zentralinstitut für Physik der Erde. Seit er 1988 aus der DDR in den Westen ging, ist er hauptberuflich fürs Theater und für den Rundfunk als Autor und Übersetzer tätig.
Inhaltsübersicht
Für M.
Diese Geschichte habe ich erfunden,
um zu erzählen, wie es war.
IDie Kündigung
1
Ich erinnere mich, wie ich innehielt, mitten in der Bewegung. Ich erinnere mich an den Geruch von Kaffee, genauer gesagt, an den Geruch des kleinen, arabischen Kaffeekochtopfs, den ich von meiner Mutter geerbt habe, und zwar daran, wie er von innen riecht, wenn er leer ist, an seinen Eigengeruch also, den er nach hundert- und tausendfachem Aufbrühen angenommen hat (und den ich nur notdürftig mit den Worten Metall und Kaffeesatz beschreiben kann, weil ich mich an Gerüche meist nur dann erinnere, wenn ich sie tatsächlich rieche).
Ich erinnere mich, sobald ich mir den Kaffeekochtopf vorstelle, an den Abdruck seines ornamentierten Messinggriffs in meiner linken Hand. Aber am deutlichsten erinnere ich mich an jene winzige (und vermutlich sinnlose) Handbewegung, nämlich daran, wie ich – tack-tack! – den Maßlöffel am Rand des Kaffeekochtopfs abschlug und innehielt, einen Atemzug lang, vielleicht nur eine Sekunde.
Ich erinnere mich an mein Erstaunen darüber, dass ich mich plötzlich so vorfand, hier in meiner Küche, in genau dieser Haltung, diesen Kaffeekochtopf in der Hand, mitten in dieser winzigen, vermutlich sinnlosen Bewegung, die ich – tack-tack – exakt so schon am Morgen zuvor ausgeführt hatte (und am Morgen vor dem Morgen zuvor), und einen Augenblick lang hatte ich das Gefühl, es sei derselbe Morgen und ich sei derselbe, ich sei, wie die Untoten, dazu verdammt, das immer gleiche Verhängnis nachzuspielen: Im nächsten Augenblick würde ich, wie am Morgen zuvor (und am Morgen vor dem Morgen zuvor), auf nackten Füßen ins Bad gehen, würde kalt duschen, würde, noch während ich mir die Zähne putzte, zurück in die Küche gehen, um genau im Moment, da der Kaffee das erste Mal aufschäumte, das Gas runterzudrehen; ich würde mir mein Müsli aus Vierkornflocken, Apfel, Banane zusammenrühren, würde, den Kaffeekochtopf in der linken und die auf die Kaffeetasse getürmte Müslischüssel in der rechten Hand, zum Schreibtisch balancieren und den PC einschalten, würde, während ich das Müsli zu löffeln begänne, das raumschiffartige Hochfahren des Lüfters vernehmen, das Säuseln der Festplatte, das beflissene Rattern des Druckers, der nach kurzem Selbsttest seine Bereitschaft anzeigte, und ich würde, wie schon am Morgen zuvor (und am Morgen vor dem Morgen zuvor), vor dem Bildschirm sitzen und auf den ungerührt blinkenden Cursor starren und wissen, dass ich auch heute wieder nichts zustande bekäme.
Das Nächste, was ich erinnere, ist der Moment, da ich mir die alte Trainingshose und den löchrigen Kaschmirpullover (die Sachen, die ich am liebsten beim Arbeiten trug) vom Leib riss und meine Jeans überzog. Ich erinnere mich an den steifen Jeansstoff, und dass es mich Überwindung kostete, meinen noch schlafweichen Körper in diesen steifen Stoff zu zwängen. Ich erinnere mich an die Verzweiflung und an die Wut, die ich dabei empfand, denn in Wirklichkeit ging es nicht um den Stoff, in Wirklichkeit ging es darum, dass ich meine Gewohnheiten über den Haufen warf, dass ich ein unausweichliches Ritual durchkreuzte, dass ich im Begriff war, die mir selbst auferlegte Arbeitsverpflichtung zu schwänzen. Meine Wut war diffus, richtete sich aber vor allem gegen meinen Vater, als wäre er schuld daran, dass ich seine Regelmäßigkeit nachlebte oder nachäffte, seinen maschinenhaften Lebensstil, seine roboterhafte Arbeitsweise, die umso schwerer zu ertragen war, als er damit Erfolg hatte.
Ich erinnere mich daran, dass draußen ein heißer Tag begann, genauer gesagt, ich erinnere mich, wie ich durch den Flur des Hinterhauses ging, in dem ich seit der Trennung von Karolin wohnte. Ich erinnere mich an die Kühle des Hausflurs und sogar, wenn ich jetzt im Geist die bunt bemalte Wohnungstür der im Erdgeschoss wohnenden Punks passiere, an den Geruch von abgestandenem Bier und Marihuana und an die lauwarme Luft, die mir durch die ewig offen stehende Haustür entgegenwehte. Ich erinnere mich an die stechende Sonne draußen vor dem Haus. Ich erinnere mich an die bräunliche Farbe des Asphalts. Ich erinnere mich daran, dass ich sehr bald schwitzte, weil ich zu warm gekleidet war, vor allem aber erinnere ich mich an den auf meinem Rücken und auf der Stirn wieder erkaltenden Schweiß, als ich im Café Kohle (eigentlich: VEB Kohle und Energie) im Schatten der großen Kastanie saß und das Frühstücksangebot studierte.
Ich war der erste Gast. Eine Kellnerin ging mit einem Schüsselchen herum und wischte – ein Akt der Vergeblichkeit – die sperrmüllartigen Gartenmöbel ab, die ich damals, in den Jahren des Wandels, für eine Übergangslösung hielt, die sich inzwischen aber als eine Art Prenzlauer-Berg-Stil entpuppt haben. Ich habe vergessen, was ich auswählte (irgendein italienisches oder spanisches oder biologisches Frühstück), aber ich erinnere mich daran, dass die Kellnerin, die vermutlich BWL oder Politikwissenschaften studierte, mich siezte, und obwohl ich es sonst immer ein bisschen aufdringlich finde, wenn ich in Cafés wie dem Café Kohle geduzt werde, empfand ich das Sie der Kellnerin an diesem Morgen als kränkend.
An das Frühstück selbst habe ich keine Erinnerung, allenfalls an die Salatreste, die ich davon übrig ließ, oder an die Krümel auf der Tischplatte, und an diese erinnere ich mich auch nur, weil sich alsbald die Sperlinge daran zu schaffen machten. Ich weiß noch, dass ich eine Weile reglos am Tisch saß und die Sperlinge beobachtete. Sie näherten sich vorsichtig und zugleich hastig, rutschten mit ihren Krallenfüßchen auf der Tischplatte herum wie ungeübte Schlittschuhläufer, und ich weiß noch, dass ich den Gedanken bemerkenswert fand, dass diese Tiere, die sich ja im Übrigen hervorragend an das Stadtleben angepasst hatten, es vermutlich nie, auch nach Tausenden von Jahren nicht, lernen würden, sich, ohne auszugleiten, auf einer glatten Tischplatte zu bewegen. Es lag, dachte ich, einfach außerhalb der ihnen eingeschriebenen Möglichkeiten, aber bevor ich weiterdenken konnte, kam die Kellnerin, räumte, die Sperlinge aufscheuchend, den Tisch ab und fragte mich, ob ich noch einen Wunsch hätte.
Obwohl meine finanzielle Lage damals so prekär war, dass ich buchstäblich bei jeder Tasse Kaffee überlegte, ob ich sie mir leisten solle, oder vielleicht gerade deswegen, nämlich weil ich vor dieser so offensichtlich desinteressierten BWL-Kellnerin nicht als Versager und Habenichts dastehen wollte, bestellte ich einen weiteren Latte macchiato, und während ich auf diesen Latte macchiato wartete, passierte etwas, das mir bis heute in fast jeder Einzelheit erinnerlich ist.
Vor dem Café, das ehemals eine Kohlenhandlung gewesen war (kein Volkseigener Betrieb, wie die ahnungslosen Neubewohner des Prenzlauer Bergs unterstellten), hielt ein schwarzer BMW, aus dem drei Personen stiegen, drei Männer. Sie waren jung, jedenfalls jünger als ich. Zwei von ihnen trugen kurzärmlige T-Shirts und Jeans, der dritte war etwas älter als die beiden anderen, sah verlebter aus und überhaupt so, wie ich mir einen Zuhälter vorstellte. Er trug einen dunklen Anzug und ein geblümtes Hemd, dessen Kragen über das Revers fiel; im krausen Haarschopf steckte eine (vermutlich teure) Sonnenbrille, die ihre endgültige Bestimmung dort gefunden zu haben schien; an den Füßen trug er zierliche, zu ernsthafter Fortbewegung kaum geeignete Schuhe, eine Art Mokassins (falls das Wort noch im Umlauf ist), auf deren Spann jeweils zwei kleine, zu einer Scheinschleife gebundene Lederbändchen saßen, deren Enden wiederum in je eine winzige Troddel ausliefen.
Als Sitzgelegenheiten im «Vorgarten» des Cafés, der aus einem vorschriftswidrig genutzten Teil des breiten Berliner Gehwegs bestand, dienten unter anderem alte, längs der Hauswand aufgebockte Gerüstbohlen, die zwar vermutlich mehrere hundert Male von einer Kellnerin abgewischt worden, aber dennoch von eingefressenen Kalk- und Zementspuren übersät waren. Der Anzugträger setzte sich, ohne zu zögern, darauf und begann sofort laut und bayrisch (oder war es österreichisch?) über Computerdinge zu reden. Genauer gesagt, redete er über den Verkauf von Computerdingen, über Marktanteile und Expansion; Worte wie Absatz, Vertrieb, Prozent, Gewinnspanne und das mir damals unbekannte (und auch heute nur halbwegs verständliche) Wort Franchising drangen an mein Ohr und in mein Ohr ein. Die beiden anderen, eher normal Gekleideten saßen dem Redner zugewandt auf Plastikstühlen, leicht vornübergebeugt, nickten, warfen hin und wieder einen zustimmenden Kommentar ein oder lachten, während der Redner, den Rücken an die Hauswand gelehnt, die Beine übereinandergeschlagen, auf der Gerüstbohle saß und den Blick wie ein Eroberer, der das zu Erobernde taxiert, über die weit einsehbare Kopenhagener Straße, über die grauen Fassaden, die Fenster, die Reihen geparkter Autos schweifen ließ, und während der ganzen Zeit, so sagt meine Erinnerung, wippte er mit dem Fuß des überschlagenen Beins, und die Troddeln seines lächerlichen, kaum zum Gehen geeigneten Schuhs umsprangen einander wie junge Dackel.
Das war, glaube ich, der Moment, da mir der Gedanke kam, diese Stadt (dieses Land, dieses Leben) bis auf weiteres zu verlassen.
2
Ich erinnere mich an den sonnigen, aber schon kühlen Herbsttag, an dem ich zum Briefkasten ging. Ich ging wie fremdgesteuert und, meiner Erinnerung zufolge, mit einem Gefühl, als wäre ich nach langer Krankheit zum ersten Mal wieder auf der Straße.
Ich erinnere mich daran, wie der Brief im Kasten verschwand: an das kurze Quietschen der Klappe. Ich erinnere mich, dass ich nach dem Einwurf des Briefes nicht wieder nach Hause, sondern weiter die Gleimstraße entlangging, vorbei am Falkplatz in Richtung Tunnel. Der Ahorn (war es Ahorn?) am Falkplatz verfärbte sich schon, der Weg führte leicht bergab, und möglicherweise war es dieses Bergab-Gehen, das mich an eine andere, inzwischen einige Jahre zurückliegende Kündigung erinnerte. Damals war es nicht die Wohnung gewesen, die ich gekündigt hatte, sondern die Arbeit, eine gutbezahlte und natürlich feste Stelle am Institut für Chemietechnik, das nach der Wende sogar bestehen blieb. Das Institut lag auf einer kleinen Anhöhe, dem Ravensberg, und während ich jetzt am Falkplatz vorbei in Richtung Gleimtunnel ging, dachte ich daran, wie ich damals, nach einem abschließenden Gespräch mit dem Kaderleiter, den langen Fußweg vom Ravensberg hinab in die Stadt gegangen war. Auch damals war es Herbst gewesen, die Sonne schien, große, lederne Blätter raschelten unter meinen Füßen, und das Wort bergab spukte in meinem Kopf herum wie eine Prophezeiung.
Als Nächstes kündigte ich den Energieversorger und die Telekom. Ich erinnere mich an langwierige telefonische Auseinandersetzungen, bevor einer meiner ständig wechselnden Gesprächspartner einsah, dass ich nicht im Besitz der eigenen Sterbeurkunde sein konnte. Diese Winzigkeit könnte der Auslöser gewesen sein. Ich begann, meine noch immer nicht ausgepackten Umzugskartons nach weiteren Verträgen und Versicherungspolicen zu durchsuchen, und obwohl die Ausbeute nicht sonderlich groß gewesen sein dürfte, fand ich mich doch erstaunlich tief verstrickt in das Ganze (in die Gesellschaft, das System), und je schwieriger und umständlicher es im Folgenden wurde, sich aus dieser Verstrickung zu befreien, desto stärker wurde mein Drang danach, bis mich eine regelrechte Kündigungsmanie befiel. Ich weiß nicht mehr, was ich im Einzelnen kündigte, aber ich kündigte alles. Es gelang mir sogar, mich von der gesetzlichen Krankenversicherung zu befreien (mit dem Argument, dass ich mich für unbestimmte Zeit im Ausland aufhielte), aber als ich zu guter Letzt noch zum Einwohnermeldeamt ging, wo ich, seltsam genug, eine Bescheinigung meines Vermieters vorlegen musste, um mich abmelden zu dürfen, stellte sich heraus, dass eine Abmeldung nur möglich war, wenn ich meinen künftigen Wohnsitz in das Abmeldeformular eintrug.
Ich erinnere mich nicht mehr an das Gesicht der Frau. Ich erinnere mich nur daran, dass sie blond war (gefärbt). Und ich erinnere mich an die tantenhafte Herablassung in ihrem Ton, als sie sagte:
Sie müssen doch wissen, wo Sie hinwollen.
Ich erinnere mich an den Anflug von Übelkeit, als die ersten Schokoladenweihnachtsmänner in den Schaufenstern auftauchten und ich noch immer nicht wusste, wo ich hinwollte. Ich erinnere mich an die schneelose Dunkelheit auf den Straßen, an den Bonbonpapierglanz der Einkaufspassagen, an die Gesichter der jungen Frauen, die mir im weißen Kunstlicht abweisender vorkamen als je zuvor. Auch an den plötzlich überall in den Geschäften hängenden Adventsstern erinnere ich mich, und obwohl ich kein Christ bin, empfand ich es plötzlich als unerträglich, dass dieses Symbol auf so schamlose Weise verwendet wurde; es verwunderte mich sogar, dass das in diesem (angeblich christlichen) Land erlaubt war. Voller Groll ging ich zwischen all den Kaufenden und Verkaufenden um und fühlte mich aufs gründlichste in meinen Fluchtplänen bestätigt.
Aber es gab auch solche Momente: später Nachmittag, die einzige Stunde, in der meine Wohnung Sonne bekam. Das Licht ist himbeerrot, die Luft scheint damit angedickt, ich trinke sie wie Sirup, während ich barfuß auf dem alten Dielenfußboden durch meine beiden Zimmer wandle; die kleine Pendeluhr, die ich von meiner Mutter geerbt habe, knuspert in ihrem Gehäuse wie ein Haustier, und ich verstehe nicht mehr, warum ich die Wohnung gekündigt habe.
Beiläufig befragte ich Freunde oder Bekannte nach ihren Auslandserfahrungen. Ich erinnere mich an Empfehlungen wie Südafrika oder Ecuador, auch Ghana kam mehrmals vor oder die mir völlig unbekannten Seychellen. Ich weiß noch, dass ich staunte, wo die Leute so wenige Jahre nach der Wende schon überall gewesen waren. Einen Ort, der im Winter warm, zugleich preiswert und möglichst auf dem Landweg erreichbar war, konnte mir indes kaum einer nennen, wobei ich zugeben muss, dass ich die letzte der drei Bedingungen nur zaghaft ins Spiel brachte, weil ich nicht eingestehen wollte, dass ich, wenn nicht unter Flugangst, so doch unter Flugunbehagen litt. Stattdessen gab ich, mich an irgendeine Max-Frisch’sche Tagebucheintragung erinnernd, vor, ein Gefühl für die Reiseentfernung bewahren zu wollen, oder versuchte zu erklären, dass ich weder auf Abenteuer noch auf touristische Attraktionen aus sei, was natürlich die Frage aufwarf, worauf ich denn eigentlich aus sei – und ich erinnere mich, dass ich diese Frage mehrmals sehr verschieden beantwortet habe, ohne dass eine der Antworten mich selbst überzeugte.
Schließlich saß ich in der Stadtbibliothek und studierte Klimakarten. Ich erinnere mich an rote und blaue Diagramme, an Zahlen und Messwerte, aber besonders deutlich erinnere ich mich daran, dass ich umso ratloser wurde, je gründlicher ich mich mit der Sache beschäftigte – eine Erfahrung, die mir auf einmal vertraut erschien: Je genauer man hinsah, desto mehr verschwamm alles. Natürlich fiel mir an dieser Stelle die Heisenberg’sche Unschärferelation ein, und mir kam der zugegeben eher philosophische als naturwissenschaftliche Gedanke, dass das, was Heisenberg auf der atomaren Ebene beschrieb (nämlich die prinzipielle Unfassbarkeit des Objekts), eine der Materie immanente Eigenschaft sei, die sich folgerichtig, ja zwangsläufig in der sichtbaren Welt fortsetzen müsse: Es war unmöglich, den richtigen Ort zu finden – diese Erkenntnis gefiel mir, ja sie erheiterte mich sogar, statt mich zu erschrecken. Es war, so erinnere ich mich, als nähme ich meine Lage nicht ernst, als würde ich neben mir stehen und mir zuschauen wie der Figur eines Romans, und wenn ich diesen Moment grundloser Heiterkeit wie auch andere, weniger bedeutende Momente im Gedächtnis bewahrt habe, dann liegt dies vermutlich daran, dass ich damals alles, was ich tat oder was mir zustieß, im selben Moment oder doch im nächsten oder übernächsten auf seine Stofftauglichkeit prüfte; dass ich mein Leben, noch während ich es erlebte, probehalber zu beschreiben begann.
3
In einer Art Waffenladen kaufte ich ein superscharfes (nicht rostfreies) Opinelmesser und eine kleine Dose rotes Pfefferspray. Außerdem kaufte ich bei Camp 4 ein aufblasbares Nackenkissen (für nächtliche Zugfahrten) und eine fast gewichtslose Hängematte mit minimalem Packmaß.
Ich dübelte in meinem Zimmer zwei gewaltige Haken ein und hängte die Matte probehalber auf. Ich hatte noch nie eine Hängematte benutzt. Ich erinnere mich, dass mir das Wort embryonal