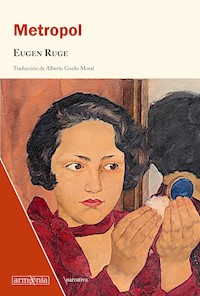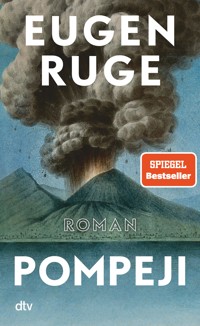
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Über Hinsehen und Wegschauen, in der Antike genau wie jetzt Als auf einem Berg oberhalb der Stadt Pompeji tote Vögel gefunden werden, hat der Einwanderer Jowna eine Eingebung: Wenn da wirklich ein Vulkan grollt, wie von manchen behauptet wird, dann muss man das Weite suchen. Ohne Schulbildung, Geld und Einfluss gelingt es ihm, sich an die Spitze einer Aussteigerbewegung zu setzen. Bald fürchtet das Stadtoberhaupt Fabius Rufus, die Vulkangerüchte könnten Pompeji schaden, aber erst als auch einer der reichen Bürger auf die Gefahr etwas zu geben scheint, schaltet sich Livia ein, die mächtigste Frau der Stadt. Jowna schwenkt um. Die Katastrophe vor Augen, tut er – nichts. Eugen Ruges Pompeji ist eine Erfindung, die auf historischer Wahrheit beruht: ein ferner Spiegel, in dem wir uns erkennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 398
Ähnliche
Eugen Ruge
Pompeji
oder Die fünf Reden des Jowna
Roman
dtv Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG, München
Als Koch hast du gearbeitet und als Kalkbrenner,
Wurstmacher und Bäcker, du bist Bauer gewesen, hast bronzenen Kleinkram hergestellt,
du bist Hausierer gewesen und jetzt machst du Krüge.
Hast du aber Fotzen geleckt, dann hast du alles gehabt.
Graffito in Pompeji, Praedia der Iulia Felix (Regio II, Insula 4, Eingang 10 – Hintereingang)
Glücklich ist dieser Ort!
Graffito in Pompeji, aus der Via Stabiana
Ich verabscheue die Armen!
Wer auch immer etwas umsonst
erbittet, ist ein Holzkopf.
Graffito in Pompeji, Fassade einer Bäckerei (I12, 3)
Sodom(a) Gomora
Graffito in Pompeji, Speisezimmer des Hauses (IX1, 26)
Vorrede
Sogar der Kaiser, erzählt man, habe geweint: der göttliche Titus, Bezwinger Jerusalems. Soll man es glauben? Jedenfalls hat er den Überlebenden Hilfe versprochen: Aufbauhilfen, Entschädigungszahlungen für den verlorenen Besitz. Was natürlich Besitz voraussetzt.
Und dass man überlebt hat, klar. Vermutlich hat der Göttliche nach den ersten Berichten, die von Misenum nach Rom getrommelt wurden, damit gerechnet, dass es nur noch Wenige gebe, die Entschädigung beanspruchen könnten. Aber da hat er sich geirrt. Abgesehen davon, dass sich die meisten Landhausbesitzer am Tag der Katastrophe auf ihren Landgütern befanden – es war prächtiges Wetter, ein milder, duftender Herbst –, hätten die Berater seiner kaiserlichen Majestät selbige darauf aufmerksam machen können, dass es so etwas wie Erben gibt: Ehegatten und Söhne, Enkel und Neffen oder, wenn gar nicht anders, die Tochter der Ehefrau des Onkels des Enkels des Verstorbenen und so weiter. Wenn es um Besitz geht, findet sich immer jemand, der Anspruch erhebt. Und es findet sich immer ein Anwalt, der sich erbietet, diesen Anspruch durchzusetzen.
Und so sind sie nach Rom gefahren, die Besitzenden oder angeblich Besitzenden, die tatsächlichen und vermeintlichen Anspruchsberechtigten, die Schönen und Reichen ebenso wie die Hässlichen und Reichen, ganz gleich, ob samnitischer oder latinischer Herkunft, ob Popularen oder Optimaten, ob ehemalige Befürworter oder Gegner Josses. Beim Geld hört die Feindschaft auf. Alle sind sie nach Rom gefahren, bereit und willens, der Kommission, die der Kaiser aufgrund des Andrangs hat gründen müssen, Rede und Antwort zu stehen. Zeugen werden bemüht, um Grundflächen verschütteter Villen zu bestätigen und nie gesehene Wandgemälde zu taxieren; Gutachten werden erstellt und Listen ominöser Wertgegenstände erarbeitet; Rechnungen werden gefälscht und erstaunliche Geldbeträge erinnert. Es wird gefeilscht und verhandelt, ein langwieriger Prozess, die Kommission ist überfordert, die Wartezeiten sind erheblich, und die Anträge stauen sich.
Schon wächst das erste Gras auf der Asche. Schon haben die Mauerspechte, wie sie genannt werden, die wenigen Überreste abgetragen, die aus dem Schutt hervorragten, schon wird der Marmorgiebel des Kapitols in Einzelteilen im neapolitanischen Baustoffhandel verkauft. Aber noch immer residieren die Antragsteller wartend in römischen Hotels oder Gästezimmern und verbringen ihre Abende damit, die notorisch gelangweilte Gesellschaft mit Berichten über die Katastrophe zu unterhalten, die sie größtenteils gar nicht miterlebt haben. Gewiss, man muss kein Vogel sein, um den Himmel zu beschreiben. Und manches sieht man aus der Entfernung sogar besser. Da, wo für die Dabeigewesenen nur Dunkelheit und Verwirrung gewesen ist, hat der entfernte Betrachter das Schauspiel in voller Ausdehnung bewundern können: jene inzwischen berühmte Wolke, die sich, je nach Berichterstatter, wie eine Pinie oder ein Schirm oder eine Stierleber, wie ein Geschwür oder ein Grünkohl über dem Monte Somma (oder neben dem Monte Somma, über dem kleineren Vesuv) erhob und irgendwann, nach acht oder zehn oder möglicherweise auch nach zwölf Stunden, in sich zusammensackte und, je nach Berichterstatter, mit der Geschwindigkeit einer Flutwelle oder eines Streitwagens, eines Pfeils oder eines aus dem dritten Stock herabfallenden Soldatenstiefels an den Hängen des Gebirges hinabstürzte und alles, was ihr im Weg war, unter sich begrub.
Aus heiterem Himmel, so heißt es immer wieder, sei das Unglück gekommen. Diesen Eindruck scheinen auch die zu bestätigen, die an Wirtshaustischen oder auf Marktplätzen ihre Version der Katastrophe zum Besten geben, angefeuert von den Spenden der sie Umdrängenden, sei es in Form geistiger Getränke oder geprägter Münze. Die Leute, die hier zu Wort kommen, sind zumeist plumpe, ungewaschene Gestalten, das sogenannte Volk; es neigt bekanntlich zu Übertreibungen. Die Erzähler überbieten sich gegenseitig, stacheln einander auf, und es bleibt nicht aus, dass sie einander Dinge bestätigen, die sie nie gesehen haben, nur um nicht als dumm dazustehen. Nicht bloß vom Steinregen ist immer wieder die Rede, von Asche und giftigem Rauch; manche wollen den Geistern der Unterwelt begegnet sein, obgleich sie angeblich die Hand vor Augen nicht mehr sahen; von Manen oder Lemuren wird erzählt, von fackelschwingenden Furien oder von Feuerschriften, die Iupiter höchstpersönlich mit Blitzen an den sich plötzlich verdunkelnden Himmel geschrieben hat.Mancher Dahergelaufene soll sich inzwischen von Geschichten ernähren, die er anderen abgelauscht hat, und es heißt, man habe in Gallien – so weit sind die Berichte schon vorgedrungen – jemanden erschlagen, weil er es mit dem Übertreiben übertrieb: Er hatte behauptet, das Meer vor Pompeji sei im Laufe von Stunden um mehrere hundert Meter zurückgetreten – eine Behauptung, von deren Richtigkeit man sich allerdings am Ort der Katastrophe noch immer überzeugen kann!
So wird geredet, von Göttern und Furien, vom röchelnden Tod, von einer schwarzen Grünkohl- oder Stierleber-Wolke; Verluste und Opferzahlen werden genannt und, je nach Absicht, unter- oder übertrieben; Wahres und Falsches wird berichtet, Gesehenes und Erträumtes, Gehörtes und Wiedergekäutes, ganz wie es sich nach einer solchen Katastrophe gehört. Nur eins ist auffällig: Niemand nennt die Sache bei ihrem Namen. Niemand spricht es aus, das Wort, das doch eben noch in aller Munde war: das V-Wort. Und wenn ein Außenstehender es ahnungslos in die Runde wirft, dann passiert es, dass die Anwesenden zusammenzucken; ihr Gesicht nimmt den ungewohnten Ausdruck von Nachdenklichkeit an, den man leicht mit dem der Betroffenheit verwechselt; der Außenstehende beeilt sich, das Thema zu wechseln, andere helfen dem stockenden Gespräch mit freundlichen Belanglosigkeiten auf den Weg. Die Eingeweihten aber wechseln scheue Blicke und sind sich stillschweigend einig, nicht mehr daran zu rühren. Man muss schließlich weiterleben in der geretteten Haut, mit seinen Dummheiten und Schandtaten.
Aus heiterem Himmel? O ja! Der Himmel war heiter – über Misenum. Die Sonne schien – über Capri. Das Meer war von bestechendem Blau, wie es nur selten an späten Oktobertagen zu sein pflegt. Nur über Pompeji lag ein milchiger Dunst. Die Sonnenuhren versagten trotz milchweißer Helligkeit, und die Leute machten sich zu früh auf den Weg zum Forum, um ja nicht die Rede ihres Kandidaten zu verpassen …
Vergiss, lieber Leser, alles, was du jemals über Pompeji gehört hast. Vergiss alles, was sie dir darüber erzählt haben. Glaube weder den Besitzenden und ihren Anwälten, die nachträglich die Grundflächen von Villen hochrechnen, noch den armen Schluckern, die sich auf einmal eine schöne Vergangenheit erfinden, nachdem sie jahrelang über buchstäblich alles geklagt und gejammert haben. Glaube nicht den Verzweifelten und Verzagten, nicht denen, die sich als Helden aufspielen, weil sie das unverdiente Glück hatten zu entkommen; glaube nicht den Dichtern, nicht den Historikern, nicht den Mächtigen und nicht den Machtlosen, nicht den Kaisertreuen und nicht den Republikanern, nicht den Auguren und Priestern, nicht den amtlichen Verlautbarungen oder dem Nachrichtenbulletin Roms. Glaube nicht denen, die vorgeblich von nichts gewusst haben, und glaube erst recht nicht denen, die sagen, sie hätten es schon immer gewusst.
Vergiss und lies.
Dies ist der wahre Bericht vom Untergang Pompejis und seiner Bewohner. Dies ist die Geschichte des Vulkanvereins von seinen chaotischen Anfängen bis zu dem Tag, da er sich zu Tode feierte. Aber vor allem ist dies die Geschichte seines Gründers oder jedenfalls des Mannes, der sich dafür hielt. Es ist die Geschichte des vielbewunderten, vielgeliebten, aber auch vielgehassten, des unglaublich schlauen, aber vielleicht auch ganz mittelmäßigen Bürgers Jowna alias Josephus alias Josse.
Dies ist kein Heldenepos, das die Wirklichkeit in Hexametern verklärt und verkleistert, keine Feier menschlicher Größe, keine Inventur der Wundertaten, wie wir sie gernhaben, sondern ein schmutziger, saurer, ja womöglich kleinlicher Bericht über ein schmutziges, saures und kleinliches Kapitel der Stadtgeschichte, und es ist klar, dass ein solcher Bericht auf dem Marktplatz der Sensationen keine Chance hat. Niemand möchte das hören. Man wird diese Stimme glatt überschreien. Man wird uns der Miesmacherei und der Niedertracht bezichtigen. Man wird die Darstellung hässlich finden, wo in Wahrheit nur ihr Gegenstand hässlich ist, und man wird die Beschreibung als unwürdig abtun, wo es den Beschriebenen an Würde mangelt. Man wird uns vorwerfen, die Opfer zu verhöhnen. Schlimmer noch, man wird diesen Bericht blasphemisch, beleidigend oder gar unrömisch finden, und auch wenn unser neuer Kaiser plötzlich den Eindruck erweckt, empfindsam geworden zu sein, bleibt abzuwarten, wann er sich des Schwertes als Mittel des Regierens erinnert.
Kurz, wir haben uns entschlossen, diesen Bericht nicht der Meute zu übergeben, die man Öffentlichkeit nennt, denn wir wollen frei sein in unseren Gedanken und Worten. Für die Toten kommt ohnehin jede Warnung zu spät. Deshalb sollen diese Schriftrollen, sobald sie geschrieben sind, fest in einer Amphore verschlossen und an unzugänglicher Stelle verwahrt werden, auf dass sie irgendwann von denen entdeckt werden, die nach uns die Erde bewohnen.
Aber werdet ihr euch noch für unsere Geschichte interessieren? Werdet ihr unsere Winke verstehen? Werdet ihr euch die Mühe machen, unsere Zeichen zu deuten, und daraus euren Nutzen ziehen?
Immer fühlen sich ja die Gegenwärtigen den Vergangenen überlegen. Immer glauben sie, es seien schon alle Fehler gemacht und sie selbst seien endlich angekommen bei der letzten Erkenntnis. Sie lachen über die verqueren Vorstellungen der Alten, fühlen sich abgestoßen von ihrer zurückgebliebenen Moral. Sie erfinden neues Kriegsgerät und neue Umgangsregeln. Sie halten ihr Wissen für gültig und sich selbst für vollendet. Sie begreifen nicht, dass auch sie nur Vorübergehende sind.
Wusstest du, Leser, dass das Wort Kapitol von den Etruskern herstammt? Caput Oli: der Schädel des Olus. Das Kapitol ist ein Grabhügel. Das Römischste aller Heiligtümer ist auf Knochen erbaut. Ist es nicht sonderbar, dass die unterworfenen Städte heute der Mode frönen, in ihrer Mitte ebenfalls Kapitole zu errichten?
Nichts wiederholt sich. Die Geschichte geht nicht auf platten Füßen im Kreis. Keine Katastrophe passiert zweimal auf dieselbe Art. Und, ja, vielleicht werdet ihr, die ihr eure Häuser auf unseren Gräbern errichtet, klüger, vernünftiger, reifer sein als wir. Dann wäre dieser Bericht überflüssig geworden. Nehmt ihn als Farce! Lest ihn zu eurem Vergnügen! Und wenn ihr euch nicht an unserer Dummheit erfreuen mögt, erfreut euch, ihr Kommenden, an eurer Weisheit.
Aber genug der Vorrede. Beginnen wir! Lassen wir die Toten auferstehen! Erinnern wir uns an den Tag, an dem Jowna alias Josephus alias Josse aus der bleichen Anonymität seines Daseins heraustrat und seine Rolle in der Stadtgeschichte zu spielen begann.
Erster Teil
Erste Rolle. Die Rede im Hühnerstall
Es war im Jahr 830 nach Gründung der ewigen Stadt oder, nach pompejanischem Zeitmaß, fünfzehn Jahre nach dem Großen Beben (das sich als Vorbote des Untergangs erweisen sollte), als ein gewisser Josse, wie er von seinen Freunden genannt wurde, im Hühnerstall eine Rede hielt, die es nachträglich zu Berühmtheit bringen sollte.
Viel ist über diese Rede gesagt worden. Brillant soll sie gewesen sein. Wie eine Axt! Und doch so raffiniert, von sophistischer Schläue … Und wenn sie nicht unter den Trümmern verschüttet wäre, könnte man sie nachlesen, denn Josse hat seine Rede später – aus der Erinnerung – aufgeschrieben. Allerdings hat er sie im Laufe der Zeit hier und da korrigiert, und dabei wurde sie naturgemäß immer klüger. Und immer länger.
In Wirklichkeit war es nicht mehr als ein Satz, den er damals herauspresste. Er war, jedenfalls am Beginn seiner Karriere, keineswegs der große Redner, als den ihn die meisten später ansahen. Ganz im Gegenteil, er war – trotz des geheimen Glaubens, zu etwas Höherem berufen zu sein – wortkarg, beinahe verstockt, was wohl vor allem darin seinen Grund hatte, dass er glaubte, sich für seine Zähne schämen zu müssen. Er kriegte buchstäblich das Maul nicht auf, bellte allenfalls Satzfetzen heraus und achtete stets darauf, die Zähne nicht zu entblößen.
Aber wer war er eigentlich, dieser Josse? Später hat er behauptet, er stamme aus einer Unternehmerfamilie, ja sogar aus dem pannonischen Adel, während er bei anderer Gelegenheit betonte, er komme von unten, aus dem Volk. Die Wahrheit ist: Sein Vater, der den Namen Jazyg trug (obwohl er nichts mit dem legendären Reitervolk zu tun hatte), hatte eine Metzgerei in Pannonien besessen und war wegen der ständigen Grenzkriege mit jazygischen und dakischen Stammesfürsten mit seiner Familie zuerst nach Rätien, dann weiter nach Kampanien geflohen, wo er Wohlstand und Sicherheit erhofft hatte. Das war fünf Jahre vor dem Großen Beben gewesen oder, nach römischer Zeitrechnung, im Jahr 809 nach Gründung der Ewigen Stadt. Fortan nannte er sich Jacobus und mühte sich redlich, ein richtiger Römer zu werden: Er ahmte mit Leidenschaft alles nach, was er für römisch hielt, äußerte niemals Kritik und erzählte tapfer Witze weiter, die er nur halb verstanden hatte. Bis zu seinem Lebensende sprach er ein jämmerliches Latein, war jedoch überzeugt, er beherrsche die Sprache, und gab seine Fehler, wenn sein Sohn ihn verbesserte, für kampanische Mundart aus.
Tatsächlich gelang es Jazyg, eine Metzgerei in der – damals noch prosperierenden – Provinzhauptstadt Pompeji zu eröffnen. Allerdings gab es keinen Mangel an Metzgereien in der Stadt, und die Leute kauften selbst dann noch zögerlich bei dem Neuen, als er sein Fleisch zum Einkaufspreis zu veräußern begann, was ihm den Unmut der Innung eintrug. Zudem war sein Geschäft ungünstig gelegen, sodass sich alle optimistischen Berechnungen bald als hinfällig erwiesen. Es dauerte keine drei Jahre, bis er bankrottging. Den Rest seines Lebens schuftete er als Sackträger oder Handlanger, um die dreitausend Sesterze Schulden abzutragen, die übrig geblieben waren: eine lächerliche Summe für jemanden, der Geld hat; nicht aber für jemanden, der mit Mühe seine Familie ernährt.
An Pannonien erinnerte sich Josse nicht. Er war kaum drei Jahre alt gewesen, als seine Eltern weggingen. Wohl aber erinnerte er sich an die Metzgerei seines Vaters in Pompeji. Er erinnerte sich an den Geruch des warmen Blutes, das in einem großen Kessel gerührt wurde; daran, wie sein Vater mit einem Beil die Hufe von den Keulen abtrennte; an die Schreie der zum Schlachten geführten Schweine, die man durch den Fußboden hindurch bis ins obere Zimmer hörte.
»Woher wissen die Schweine, dass sie sterben müssen?«
»Das sagt ihnen der Instinkt«, erklärte sein Vater.
Und Josse stellte sich den Instinkt als eine kleine Gestalt vor, unsichtbar wie ein Gott, die den Tieren etwas ins Ohr flüsterte: der Gott der Schweine. Aber hatten denn Schweine Götter?
Jazyg war zu sehr mit seiner Metzgerei beschäftigt, um solche Fragen zu beantworten. Aber auch später, als er nur noch die Schulden abtrug, die er angehäuft hatte, blieb ihm kaum Zeit für seinen Sohn. Er schuftete zwölf oder vierzehn Stunden am Tag, und wenn es ihm nicht gelang, Arbeit zu finden, lag er mit schmerzenden Knochen auf dem Bett und machte sich Vorwürfe.
Josse erinnerte sich nur an einen einzigen kleinen Ausflug mit seinem Vater. Es muss drei oder vier Jahre vor dem Großen Beben gewesen sein und kurz nachdem Jazyg seine Metzgerei aufgegeben hatte, womöglich unmittelbar danach, in jenem Moment der Erleichterung, der mit dem Aufgeben ja auch immer verbunden ist – an einem dieser Tage nahm er den Vierjährigen mit in die Stadt, um ihm zu zeigen, wo die Demokratie wohnt, auf die er, der Neupompejaner, so stolz war.
Nach Josses Erinnerung war es ein Feiertag, allerdings trat der Magistrat an Feiertagen nicht zusammen. Aber die Stimmung war feierlich, sein Vater trug ausnahmsweise keine Arbeitskleidung, die Sonne schien mild, und der weiße Marmorboden des Forums glänzte vor Sauberkeit. Vielleicht rührte die Feierlichkeit auch von den Männern her, die einzeln oder in kleinen Grüppchen über den Platz schritten, plaudernd, sich gegen die Sonne abschirmend, manche mit Schriftrollen unterm Arm. Sie trugen allesamt reinweiße Togen, ihre Gesichter waren glattrasiert, und im Gegensatz zu seinem Vater, der immer in Eile war, bewegten sich diese Leute geradezu provozierend gemächlich. Sie schlenderten auf das große Eckgebäude am Rande des Platzes zu und verschwanden lautlos darin. Das Gebäude hieß die Große Basilica. Dort fand die Demokratie statt: ein Spiel mit schwarzen und weißen Steinchen, die man in eine Urne warf, wie ihm sein Vater erklärte. Der Vierjährige wunderte sich ein wenig, dass diese ernsten Herren sich mit einem Wurfspiel beschäftigten. Aber was ihn noch stärker umtrieb: Wer durfte mitspielen?
Sein Vater jedenfalls nicht, so viel begriff Josse. Er unterschied sich schmerzlich von diesen reinweißen Gestalten. Und anstatt die heilige Ehrfurcht, die sein Vater vor diesen Männern empfand, zu teilen, entdeckte Josse an jenem Tag die Scham. Er begann, sich für seinen Vater zu schämen: für seinen jämmerlichen Akzent und für seine Armut und für seinen Blutgeruch, den er nie loswurde und dessen er sich ebenso wenig bewusst war wie seines Akzents. Je älter Josse wurde, desto mehr verachtete er seinen Vater, er durchlitt sogar Anfälle von Hass, und erst als der Alte, nachdem er tatsächlich seine Schulden abbezahlt hatte, erschöpft umfiel und nicht wieder aufstand, als er im Feuer aus altem Bauholz verbrannt wurde, und der Nieselregen den Rauch niederdrückte und Josse glaubte, er atme ihn, seinen Vater, ein – erst da rannen ihm die Tränen über die Wangen angesichts der restlosen Vernichtung dieses Elends.
Auch für seine Mutter schämte er sich. Jadwiga gehörte zu jenen Frauen, die schon alt geboren schienen. Dabei war sie einmal eine Schönheit gewesen, Josse verdankte ihr, ohne es zu wissen, sein Gesicht und seine tadellose Haltung. Aber das Leben hatte sie gekrümmt und ihr tiefe Sorgenfalten eingeprägt. Anders als ihr Mann neigte sie keineswegs zu falschem Optimismus, aber sie klagte auch nicht; sie hatte sich daran gewöhnt, dass das Leben gegen sie war. Die große Erfahrung ihres Daseins bestand darin, dass man dem Schicksal nicht entflieht. Sie hatte alles aufgegeben, war Hunderte Meilen gewandert; was Flucht bedeutete, konnte sie niemandem erzählen, und nicht nur, weil sie die Sprache schlecht beherrschte. Der Weg, der Hunger, die Angst; das Gefühl, der rauen Welt ausgeliefert zu sein. Aber vor allem: der Verlust der Heimat, die Fremdheit. Und wozu das alles? Um hier, im gepriesenen Italien, den letzten Rest des Ersparten zu verlieren. Sie hätte verrückt werden können, aber sie wurde gleichgültig. Sogar ihrem Mann gegenüber, der sich an ihrer Seite totschuftete.
Wenn es einen Grund gab, dass Jadwiga nicht einfach zu atmen aufhörte, dann war es ihr Sohn Jowna – denn so hieß er eigentlich; ihr Mann hatte ihn in der Schule als Josephus eingetragen, in der irrigen Annahme, es handle sich um einen römischen Namen. Aus Josephus wurde bald Josse, was Jadwiga als roh und stechend empfand. Sie nannte ihn beharrlich weiter Jowna, und das weiche w ihrer Muttersprache umfing das Wort wie eine Liebkosung. Für ihn stand sie morgens auf, für ihn ging sie weiter durch die Mühle des Lebens, kochte, buk an den freien Tagen Käsefladen, seine Lieblingsspeise, und flocht von früh bis spät Weidenkörbe, um wenigstens für ein oder vielleicht zwei Jahre das Schulgeld bezahlen zu können, obwohl sie von den geschälten Ruten Ekzeme an den Unterarmen bekam.
Aber Josse hatte keine Lust auf Schule. Er hatte keine Lust, vor dem Morgengrauen aufzustehen. Das chorische Sprechen auswendig gelernter Verse demütigte ihn. Er war zu stolz, um sich den Regeln der Mathematik zu unterwerfen.
Ein Jahr lang besuchte er den Unterricht widerwillig, aber mehr oder weniger regelmäßig, nicht so sehr wegen der endlosen Ermahnungen seines Vaters, sondern weil er die stumme Enttäuschung seiner Mutter schwer ertrug – bis sich das Schulproblem von selbst löste. Eines Nachts nämlich wurde er davon wach, dass Gegenstände aus dem Küchenregal fielen. Am nächsten Morgen war die halbe Stadt zerstört. Es gab kein Wasser, kein Brot, die Straßen waren von Schutt verstopft. Und während man überall mit dem Beräumen von Trümmern und dem Bergen von Toten beschäftigt war, begann für Josse eine Epoche paradiesischer Verwahrlosung.
Zusammen mit seinen Freunden durchstreifte er die Ruinen der Oststadt, bis sie zum Abendessen gerufen wurden. Anfangs waren sie zu dritt: Josse, Mugo und Felix, den sie aus unklaren Gründen Fisch nannten. Mugo, lang und altklug, war der Sohn einer Haarschneiderin. Einen Vater hatte er nie gehabt; das war ein Defizit, das Mugo durch Informationen ausglich, die er von seiner Mutter aufschnappte. Der Fisch dagegen war gedrungen und robust und zeigte stolz die Striemen vor, die ihm sein Vater zufügte. Beide waren Josse ergeben; und wenn sich ihnen nach und nach weitere Verwahrloste und Streunende anschließen wollten, so verstand Josse es stets, jeden zu vergraulen oder abzustoßen, der nicht seine Oberhoheit akzeptierte. So wurde er allmählich zum Anführer einer kleinen Bande – einfach aufgrund seines Anspruchs, es zu sein.
Über die Bandenjahre gibt es nachträglich überraschend wenig zu berichten, auch wenn Josse später dazu neigte, sie zu einer heroischen Epoche zu verklären. Es schien kein Zeitmaß zu geben. Die Jahre vergingen, ohne dass man der Zukunft näher kam. Die Sommer waren endlos, aber wenn man Josse gefragt hätte, was während dieser Sommer eigentlich geschehen war, wäre ihm wenig eingefallen. Einmal hatten sie bei riskanten Grabungen in den Ruinen einen alten Bronzekessel erbeutet; und einmal, als sie sich schon in fernere Stadtbezirke wagten, sogar eine Silbertasse, die sie für eine viel zu geringe Summe auf dem Kleinmarkt verscherbelten. Als sie älter wurden, lieferten sie sich kleine Gefechte mit anderen Banden oder jagten hin und wieder ein paar betrunkenen Touristen, die aus der näheren oder auch ferneren Umgebung ins Amphitheater oder in die legendären, aber heruntergekommenen Bordelle der Stadt strömten, ein paar Asse ab. Hauptsächlich aber gaben sich Josse und seine Kumpane heroischer Untätigkeit hin: Tagelang lagen sie im Gras hinter irgendeiner ruinösen Mauer, spuckten Kirschkerne um die Wette, leerten gemeinsam ihre erste, widerwärtig schmeckende Amphore Wein (die der Fisch seinem Vater gestohlen hatte) und begannen, kaum dass der Schatten eines Flaums die Oberlippe bedeckte, über die Beschaffenheit des Weibes zu rätseln und sich über Interpretationen obszöner Kritzeleien zu streiten, die sie auf den Hauswänden entdeckten. So reifte Josse zum Mann – fast ohne es zu merken.
Die einzige regelmäßige Tätigkeit, der er irgendwann nachzugehen begann, war das Training auf der Großen Palästra, das der Ertüchtigung der verweichlichten pompejanischen Jugend dienen sollte. Tatsächlich hatte die Stadt seit ihrer Kolonialisierung keinen Krieg mehr erlebt. Die Teilnehmerzahlen waren gering, es fehlte den jungen Zivilisten die Motivation, ihre Körper in ausdauernden Übungen für den militärischen Einsatz zu stählen, obwohl die Trainingsstunden, die im Auftrag der Stadt von Trebius Gallus durchgeführt wurden, kostenlos waren. Trebius war gerade aus dem Judäischen Krieg zurückgekehrt (nur sein rechter Unterarm war dortgeblieben). Er war Decurio einer Hilfstruppe gewesen. Seine Stimme war darauf trainiert, den Höllenlärm der Belagerungsmaschinen zu übertönen, und mit dieser Stimme schindete er seine Schutzbefohlenen auf der Palästra, als würde er an ihnen den Verlust seines Arms rächen wollen.
Dabei meinte er es gut. Er fand es richtig und nützlich, wenn junge Menschen geschunden und angeschrien wurden, wie er selbst einst geschunden und angeschrien worden war. Und seltsamerweise hatte Josse wirklich das Gefühl, hier meine es jemand gut mit ihm. Trebius beschäftigte sich mit ihm, erklärte ihm, wie er seinen Leib am besten vor Pech und Steinen schützte, die es von einer imaginären Festungsmauer herabregnete; er brachte ihm bei, was eine Finte ist und wie man einen Schild im Kampf handhabt. Und wenn Trebius ihm mit seiner übrig gebliebenen Hand auf die Schulter klopfte und ein paar anerkennende Worte grummelte, schluckte Josse vor Rührung.
Aber er stärkte auf der Großen Palästra nicht nur Muskeln und Ausdauer, sondern er lernte auch etwas über Taktik und Strategie. Er lernte, seine Angst zu unterdrücken und sich vor einem Kampf in einen Zustand der Ruhe und des Gleichgewichts zu bringen. Er lernte, seinen Gegner abzuschätzen und dessen Schwächen und Stärken zu erfassen, anstatt blindlings draufloszuschlagen. Er lernte es, mit seinen Kräften zu haushalten, sie im rechten Moment einzusetzen. Konzentration nannte es Trebius, und auch wenn er in allen anderen Lebensbereichen ein ziemlicher Idiot war – von Konzentration verstand er was.
Manchmal lud Trebius ihn noch zu einem Becher Wein in die sogenannte Gladiatorenkneipe ein, wo sich die Veteranen des Judäischen Krieges trafen, um sich gegenseitig daran zu erinnern, wie sie in Jerusalem die Freiheit verteidigt hatten. In ihren Berichten schien der Krieg eine erstaunlich dreckige, hinterhältige Angelegenheit zu sein, wobei es natürlich stets die andere Seite war, die sich dreckiger und hinterhältiger Methoden bediente. Sie berichteten von den Todesschwadronen der Juden, die durch geheime Gänge die Festung verließen und nachts über das römische Lager herfielen; oder von der berühmten Westhalle, auf die die Juden ein paar hundert römische Kämpfer gelockt hatten, um die Halle dann anzuzünden. Auch den Verlust seines Arms verdankte Trebius der Hinterhältigkeit der Juden.
Er war der Kommandeur einer Rammschildkröte gewesen: eines Rammbocks auf Rädern, der mit einem spitzen Dach aus Palmenholz und Eisenplatten versehen war, das die Besatzung vor Steinen und heißem Pech schützen sollte, während sie stunden- oder sogar tagelang in monotonem Rhythmus den an Ketten hängenden Eichenstamm in die Mauer rammte. Eines Tages nun war es den Juden gelungen, den Damm, der eigens für die Schildkröte errichtet worden war, damit sie an der richtigen Stelle angesetzt werden konnte, zu unterminieren. Vom Keller eines Festungsturms aus hatten sie einen Stollen gegraben, ihn mit ölgetränkten Balken abgestützt und diese angezündet, während die Maschine im Einsatz war. Trebius erinnerte sich, wie der Boden nachgab und wie das tonnenschwere, sieben Meter lange Gerät einsank, sich schräg stellte. Solange es aufrecht stand, trafen die von der Festungsmauer herabgeworfenen Steine in einem ungefährlichen Winkel auf das extrem spitze Dach. In der Schräglage aber konnte es den Angriffen nicht mehr standhalten. Es wurde von Steinen durchschlagen, brennendes Pech drang ein, die Konstruktion fing Feuer. Und wer nicht verschüttet worden war und dem Feuer entkam, dem schickten die Juden ihre Speere und Armbrustpfeile nach. Dass sein Arm zerquetscht war, merkte Trebius erst, als er – als Einziger – wieder im Lager ankam.
Natürlich waren sich die Veteranen darüber einig, dass die Opfer nicht umsonst gewesen seien. Für die Verteidigung Roms war kein Opfer vergebens. Wieso Rom aber ausgerechnet dort, in Jerusalem, verteidigt werden musste, blieb Josse unklar. Und bei aller Bewunderung für die Veteranen – eine militärische Laufbahn zog er lieber nicht in Betracht.
Mit siebzehn hatte er die Idee, Isis-Priester zu werden, und diente sich sogar als Helfer an. Allerdings flog er schon nach wenigen Wochen wieder raus, weil er im verbotenen Raum der Isis-Statue dabei erwischt worden war, wie er sich selbst befriedigte. Man muss die pompejanische Isis gesehen haben, um dem Siebzehnjährigen diesen Fehltritt durchgehen zu lassen. Also zog er, wenn er nicht auf der Palästra das Prügeln trainierte, weiter mit seiner Bande umher, schlief bis in den Mittag, träumte von unbestimmtem Ruhm und ließ sich nur selten, wenn er unbedingt ein paar Asse brauchte, hinreißen, sich als Tagelöhner auf einer Baustelle zu verdingen.
So vergingen Tage und Jahre, unmerklich und zäh, und dann, im Rückblick, doch wieder erstaunlich schnell. Manchmal, wenn er nach dem Konsum des elenden, geharzten Gesöffs, das man in der Wirtschaft der Asellina Wein nannte, in der Nacht aufwachte und nicht wieder einschlafen konnte, überkam ihn der Jammer. Er wälzte sich hin und her, hörte das Poltern der Räder auf dem Basaltpflaster. Er sah das Mondlicht durch die Ritzen zwischen Dachsparren und Wand und die Fledermäuse, die an den undichten Stellen in irgendwelche Zwischenböden huschten, aus denen ihr Kot auf die Bettdecken fiel. Seit dem Tod seines Vaters lebten seine Mutter und er in dieser Dachkammer, die sie für ein überhöhtes Entgelt bei einer gewissen Iulia Felix mieteten. Der halbe Verdienst seiner Mutter ging für die Miete drauf, und Josse fragte sich, wie es mit ihm weitergehen solle, wenn seine Mutter starb.
In solchen Nächten geschah es, dass er bedauerte, sich in der Schule so wenig Mühe gegeben zu haben. Von Reue geplagt, beschloss er, nicht mehr zu trinken und auch nicht mehr müßig mit seinen Kumpanen herumzuhängen, sondern mit irgendetwas zu beginnen. Er fing an, wieder Lesen zu üben (wobei sein Lesestoff in Ermangelung von Büchern vor allem in den Wandschmierereien an pompejanischen Hauswänden bestand – eine unerschöpfliche Anhäufung von Volksweisheiten und Obszönitäten). Er ging sogar Holz sammeln und Wasser holen, reparierte die Dielen und versuchte, die Ritzen in der Zwischendecke zu verstopfen. Aber so, wie seine Anfälle von Rastlosigkeit kamen, vergingen sie auch wieder. Josse spürte, dass ihn von jenen Herrschaften, denen er gern zugehören würde, mehr trennte als nur der Arbeitswille und die Fähigkeit, fließend zu lesen.
Es war einer dieser endlosen Nachmittage im Mai. Wie so oft verbrachten sie ihre Zeit damit, auf den Abend zu warten: Josse, Mugo, der Fisch, außerdem der rotbärtige Toni, Sabinus, der Spieler, der stämmige Paquius und Balbus, die Katze genannt, weil er jede Mauer hochkletterte. Die Sonne stand hoch über Pompeji, die Steine waren warm, auf den Brachen vergilbte das Gras – fünfzehn Jahre nach dem Großen Beben gab es noch immer Ruinen in der Nordoststadt. Die sieben jungen Leute lungerten zwischen den Mauerresten herum und langweilten sich, stritten aus lauter Übermut darüber, ob Crescens, der Netzkämpfer, oder Samus mit dem Kurzschwert der Größere unter den Gladiatoren der Fortunatus-Schule sei; ob es Juden schwarzer Hautfarbe gebe; ob in Arabien fliegende Schlangen die Obstbäume bewachten, wie es Tonis versoffener Vater bei Herodot gelesen haben wollte – lauter Fragen also, die für ihr Fortkommen von ungeheurer Bedeutung waren und daher gewöhnlich auch nicht durch Argumente, sondern durch Prügelei entschieden wurden, wobei Josse streng überwachte, dass man sich nach den Regeln schlug. Im Fall der fliegenden Schlangen schlug sich Toni mit dem Fisch. Der Fisch siegte, und die fliegenden Schlangen des Herodot wurden als Gerücht eingestuft.
Nachdem sie sich eine Weile gezankt und gerauft hatten, wurden sie erneut von der Nachmittagslähmung übermannt. Aber dann, aus dem Halbschlaf heraus, von flüchtigen Bildern inspiriert und von einer schläfrigen Erektion belästigt, begann irgendwer, von Weibern zu sprechen. Insgeheim wusste jeder von ihnen, dass die Geschichten, die hier in der Nachmittagssonne erzählt wurden, zu wesentlichen Teilen erfunden waren, denn ihre Erfahrungen auf diesem Gebiet waren äußerst dürftig. Überflüssig zu sagen, dass es kaum ein anständiges Mädchen gab, das zu vorehelichem Verkehr mit einem dieser Habenichtse bereit gewesen wäre. Zwar gab es unzählige Prostituierte in der Stadt, die billigsten bekam man schon für einen As. Aber für jemanden, der nichts hat, ist selbst ein As Geld. Außerdem hatten sie Bammel vor den abgeklärten Frauen. Einmal hatte es Josse mit der Kellnerin Smirna versucht, die gelegentlich für einen As die Röcke hob, aber ihre Eile hatte ihn so unter Druck gesetzt, dass er versagte. Kurz, es wurden hier wohl vor allem erfundene Geschichten erzählt, ja noch nicht einmal Geschichten, sondern Andeutungen von Geschichten, die hätten passieren können oder passieren könnten: Diese oder jene, wurde berichtet, habe gezwinkert, gelächelt oder sei vorbeigegangen, schon das genügte mitunter, um die Phantasie zu entzünden oder Hoffnungen zu wecken.
An diesem nicht enden wollenden Nachmittag im Mai war es der lange Mugo, der anfing, von Frauen zu reden. Sein Wissen war nicht immer zuverlässig, aber spektakulär. Dieses Mal ging es um den Vogelschutzverein. Dort nämlich, im Vogelschutzverein, seien Frauen zugelassen, hatte er bei seiner Mutter aufgeschnappt. Und nicht nur zugelassen, sondern auch wirklich da. Sie nähmen an den Sitzungen teil, und nach den Sitzungen, hatte er gehört, gehe es dort drunter und drüber. Drunter und drüber!
Vom Vogelschutzverein hatte auch Josse schon gehört. Aber was taten die da eigentlich, Vögel schützen? Vor wem? Und wozu? Mugos Erklärung schien plausibel: dass nämlich der Vogelschutzverein bloß ein Tarnname sei, unter dem die verbotenen Kyniker und EpikureerSchutz suchten. Und Toni, der im Streit um die geflügelten Schlangen verloren hatte, wollte auf einmal gehört haben, dass die Kyniker öffentlich vögelten, und zwar auch mit Hunden. Und der Fisch kannte sogar jemanden, der jemanden kannte, der im Vogelschutzverein war, und wenn sogar der Fisch jemanden kannte, der jemanden kannte, dann konnte es nicht weit her sein mit diesen Leuten.
Und so entstand aus der Trägheit eines späten Nachmittags, aus Neugier und Dummheit und einer anhaltenden sexuellen Notlage die Idee, diesem Vogelschutzverein einen Besuch abzustatten: ihn aufzumischen, dieses Wort machte die Runde. Man sprach einander Mut zu, das drastische Vokabular pompejanischer Hauswände wurde ausgiebig gebraucht. Dann zogen sieben junge Männer – unbewaffnet, aber im Bewusstsein enormer Schlagkraft – zum sogenannten Hühnerstall, wo die Vogelschützer angeblich ihre Sitzungen abhielten.
Doch der Hühnerstall war verschlossen, es war niemand da. Der lange Mugo versprach herauszufinden, wann der Verein das nächste Mal hier tagte.
Ja, tatsächlich gab es in Pompeji einen Vogelschutzverein, und wir kommen nicht umhin, über diesen Verein, in dem Josses denkwürdige Laufbahn begann, ein paar Worte zu verlieren.
Er war von einem Kreter gegründet worden, einem schrulligen Rhetoriklehrer mit dem unaussprechlichen Namen Epameinondas (den wir sogleich wieder vergessen können). Dieser Mann war ein großer Naturfreund und liebte es, barfuß im Somma-Gebirge nördlich der Stadt zu wandern, wo er eines Tages an einem flachen, kargen Hang, der als Schafsweide und erst recht als Schweineweide ungeeignet war, einen Schwarm toter Vögel entdeckte. Der Lehrer war sofort überzeugt, dass sie an den Leimruten zugrunde gegangen seien, welche massenhaft am Rand des Hochwaldes in den Bäumen hingen, um das Fluggetier einzufangen.
Das war im Jahr 815 nach Gründung der Ewigen Stadt gewesen oder, wenn man wiederum in pompejanischen Maßstäben misst, im ersten Jahr nach dem Großen Beben, und natürlich kümmerte sich niemand um den obskuren Verein. Die Stadt kämpfte ums Überleben, die Armen wohnten in einem Trümmerfeld, die Reichen aber waren auf ihre Güter geflohen, wo sie mit großem Appetit Wachteln, Amseln und Drosseln verspeisten. Obendrein verstarb der Vereinsgründer bald nach dem Beben an einer rätselhaften Krankheit, die vielleicht nicht ganz unzutreffend als Unterernährung zu bezeichnen war, und infolge des Todes ihres Meisters einigten sich die wenigen verbliebenen Mitglieder auf ein kollektives Leitungsprinzip, was eine Zeit lang glimpflich abging, denn – es gab nichts zu leiten. Aber dann bekam der Verein unerwartet Zulauf.
Die Heutigen, die davon ausgehen, dass das Reich ewig besteht, können die Reihe der sieben Kaiser von Augustus bis Titus – wenn man die Irrlichter des Vierkaiserjahres überspringt – im Schlaf herunterbeten. Die Frage, ob auch ein zukünftiger Leser sich an diese Göttlichen erinnern wird, könnte manchem guten Römer als blasphemisch erscheinen, indes wollen wir sichergehen, dass der geneigte Leser weiß, wovon die Rede ist. Daher gestatten wir uns, zwei Worte über den göttlichen Vespasian zu verlieren, Vater des Titus, denn hier ist die kleine Geschichte unseres Vereins mit der großen Geschichte des Reiches verknüpft.
Dem Vorgänger Vespasians ist ja die Göttlichkeit abgesprochen worden. Nero ist der ewigen Verdammnis anheimgefallen, und inzwischen ist es zumindest verpönt, wenn nicht gar sträflich, etwas Freundliches über ihn zu sagen, wie früher das Gegenteil sträflich war, sogar lebensgefährlich. Die Aristokratie hat Kaiser Nero immer gehasst, zuerst für seinen Gesang, weil man es ehrenrührig fand: nicht, dass er mittelmäßig sang und dabei die Finger abspreizte und den Kopf schief hielt, wenn er Wehmut darstellen wollte, nein, dass er überhaupt sang. Die hohen Herren fühlten sich persönlich dadurch beleidigt, dass einer ihresgleichen irgendwelche Kostüme anzog und vor dem Volk auftrat. Erst später, als Nero die Aristokratie mit Todesurteilen zu überziehen begann, teils, weil er ihr misstraute, teils aber auch, weil er durch die Konfiszierung der Vermögen Geld in die Kassen seines verschwenderischen Haushalts spülen wollte, begriffen sie, dass sein Gesang noch das Beste an ihm gewesen war.
Das Volk aber fand ihn amüsant, es liebte seine Feste und seine Auftritte und freute sich verstohlen, dass seine Schläge fast immer die Reichen und Mächtigen trafen. Und auch die Kunst und die Philosophie erlebten unter dem durchgedrehten Philhellenen eine bescheidene Blüte, wiewohl sich diese in der Nachahmung erschöpfte. Man schrieb ein paar griechische Buchrollen ab, erfand Denkerschulen, die es schon gab, und es wurde sogar in Provinzstädten Mode, in den Säulengängen zu wandeln und dabei auf Griechisch philosophische Dispute über Texte zu führen, die man nicht gelesen hatte.
Das änderte sich unter Vespasian. Er war ein guter Kaiser, jedenfalls wenn man es aus der Perspektive der Staatsfinanzen sieht. Tatsächlich schaffte es dieser Mann, den größten Amphitheater-Bau der Welt, das Kolosseum, unter anderem aus Pisse zu finanzieren, denn von den erbarmungslosen Steuergesetzen, die er erließ, betraf eines die Besteuerung der öffentlichen Urinale, aus denen die Walker und Färber einen ihrer wichtigsten Rohstoffe entnahmen. Auf die Idee muss man kommen. Vespasian schröpfte den Mittelstand, versöhnte sich mit der Aristokratie, er gab dem Senat ein paar Rechte zurück und richtete seine Grausamkeit freundlicherweise aufs Ausland: Während Nero ein paar hundert Christen brennen ließ, schickte Vespasian seinen Sohn Titus nach Jerusalem, wo dessen Armee eine halbe Million Juden abschlachtete, Priester, Frauen und Kinder eingeschlossen.
Ja, er war zweifellos ein bedeutender, ein wahrhaft römischer Kaiser: Vespasian. Ein strenger und sparsamer Mann mit quadratischem Gesicht, der seine Zeit nicht für Kunst und schöne Literatur verschwendete. Er verstand etwas von Finanzmathematik und Straßenbau, aber er langweilte sich bei jedem Konzert; noch unter Neros Herrschaft brachte er sich einmal in Lebensgefahr, weil er während dessen Darbietung einschlief.
Noch weniger als die Kunst schätzte er die Philosophie. Er mochte einfach keine Grübler und Zweifler, keine Leute, die immer alles in Frage stellten, überall Widersprüchliches sahen und die Dinge so lange wendeten und drehten, bis nichts Verlässliches mehr übrig blieb. Er hielt die intellektuellen Vereine Roms – zu Recht – für republikanisch. Zwar stellte er sich selbst als Republikaner dar und sprach öffentlich gern von der Römischen Republik, in welcher er nur der Erste unter Gleichen sei; aber als ein paar Männer dagegen aufbegehrten, dass er seinen Sohn Titus schon zu Lebzeiten als Thronfolger etablierte, ließ er sie wegen Zugehörigkeit zu einer kynischen Vereinigung auf den Balkan verbannen und entzog den Philosophen landesweit das Recht, Vereine zu gründen – womit wir wieder bei der Geschichte unseres Vogelschutzvereins wären.
Denn so geschah es, dass der Vogelschutzverein – beinahe wie der lange Mugo es dargestellt hatte – unmerklich zu einem Sammelpunkt all jener verstreuten, schwächlichen Strömungen wurde, die der amtierende pompejanische Magistrat als philosophisch einstufte. Deren Anhänger waren es, die sich nun ein-, höchstens zweimal monatlich trafen, um unter dem Vorwand des Vogelschutzes mehr oder weniger ungehemmt über politisch-philosophische Themen zu disputieren.
Auf diese Weise hatte sich die Zahl der Vereinsmitglieder seit dem Tod des Gründers von neun auf neunundvierzig erhöht. Längst hatten sie aufgehört, sich in privaten Wohnzimmern zu versammeln; stattdessen mietete der Verein für billiges Geld eine alte Schmiede nordöstlich der Stadt, die vor dem Großen Beben als Produktions- und Lagerstätte des berühmten pompejanischen Garums genutzt worden war – jener Soße, die, wie dem geneigten Leser vielleicht bekannt ist, aus Fischabfällen hergestellt wird, welche monatelang in der Sonne zu verfaulen haben, bevor sie durch wundersame Wandlung in jenes köstliche Elixier übergehen.
Josse hatte sich niemals Gedanken darüber gemacht, warum das Gebäude, in dem die Vogelschützer sich trafen, Hühnerstall genannt wurde. Die Erklärung ergab sich, bevor er die Frage stellen konnte. Es war inzwischen Juni geworden, der Tag war heiß. Alter Fischgeruch stieg aus den Poren des Bauwerks auf, vermischte sich mit dem Geruch von Schweiß und Atem, wie ihn offenbar nur erregt disputierende Philosophen absondern, und dem Duft mitgebrachter Speisen, die man während der Sitzung verzehrte, verkrümelte und festtrat. Es roch wie in dem Stall, in dem Lucretius seine heiligen Hühner hielt. Die Vereinsmitglieder saßen auf Bohlen, die man links und rechts in aufsteigender Folge angeordnet hatte, und während im Dachgebälk die Tauben gurrten und flatterten, wurde ununterbrochen in Gruppen und Grüppchen palavert, es wurde dazwischengerufen, beantragt und protestiert. Ein Versammlungsleiter sprang herum und rief die Anwesenden vergeblich zur Ordnung, während an der dem Eingang gegenüberliegenden Schmalseite ein Mann vor – ja, vor was? – einer Waschschüssel stand.
Tatsächlich waren auch Frauen da, wie Mugo es angekündigt hatte. Frauen redeten, stritten, wedelten sich, die Waden entblößend, mit den Röcken Luft zu. Aber es war vollkommen klar, dass es hier nicht um Anzügliches ging; hier wurde kein Fest gefeiert, keine Orgie war hier im Gang. Aber was war es sonst? Worum ging es?
Josse ließ sich mit seinen Kumpanen stumm auf dem Fußboden in der Nähe des Eingangs nieder. Es dauerte eine Weile, bis er begriff, dass der Mann, der da vor einer Waschschüssel stand, einen Vortrag hielt. Allerdings redete er viel zu leise. Josse legte seine Hände wie Schalltrichter hinter die Ohren, versuchte, die Worte des Mannes zu erhaschen: Boden … Gestein … Monte Somma … Und dann plötzlich dieses Wort: Vulkan. Oder hatte er sich verhört?
Erst nachträglich würde Josse erfahren, wer dieser Mann war und warum ihn die Vogelschützer eingeladen hatten. Es war nicht das erste Mal, dass sich ein externer Referent im Hühnerstall daran versuchte, die Ursachen des allgemeinen Vogelsterbens darzulegen. An diesem Tag sprach ein Bergbauspezialist, der lange in den Iulianischen Bleiminen tätig gewesen war. Die Initiative, ihn herzubitten, war von den Epikureern ausgegangen, genauer gesagt: von ihrer hedonistischen Fraktion, was ein wichtiger Unterschied ist, denn die Epikureer waren untereinander aufs Übelste verfeindet. Es ging um die Frage, ob der Kern des Epikureismus hedonistisch oder, ganz im Gegenteil, asketisch sei. Die Mehrheit, angeführt von einem Sanguiniker namens Diablo (den wir noch kennenlernen werden), neigte zur hedonistischen Auffassung, während eine kümmerliche Resttruppe noch immer verbittert darum kämpfte, Epikur von dem üblichen Vorwurf der Genusssucht und der Obszönität zu rehabilitieren, was wiederum nach Auffassung der Hedonisten eine »arschkriecherische Anpassung an den römischen Moralismus« (Diablo) darstellte. Zwar hatten die Asketen ihren Epikur genauso wenig gelesen wie die Hedonisten, dennoch hatten sie recht, wie wir uns anzumerken erlauben: Epikur war, wie alle Zeitdokumente bestätigen, ein humorloser, magenkranker Mann gewesen, dessen ganzes Streben sich weniger auf Lustgewinn als auf Schmerzvermeidung richtete. Seine Philosophie war kränklich und vorsichtig, gemacht für eine Welt, in der die Mächtigen allzu mächtig und die Ohnmächtigen allzu ohnmächtig geworden waren. Jede Leidenschaft fand der alte Epikur riskant, jede Hingabe gefährlich. Und wenn er von Lust sprach, dann meinte er etwa jenen genügsamen Gleichgewichtszustand, den ein Wiederkäuer zwischen zwei Verdauungsgängen empfinden mag.
Man verzeihe uns diesen kleinen Exkurs, aber es war in gewisser Weise eben diese Fehldeutung – der missverstandene Epikur –, die unsere Geschichte in Gang brachte, denn die sogenannten Hedonisten frönten neben anderen Leidenschaften insgeheim auch dem Verspeisen köstlicher Wachteln und Amseln, und deswegen, nicht etwa aus wissenschaftlichen oder philosophischen Gründen, waren sie so erpicht darauf zu beweisen, dass nur ein geringer Anteil des Fluggetiers dem Verzehr zum Opfer fiel. Sie sammelten tote Vögel, um zu dokumentieren, dass im Gefieder der allermeisten kein Fangleim zu finden sei, und entdeckten bei ihren Expeditionen im Somma-Gebirge nach und nach immer mehr andere tote Tiere: Eidechsen, Insekten, einmal sogar ein Wildschwein.
Bis eines Tages auch zwei Vereinsmitglieder, die sich auf einer Expedition im Somma-Gebirge befunden hatten, tot aufgefunden wurden. Zeichen von Gewalteinwirkungen waren nicht zu erkennen. Die Toten hatten sich neben eine Quelle gebettet wie zum Schlaf. Der Kopf des einen Wanderers ruhte auf seinem Bündel, der andere Wanderer lag bäuchlings im Gras. Und in der Umgebung, so hieß es, roch es schweflig. Die Epikureer fühlten sich durch das tragische Ereignis bestätigt – aber worin eigentlich? Woran waren die beiden gestorben?
Unter den pompejanischen Lokalphilosophen brach wie immer ein leidenschaftlicher Diskurs aus. Die Radikalplatoniker, die selbst zu rabiaten Methoden neigten, vermuteten einen politischen Mord und riefen zum Handeln auf. Die Aristoteliker mahnten zur Besonnenheit und wurden von den Radikalplatonikern der Kollaboration beschuldigt. Die Sophisten sahen verschiedene Möglichkeiten. Die Kyniker, auch davon gab es hier einige, hoben ihre Gleichgültigkeit gegenüber dem Tod hervor. Ein paar Anhänger des Heraklit stritten sich mit ein paar Anhängern des Parmenides über die Ereignishaftigkeit des sich ereignenden – oder nicht ereignenden – Ereignisses. Die Pythagoreer waren zerrissen. Die separatistische Fraktion um einen Mann namens Maras war sich mit den Fundamentalisten, die von einer Frau namens Dito angeführt wurde, darin einig, die Schuld nicht in der Natur, sondern auf jeden Fall bei der römischen Aristokratie zu suchen. Nur die Epikureer, genauer gesagt, Diablos hedonistische Fraktion, vertraten unbeirrt die These, dass Gase, wie man sie aus dem Bergbau kennt, die Ursache des tragischen Unfalls wie auch des Vogelsterbens seien, und beauftragten einen Bergbauspezialisten mit der Untersuchung der Angelegenheit.
Der Mann hieß Georgios, stammte aus Syrakus und hatte sein halbes Leben am Fuß des Ätna verbracht – was sich als entscheidend erweisen sollte. Georgios untersuchte die Angelegenheit eine Woche lang gründlich, sprach dabei wenig, befragte Bauern und Schäfer, machte sich Notizen, klopfte hier und da Gesteinsproben ab und ließ mit einem irren Lächeln die Erde der Weinplantagen durch seine Finger rieseln. Dann bestieg er mit einem Gerät zur Vermessung von Winkeln und Entfernungen den Monte Somma, wanderte sogar bis zu den Phlegräischen Feldern. Er kostete das Wasser der Brunnen in den Gehöften am Fuß des Gebirges. Mehr als einmal lag er stundenlang auf dem Boden, sodass man glauben konnte, er selbst sei Opfer giftiger Ausdünstungen geworden. Und nach genau einer Woche verkündete er seinen Auftraggebern ohne Pathos, dass man auf einem Vulkan lebe – und ließ sich überreden, seine Erkenntnisse dem Vogelschutzverein vorzutragen.
Auch wenn Georgios äußerlich bescheiden auftrat, war er davon ausgegangen, dass seine Botschaft auf höchstes Interesse stoßen und die Ergebnisse seiner Nachforschungen mit Respekt und Staunen aufgenommen würden. Allenfalls war er eingestellt auf Fassungslosigkeit oder auf irrationale Abwehrreaktionen, und als er erfuhr, dass dem Verein auch Frauen angehörten, riet er sogar dazu, sie vorsichtshalber vom Vortrag auszuschließen (was mit einem Schmunzeln quittiert wurde). Als er den Hühnerstall betrat, erging es ihm jedoch nicht viel anders als Josse. Die Gestalten, die den Raum bevölkerten, waren ihm schon durch ihr Erscheinungsbild suspekt: Kostüme wie zu den Saturnalien, Halsketten, Hütchen, Stickereien, Bärte und lange Haare. Er selbst, muss man wissen, verabscheute jede äußerliche Auffälligkeit. Er war ein Mann der Systematik und Empirie, darin dem Kaiser nicht unähnlich. Er war jemand, der den Homer zugeklappt hatte, nachdem er auf Unstimmigkeiten in Zeit- und Altersangaben gestoßen war. Kurz, er war, obgleich Grieche, in seinem Wesen ziemlich römisch veranlagt. Und das hier roch ziemlich unrömisch; es roch nach Unordnung und Opposition.
Abgestoßen von der Horde, gestört durch die Unruhe und das Gezänk in den Sitzreihen, angewidert von der Respektlosigkeit des Auditoriums, spulte er seinen Vortrag ab. Er kümmerte sich nicht darum, ob ihm jemand folgte, ob ihn jemand verstand. Er wollte fertig werden, wollte so schnell wie möglich verschwinden, bevor er erstickte und umfiel oder bevor, wer weiß, die Garde kam und all diese Chaoten verhaftete. Er versuchte gar nicht erst, gegen den Lärm anzubrüllen, sprach leise und monoton, arbeitete stur seine Stichpunkte ab – und man musste ihm zuhören wollen, um ihn zu verstehen.
Und Josse wollte. Augenblicklich hatte er den ursprünglichen Zweck des Besuches vergessen. Mit aufgerissenen Augen und durch Handflächen vergrößerten Ohren lauschte er den erstaunlichen Gedankengängen des Mannes, und jedes Wort, jeder Satz prägte sich fest in sein ungeprägtes Gehirn; nicht einmal ein Paar wasserblauer Augen, das ihn von irgendwoher aus den Bankreihen anschwirrte, konnte ihn ablenken.
Es sei bereits an der Art der Vegetation abzulesen, erklärte der Mann. Erst recht an den Böden und am Gestein, das er gründlich untersucht habe. Das Quellwasser in den Bergen habe jenen unverwechselbaren Beigeschmack. Und der Gipfel des Monte Somma sei eindeutig aus einem Krater hervorgegangen, das habe er mit Hilfe von Lot und Visierkreuz festgestellt. Diese Landschaft sei unzweifelhaft vulkanisch – wie auch die Landschaft in seiner Heimat Syrakus am Fuß des Ätna. Das, worauf man hier stehe, worauf der Wein so prächtig gedeihe, sei nichts anderes als vulkanische Asche, die bei einer gewaltigen Eruption aus der Erde geschleudert worden sei und alles Lebendige ringsum verschüttet habe. Der Tuffstein, aus dem man Häuser baue, das Pflaster, auf dem man gehe, sei nichts anderes als erkaltete Lava. Einige hundert, vielleicht sogar tausend Jahre habe der Vulkan offenbar geruht und dem Leben Zeit gelassen, sich zu erneuern. Aber seit dem sogenannten Großen Beben, sagte der Mann, während er eine schematische Zeichnung im Sand entwarf, mehrten sich die Anzeichen für einen erneuten Ausbruch.