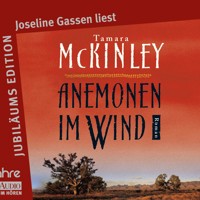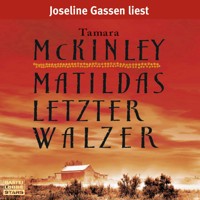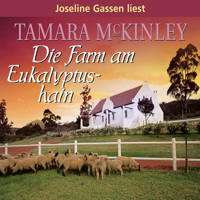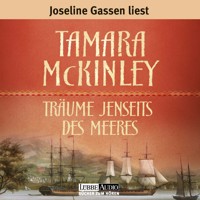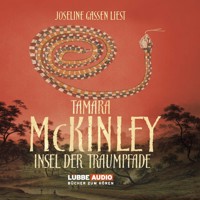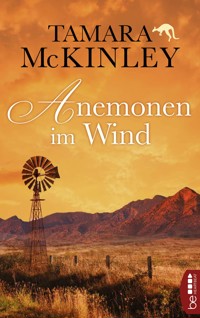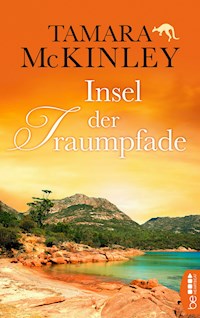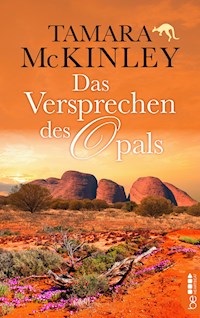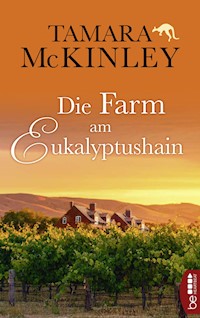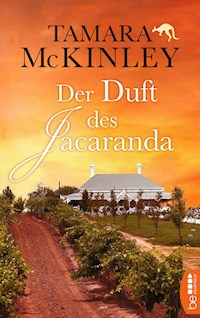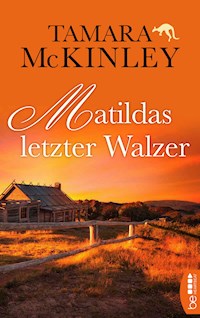7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Australien 1946. Die jung verwitwete Becky kehrt mit ihrem kleinen Sohn Danny zu ihrer Familie nach Morgan's Reach zurück. Ihr Mann ist im Krieg gefallen, doch seine Leiche wurde nie gefunden - und der kleine Danny weigert sich zu glauben, dass sein Vater wirklich tot ist. Immer wieder unternimmt er Streifzüge ins Outback, um dort nach ihm zu suchen. Als Morgan's Reach eines Tages von einem verheerenden Buschfeuer bedroht wird, fürchten die Bewohner um ihr Leben - und Danny ist spurlos verschwunden...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 489
Ähnliche
Inhalt
Über die Autorin
Tamara McKinley wurde in Australien geboren und verbrachte auch ihre Kindheit im Outback des fünften Kontinents. Heute lebt sie an der Südküste Englands, aber die Sehnsucht treibt sie stets zurück in das weite, wilde Land, dessen faszinierende Facetten sie in jedem ihrer Australienromane zum Leben erweckt.
Besuchen Sie die Autorin auf ihrer Website
Tamara McKinley
Das Land am Feuerfluss
Roman Übersetzung aus dem Englischen von Marion Balkenhol
BASTEI ENTERTAINMENT
Vollständige E-Book-Ausgabe
des in der Bastei Lübbe AG erschienenen Werkes
Bastei Entertainment in der Bastei Lübbe AG
Titel der englischen Originalausgabe: »Firestorm«
Für die Originalausgabe: Copyright © 2013 by Tamara McKinley Published by arrangement with Quercus Publishing Plc., London
Für die deutschsprachige Ausgabe: Copyright © 2014 by Bastei Lübbe AG, Köln Umschlaggestaltung: Gisela Kullowatz Umschlagmotiv: © getty-images/Panoramic; © picture alliance/Design Pics E-Book-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-8387-4486-5
www.bastei-entertainment.de
www.lesejury.de
Die Liebe hat viele Ausprägungen – und jede folgt ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten, geformt von äußeren Umständen, Erfahrung und Erwartung.
Lange bevor die Weißen nach Australien kamen, hatten die Aborigines schon die Bedeutung des Feuers erkannt, denn es reinigt und beseitigt die Reste der alten Vegetation, um im Buschland des Outback einen neuen Kreislauf des Lebens in Gang zu setzen und zu nähren.
1
Brisbane 1946
Er wusste, dass er mit Sicherheit eine befremdliche Figur abgab in dem schlecht sitzenden Anzug, den jemand ihm freundlicherweise überlassen hatte. Doch er hatte Geld in der Tasche und die Entlassungspapiere der Armee im Seesack. Im Grunde war er ein freier Mann.
Nicht nur der helle Glanz auf dem Wasser des Brisbane River trieb ihm Tränen in die Augen, denen er schließlich ungeniert freien Lauf ließ. Er hatte so lange auf seine Rückkehr nach Australien gewartet, hatte sich die Düfte, Bilder und Geräusche des Landes in der Erinnerung und im Herzen bewahrt wie ein süßes Versprechen, um den Dschungelkrieg und die Entbehrungen der japanischen Kriegsgefangenenlager zu überstehen. Dennoch hatte die Rückkehr ihm keine Erlösung gebracht. Selbst nach den langen Monaten im Krankenhaus verfolgten ihn seine Erlebnisse noch immer, und nun musste er sich einem neuen Kampf stellen – gegen einen anderen, weit gefährlicheren Feind.
Er war vierunddreißig und hatte Dinge gesehen, die kein Mensch jemals sehen sollte; er hatte die unmenschlichsten Schlachten überlebt, nur um festzustellen, dass sein geschwächter, zerschundener Körper von Krebs befallen war und er ohnehin sterben würde. Diese Ironie des Schicksals hatte ihn hart getroffen, und im Stillen haderte er mit der Grausamkeit dieser Situation. Er wischte die Tränen fort und bemühte sich um Haltung.
Sobald er bereit war, sich wieder der Welt zu stellen, warf er den Seesack über die knochige Schulter, kehrte dem Fluss den Rücken zu und machte sich auf den Weg zum Bahnhof. Am Morgen hatte er das Hospital gegen den ärztlichen Rat verlassen. Der Chirurg schien allerdings zu verstehen, dass sein Patient das Bedürfnis verspürte, die ihm verbleibende Zeit zu nutzen, um die momentane Freiheit zu genießen und einen gewissen Frieden zu finden.
Langsam schritt er durch die emsige Stadt, beeindruckt von den neuen Gebäuden und der Zielstrebigkeit der Menschen ringsum. Nach all den Jahren, in denen er Befehle ausgeführt und unter der Knute gestanden hatte, war es beängstigend, frei zu sein, und der Verkehrslärm und das Gewusel der Passanten verwirrten ihn. Die Stadt hatte sich während seiner Abwesenheit verändert, er selbst allerdings auch. Er war nun ein Fremder, unsichtbar für seine Mitmenschen, eine dürre, schemenhafte Gestalt, der man nicht einmal einen flüchtigen Blick schenkte.
Diese mangelnde Aufmerksamkeit traf ihn jedoch nicht, denn sein Herz und sein Verstand waren auf einen weit entfernten Ort konzentriert; auf einen Ort, dessen Stille nur vom Rauschen des Windes im Eukalyptus gestört wurde; ein Ort, an dem sich ein gewaltiger Himmel über endlose fruchtbare Ebenen und mit Buschwerk bewachsenes Weideland wölbte und ein klares, helles Licht auf die alten Wallaby-Fährten fiel, die ihn schließlich nach Hause führen würden.
Dunkles Donnergrollen wälzte sich über das Outback. Der Himmel bezog sich mit schwarzen Wolken, gezackte Blitze gingen über den Hügeln nieder und spiegelten sich in den nahezu ausgetrockneten Flüssen und Wasserlöchern. Die Hitze war enorm, die Luft förmlich aufgeladen von dem mächtigen Gewitter, das sich südwestlich von Morgan’s Reach zusammenbraute. Die verängstigten Farmer, die von ihrem verdorrten Land in diesen bedrohlichen Himmel schauten, beteten, die Wolken mögen diesmal aufbrechen und nach drei langen Jahren des Wartens endlich Regen bringen.
Morgan’s Reach existierte nur aufgrund einer natürlichen Quelle, die selbst in den trockensten Jahren Wasser führte. Die kleine Ansiedlung von weniger als zwanzig Wohnstätten lag tief im Outback von Queensland, weit abgelegen von der Fernstraße, am Ende eines gewundenen Feldwegs. Die Hauptstraße war eine halbe Meile lang und breit genug, um ein Ochsengespann aufzunehmen, aber sie führte nur zu den Trails der Schafe und Rinder sowie zu den alten Fährten der Aborigines und der Wildtiere, die ringsum durch das Buschland streiften. Für Morgan’s Reach gab es keine Wegweiser, denn die Menschen, die auf den großen Schaf- und Rinderfarmen der Gegend lebten und arbeiteten, wussten, wo es zu finden war. Außenstehenden blieb es daher verborgen, bis sie geschäftlich dort zu tun hatten.
Rebecca Jacksons Großvater, Rhys Morgan, ein Arzt, Forscher, Abenteurer, Wohltäter und Exzentriker, stolperte im Jahr 1889 über diese abgeschiedene Oase. Nachdem er den seiner Meinung nach perfekten Platz für ein Buschkrankenhaus entdeckt hatte, feierte er seinen vierzigsten Geburtstag mit der Grundsteinlegung für das Hospital und gab der Ansiedlung seinen Namen. Dann fehlte ihm nur noch eine Ehefrau.
Gwyneth Davies war zwanzig und fühlte sich von ihren Eltern ständig unter Druck gesetzt; sie bedrängten ihre Tochter, einen Mann zu heiraten, der ihnen – wie sie glaubten – zu einer höheren Stellung in der Gesellschaft von Brisbane verhelfen würde. Gwyneths Entschlossenheit dazu geriet ins Wanken, als sie auf dem Bürgersteig vor dem Tuchladen förmlich in Rhys Morgan hineinlief. In der Zeit, die sie benötigte, um ihre Pakete einzusammeln und seine Einladung zu einer Tasse Tee in einem benachbarten Café anzunehmen, hatte Gwyneth sich verliebt.
Trotz ihrer vornehmen Erziehung war Gwyneth von zähem walisischen Geblüt, und die Aussicht, ihr Leben am Ende der Welt zu verbringen, schüchterte sie keineswegs ein. Sie wusste, dass sie mit diesem aufregenden, passionierten Mann an ihrer Seite ein Abenteuer eingehen würde.
Dennoch war sie eine Frau mit Grundsätzen, und als sie einen flüchtigen Blick auf das Buschwerk und die Blechhütte geworfen hatte, in der ihr frischgebackener Ehemann mit ihr leben wollte, machte sie ihm unmissverständlich klar, dass sie sich darauf nicht einlassen werde.
Rhys erstarrte in Ehrfurcht vor seiner forschen jungen Frau und erkannte sofort, dass er ihr ein angemessenes Heim schaffen müsse, um sie zu halten.
Gwyneth kontrollierte die Bauarbeiten des Hauses mit einem wachsamen Auge fürs Detail. Als sie zufrieden war, stellte sie die mitgebrachten Möbel auf, krempelte die Ärmel hoch und nahm die Herausforderung ihres neuen Lebens an.
In den folgenden Jahrzehnten arbeitete Gwyneth an Rhys’ Seite, versorgte die Kranken und tröstete die Sterbenden. Sie ertrug die Fliegen und den Staub in dieser äußerst primitiven Umgebung und lernte, Feuer, Überschwemmungen, Hitze und Dürre zu überstehen, während sie sechs Kinder großzog und die Schulbehörde drangsalierte, eine Lehrerin in die kleine Schule zu entsenden, die Gwyneth in der Stadtmitte gegründet hatte.
Drei seiner Enkelkinder, Millicent, Rebecca und Terence, hatten Rhys besonders nahegestanden, und er hatte so lange gelebt, dass er seinen Urenkel Danny noch kennenlernen konnte. Als Rhys im Frühjahr 1939 den Belastungen der unwirtlichen Umgebung und seiner weit gestreuten Aktivitäten erlag, hatte er das stolze Alter von neunzig Jahren erreicht.
Damit hatte Gwyneth nicht nur einen Ehemann, sondern auch ihren engsten Freund verloren, und sie trauerte noch immer um ihn. Dennoch erfüllte es sie mit Dankbarkeit, dass er in Frieden gegangen war, in der Gewissheit, dass sein ältester Sohn Hugh das Lebenswerk des Vaters fortführen und Hughs Frau Jane und seine Tochter Rebecca ihm dabei zur Seite stehen würden.
Das Buschkrankenhaus hatte sich seit den frühen Anfängen verändert. Die technische Ausstattung war inzwischen deutlich verbessert. Die alte, baufällige Hütte war durch einen einstöckigen Holzbau ersetzt worden, der etwas zurückgesetzt von der Straße auf einem großen Grundstück stand. Die breiten Veranden und grün gestrichenen Fensterläden sorgten an heißen Tagen für Schatten. Man hatte einen Blick auf den Feldweg, der schließlich in die Fernstraße mündete. Es gab einen Krankensaal, einen Isolierraum, ein Sprechzimmer mit einem dahinterliegenden kleinen Operationssaal für Notfälle, eine Küche sowie ein gut eingerichtetes Bad und eine Toilette im Haus. Die Medikamente wurden hinter einer stabilen Tür verschlossen aufbewahrt, und das Funksprechgerät war mit dem benachbarten Wohnhaus verbunden, wo Rebecca und ihr neunjähriger Sohn Danny inzwischen mit Rebeccas Eltern lebten.
Rebecca hatte alle Fensterläden geschlossen, um die glühende Mittagshitze auszusperren, sodass es im Krankensaal schummrig war. Es hätte relativ kühl sein sollen, doch der quietschende Deckenventilator vertrieb die Hitze nicht. Als Rebecca sich anschickte, nach ihren sechs Patienten zu sehen, nahm sie sich vor, ihn ölen zu lassen, bevor alle verrückt würden.
Ihre gestärkte Schürze knisterte, als sie leise auf Gummisohlen an den Betten vorbeiging. Es war ungewöhnlich, dass sämtliche Betten belegt waren, doch keiner der Fälle hatte sich als so schwerwiegend erwiesen, dass man einen Flying Doctor hätte rufen müssen. Dieser Arzt erreichte im Notfall entlegene Gebiete per Flugzeug und flog die Kranken bei Bedarf ins große Hospital von Brisbane aus. Doch das war nicht nötig gewesen. Die meisten Patienten würde man am nächsten Tag bereits entlassen. Froh, dass diese es nach ihrem Mittagessen bequem hatten, ließ Rebecca sie in Ruhe vor sich hin dösen und trat hinaus auf die Veranda.
Die Hitze flimmerte über dem breiten Feldweg, die stehende Luft war von einem scharfen Geruch nach Kupfer durchsetzt, der ein schweres Gewitter ankündigte. Eukalyptusbäume welkten an dem fast trockenen Wasserloch, die Vogelstimmen waren verstummt, und die Sonne brannte auf die Wellblechdächer und das gelbe Gras hernieder. Seit mehr als drei Jahren hatte es keinen nennenswerten Regen mehr gegeben. Die Wahrscheinlichkeit einer Feuersbrunst wuchs von Tag zu Tag, und die Betreiber der entlegenen Rinder- und Schaffarmen hatten Mühe, Futter und Wasser für ihren schwindenden Viehbestand aufzutreiben.
Rebecca öffnete den oberen Knopf ihres blau-weiß gestreiften Kleides, erleichtert, dass sie keine gestärkten Kragen und Manschetten tragen musste, wie es während ihrer Ausbildung in Sydney Pflicht gewesen war. Sie warf einen prüfenden Blick auf die Uhr, die an ihren Schürzenlatz gesteckt war, und betrachtete die dunklen Wolken, die sich im Westen auftürmten, sowie die verlassene Straße, die sich durch die kleine Ansiedlung zog. Von Danny war keine Spur zu entdecken, obwohl sie ihm unmissverständlich befohlen hatte, gegen zwölf wieder zu Hause zu sein. Unter diesen Umständen, dachte sie finster, läuft er Gefahr, seine morgige Geburtstagsfeier zu verpassen.
Gereizt kaute sie auf ihrer Unterlippe, denn ihr fiel ein, dass er sich am Morgen geweigert hatte, ihr zuzuhören, als sie ihm erneut zu erklären versucht hatte, dass sein Vater Adam tot sei und keinerlei Hoffnung auf seine Heimkehr bestehe. Danny war davongestürmt und hatte die Fliegengittertür hinter sich zugeschlagen. Die Angewohnheit ihres Sohnes, immer wieder im Busch zu verschwinden, war beängstigend – nicht zuletzt wegen des Grundes, aus dem er es weiterhin tat. Sie hatte gehofft, dass er nun, da er ein Internat in Brisbane besuchte, aus seiner Besessenheit herauswachsen und erkennen würde, dass es sich um eine kindliche Phantasie handelte, die einer tiefen Sehnsucht entsprang. Aber offenbar hatte sich nichts geändert. Diese Schulferien würden demselben Muster folgen wie alle vorherigen.
Rebecca hatte lange darüber nachgedacht, wie sie mit Danny umgehen solle. Sie war sogar die sechzig Meilen zur Killigarth-Farm im Norden gefahren, um sich bei ihrer besten Freundin, Amy Blake, Rat zu holen. Deren Lebensumstände ähnelten ihren eigenen sehr, denn auch Amy war Witwe. Ihr Mann John war genau wie Adam in Malaya umgekommen. Amy lebte bei ihren Eltern auf der Rinderfarm und hatte daher – ebenso wie Rebecca – die Liebe und Unterstützung ihrer Familie, die ihr in der schmerzhaften Trauerzeit und bei der Erziehung ihres Sohnes George beistand, der genauso alt war wie Danny. Doch selbst die kluge und freundliche Amy konnte nicht helfen, weshalb Rebecca sich manchmal sehr einsam fühlte.
Ungehalten darüber, dass sie sich in Selbstmitleid erging, verließ Rebecca den Schatten der Veranda, schob die äußere Fliegengittertür auf und ging die Stufen hinunter ins grelle Sonnenlicht. Sie war an die Launen des Wetters im Outback gewöhnt, war sie doch in Morgan’s Reach geboren und aufgewachsen und hatte fast jedes ihrer dreißig Lebensjahre hier verbracht. Trotzdem war es traurig zu sehen, wie sehr die Dürre dem wunderschönen Garten ihrer Mutter zugesetzt hatte.
Sie überquerte den welkenden Rasen, bemerkte, dass der alte Kleintransporter ihres Vaters an der Treppe zum Farmhaus abgestellt war, und schob sich durch die Fliegengittertür, die Veranda und Haus schützte. Seit ihrer Kindheit hatte sich nicht viel verändert, denn die Möbel waren schon immer angeschlagen, die Vorhänge und Teppiche durch die Sonne ausgebleicht gewesen, aber es war ihr Zuhause – ein Refugium, in das sie mit Danny zurückgekehrt war, als es Gewissheit wurde, dass Adam nicht aus dem Krieg heimkehren würde.
Rebeccas Eltern, Hugh und Jane, saßen in der schäbigen Küche; die Reste ihres hastigen Mittagessens waren auf dem Tisch verteilt. Hugh wirkte erschöpft; er hatte dunkle Ränder unter den Augen, aber Jane wirkte in ihrer Schwesternuniform wie immer kühl und elegant.
»Habt ihr Danny gesehen?«, fragte Rebecca.
Hugh schüttelte den Kopf. »Ich bin gerade erst von der Waratah-Farm zurückgekehrt und unterwegs nicht an ihm vorbeigekommen. Warum? Ist er schon wieder ausgerissen?«
Rebecca nickte und ging zurück zur Tür. »Ich sehe mal nach, ob er bei Gran ist.«
»Du machst dir zu viele Sorgen um den Jungen.« Hugh gähnte ausgiebig. »Morgen wird er zehn, und er kennt sich aus im Busch.«
Rebecca und ihre Mutter wechselten vielsagende Blicke, denn sie teilten die Sorge um Danny, die sehr wenig damit zu tun hatte, dass ihm der Busch und dessen Gefahren vertraut waren. »Das mag ja sein«, erwiderte sie, »aber er verwildert, und es ist höchste Zeit, dass er lernt, zu tun, was man ihm sagt.«
Sie verließ das Farmhaus, überquerte die menschenleere Hauptstraße und eilte zu einem Holzhaus an der Ecke. Granny Gwyn wohnte in einem hübschen einstöckigen Pfahlbau, der vorn den Blick auf das Krankenhaus bot, hinten jedoch an den Busch grenzte. Danny ging gern hinüber, um Gwyneth zu helfen, wenn sie sich um ihre Menagerie kranker und ausgesetzter Tiere kümmerte, und um ihren zahlreichen Geschichten über vergangene Zeiten zu lauschen. Sollte Rebecca ihn dort nicht antreffen, müsste sie Sarah in den Hütten der Aborigines auf der anderen Seite der Stadt aufsuchen und sie fragen, ob ihr Sohn Billy Blue auch verschwunden sei. Die beiden liefen immer zusammen fort, und Rebecca ging jede Wette ein, dass die Jungen den einen oder anderen Unsinn im Kopf hatten.
Als Rebecca gerade das Tor aufklinken wollte, vernahm sie das unverkennbare Dröhnen eines schnell fahrenden Lastwagens. Sie drehte sich um. Er gehörte Ben Freeman, dem Feuerwehrhauptmann des Ortes. Als der Wagen mit kreischenden Bremsen neben Rebecca hielt, hüllte er sie in eine Staubwolke ein.
Obwohl Rebecca sich freute, Ben zu sehen, begrüßte sie ihn mit einem Stirnrunzeln. »Danke, Ben«, sagte sie und versuchte, den gröbsten Dreck von Schürze und Kleid abzuschütteln. »Die Sachen waren heute Morgen noch sauber. Jetzt muss ich mich umziehen, bevor ich den Krankensaal wieder betrete.«
»Tut mir leid, Becky«, antwortete er schleppend und sprang aus dem Laster.
Er wirkte kein bisschen verlegen – nicht mit dem dümmlichen Grinsen im Gesicht. Aber dieses Grinsen ließ ihr Herz flattern und erregte sie, daher würde sie die Entschuldigung notgedrungen annehmen. »Wozu überhaupt die Eile?«, fragte sie, schirmte die Augen vor der Sonne ab und ließ ihren Blick von seinen Stiefeln und der Moleskin-Hose über das Karohemd, das sich über der breiten Brust spannte, bis hin zu seinem Gesicht mit den blauen Augen wandern.
»Ich wollte dich in deiner Mittagspause abfangen«, erklärte er, während er sie musterte. »Ich habe mich gefragt, ob du und Danny heute Abend vielleicht auf ein Häppchen bei mir vorbeikommen wollt?«
»Das wäre schön, Ben, aber Danny ist wieder mal ausgerissen, und wenn ich ihn finde, wird er für den Rest des Tages in sein Zimmer verbannt.« Sie schenkte ihm ein Lächeln, um ihn mit der Absage zu versöhnen. »Tut mir leid. Vielleicht ein anderes Mal?«
Er steckte die Hände in die Hosentaschen, lehnte sich an den Laster und schlug die Beine an den Fußknöcheln übereinander. »Ich schätze, ich kann noch eine Weile warten, aber es ist jetzt fast ein Jahr her, Becky. Ich habe gehofft, wir könnten etwas Dauerhaftes zwischen uns aufbauen.«
Sie ließ zu, dass er ihre Hand nahm und sie an sich zog. »Das werden wir, Ben, versprochen. Aber Danny muss sich erst an den Gedanken gewöhnen, und dazu ist er noch nicht bereit. Bitte, hab ein bisschen Geduld!«
»Ich werd’s versuchen, Becky, aber es ist nicht leicht.«
Seine Augen waren bezaubernd, als er auf sie herabschaute. Rebecca konnte die feinen Linien sehen, die seinen gebräunten Teint durchzogen. Ben war mit seinen fünfunddreißig Jahren ein gutaussehender Mann, und die Gewissheit, dass er sie liebte, sie heiraten und Danny annehmen wollte, vermittelte ihr eine Wärme, die nur wenig mit der brennenden Sonne zu tun hatte.
»Ich bin sicher, wir können uns ein paar ruhige Minuten zu zweit abzwacken, wenn Dannys Party morgen in vollem Gang ist«, meinte sie. »Außerdem finden im nächsten Monat die Picknick-Rennen statt. Vielleicht können wir alle hingehen und uns amüsieren?«
»Ja, das wäre schön. Soll ich euch abholen?«
Sie dachte darüber nach und schüttelte dann den Kopf. »Wahrscheinlich ist es besser, wenn wir dich dort treffen.«
»Du zweifelst doch nicht an uns, oder?« Sein Ausdruck veränderte sich, und seine Augen umwölkten sich vor Skepsis.
Rasch schaute sie die Straße entlang und küsste ihn leicht auf die Wange. »Nicht im Geringsten«, versicherte sie ihm. »Du bist der Mann für mich, Ben Freeman, und ich habe nicht die Absicht, dich zu verlieren. Aber du weißt, wie schnell hier Gerüchte entstehen. Wir wollen es noch ein bisschen für uns behalten, ja?«
Er grinste. »Schätze, damit muss ich mich vorerst zufriedengeben.«
Sie kicherte. »Kann schon sein. Und jetzt muss ich wirklich gehen.«
»Bis später dann«, sagte er sehnsüchtig.
Sie nickte.
Er tippte zum Abschiedsgruß an seine breite Hutkrempe und öffnete die Fahrertür. »Ich werde nach Danny Ausschau halten. Wenn er mir über den Weg läuft, bringe ich ihn nach Hause.«
Rebecca sah ihm nach, als er abfuhr und erneut eine Staubwolke hinter sich aufwirbelte. Der arme Ben war schon einmal verletzt worden: Er hatte von seiner Verlobten einen Brief mit der Anrede »Lieber John« erhalten, während er in Ägypten gegen Rommels Armee kämpfte. Und es lag auf der Hand, dass er sich allmählich fragte, ob Rebecca es mit ihrer Beziehung wirklich ernst meinte.
Sie seufzte tief und ging zur Rückseite des Hauses ihrer Großmutter. Ben und sie waren auf unterschiedliche Weise vom Krieg beschädigt worden. Dennoch heilte die Zeit tatsächlich Wunden, sodass sie inzwischen bereit waren, sich eine gemeinsame Zukunft zu schaffen. Aber Danny war der wunde Punkt, und Rebecca konnte nichts tun, um diese wachsende Beziehung zu fördern, solange ihr Sohn nicht einsehen wollte, dass sein Vater tot war.
Gwyneth spürte jedes einzelne ihrer siebenundsiebzig Jahre, würde sich jedoch eher ein Bein abhacken, bevor sie sich wegen ein paar kleiner Unpässlichkeiten von ihren zahlreichen Pflichten abbringen ließe. Ohne auf die Schmerzen in Knien und Schultern zu achten, fütterte sie das letzte der verwaisten jungen Wallabys zu Ende und steckte es dann fest in einen Kissenbezug, den sie an das Geländer der Veranda gebunden hatte. Insgesamt hingen dort vier Kissenbezüge, die von ihrem langbeinigen Inhalt ausgebeult waren. Es war ziemlich zeitaufwendig geworden, alle Tiere zu versorgen, zumal sie sich auch um viele andere Dinge zu kümmern hatte. Bei solchen Gelegenheiten fehlte ihr Danny, und sie fragte sich flüchtig, wo er heute wohl stecken möge.
»Hallo, Gran. Ist Danny bei dir?«
Gwyneth drehte sich um, und ihr herzliches Lächeln erstarb, als sie Rebeccas besorgte Miene bemerkte. »Ich habe ihn nicht mehr gesehen, seitdem er gestern Abend Wally gefüttert hat. Wieso? Ist er wieder mit Billy Blue unterwegs?«
Rebecca kaute mürrisch auf der Unterlippe. »Sieht ganz danach aus. Wenn ich ihn zu fassen kriege, zieh ich ihm die Ohren lang, weil er nicht auf mich hört.«
Gwyneth zuckte mit den Schultern. »Er ist ein kleiner Junge, und Jungs tun selten das, was man ihnen sagt. Ich würd mir keine Sorgen machen, Rebecca. Er kennt den Busch gut genug und wird schon wieder auftauchen, wenn er Hunger hat.«
»Darum geht es nicht, Gran, und das weißt du auch.« Unterdrückte Tränen glitzerten in Rebeccas Augen, als sie sich die hellbraunen Haare hinter die Ohren strich. »Ich dachte, jetzt wäre es anders, nachdem er das Jahr über so viel Zeit im Internat verbracht hat. Aber anscheinend kann er sich nicht damit abfinden –« Sie blinzelte und schlang die Arme fest um die Taille. »Heute Morgen habe ich versucht, mit ihm zu reden, aber er ist nach draußen gestürmt und wollte mir partout nicht zuhören. Mir kommt es vor, als würde er mich jedes Mal bestrafen, wenn er in den Busch geht, und ich weiß nicht, was ich noch tun soll, Gran.«
Gwyneth hatte durchaus eine Vorstellung davon, wusste aber, dass Rebecca nicht in der Stimmung für ein offenes Wort war. Danny und seine Mutter waren sich in mancher Hinsicht sehr ähnlich und nahmen keinen Rat an, auch wenn er noch so gut gemeint war. Rebecca hatte in den letzten Jahren viel durchgemacht und hatte freilich jede Hilfe verdient, die sie bekommen konnte. »Ich werd versuchen, noch mal mit ihm zu reden«, sagte Gwyneth leise, »aber erwarte keine Wunder, Becky. Es ist sehr schwer, das zu verkraften.«
»George Blake ist genauso alt, aber er hat akzeptiert, dass John nicht wiederkommen wird. Ich hatte gehofft, dass Danny seinem Beispiel folgt, nachdem die beiden jetzt gemeinsam die Schule in Brisbane besuchen«, erklärte Rebecca mit einem matten Lächeln.
»Danny ist ein helles Köpfchen und denkt zu viel«, sagte Gwyneth nüchtern, »aber am Ende wird er sich mit den Gegebenheiten abfinden müssen. Und das wird er, Becky, ganz bestimmt.«
»Hoffentlich hast du recht. Das dauert jetzt schon lange genug, und jedes Mal, wenn er im Busch verschwindet, wird alles wieder aufgerührt. Dabei muss ich es allmählich hinter mir lassen – und neu anfangen.«
Gwyneth betrachtete ihre Enkelin liebevoll. »Dann mach das. Du bist noch jung, und Ben Freeman scheint ein guter Mann zu sein.«
Rebecca wurde rot. »Woher weißt du das mit Ben?«
Gwyneth kicherte. »Ich mag zwar in die Jahre kommen, aber ich bin weder blind noch taub. Mir ist aufgefallen, dass er regelmäßiger in der Stadt auftaucht – und dann die Art, wie du mit ihm umgehst.«
»Ich gehe lieber wieder«, sagte Rebecca, deren Wangen noch immer rot waren. »Dad ist geschafft, weil er die ganze Nacht auf war, und Mum hat heute Nachmittag noch ein paar Hausbesuche zu erledigen. Außerdem gibt’s noch etliches für Dannys Geburtstagsfeier vorzubereiten. Wenn du den Lümmel siehst, dann richte ihm aus, er soll seinen kleinen Hintern nach Hause bewegen, sonst muss er die Konsequenzen tragen.«
Gwyneth schaute ihrer Enkelin nach, strich sich dann die grauen Haarsträhnen aus dem verschwitzten Gesicht, rieb die schmutzigen Hände an der Hose ab und zerrte am Saum ihrer weiten Baumwollbluse. Sie hatte nie großen Wert auf schicke Kleidung oder Make-up gelegt; hier draußen war es praktisch und bequem, feste Stiefel und alte, vom häufigen Gebrauch verschlissene Sachen zu tragen. Gwyneth schmeckte das Kupfer in der Luft, sie spürte die Hitze und Schwüle des heraufziehenden Gewitters – nicht nur in der Natur, sondern auch innerhalb ihrer Familie.
In sorgenvolle Gedanken über Rebeccas unglückliche Lage vertieft nahm sie ihren Gehstock und einen breitkrempigen Hut und stieg vorsichtig die Verandastufen hinunter, um den Rest ihrer Menagerie zu versorgen.
Der Hühnerauslauf und die Voliere waren im Schatten der Bäume am hinteren Rand des Gartens angelegt worden, wo der Busch allmählich auf das Grundstück übergriff und die frei lebenden Ziegen grasten. Neben dem Auslauf befanden sich Gehege für die verletzten und verwaisten Tiere, die man Gwyneth ständig brachte. Tagtäglich war sie mehrere Stunden damit beschäftigt, die Gehege zu reinigen und sich um die Tiere zu kümmern.
Sie hatte dort einen Papagei mit einem gebrochenen Flügel, zwei verwaiste Opossums, mehrere Echsenarten mit unterschiedlichen Verletzungen, ein Felskänguru, das sich von einem hässlichen Abszess erholte, und einen jungen Wombat, der ungewöhnlicherweise in der langen Dürrezeit geboren worden war. Er wäre verhungert, hätte Gwyneth ihn nicht in der aufgegebenen Erdhöhle gefunden.
Den Papagei würde sie bald freilassen können. Die Opossums gediehen. Die Echsen schliefen in ausgehöhlten Ästen; es war kaum zu erkennen, wie es ihnen ging. Der Abszess des kleinen Felskängurus heilte gut ab. Gwyneth nickte zufrieden, schaute sich um und stellte fest, dass Wally, der junge Wombat, aus der Erdhöhle ausgerissen war, die sie unter der Veranda für ihn angelegt hatte. Zweifellos war er irgendwo in der Nähe und hatte Flausen im Kopf – genau wie Danny.
Sie fütterte die Hühner und stand im Schatten der ausladenden Bäume, genoss die kurze Erholung von der Sonne und betrachtete ihre Umgebung. Morgan’s Reach mochte zwar abgelegen sein, die Bevölkerung weit verstreut, aber es war eine verschworene Gemeinschaft, die unter zwei Weltkriegen schwer gelitten hatte.
Zwei Generationen junger Australier waren dem Ruf an die Waffen aus England gefolgt – dem Land, das sie noch immer als ihr »Mutterland« ansahen. In dem festen Glauben, dass sie ihr gewohntes Zuhause vorfinden würden, wenn alles vorbei wäre, hatten die Männer sich freiwillig zur Armee gemeldet, darauf erpicht, zu kämpfen und ihren Mut unter Beweis zu stellen. Die Farmen blieben den Frauen überlassen und den Aborigines, die das Vieh für sie hüteten, sowie allen, die zu alt, zu jung oder für den Kriegsdienst untauglich waren. Doch viele der Soldaten waren nicht zurückgekehrt, so wie Rebeccas Mann Adam und Amy Blakes Mann John, und dieser Verlust war für alle noch immer schmerzlich.
Die inzwischen gewohnte Traurigkeit überfiel Gwyneth, doch sie ließ sie nicht lange zu, denn damit half sie niemandem. Stattdessen richtete sie die Aufmerksamkeit auf eine fernere Vergangenheit. Morgan’s Reach war gewachsen, seit sie vor vielen Jahren mit Rhys hergekommen war. Gwyneth verzog den Mund zu einem schiefen Lächeln, als ihr wieder einfiel, wie schockiert sie damals gewesen war, als sie feststellen musste, dass Rhys’ angebliches Paradies in Wirklichkeit eine bunt zusammengewürfelte Ansammlung von baufälligen Holzhäusern, fragwürdigen Wellblechhütten und Unterkünften aus Flechtwerk mit Lehmfüllung war.
Das Buschkrankenhaus, das Rhys so stolz angepriesen hatte, hatte sich letzten Endes als Pfahlbau mit einem einzigen Raum, einer Veranda und durchhängendem Dach erwiesen. Und das ihr in Aussicht gestellte Zuhause war nicht viel besser gewesen. Es besaß weder Tür noch Fenster, der Fußboden bestand aus festgestampfter Erde, und sie sollte das Essen auf einem Feldkocher zubereiten, der draußen neben einem Waschzuber und einer Mangel stand. Das war weit entfernt von dem bequemen Haus, das sie in Brisbane gehabt hatte, und sie hatte ihrem Mann unmissverständlich klargemacht, dass sie so nicht leben wolle.
Gwyneth lachte in sich hinein. Armer Rhys! Er hatte damals noch nicht erkannt, wie willensstark sie war, doch im Lauf der Jahre hatte er gelernt, ihre Tatkraft zu bewundern, und sie konnte auf eine lange, glückliche Ehe zurückblicken.
Morgan’s Reach hatte damals eine kleine Kirche, eine Kneipe und einen Kramladen an einem Feldweg, den man verbreitert hatte, um Platz zu schaffen für die Rinder- und Schafherden, die von den Hirten darübergetrieben wurden, um die Tiere auf dem Weg zum Markt an der Quelle zu tränken, sowie für die Ochsengespanne, die mit Wollballen und Vorräten beladen waren.
Vor allem für die wenigen Frauen war es ein recht unwirtlicher Ort gewesen, denn die Schafscherer, Viehhirten, Ochsentreiber und Fuhrleute versoffen hier ihren Lohn und rauften sich, bevor sie weiterzogen. Der kleine Stamm ortsansässiger Aborigines hegte allen Weißen gegenüber Misstrauen. Nur vereinzelte wagten sich in den Ort. Die meisten zogen es vor, sich an die alten Sitten zu halten, in ihrem traditionellen Lager im Busch zu leben und oft monatelang zu ihren Buschwanderungen zu verschwinden.
Gwyneth dachte an die Veränderungen, die sich in den vergangenen fünfzig Jahren eingestellt hatten. Die Viehtreiber und Schafscherer kamen nach wie vor in den Ort, betranken und schlugen sich, aber es ging inzwischen viel gesitteter zu, denn es gab mehr Frauen. Und die stabilen Häuser entlang der Hauptdurchfahrt hatten Fliegengitter und Gärten mit Lattenzäunen.
Die schlichte Kirche, die am nördlichen Ende der Straße stand, war noch immer dieselbe mit ein paar abgenutzten Bänken und einem alten Küchentisch, der als Altar diente. Der Pfarrer musste allerdings nicht mehr im Zelt leben, denn seine Gemeinde hatte ihm ein schönes Haus direkt neben dem Friedhof gebaut. Nur schade, dass Reverend Algernon Baker, der derzeitige Seelsorger, ein mürrischer, ungeselliger Mann war, den niemand mochte, trotz der Bemühungen seiner schüchternen kleine Frau Frances und des lausbübischen Charmes ihrer Zwillingssöhne. Andererseits führte dieser Charme häufig zu Ärger, und die Jungen hatten schnell den Ruf erlangt, ständig Unfug zu treiben.
Gwyneths Gedanken wanderten zum Schulhaus. Es stand auf dem nächsten großen Grundstück und wurde von der jungen, fähigen Emily Harris geführt, die in einem kleinen Haus dahinter wohnte. Der alte Gemeindesaal war vor langer Zeit abgebrannt; daher erfüllte die Schule an Wochenenden die Doppelfunktion eines Tanzsaals und Treffpunkts.
Vor dem Kramladen hatte man einen von Planen beschatteten Plankenweg angelegt. Daneben reihten sich einige kleine Holzhäuser aneinander sowie eine Schmiede, in der Charley Sawyer herrschte, der sich wegen seines räudigen Hundes ständig mit den alleinstehenden Nachbarinnen stritt. Die Polizeiwache lag gegenüber – obwohl diese Bezeichnung ein wenig lächerlich war, führte Jake Webber das Büro doch im Vorderzimmer seines Privathauses, wobei die Gefängniszelle aus einem hinteren Anbau bestand.
Einige Aborigines hielten sich noch immer an die Tradition, doch die meisten von ihnen lebten inzwischen in Hütten am Nordrand der Ansiedlung, wo einst das alte Buschlager gewesen war. Allmählich hatten sie sich in die Gemeinschaft integriert und arbeiteten nun als Jackaroos, Gehilfen auf den Rinderfarmen, sowie als Viehtreiber. Und nachdem Gwyneth viel Überredungskunst aufgewendet hatte, schickten sie ihre Kinder zur Schule.
Bert und Sal Davenport führten das Hotel Dog and Drover, das neben der Kirche günstig gelegen war. Per Gesetz war es nicht erlaubt, die Ureinwohner im Pub zu bedienen. Aber der gerissene Bert umging das Verbot, indem er ihnen Bier aus dem hinteren Fenster verkaufte. Leider führte das zu ziemlich ernsten tätlichen Auseinandersetzungen, denn die Aborigines vertrugen kaum Alkohol. Derzeit setzten die Leute aus dem Ort Jake zu, etwas zu unternehmen, um Bert Einhalt zu gebieten. Dabei wird es nichts nützen, dachte Gwyneth, denn die Aborigines haben entdeckt, wie sie aus Beeren und Blättern des Busches einen höllischen Fusel herstellen können.
Sie richtete die Aufmerksamkeit wieder auf ihr Zuhause. Das ursprüngliche Wohnhaus war vor langer Zeit abgebrannt, den Ersatz hatten Termiten zerstört. Stattdessen stand nun ein stabiles Holzhaus auf Betonpfeilern, die oben und unten mit Metall beschlagen waren, um die weißen Ameisen abzuhalten. Rings um das Haus führte eine Veranda, die an den heißen Tagen Schatten bot. Da es dort relativ kühl blieb, konnte man nachts hinter Fliegengittern schlafen, die fest angenagelt waren.
Danny und sein Freund George Blake schliefen gern in den Ferien draußen. Gwyneth hatte den Verdacht, dass sie nachts häufig umherstreiften, was sie beunruhigte. Im Dunkeln war es im Busch gefährlich, auch wenn man sich noch so gut auskannte. Obwohl die beiden für gewöhnlich mit ihrem Kumpel Billy Blue, einem Aborigine, unterwegs waren, fand Gwyneth erst Ruhe, wenn sie die beiden zurückkommen hörte.
Sie seufzte tief. Es tat gut, wieder junge Menschen um sich zu haben, denn fünf ihrer eigenen Kinder waren über ganz Australien verstreut. Gwyneth sah sie nur selten und hatte nur mit Bethanys Tochter Millicent engeren Kontakt, die vor Kurzem mit ihrem Mann in die Gegend gezogen war, weil er auf der Farm Carey Downs arbeitete.
Hugh, ihr ältester Sohn, war der Einzige, der nach seiner Ausbildung als Arzt zurückgekehrt war, aber er war inzwischen Mitte fünfzig. Gwyneth wusste, dass die Arbeit ihm allmählich zu viel wurde, trotz der Fliegenden Ärzte und der unermüdlichen Hilfe von Jane und Rebecca. Sie hatten die leise Hoffnung gehegt, dass sein Sohn Terence die Familientradition vielleicht fortführen werde, sobald er seinen Abschluss hatte, doch Gwyneth bezweifelte das inzwischen, da sie seine Frau Sandra kennengelernt hatte, die überhaupt nicht in diese Gegend passen würde.
Gwyneth wurde bewusst, dass sie mit ihren Tagträumen Zeit vergeudete. Dennoch stützte sie sich weiter auf den Stock und genoss den kühlen Schatten unter den Bäumen. Der Garten ist nicht gerade gepflegt, dachte sie, während sie die kahlen Flecken roter Erde zwischen den Grasbüscheln, die wuchernden Wandelröschen und das Unkraut betrachtete. Er war weit entfernt von den üppigen Rasenflächen und dem intensiv duftenden Rosengarten, an die sie sich noch aus Kindertagen erinnerte – allerdings war dies hier auch nicht Wales, und der Regen, der in den letzten drei Jahren gefallen war, hätte nicht einmal eine Teetasse gefüllt.
Bei dem Gedanken an Tee kehrte Gwyneth zum Haus zurück. Als sie an dem großen Vogelkäfig vorbeikam, der neben der Fliegengittertür stand, wurde sie von dem Kakadu ihres verstorbenen Mannes begrüßt.
»Hallo, hallo, hallo«, krächzte der Vogel, wobei er die schwefelfarbene Haube aufstellte und auf der Stange auf und ab wippte.
»Hallo, Coco«, antwortete sie, während sie seine Wasserschale auffüllte und ihm ein paar Körner gab.
»Hübscher Junge, hübscher Junge. Arrgh.« Coco rutschte auf der Stange hin und her, verlor das Gleichgewicht und konnte sich gerade noch festkrallen. Kopfüber schwang er hin und her und schlug mit den Flügeln. Der Name passte gut zu ihm, denn er war ein absoluter Clown.
»Du bist ein alberner, alter Angeber«, flüsterte Gwyneth liebevoll. »Aber ich habe keine Zeit, den ganzen Tag rumzustehen und dir zuzuschauen. Ich muss einen Geburtstagskuchen backen.«
Sie öffnete die Fliegengittertür und ließ sie hinter sich zuknallen, trat in das Halbdunkel des Hauses und ging in die Küche. Sie hatte alle Fensterläden geschlossen, um die Sonne draußen zu halten, brauchte aber kein Licht, denn sie kannte hier jede staubige Ecke.
Rhys hatte die Welt bereist, bevor er seine zukünftige Frau kennenlernte, und begeistert Artefakte und Kuriositäten gesammelt. Gwyneth betrachtete diese Objekte hauptsächlich als Gerümpel, das man nicht einmal geschenkt haben wollte, hatte es aber nicht übers Herz gebracht, sich nach Rhys’ Tod auch nur von einem einzigen Teil zu trennen. Sie gehörten inzwischen so fest zu ihrem Leben, dass sie ihr kaum noch auffielen.
Schilde von Kriegern, Speere und Schrumpfköpfe aus Südamerika waren darunter; Holzschnitzereien aus Indien und von den Südseeinseln; der Stoßzahn eines Elefanten, das Horn eines Rhinozerosses, Steinfiguren aus Ägypten und unzählige Bücher, Zeitschriften, alte Landkarten und Tagebücher. Schubladen und Kartons waren vollgestopft mit einer Fülle von unbedeutenden Souvenirs, und sein Schreibtisch war heute noch so übersät wie an dem Morgen vor sieben Jahren, als er sich im Ledersessel zurückgelehnt hatte und endgültig eingeschlafen war.
Der Herd war angezündet und verwandelte den kleinen Raum in einen Schmelzofen. Gwyneth öffnete die Fensterläden in der Hoffnung auf eine kleine Brise, die ein wenig Kühlung bringen würde. Als das Licht hereindrang, stellte sie zu ihrem Entsetzen fest, dass Wally in die Vorratskammer eingedrungen war und sich selig durch ihren letzten Zuckersack wühlte.
»Du bist ein böser Junge«, schimpfte sie, mied seine tödlichen Klauen und packte ihn am Nacken. »Kein Wunder, dass du so dick wirst.« Unwillkürlich musste sie grinsen, als er sie beäugte und sich weiterhin genüsslich Zucker von Schnauze und Krallen leckte. Sie trug ihn zur Hintertür und ließ ihn auf die Veranda plumpsen. »Ab mit dir!«
Wally betrachtete sie traurig und trollte sich dann auf krummen Beinen davon. Man konnte sich nur wundern, dass er nicht darüber stolperte.
»Schön«, sagte sie nachdrücklich. »Jetzt kann ich vielleicht weitermachen.«
Sie ging wieder in die Küche, in Gedanken mit dem Geburtstagskuchen beschäftigt. Danny war ihr Ein und Alles. Wenn er in der Schule war, fehlten ihr sein freches Grinsen und seine endlose Fragerei. Im Grunde ihres Herzens wünschte sie sich jedoch, er wäre eher wie John Blakes Sohn. George war ein ruhiges Kind, das keine Fragen stellte und den Tod seines Vaters einfach hingenommen hatte.
Seufzend wog Gwyneth die Zutaten für den Kuchen ab. Sie konnte nur hoffen, dass Dannys lange Abwesenheiten von Morgan’s Reach und seine Freundschaft mit George ihn schließlich zur Vernunft bringen würden. Doch nach der Szene, die Rebecca ihr gerade beschrieben hatte, zog sie das allmählich in Zweifel – und das beunruhigte sie zutiefst.
2
Ben Freeman war verunsichert, als er aus Morgan’s Reach hinausfuhr und den Pick-up durch den Busch zu dem Haus steuerte, das er sich gebaut hatte.
Er kannte Rebecca schon sein ganzes Leben lang, denn seinen Eltern gehörte die Wilga-Farm westlich von Morgan’s Reach. Im Lauf der Jahre hatten Rebecca und er dieselbe Schule, dieselben Picknick-Rennen und Treffen besucht. Aber damals hatte er sich nichts aus ihr gemacht, denn sie war nur eins von vielen lästigen Mädchen und vollkommen uninteressant. Er ging fort, um seine Ausbildung in Brisbane zu beenden, wie die meisten Kinder aus dem Outback, und nach dem College blieb er dort, um bei der Feuerwehr zu arbeiten.
Doch der Reiz der weiten Ebenen und der Zauber des Busches zogen ihn wieder zurück in die Heimat. Bei seiner Rückkehr nach Morgan’s Reach erfuhr er gerüchteweise, dass Rebecca in Sydney eine Ausbildung als Krankenschwester absolviere und mit einem Studenten der Tiermedizin verlobt sei, einem gewissen Adam Jackson. Selbst das nahm er nicht weiter zur Kenntnis, denn er war zu jener Zeit in Maggie Wheeler verliebt. Tratsch war etwas für Hausfrauen, und er konnte sich kaum noch daran erinnern, wie Rebecca Morgan überhaupt aussah. Dann, im September 1939, wurde der Krieg erklärt, und Ben verließ Morgan’s Reach, um sich mit seinen Freunden freiwillig zur Armee zu melden, da er der Meinung war, der Krieg werde ein großes Abenteuer und biete eine Chance, die Welt zu sehen.
Ben verzog das Gesicht. Es war eine an die Nieren gehende, entsetzliche, blutige Erfahrung gewesen – alles andere als ein Abenteuer. Und der letzte Brief von Maggie hatte den einzigen Funken Hoffnung ausgelöscht, den er während der endlosen feindlichen Bombardements in der afrikanischen Wüste gehegt hatte, wodurch das Grauen des Krieges und das Heimweh nur noch unerträglicher wurden.
Ben lenkte den Wagen zwischen Bäumen hindurch. Das flackernde Licht, das durch das Laubdach auf die staubige, verkratzte Windschutzscheibe fiel, erschwerte ihm den Blick auf den Weg. Doch er war schon so oft hier entlanggefahren, dass er sich kaum konzentrieren musste und in Gedanken wieder zu seinem Dilemma zurückkehrte.
Er hatte den Krieg überlebt und war nach Hause zurückgekehrt, wo er feststellen musste, dass sein Kumpel John Blake nicht so viel Glück gehabt hatte – ebenso wie viele andere. Maggie hatte längst geheiratet und war nach Darwin gezogen. Die Entfernung zu ihr und die Zeit hatten die Wunde geheilt, und als er Rebecca wiedertraf, fühlte er sich sogleich zu ihr hingezogen. Es erstaunte ihn, wie schnell sie sein Herz erobert hatte.
Dennoch war er auf der Hut. Er wollte nicht wieder verletzt werden, und auch Rebecca war noch immer verwundbar, nachdem sie Adam verloren hatte. Er versuchte, nichts zu überstürzen und zu verstehen, dass sie und Danny Zeit brauchten, um eine neue Bindung einzugehen, aber es fiel ihm zunehmend schwer, sich in Geduld zu fassen. Und trotz Rebeccas gegenteiliger Versicherung hatte er allmählich den Verdacht, dass ihr Zweifel gekommen waren.
Eine Bewegung im Schatten weckte Bens Aufmerksamkeit. Er schaute gerade noch rechtzeitig hin, um einen Blick auf hellrotes Haar und zwei rennende Gestalten zwischen den Bäumen zu erhaschen.
»Treffer!«, murmelte er, während er weiterfuhr, als habe er die Jungen nicht bemerkt. Billy Blue und Danny waren unterwegs zu den Höhlen am Berghang – einem beliebten Versteck für Generationen von Jungen. Er würde ihnen Zeit lassen, sich darin einzurichten in dem Glauben, sie seien in Sicherheit, bevor er sie nach Hause schleifen würde.
Er passierte den nahezu unsichtbaren Pfad, der zu den Höhlen und zu einem Wasserfall führte, und fuhr den steilen Abhang hinauf bis an die Stelle, an der er ein großes Stück Land gerodet hatte, um sein Haus auf den Vorsprung eines abgeflachten Berges zu setzen.
Das Gebäude war nicht groß, aber er war stolz darauf. Die Wände bestanden aus dicht zusammengefügten Baumstämmen, die er aus dem Busch geholt hatte; der Kamin aus schwarzen Felsbrocken, die auf dem Berg verstreut lagen. Das Wellblechdach ragte tief über die Fenster, von denen man einen unverstellten Blick über das Laubdach des Busches und auf die Ebenen der direkten Umgebung und die Berge in der Ferne hatte.
Die Küche und die beiden Schlafzimmer gingen von einem großen Wohnzimmer in der Mitte ab. Den Luxus eines innen liegenden Bades hatte er zwar nicht, aber er konnte sich draußen, im Freien, in einen alten Zinnkübel setzen und bis zum Hals in warmem Wasser aus dem Kupferboiler baden und den phantastischen Ausblick genießen in der sicheren Gewissheit, dass man ihn nicht sehen und stören konnte. Nach dem Lärm und den Schrecken des Krieges war dies sein Refugium, und er konnte sich nichts Schöneres vorstellen, als es mit Rebecca und ihrem Sohn zu teilen.
Er stellte den Wagen ab, stieg aus und begab sich nicht zur Haustür, sondern zu dem hohen steinernen Wachturm, den er neben dem Haus errichtet hatte. Er hatte Django die Beobachtung überlassen, während er rasch in die Stadt gefahren war. Ben vertraute dem älteren Aborigine vollauf, wusste aber auch, dass es mit der Aufmerksamkeit des Mannes nicht weit her war, wenn man ihn zu lange sich selbst überließ.
Djangos breites braunes Gesicht strahlte, als Ben die hohe Holzplattform betrat. »Alles klar, Boss«, sagte er fröhlich. »Obwohl schweres Gewitter kommt. Schätze, heute Abend hier.«
»Danke, Kumpel. Geh und iss was, solange ich hier bin! Aber halte dich nicht allzu lange auf – ich muss zwei Rowdys aufsammeln und nach Hause bringen.«
»Die Jungs wieder Unsinn machen, was?« Djangos bernsteinfarbenen Augen glitzerten belustigt, während er den verschwitzten Hut über den buschigen Haarschopf zog. »Sarah sich Billy Blue mal zur Brust nehmen müssen, aber das wohl nichts nützen. Der Junge sein wild. So wild wie sein rotes Haar.« Er schüttelte noch immer den Kopf und lachte in sich hinein, als er die Leiter herunterstieg und auf der Suche nach etwas Essbarem ins Haus ging.
Ben nahm das Fernglas und betrachtete das Panorama, das sich hinter den Baumwipfeln ausbreitete. Die schwere Luft stand. In der Ferne grollte Donner, und über den Bergen gingen gezackte Blitze nieder. Dunkle Wolken zogen sich zusammen und warfen tiefe Schatten über die Ebenen und felsigen Ausbisse. Von Feuer jedoch keine Spur – zumindest noch nicht.
Ben stellte das Fernrohr auf die Baumwipfel ein und fand oberhalb des tröpfelnden Wasserfalls die Höhlen, die Djangos Stamm einst als Zufluchtsort gedient hatten und wo sich noch immer uralte Zeichnungen an den Wänden befanden. Billy Blue und Danny waren in eine hineingekrochen, aber ihre Beine baumelten über dem Rand, während sie um die Wette Steine ins Wasser warfen, das von der unterirdischen Quelle über die Felsen spritzte und schließlich in einen großen Teich am Fuß des Hügels mündete.
Grinsend dachte er daran, dass er und seine Freunde sich am selben Platz zu verstecken pflegten, wenn sie den Unterricht schwänzen oder sich vor ihrer endlos langen Liste von Pflichten drücken wollten. »Tut mir leid, Jungs«, flüsterte er und griff nach dem Funkgerät, das er am Generator befestigt hatte. »Zeit, nach Hause zu gehen.«
Im Kopfhörer des Funkgeräts knackte und heulte es, als er seine Rufnummer durchgab und ungeduldig darauf wartete, dass Jake Webber sich meldete. Entweder machte Jake gerade Emily Harris in ihrem Haus hinter der Schule den Hof, oder er lag, was noch wahrscheinlicher war, dösend in der Hängematte auf seiner vorderen Veranda und hatte alles um sich herum vergessen. In der Gegend wurden nur sehr selten Verbrechen begangen, und obwohl Jake auch als Feuerwehrmann arbeitete, hatte er viel zu viel Zeit zur Verfügung.
Ben wollte gerade die Verbindung unterbrechen, als Jakes verschlafene Stimme durch das Knacken drang. »Hi, Kumpel. Hast du da oben Probleme?«
»Nichts Ernstes zu berichten, Jake. Aber Rebecca hat Danny gesucht, und ich hab ihn gerade mit Billy oben an den Höhlen entdeckt. Würdest du ihr bitte sagen, dass es ihm gut geht und ich ihn nach Hause bringe?«
»Kein Problem, Kumpel.«
»Danke. Und Jake, bleib wachsam! Ein Gewitter braut sich zusammen, und ich brauche dich heute Abend für die Brandwache.«
»Kein Problem«, wiederholte Jake gedehnt. »Bis später.«
Ben trennte die Verbindung, warf noch einen Blick auf die schwarze Wolkenbank in der Ferne und stieg zögerlich vom Turm. Er und Jake hatten eine lange Nachtwache vor sich, wenn das Gewitter keinen Wolkenbruch mitbrachte, denn der Busch war trocken wie Zunder, und es würde nur eines einzigen Blitzeinschlags bedürfen, um ein verheerendes Feuer auszulösen.
»Ich bin dann mal weg und hole die Jungs«, teilte er Django mit, der mit einem dicken Hammelsandwich und einem Becher Tee auf dem Sofa faulenzte. »Bleib in der Nähe des Funkgeräts, bis ich wieder da bin. In ungefähr einer halben Stunde.«
»Geht klar, Boss.« Django machte es sich in den Polstern gemütlich und schlürfte den Tee.
Wahrscheinlich war es unklug, Django mit Sandwich und Tee allzu lange allein zu lassen, denn die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass der Mann im Nu einschlafen konnte. Doch Becky musste wissen, dass ihr Sohn wohlauf war – und der Busch war nicht der rechte Ort, wenn ein Gewitter hereinbrach.
Ben eilte über die Lichtung, und seine ausholenden Schritte beschnitten die Entfernung, während er auf die Ansammlung von Basaltfelsen zuging, die Eagle’s Head genannt wurde. Die schwarzen Felsen lehnten unsicher aneinander und tauchten aus dem sie umgebenden Mulgagestrüpp und Spinifexgras auf wie ein gigantischer prähistorischer Vogel, der sich für den Flug bereit macht. Sie sahen aus, als würde der leiseste Windstoß sie auf den Waldboden werfen, doch sie standen seit Jahrtausenden dort, gemeißelt von den Elementen, um an dem Traumplatz Wache zu stehen, den der heimische Stamm Namardol, Keilschwanzadler, nannte.
Die Armee hatte Ben gut ausgebildet, und er suchte sich vorsichtig einen Weg über die Felsen hinab. Seine Stiefel machten keinerlei Geräusch, während er jeden Halt prüfte und darauf achtete, nicht auf Schiefergestein zu treten, das sich lösen könnte und ihn ins Rutschen bringen würde. Langsam schob er sich um den letzten Geröllblock, trat leise auf das Felssims und versperrte damit den Jungen die Flucht.
Barfuß, in dreckigen Hemden und kurzen Hosen, die spitze Ellbogen und Knie zum Vorschein brachten, waren die beiden derart in ihr Spiel vertieft, dass sie Ben nicht bemerkten. Die Jungen waren etwa gleich groß, schlaksig und hatten noch weiche Kindergesichter. Dannys hellere Haut war von der Sonne gebräunt, sodass er fast genauso dunkel war wie Billy. Der hatte seinen roten Schopf einem Viehtreiber zu verdanken, dessen Name und Aufenthaltsort unbekannt waren.
Billy Blue sah Ben als Erster, und er stieß Danny an, bevor er sich aufrappelte. »Wir haben nichts angestellt«, sagte er abwehrend. Sein wilder Haarschopf glitzerte in der Sonne. Mit hektischen Blicken aus bernsteinfarbenen Augen suchte er nach einem Fluchtweg.
»Das weiß ich, Freundchen«, sagte Ben. »Aber jetzt wird es Zeit, nach Hause zu gehen.«
Danny hatte die Hände zu Fäusten geballt und beäugte Ben streitlustig durch eine braune Haarsträhne, die ihm ins Gesicht gefallen war. »Sie haben uns nichts zu sagen.«
»Das habe ich gerade«, erwiderte er milde. »Ein starkes Gewitter zieht auf, und eure Mütter wollen, dass ihr nach Hause kommt.«
»Ich will nicht nach Hause«, widersetzte sich Danny. »Sie sind nicht mein Vater. Ich muss Ihnen nicht gehorchen.«
Ben betrachtete nachdenklich den trotzigen Zug um das Kinn des Jungen. Dessen braune Augen drückten jedoch nur den Schmerz aus, den er unterdrücken wollte, und Ben erkannte, dass Danny trotz seines großmäuligen Getöses nur ein kleiner Junge war, der Mühe hatte, mit der Bürde des Lebens zurechtzukommen. »Tut mir leid, Kumpel«, sagte er mild, »aber ich trage hier oben die Verantwortung, und ob es euch gefällt oder nicht, ihr könnt nicht bleiben.«
»Dann gehen wir lieber«, murmelte Billy Blue und senkte den Kopf, um Bens Blick auszuweichen. »Mum wird ziemlich sauer, wenn ich zu spät zum Essen komme.«
Danny trat von einem Bein auf das andere. Er wollte nicht nachgeben, wusste aber, dass ihm in dieser Situation nichts anderes übrig blieb. »Wir können nicht gehen, solange Sie im Weg stehen«, knurrte er.
Ben trat zur Seite und ließ ihnen keine andere Wahl, als durch die Felsblöcke hinaufzuklettern. »Du steigst voran, Billy. Danny und ich folgen.« Er hatte keine Skrupel, die Jungen über die Felsen klettern zu lassen – sie waren geschmeidig wie Eidechsen –, vermutete jedoch, dass Danny versuchen würde auszubüxen, sobald sie oben angelangt wären.
Billy begann den Anstieg, und Ben folgte dicht hinter Danny, bereit, ihn zu packen, sobald dessen Füße den Gipfel erreichten. Als sie sich dem Gipfel näherten, setzte Danny tatsächlich plötzlich zu einem Spurt an, aber Ben war schneller. Auf der Anhöhe packte er den Jungen am Hinterteil seiner kurzen Hose.
»Lassen Sie mich los!«, rief der Junge wütend und trat um sich.
»Erst, wenn du im Wagen sitzt. Und wenn du nicht aufhörst, mich zu treten, lege ich dich über die Schulter, werfe dich auf die Ladefläche und binde dich wie einen kleinen Viehhund an.«
»Das sag ich meiner Mum!«, schrie Danny, das Gesicht vor Zorn rot angelaufen.
»Nur zu, Kumpel! Aber deine Mum hat mich gebeten, dich nach Hause zu bringen, und genau das habe ich vor.«
Er hielt den Jungen weiterhin fest und schaute ihn ruhig und entschlossen an, bis dessen Kampflust erlahmte. Noch immer ließ Ben Danny nicht los, denn er traute ihm nicht. »Schon besser«, sagte er leise. »Und jetzt kannst du mir mal zeigen, wie gut du einen Kleinlaster fahren kannst.«
Danny riss die Augen weit auf und schaute zu Ben hoch, der in dem schmutzigen Gesicht des Jungen unwillkürliche Aufregung ablesen konnte. »Wirklich? Sie wollen mich fahren lassen?«
Ben nickte und löste den Griff an der Hose des Jungen, bevor er hinter Billy auf den Beifahrersitz kletterte. »Das nächste Mal bist du an der Reihe, Kumpel«, versicherte er dem Aborigine, der ein wenig enttäuscht wirkte.
Danny kletterte auf den Fahrersitz und rückte ihn nach vorn, um mit den nackten Füßen an die Pedale zu reichen. Wie die meisten Kinder im Outback hatte er schon in sehr jungen Jahren fahren gelernt, denn niemand konnte den Notfall vorhersehen, der diese Fähigkeit eines Tages erfordern würde. Es war am besten, wenn man stets auf alles vorbereitet war.
Die Rückfahrt nach Morgan’s Reach war, gelinde gesagt, riskant, aber sie schafften sie in einem Stück. Vor dem Krankenhaus warteten Rebecca und Sarah bereits. Ihre Mienen verhießen nichts Gutes für die beiden Ausreißer.
Billy flitzte los und konnte gerade noch Sarahs Griff nach seinem Ohr ausweichen, aber Danny hatte nicht so viel Glück. Rebecca hievte ihn aus dem Wagen, versetzte ihm einen Klaps auf den Hintern und befahl ihm, ins Haus zu gehen.
»Danke, Ben.« Sie lächelte abwesend. »Tut mir leid, dass sie dir solche Umstände gemacht haben. Möchtest du auf eine Tasse Tee reinkommen?«
»Lieber nicht«, sagte er bedauernd. »Ich muss wieder zurück und das Gewitter im Auge behalten.«
»Dann sehen wir uns morgen Nachmittag.« Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange und bedankte sich noch einmal, bevor sie ins Haus eilte, um sich Danny vorzuknöpfen.
Ben fuhr zurück auf die Hochebene, gewärmt von ihrem Lächeln und der zarten Berührung ihrer Lippen.
Hugh Morgan war daran gewöhnt, von den Kindern der Aborigines beobachtet zu werden, die anscheinend fasziniert waren vom Krankenhaus und dem, was er und seine Familie dort taten. Obwohl sie ständig wie Kakadus schnatterten und oft im Weg standen, machte es ihm überhaupt nichts aus.
Marys Brut bildete da keine Ausnahme. Ihre sechs Jüngsten drängten sich um sie, als er ihr einen Glassplitter aus dem Fuß zog und einen Verband anlegte. Mary, klein und stämmig, mit dürren Beinen und Armen und derart dunkler Haut, dass sie das Licht nicht reflektierte, war Billy Blues Tante. Ihre Augen und das zerzauste Haar waren hell; ihr breites Gesicht wies Stammeszeichen und tiefe Furchen der Entbehrung auf. Weder Hugh noch Mary hatte eine Ahnung, wie alt sie war, doch sie konnte offensichtlich noch immer Kinder gebären, denn es war wieder eines unterwegs, was nach Hughs Schätzung insgesamt zwölf ergeben würde.
Er betrachtete die Patientin streng. »Sie haben da eine schlimme Schnittwunde. Sie müssen den Verband sauber halten und morgen zur Kontrolle wiederkommen.«
Grinsend wedelte Mary mit dem verbundenen Fuß, damit die Kinder ihn bewundern konnten, bevor sie wieder den Arzt anschaute. »Ich kriegen Stock?«
Er betrachtete ihre Füße und nickte, bevor er in einen Schrank griff. Mit Krücken wäre ihr besser gedient, aber sie waren alle verloren gegangen und neue noch nicht eingetroffen. Er suchte zwei stabile Stöcke aus und reichte sie ihr. »Die hätte ich gern zurück, Mary. Geben Sie sie nicht den Kindern zum Spielen.«
»Ich behalten Stöcke«, erwiderte sie und sah ihn verschmitzt an. »Gut für schlagen Kinder und Alten hindern, wenn er gig-gig machen will.« Sie kreischte vor Lachen, und die Kinder, die an ihren derben Humor gewöhnt waren, kicherten mit.
Hugh half ihr beim Aufstehen. Die Kleinen schwärmten um sie herum, als sie vorsichtig auf einem Bein balancierte und die Stabilität der Stöcke testete. Er beobachtete, wie sie sich auf die Veranda hinausschwang und die Treppe hinunter in das grelle Licht des Spätnachmittags humpelte.
Die Kinder folgten ihr und imitierten ihren unbeholfenen Gang, woraufhin sie gutmütig mit einem Stock nach ihnen ausholte, bevor sie die Lichtung überquerte und verschwand.
Hugh lächelte matt, drehte sich um und begann, das Behandlungszimmer zu säubern, froh, dass keine Patienten mehr da waren. Der Tag hatte sich hingezogen, und Hugh hatte bei der Hitze seinen Schlafmangel nicht ausgleichen können. Inzwischen war der Schmerz im Brustkorb wieder da, und Hugh sehnte sich nach seinem Bett.
Zaghaft klopfte es an die Tür. »Verzeih, Hugh, komme ich zu spät?«
Er drehte sich um. Sal Davenport stand auf der Schwelle, wie üblich in einem hellen Rock und einer hübschen Bluse. Die Haare quollen unter einem Strohhut hervor und fielen ihr über die Schultern. Sein freudiges Lächeln erstarb, als er eine klaffende Wunde in Sals Wange und eine Schwellung am Auge entdeckte. »Komm rein, Sal«, sagte er resigniert. »Du kennst den Ablauf ja.«
Sal und Bert hatten das Dog and Drover übernommen, nachdem Sals Eltern sich vor zwanzig Jahren in einen Bungalow an der Ostküste zurückgezogen hatten. Sal war eine schlanke, geschäftige kleine Frau Anfang vierzig, die sich rote Strähnen in die zerzausten schwarzen Locken färbte, klimpernden Schmuck trug und nur selten ohne Lächeln angetroffen wurde – selbst wenn ihr anzusehen war, dass Bert sie mal wieder geschlagen hatte.
Hugh mochte sie sehr, denn offenbar ging ihr nie die Energie aus, obwohl sie die Arbeit im Pub übernahm, wenn Bert sich auf der anderen Seite der Bar mit den Gästen betrank. Obwohl sie kein Blatt vor den Mund nahm und Widerstand leistete, wurde Sal im Lauf der Jahre zu einer regelmäßig wiederkehrenden Patientin, und Hugh fragte sich zum x-ten Mal, warum eine so patente Frau auch nur daran gedacht hatte, einen solchen Dreckskerl wie Bert Davenport zu heiraten – und erst recht, bei ihm zu bleiben.
»Ich bin gestürzt und mit dem Kopf auf dem Tresen aufgeschlagen«, behauptete sie, um seinen Fragen zuvorzukommen.
»Allem Anschein nach fällst du oft und schlägst irgendwo auf, Sal.« Er reinigte die Wunde und prüfte, ob der Wangenknochen nicht erneut gebrochen war. »Vielleicht solltest du mal deine Augen untersuchen lassen?«
»Mit meiner Sehkraft ist alles in Ordnung, Hugh«, erklärte sie nüchtern. »Ich bin nur ungeschickt auf die Welt gekommen.«
Hugh gab sich nicht die Mühe, mit ihr zu streiten. Sie würde niemals eingestehen, dass Bert sie schlug. Er prüfte ihr Sehvermögen, so gut es ihm trotz des geschwollenen Augenlids möglich war, und desinfizierte die Wunde mit Jod. »Ich muss die Wunde nähen, Sal, sonst bekommst du am Ende eine Narbe.«
Sie zuckte zusammen, als er ein Narkotikum spritzte. »Das wäre egal. Ich war noch nie eine Schönheitskönigin. Außerdem würde das keinem mehr auffallen – bei meinem Alter.«
Er zog den Schemel näher heran und begann, den Riss vorsichtig zu nähen. »Du bist immer noch eine attraktive Frau, Sal. Und jung genug, um von vorn anzufangen.«
»Hm. Und wohin soll ich dann gehen? Meine Eltern haben mir die Kneipe hinterlassen, und ich habe zu viel Zeit und Mühe reingesteckt, um einfach davonzulaufen.«
»Du könntest sie verkaufen.«
»Niemand will so weit draußen was kaufen.« Ihre braunen Augen betrachteten ihn ruhig, als er die letzten Stiche setzte. »Bert und ich kommen gut miteinander klar. Er hat seine Macken – genau wie ich. Wenn mich was fertigmacht, gönn ich mir eine Verschnaufpause. Er ist nicht so schlecht, weißt du.«
Bert hatte absolut nichts Gewinnendes an sich, doch Hugh sagte nichts. Er legte ein Stück Mull über die Wunde, befestigte es mit einem Pflaster und schob den Schemel zurück.
Sal kam ziemlich wackelig auf die Beine und zupfte an ihren Haaren, bis sie über ihr übel zugerichtetes Auge fielen. Sie zog den breitkrempigen Hut darüber, erwischte Hugh, wie er sie dabei beobachtete, und schenkte ihm ein mattes Lächeln. »Er verbirgt mein Gesicht. Das erspart mir die Fragen der Wichtigtuer«, erklärte sie leichthin.
»Er steht dir gut«, murmelte Hugh.
Sie überhörte seine Schmeichelei und legte die abgezählten Münzen für die Behandlung auf den Tisch. »Bis dann, Hugh – und sieh zu, dass du ordentlich Schlaf kriegst, mein Freund. Ich seh vielleicht aus wie eine Krücke, aber du siehst aus wie eine wandelnde Leiche.«
Hugh lächelte noch immer, als sie aus dem Behandlungszimmer eilte. Ihr roter Rock flatterte, die Armbänder klirrten, und die Haare tanzten auf ihrem Rücken. Sie sah aus wie eine Zigeunerin. Vielleicht waren ihre Ahnen tatsächlich Roma – verschwand sie doch oft tagelang mit ihrem alten, zerbeulten Pick-up.
In einem kleinen Ort wie Morgan’s Reach wusste einer über den anderen Bescheid, aber trotz der Gerüchte und Klatschgeschichten hatte noch niemand entdeckt, wohin Sal dann fuhr – oder was sie in den Zeiten ihrer rätselhaften Abwesenheit trieb.
»Alles Gute, Sal«, flüsterte Hugh, als sie in einer Staubwolke vom Krankenhaus abfuhr. »Wohin du auch gehst, ich hoffe, du findest den Frieden, den du auf jeden Fall verdient hast.«