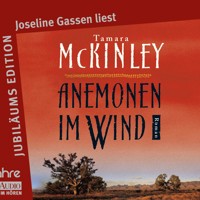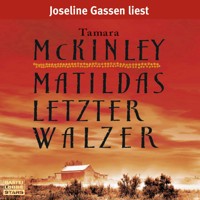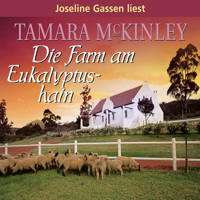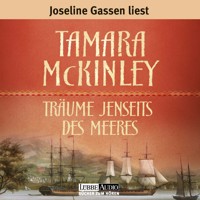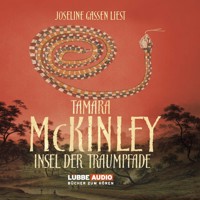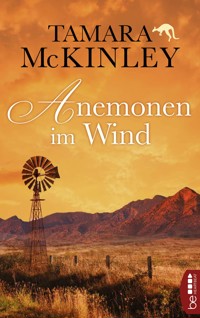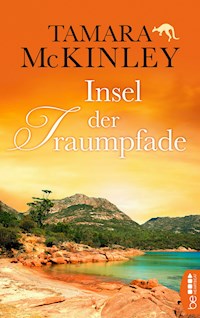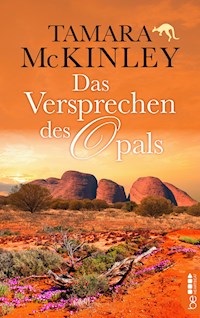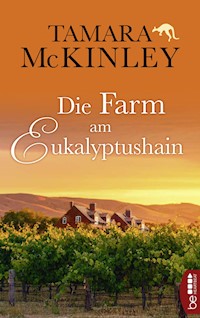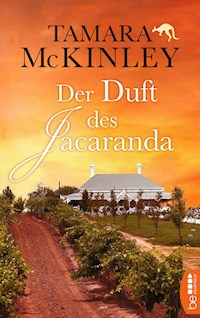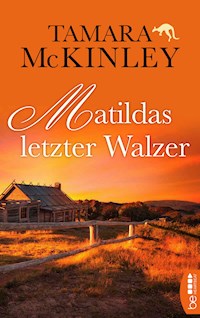7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ozeana-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Von England über Tahiti nach Australien - eine kühne Reise zu neuen Ufern und zum Mittelpunkt des Herzens
1768: James Cook nimmt Kurs auf Tahiti, begleitet von dem jungen Lord Jonathan, der seine Liebste Susan in Cornwall mit einem Eheversprechen zurücklässt. Da das Schiff in Seenot gerät, landet die Mannschaft schließlich in Australien, wo sie nur mit Hilfe der Aborigines überlebt. Als Jonathan nach seiner abenteuerlichen Reise endlich heimkehrt, hat er sein Treuegelübde gebrochen. Aber auch Susan hat aus reiner Not einen anderen Mann geheiratet. Noch ahnt sie nicht, dass ihre verlorene Liebe auch sie über das Meer führen und alles dramatisch verändern wird ...
Fesselnd erzählt Tamara McKinley von der Besiedlung des roten Kontinents, aber auch von den Eroberungen der Herzen. Sie zieht uns hinein in die Mythen und Riten geheimnisvoller Welten und lässt die Epoche der Entdecker in persönlichen Schicksalen lebendig werden.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 627
Ähnliche
INHALT
ERSCHIENENE TITEL DER AUTORIN
Die Ozeana-Trilogie:
Band 1: Träume jenseits des Meeres
Band 2: Insel der Traumpfade
Band 3: Legenden der Traumzeit
Anemonen im Wind
Das Land am Feuerfluss
Das Lied des Regenpfeifers
Das Versprechen des Opals
Der Duft des Jacaranda
Der Himmel über Tasmanien
Der Zauber von Savannah Winds
Die Farm am Eukalyptushain
Jene Tage voller Träume
Matildas letzter Walzer
ÜBER DIESES BUCH
Von England über Tahiti nach Australien – eine kühne Reise zu neuen Ufern und zum Mittelpunkt des Herzens
1768: James Cook nimmt Kurs auf Tahiti, begleitet von dem jungen Lord Jonathan, der seine Liebste Susan in Cornwall mit einem Eheversprechen zurücklässt. Da das Schiff in Seenot gerät, landet die Mannschaft schließlich in Australien, wo sie nur mit Hilfe der Aborigines überlebt. Als Jonathan nach seiner abenteuerlichen Reise endlich heimkehrt, hat er sein Treuegelübde gebrochen. Aber auch Susan hat aus reiner Not einen anderen Mann geheiratet. Noch ahnt sie nicht, dass ihre verlorene Liebe auch sie über das Meer führen und alles dramatisch verändern wird …
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
ÜBER DIE AUTORIN
Tamara McKinley wurde in Australien geboren und verbrachte ihre Kindheit im Outback des fünften Kontinents. Heute lebt sie an der Südküste Englands, aber die Sehnsucht treibt sie stets zurück in das weite, wilde Land, dessen Farben und Düfte sie in ihren Büchern heraufbeschwört. Mit ihren großen Australien-Romanen hat sie sich eine weltweite Fangemeinde erobert.
Homepage der Autorin: http://www.tamaramckinley.co.uk/
Tamara McKinley
Träume jenseits des Meeres
Aus dem australischen Englisch von Marion Balkenhol
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2007 by Tamara McKinley
Titel der englischen Originalausgabe: »Land Beyond the Sea«
Originalverlag: Hodder & Stoughton Ltd., London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2007/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Regina Maria Hartig
Redaktion: Alexandra Beilharz
Covermotive: © pisaphotography/shutterstock; © Worakit Sirijinda/shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-0213-3
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
»Ich reiste unter unbekannten Menschen in Ländern jenseits des Meeres.« William Wordsworth (1770–1850)
VORWORT
Dies ist ein Roman. Dennoch habe ich versucht, mich an die historischen Fakten zu halten, was die Entdeckung Australiens und die daraus folgenden Ereignisse angeht. Die Charaktere zeugen von der schmerzhaften Geburt der Südkolonie und sind ein Abbild der wahren Pioniere, die Australien zu dem machten, was es heute ist. Die Familien Cadwallader und Collinson sind frei erfunden, und jede Ähnlichkeit mit Lebenden oder Verstorbenen ist rein zufällig.
William Cowdray war der Kerkermeister auf der Hulk Dunkirk. Captain Cook, Joseph Banks, Solander und der junge Botaniker Sydney Parkinson sind wahre Gestalten aus der Geschichte. Auch den einarmigen Koch an Bord der Endeavour hat es tatsächlich gegeben, und Banks hat wirklich zwei Windhunde mit an Bord genommen – einer der beiden hat bei ihrem Aufenthalt in Cooktown ein kleines Wallaby gefangen. Gouverneur Arthur Phillip war der erste Gouverneur von Australien und Reverend Richard Johnson der erste Pfarrer.
Die Schrecken der zweiten Flotte sind hinlänglich bekannt. Donald Trial, Kapitän der Neptune, wurde 1792 zusammen mit seinem Ersten Maat im Old Bailey wegen Mordes angeklagt. Sie wurden freigesprochen.
PROLOG
Morgennebel
Kakadu, vor 50000 Jahren
Sie hieß Djuwe, war dreizehn Jahre alt und eine Schönheit. Djanay beobachtete, wie sie mit den anderen jungen Frauen lachte. Sein Blick folgte der köstlichen Rundung ihres Rückens und dem verlockenden Hüftschwung, als sie sich mit wiegenden Schritten von ihm entfernte, den geflochtenen Korb aufreizend in die Seite gestemmt. Er begehrte sie, seit er ihr zum ersten Mal begegnet war.
Als spüre Djuwe seine forschenden Blicke, schaute sie ihn über die Schulter hinweg mit neckischer Direktheit an. Ihre Augen blitzten und ein Lächeln huschte über ihre Lippen, bevor sie sich umdrehte und im lichtgetüpfelten Schatten zwischen den Bäumen verschwand.
Djanay rollte sich im hohen Gras auf den Rücken und unterdrückte ein Stöhnen. Sie war unerreichbar für ihn, denn diese Verbindung würde gegen das heilige Gesetz verstoßen, ihr mardayin. Dieses Gesetz zu brechen würde Verbannung, ja sogar den Tod bedeuten. Warum verhöhnte sie ihn? Er schloss die Augen. Weil sie Macht über ihn besaß, sagte er sich, und nicht davor zurückschreckte, sie zu gebrauchen.
»Steh auf, du fauler Kerl!«
Ein fester Tritt in die Rippen riss ihn aus seinen Gedanken. Wütend schaute er zu seinem Halbbruder auf. »Ich bin nicht faul«, entgegnete er und rappelte sich hastig auf.
Malangi war fast zwanzig Jahre älter als er, in seinem Haar blitzte erstes Grau auf. Die Narben der Initiation hatten sich tief in seinen geschmeidigen Körper gegraben. Er war ein erfahrener Jäger und geachtet unter den Ältesten, so dass man ihm lieber nicht in die Quere kam.
»Du schläfst in der Sonne wie die alten Frauen«, fuhr Malangi ihn an. »Bevor wir aufbrechen, müssen wir auf die Jagd gehen.«
Djanay nickte und wich dem forschenden Blick aus, denn Malangi hatte ihm bestimmt angesehen, dass er die junge Frau des Bruders begehrte. Innerlich aufgewühlt machte er sich davon. Der Blick des Bruders bohrte sich ihm wie ein gut gezielter Speer in den nackten Rücken.
Die Sonne stand hoch, die Bäume ringsum warfen dunkle Schatten auf die Lagune. Djanay wandte sich dem Busch und den steilen roten Klippen über dem sich schlängelnden Fluss zu. Er begann zu klettern; mit dem Schweiß verfloss die Sehnsucht nach dem Unerreichbaren. Er war ein typischer Vertreter seines Clans: groß und schlank, mit dunkler, von den Stammeszeichen geprägter Haut. Bis auf einen dünnen Bastgürtel und eine Kette aus Känguruzähnen war er nackt. Seine Augen glänzten bernsteinfarben, sein Haar stand als Gewirr aus schwarzen Locken nach allen Seiten ab. Er hatte eine breite Nase, die mit einem Vogelknochen durchbohrt war; die Lippen wölbten sich in jugendlicher Fülle über dem ersten Bartflaum. Mit vierzehn war er gerade zum Mann geweiht worden; nun wurde von ihm erwartet, dass er sich als Jäger denselben Respekt verdiente wie sein Vater und sein Bruder.
Er erreichte den glatten, flachen Fels, der aus den Klippen herausragte und eine herrliche Sicht auf die ausgedehnten Wälder, die hohen Berge und, tief unten, auf das glitzernde Wasser freigab.
Das war das Land, das die Geister der Urahnen in die Obhut seines Clans gegeben hatten. Es war heiliges Land, und in jedem Stein und Fels, in jeder Flusswindung und im Flüstern des Windes lebten Überreste der Schöpfungsgeister. Wie alle Clanmitglieder würde auch Djanay ein Wächter dieses Landes sein, bis seine Knochen zu Staub zerfielen. Mutter Erde nährte, tröstete und lehrte sie; es war wichtig, dass er lernte, im Einklang mit den Jahreszeiten zu leben, mit dem Kommen und Gehen der Geschöpfe, die ihn begleiteten – denn eines hing vom anderen ab, und die Spiritualität musste um jeden Preis gewahrt werden.
Das Volk der Kunwinjku war hierher gekommen, als die Geister von Djanays Urahnen in der Traumzeit lebten – in einer Zeit vor Menschengedenken, einer Zeit, als die Geister sich zeigten und den Clan in sein gelobtes Land führten. Sie wurden geleitet von Bininuwuy, dem großen Ältesten, der längst verstorben war und mit den Geistern im Himmel lebte, doch lebte ihre Reise in den Erzählungen der Ältesten und in den Bildern an den Wänden der Höhle hinter ihm weiter.
Hoch oben in den Klippen war alles ruhig und still. Djanay meinte die Last der Erwartungen seiner Urahnen zu spüren, während er dort stand und seine Muskeln spielen ließ. Es war eine schwere Bürde, sich an die Gesetze zu halten, wenn er sich mit jeder Faser nach Djuwe sehnte. Er dachte an das Mädchen, das ihm im Alter von fünf Jahren versprochen worden war. Aladjingu war aus dem Stamm der Ngadyandyi, der weiter im Nordosten lebte; sie war die Tochter des Onkels seiner Mutter. Sie waren sich bisher nur flüchtig begegnet, doch nach dem corroboree würde sie seine Frau werden. Sie entflammte seine Lenden nicht so wie Djuwe.
Aufseufzend trottete er in die heilige Höhle; er hoffte, in ihr Trost zu finden. Frauen und nicht initiierten Jungen war das Betreten verboten, doch Djanay hatte die Zeremonie mannhaft durchgestanden, als man ihm ein Stück von seiner Männlichkeit abgeschnitten und die heiligen Linien mit einem scharfen Stein in Brust und Arme geritzt hatte. Die geheimen Riten waren ihm nun vertraut, denn er hatte die Gefahren des Überlebens allein in der großen Wildnis mit Namen Kakadu erlebt.
Er stellte sich vor die ockerfarbenen Wandzeichnungen und folgte mit den Augen den von den Alten hinterlassenen Erzählungen.
Die erste handelte von einem weiten Land, das die Ältesten Gondwana nannten. Sie zeigte sein Volk, das dort neben anderen Stämmen lebte, und den bitterkalten weißen Regen, der die Erde erstarren ließ und die Jagd erschwerte. Die zweite schilderte, wie Gondwana abbrach und durch seichtes Wasser von einer größeren Landmasse getrennt war, auf der es Bäume und Tiere im Überfluss gab. In der dritten überquerten Angehörige vieler Stämme in Kanus oder zu Fuß jenes Wasser, eine vierte folgte ihrem Pfad über das ausgedehnte Land, in dem Djanay jetzt lebte.
Zwischen den Stämmen wurden Kriege mit vielen Toten geführt. Frauen waren entführt, Krieger erschlagen worden; dennoch hatte es auch Eheschließungen und Bündnisse gegeben, als noch mehr Stämme den Weg nach Süden fanden. Schon bald wurde die Jagd schwierig, die Verständigung zwischen den Stämmen wegen der Spannungen und der vielen Sprachen und Dialekte beinahe unmöglich. Schließlich hatten sie sich in alle Winkel des riesigen neuen Landes verstreut und dem Volk der Kunwinjku die Verantwortung für Kakadu überlassen.
Djanay fragte sich zwar, was hinter den Jagdgründen, die er so gut kannte, liegen mochte, doch hatte er sich zugleich damit abgefunden, es nie zu erfahren. Denn es gab nicht markierte Grenzen – Traumpfade – um das Gebiet der Kunwinjku, die man nur mit Erlaubnis der Ältesten und nur während eines corroboree überqueren durfte. Ohne eine solche Erlaubnis drohte einem der sichere Tod.
Nachdem er die altehrwürdigen Segen über den Gebeinen der verstorbenen Ältesten gesprochen hatte, machte er sich an den langen, steinigen Abstieg. Höchste Zeit, zu jagen.
Die Enten waren eine leichte Beute gewesen. Der köstliche Duft nach gerösteten Leguanen und Wallabys stieg mit dem Rauch des Lagerfeuers auf, und sein Magen knurrte in freudiger Erwartung, als er seiner Mutter die zwanzig Vögel vorlegte.
»Gut gemacht, Djanay!« Garndays Gesicht überzogen lauter Lachfältchen. Sie drückte den trinkenden Säugling noch fester an ihre Brust.
Djanay reckte die Schultern und versuchte, sich den Stolz über das Lob nicht zu sehr anmerken zu lassen, konnte aber nicht widerstehen und schaute rasch zu Djuwe hinüber, um zu prüfen, ob sie sein Geschick zur Kenntnis genommen hatte.
Djuwe beugte sich über die Beeren, die sie zubereitete, doch der Seitenblick, den sie ihm durch die langen Haare zuwarf, zeigte ihm, dass sie ihn sehr wohl zur Kenntnis nahm.
»Dein Vater wartet auf dich«, murmelte Garnday mit durchdringendem Blick. »Am besten, du beeilst dich.«
Djanay merkte, dass er aufpassen musste, denn den Augen seiner Mutter entging nichts. Er gesellte sich zu den anderen initiierten Jungen; sie hielten respektvollen Abstand zu den Ältesten, die in Begleitung der üblichen Hundeschar unter den Bäumen faulenzten. Diese dalkans mit dem gelben Fell sorgten für Wärme im Winter, für Nahrung bei Hungersnöten, warnten vor Gefahren, und obwohl sie alles andere als zahm waren, fühlten sie sich anscheinend zu den Buschmännern hingezogen.
In Gegenwart der ehrwürdigen Männer war Djanay nach wie vor unbehaglich zumute. Ohne sie gäbe es keine Initiationsriten, keine Verbindung zum Leben der spirituellen und gesetzestreuen Kunwinjku, und niemand würde von der Traumzeit erzählen.
Er ließ den Blick über das Lager schweifen und war zufrieden. Die Frauen und jungen Mädchen zwitscherten wie Vögel, während sie das Festmahl für den Abend zubereiteten und die neugierigen Hunde verscheuchten. Säuglinge hingen an der Brust ihrer Mütter, und ein paar kleine Kinder spielten mit einer gefangenen Eidechse. Unwillkürlich musste er lächeln. Seine Mutter, Garnday, erteilte wie gewohnt Befehle, ungeachtet der Tatsache, dass sie nur eine zweite Frau war und daher eigentlich kein Recht dazu besaß.
Er schaute zur ersten Frau seines Vaters hinüber, der Mutter von Malangi. Sie war alt, gebrechlich und runzlig. Bald würde ihre Zeit kommen, da sie den Gesang des Geistvolkes vernehmen und ihm zu den Sternen folgen würde. Ob Garnday das spürte und ihre Autorität erprobte? Sie sollte vorsichtiger damit umgehen, dachte er, denn die ältere Frau genoss Hochachtung und übte noch immer großen Einfluss auf den gemeinsamen Mann aus.
Garnday dachte verzweifelt darüber nach, was sie mit Djanay machen sollte. Wie dumm von ihm, einen Blick auf Djuwe zu werfen! Über kurz oder lang würde Blut fließen, denn Malangi war ein eifersüchtiger Ehemann.
Djanay war jetzt ein Mann, von dem erwartet wurde, dass er dem heiligen mardayin treu blieb. Sie war so stolz auf ihn gewesen und hatte hohe Erwartungen an ihren Lieblingssohn. Seine bevorstehende Heirat mit Aladjingu würde ihn näher an den Kreis der Ältesten heranführen. Eines Tages, wenn alles gut ging, hoffte sie, ihn als Anführer ihres Stammes zu sehen. Malangi war bereits fünfunddreißig und wäre längst tot, wenn Djanay in das Alter käme, die Führung zu übernehmen. Nun zerbrachen ihre ehrgeizigen Hoffnungen – das war Djuwes Schuld. Sie war ein Eindringling und verursachte nur Ärger.
Ihre Augen wurden schmal, als sie das Mädchen beobachtete. Djuwe war Malangi in früher Kindheit versprochen worden. Sie war die Tochter eines Ältesten der Iwadja, und der große Altersunterschied war nicht ungewöhnlich. Das Bündnis zwischen den beiden Stämmen war wichtig, denn sie hatten gemeinsame Jagdgründe und standen sich zur Seite, wenn eindringende Stämme angriffen.
Garnday bemerkte plötzlich, dass die alte Frau sie beobachtete. Schaudernd überkam sie die Vorahnung, dass ihr Sohn in großer Gefahr schwebte. Es war nur eine Frage der Zeit, bis Djanay das Mädchen mit in den Busch nehmen würde, und die alte Frau würde nicht zögern, ihn zu bestrafen. Denn trotz ihres hohen Alters hatte auch sie Ambitionen und sähe Malangi gern als Stammesführer.
Die beiden Frauen funkelten sich an. Sie hatten nicht viel füreinander übrig. Garnday wusste, dass die Ältere ihr die Jugend und die Fähigkeit neidete, ihrem Mann viele Söhne zu schenken. Doch als Jüngere musste Garnday ihr Respekt erweisen – musste von der Alten die Geheimnisse des Überlebens lernen, sich ihren Wünschen fügen und sich um sie kümmern, wenn diese alt war. Sie straffte die Schultern, warf trotzig ihr dichtes schwarzes Haar in den Nacken und eilte zurück ans Lagerfeuer.
Djuwe war seit zehn Monden bei ihnen, und noch immer machten sich keine Anzeichen einer Schwangerschaft bemerkbar. Garnday beäugte sie mit Abscheu. Sie hatte Djuwe in Verdacht, dass sie die besondere Mischung aus Blättern und Beeren aß, die neues Leben im Keim erstickte.
Alle Frauen machten das, denn es war unmöglich, mehr als ein Kind zu stillen und sich zugleich im Clan nützlich zu machen. Gebar eine Frau Zwillinge, wurde der eine sofort erschlagen, denn in den trockenen Jahreszeiten mussten sie auf der Suche nach Wasser oft lange Wanderungen über verdorrtes Land unternehmen, und nur der Stärkere konnte überleben.
»Sie hat keinen Grund, kinderlos zu bleiben«, murmelte sie vor sich hin. »Es sei denn, sie ist unfruchtbar – und das bezweifle ich.« Sie sah, wie das Mädchen Djanay einen koketten Blick zuwarf. »Nein, sie hat andere Pläne«, sagte sie kaum hörbar.
Das Ritual der Abendmahlzeit lenkte ihre Gedanken wieder auf die Gegenwart und die Verteilung des Essens. Zuerst wurden den Männern und initiierten Jungen die besten Stücke aufgetragen. Die jungen Frauen fütterten ihre Kinder, aßen dann selbst und überließen es den Älteren, in der Asche nach Resten zu suchen. Dieser Brauch entsprang nicht etwa einem Mangel an Respekt; die Älteren würden in absehbarer Zeit in das Land der Geister gerufen, die Nahrung wäre an sie verschwendet. Da war es besser, die Jäger und Sammler zu nähren und der folgenden Generation Kraft zu verleihen.
Während Garnday das heiße Fleisch aß, beobachtete sie Djuwe verstohlen. Das Mädchen lachte und schwätzte mit den anderen jungen Frauen, seine Lippen glitzerten vom Fett der Vögel, sein Blick schoss wiederholt zu Djanay. Djuwe war schön, gestand sich Garnday schmollend ein; allerdings war Malangi schon misstrauisch und beobachtete jede ihrer Bewegungen. Scherereien drohten, falls sie nichts dagegen unternahm.
Schließlich war die Mahlzeit beendet. Das Feuer wurde geschürt, um Licht und Wärme zu verbreiten und die Raubtiere fernzuhalten. Mit sanfter Stimme trug der Erzähler die Traumzeitlegende vor, warum die Eule bei Nacht jagte. Auf der weichen roten Erde lagen Familien unter den Fellen von Wallabys und Wombats beisammen, und schon bald war es still im Lager bis auf leise Schnarchtöne oder das gelegentliche Wimmern eines unruhigen Säuglings.
Garnday kuschelte sich mit dem Rücken an den knochigen Körper ihres Mannes. Die beiden kleinen Jungen und der Säugling schmiegten sich an ihren Bauch. Die Hunde lagen eingerollt in ihrer Nähe. Die erste Frau drängte sich an den Rücken ihres Mannes und schlang den Arm um seine Taille, als wolle sie das Recht der Älteren hervorheben.
Garnday wusste, dass sie in dieser Nacht nicht gut schlafen würde. Djanay war bei den anderen unverheirateten Jungen auf der anderen Seite des Lagers, und obwohl sie seine hingestreckte Gestalt im tanzenden Licht des Feuers erkannte, sah sie, dass er noch nicht schlief. Ein Stück weiter lag Malangi mit seinen drei Frauen, und Garnday stellte fest, dass Djuwe sich einen Platz am äußersten Rand des Knäuels aus Frauen und Kindern gesucht hatte. In der Luft hing eine Stille, die Böses ahnen und Garndays Herz schneller schlagen ließ. Wachsam und angespannt lag sie da, während der Mond tanzende Schatten unter die Bäume warf.
Djanays Bauch war gut gefüllt, und doch fand er keinen Schlaf. Verstohlen rutschte er in den tieferen Schatten, denn er hielt es nicht mehr aus, Djuwe bei ihrem Mann liegen zu sehen. Außerdem musste er dem aufmerksamen Blick seiner Mutter entfliehen.
Seine bloßen Füße machten kaum ein Geräusch, als er der Einsamkeit des Flussufers zustrebte.
Das Wasser wirbelte in Strudeln, wenn es sich an dicken Steinen fing, und fiel über Felskanten hinab. Djanay hockte sich auf einen von der Hitze noch warmen Stein und starrte in sein Spiegelbild. Er sah einen Mann in den besten Jahren. Trotzdem hatte er noch nie mit einer Frau geschlafen, denn das war nach den Stammesregeln vor der Ehe verboten. Er wusste, dass Djuwe ihm niemals gehören konnte, doch die Erregung, die sie versprach, war so stark, dass er nicht mehr klar denken konnte. Er tauchte die Hände ins Wasser und trank in tiefen Zügen, spritzte sich die eisigen Tropfen ins Gesicht in der Hoffnung, Wanjina, der Wassergeist, werde ihm helfen.
Das Flüstern kam aus der Dunkelheit. »Djanay?«
Erschrocken schaute er auf. Seine Entschlossenheit schwand.
Er erhob sich, verzaubert durch das Spiel des Mondlichts auf Djuwes schönem Körper. Die Berührung ihrer Hand ließ ein Feuer in ihm auflodern. Wortlos folgte er ihr in den Busch.
Sie standen voreinander; nur ihr Atem war zu hören. Djuwes Finger zogen eine heiße Spur von seiner Schläfe bis an die Lippen, dann über die Brust bis zum Bauch und noch tiefer. Unter den Wimpern lächelte sie zu ihm auf, die Grübchen auf ihren Wangen zeigten sich flüchtig, als sie sich ihm näherte. »Djanay«, flüsterte sie. »Endlich!«
Djanay stockte der Atem. Vorsichtig berührte er ihre Brüste, verwundert darüber, wie sie sich in seine Handflächen schmiegten, wie die dunklen Brustwarzen steif wurden, als er mit dem Daumen darüberstrich.
Djuwe ließ die Finger über seinen Bauch bis an den schmerzhaft pochenden Puls seiner Männlichkeit gleiten. »Schnell«, keuchte sie, »bevor man uns erwischt.«
Endlich gab Djanay dem Verlangen nach, das er so lange unterdrückt hatte.
Vollkommen verausgabt lagen sie ineinander verschlungen auf dem Boden. Schweiß rann über ihre Körper, während sie Atem schöpften. Sie hatten die verbotene Frucht gekostet, und als sie sich mit den Händen gegenseitig erforschten, stieg die Begierde erneut und noch stärker in ihnen auf.
So sehr waren sie miteinander beschäftigt, dass sie die stille, aufmerksame Gestalt nicht bemerkten, die sich schließlich entfernte und mit den Schatten verschmolz.
Noch vor dem Morgengrauen stillte Garnday mit schweren Lidern ihren Säugling und schickte die anderen beiden Jungen fort, Holz für das Feuer zu sammeln. Ihr Mann schlief noch, doch die alte Frau stocherte bereits in der Glut des Lagerfeuers. Garnday gähnte, kratzte sich den Kopf und pickte mit geübter Hand Zecken und Läuse heraus, die sie rasch zwischen den Fingern zerdrückte. Es war ihr gelungen, so lange nicht einzuschlafen, bis die Alte schnarchte, doch als sie mitten in der Nacht wach geworden war, hatte sie mit raschem Blick erfasst, dass es zu spät für sie war, dem Unvermeidlichen Einhalt zu gebieten.
Ihr einziger Trost war, dass die alte Frau nicht wach geworden war und Malangi weitergeschnarcht hatte, ohne etwas vom Seitensprung seiner jüngsten Frau mitzubekommen. Garnday wusste, dass sie mit ihrem Sohn reden musste, bevor jemand merkte, was vor sich ging.
Djanay musste begreifen, in welcher Gefahr er schwebte – sie würde ihn sich vorknöpfen, wenn der Rest des Clans anderweitig beschäftigt war.
Sie hockte sich an die Feuerstelle, griff nach dem glatten Mahlstein und begann mit der ermüdenden Arbeit, Samen mit Kräutern zu Mehl zu verarbeiten, das sie mit Wasser vermischte und zu Fladen knetete, die in der Glut gebacken wurden. Dieses ungesäuerte Brot war ein wichtiger Bestandteil ihrer Nahrung; sie aßen es mit Fleisch und Fisch noch vor Sonnenaufgang und bei Einbruch der Dunkelheit, wenn die Jagd erfolgreich gewesen war.
Djuwe näherte sich dem Lagerfeuer mit einem Binsenkorb voll frisch gefangener Fische, eine silbrige Masse, die sie neben Garnday ausschüttete. »Ich bin eine gute Fischerin«, sagte sie. »Ich fange große Fische.«
Der Triumph in ihren Augen grenzte an Unverschämtheit, ihre Worte waren doppeldeutig, und Garndays Hand zuckte. Am liebsten hätte sie in dieses kecke Gesicht geschlagen. Stattdessen hielt sie ihre Zunge im Zaum und schwieg, während sie jeden Fisch einzeln in Blätter und Kräuter einwickelte und neben das Brot in die Glut legte. Über kurz oder lang würde Djuwe die Kraft ihrer Wut kennenlernen.
Dabei gab sie dem Mädchen nicht allein die Schuld. Djanay war töricht, halsstarrig und schwach – er war eben ein Mann und kam nicht dagegen an. Trotz ihrer Tüchtigkeit beim Jagen und ihres großspurigen Geredes konnten Männer nicht ohne Frauen überleben: Sie hatten ihre Bedürfnisse, und darin lag ihre Schwäche.
Die Sonne lugte gerade eben über den Horizont, und die Kälte der Nacht glitzerte noch im hohen Gras. Erregung breitete sich aus, als man über Pläne sprach. Sobald sich alle den Bauch bis zum Platzen gefüllt hatten, wurde das Feuer gelöscht, und die Männer griffen zu ihren Speeren, Bumerangs, woomeras und Schilden.
Die alte Frau begann mit ihrem jährlichen Ritual, Eier von Emus zu sammeln. Unter ihren harschen Befehlen trugen Garnday und die anderen Frauen die Eier vorsichtig zum Fluss hinunter. Das Fleisch des ngurrurdu war zäh und nicht sehr nahrhaft, doch diese nicht ausgebrüteten Eier, deren Inhalt sich längst verflüchtigt hatte, ergaben ausgezeichnete Wasserbehälter. Mit einem scharfen Stein wurden sie angestochen und gefüllt, dann wurden die Löcher mit Pfropfen aus geflochtenem Gras verstopft.
»Wir haben genug«, verkündete die alte Frau. »Verteilt sie. Sie dürfen nur im Notfall benutzt werden«, schnarrte sie. »In der Wüste gibt es noch andere Wasserquellen.«
Garnday setzte sich den Säugling auf die Hüfte, rückte Eier und Kind in eine bequemere Position und wartete, auf ihren starken Grabstock gestützt, dass die Ältesten die Geister besängen, bevor sie den Weg wieder aufnahmen. Sie hatte keine Gelegenheit gehabt, mit Djanay zu reden – sie musste es auf später verschieben.
Ein dichter Schwarm winziger bunter Vögel zog wie eine Wolke über das Lager. Das war ein gutes Omen. Die Vögel waren nach Hause zurückgekehrt – also würden sie es auch schaffen.
Nachdem die unumgänglichen Gesänge und Rituale vorbei waren, stampften die Ältesten mit den Füßen, hoben die Schilde und stießen einen lauten Triumphschrei aus. Zeit aufzubrechen.
Sobald der Clan die langen, kühlen Schatten der roten Klippen verlassen hatte, änderte sich die Landschaft abrupt. Die Erde war blutrot, die Bäume verkümmert und welk. Die Hitze zog sich in Wellen über den ausgedörrten Boden. Erdbeben hatten höhlenartige Schluchten und hoch aufragende rote und schwarze Felsnadeln entstehen lassen; Wächtern gleich, standen riesige Ameisenhügel an ihrem langen Weg nach Süden. Der Himmel war strahlend blau, aber am Horizont von einer grauen Säule verdunkelt. Das war der Geist des Hollow Mountain, der Feuer und Rauch spie, um Unbefugte zu warnen. Doch Garnday wusste, dass sie das Land des zornigen Geistes nicht durchqueren würden, denn ihr Pfad führte nach Süden zum Herzen des Träumens und zu den heiligen Erhebungen von Uluru und Kata Tjuta.
Schwelend heißen Tagen folgten eiskalte Nächte. Die Wanderung nach Süden hatte einen ganzen Mondzyklus gedauert, ehe Garnday die Möglichkeit fand, mit ihrem Sohn zu reden. Djanay war ihr aus dem Weg gegangen.
Sie hatten das sengende Herz ihrer großen Insel erreicht. Hier war die Erde weicher; sie stieg wie Staub unter ihren Füßen auf, als sie sich langsam ihrem traditionellen Lagerplatz näherten. Ringsum lagen riesige Felsbrocken verstreut, rund und glatt wie Eier. Das war Karlwekarlwe, und die Steine waren Eier, die die Regenbogenschlange während der Traumzeit hier abgelegt hatte.
Dies war ein heiliger Ort mit einer eigenen Aura, weshalb nur leise gesprochen wurde. Die Kinder drängten sich an ihre Mütter, denn zwischen den Eiern hausten böse Geister, die Menschengestalt annahmen und Kinder fortlockten. Verlorene Kinder sah man nie wieder, es sei denn, man stimmte besondere Lieder an – zuweilen funktionierten auch sie nicht, denn hatten die Geister ein Kind einmal mitgenommen, gaben sie es nur widerwillig wieder her.
Garnday fiel mit ein, als die Frauen die Regenbogenschlange besangen. Die Medizinfrau rasselte mit ihrem Zauberkürbis, und die Männer klopften mit den Speeren auf die Schilde, um böse Geister zu verscheuchen. Am Ende wurde der Platz für sicher erklärt.
Die Männer hatten unterwegs zwei Schlangen und eine große, dicke Eidechse gefangen, die ins Feuer geworfen wurden. Garnday machte sich auf die Suche nach den breiten, fleischigen Blättern der Pflanzen, die im Schatten der Schlangeneier wuchsen. Die Blätter enthielten Wasser und Saft, und wenn man sie zerdrückte, ergaben sie eine Heilsalbe gegen Insektenstiche, Schnitte und Schürfwunden. Sie hatte jedoch einen viel dringenderen Grund, die Feuerstelle zu verlassen, denn sie hatte Djanay in die Dunkelheit wandern sehen.
»Wir müssen miteinander reden«, hob sie an.
»Ich habe dir nichts zu sagen«, entgegnete er. »Lass mich in Ruhe!«
»Ich habe Augen im Kopf«, fuhr sie ihn leise an, damit niemand sie hörte. »Ich weiß, was du mit Djuwe treibst.«
Er wich ihrem Blick aus. »Gar nichts weißt du«, murmelte er.
Sie packte sein Kinn und zwang ihn, sie anzusehen. »Ich weiß Bescheid«, sagte sie. »Und es muss aufhören. Sofort. Malangi beobachtet sie. Er wird euch beide umbringen.«
Er schaute auf sie herab. »Kümmere dich um deine Kinder, Mutter! Ich bin jetzt ein Mann.«
Er wollte sich schon abwenden, doch sie hielt ihn am Arm fest. »Als Mann kennst du die Strafen für den Bruch des heiligen mardayin. Djuwe bringt nichts als Ärger.«
Sie wusste nicht, was in Djanays Kopf vorging. Er riss sich von ihr los und war mit zwei Schritten in der Dunkelheit verschwunden.
Garndays Unterlippe zitterte, sie spürte, wie ihr die Tränen kamen. Wütend wischte sie sich über die Augen, sammelte die kostbaren Blätter ein und schaute zur Feuerstelle zurück. Sie hatte ihren Sohn verloren. »Was soll ich nur machen?«, stöhnte sie. Sie schloss die Augen und bat die Regenbogenschlange um Hilfe, obwohl sie tief in ihrem Herzen wusste, dass selbst dieser Große Geist weder die Lust ihres Sohnes noch die Tücken eines wollüstigen Mädchens zu bekämpfen vermochte.
Sobald das Abendessen vorbei und die rituelle Geschichte zu Ende erzählt war, bettete Garnday ihre Kinder dicht an ihren Mann. Das Herz war ihr schwer, und sie wusste, sie würde trotz ihrer Schwäche in dieser Nacht kaum ein Auge zutun. Djuwe lag wieder am Rand ihrer Familiengruppe, und Djanays Erregung war beinahe mit Händen zu greifen. Garnday zog das Kängurufell über ihre schlafenden Kinder und forderte die dalkans auf, ihnen Wärme zu spenden. Zufrieden, sie in Sicherheit zu wissen, huschte sie in die Dunkelheit.
Der Frühlingsmond hatte fast ein Drittel seines nächtlichen Wegs zurückgelegt, als Djuwe sich aufsetzte und das Tierfell ablegte.
Garnday spannte sich an, ihr Blick flog zu Djanay. Er gab vor zu schlafen, doch sie sah den Schimmer des verlöschenden Lagerfeuers in seinen wachsamen Augen.
Kurz schaute Djuwe auf ihren schlafenden Mann, streckte sich, gähnte und schälte sich behutsam aus der Gruppe. Vorsichtig kroch sie ins Buschwerk.
Garnday erstarrte.
Malangi richtete sich auf und beobachtete seine Frau.
Mit klopfendem Herzen schaute Garnday zu Djanay hinüber. Er tat noch immer so, als schliefe er.
Malangi zog sich das Kängurufell über die Schultern, funkelte mit grimmiger Miene zu Djanay hinüber, dann über die kreisrunde Feuerstelle hinaus.
Garnday hielt die Luft an.
Djanay bewegte sich, schlug das Wombatfell beiseite, stützte sich auf einen Ellenbogen, bereit, aufzustehen und dem Mädchen zu folgen.
Malangi spannte sich an, durch die Bewegung alarmiert.
Garnday wollte aufschreien, Djanay warnen, doch sein Schicksal lag nicht mehr in ihren Händen.
Malangis harter Blick hatte sich auf seinen Bruder gerichtet, und als wäre er sich dessen bewusst, erstarrte Djanay.
Endlos verharrte er auf dem Ellenbogen. Dann veränderte er die Lage, als versuche er, eine bequemere Stelle zu finden, und rollte sich wieder unter das Wombatfell.
Garnday stieß einen tiefen Seufzer der Erleichterung aus, doch das Herz schlug ihr bis zum Hals, und ihr Mund war trocken. Das war knapp gewesen. Leise entfernte sie sich von ihrem Beobachtungsposten. Sie musste das Mädchen finden und ihm zu verstehen geben, wie gefährlich es jetzt war, nachdem Malangi Verdacht geschöpft hatte.
Unheimlich zeichneten sich die großen Rundungen der Schlangeneier vor dem Nachthimmel ab. Deren schiere Größe und Majestät raubten ihr beinahe den Mut, als sie über die uralten, von Sternen erhellten Pfade schlich. Ihr Puls raste, und als eine Eidechse vor ihren Füßen davonhuschte, musste sie einen Aufschrei unterdrücken.
Ein dumpfer Laut, der nicht zu den nächtlichen Geräuschen passte, ließ sie innehalten. Sie blieb stehen und lauschte, doch er kam nicht wieder. Sie schüttelte den Kopf, redete sich selbst gut zu weiterzugehen; doch ihre Anspannung war so stark, dass sie bei jedem Seufzer des Windes zusammenfuhr.
Sie umrundete die sinnliche Wölbung eines riesigen Eis und erstarrte.
»Geh fort!«, zischte die alte Frau. »Das sollst du nicht mit ansehen.«
Garnday taumelte um den heiligen Felsen herum und näherte sich der auf dem Boden zusammengesunkenen Gestalt. »Was hast du getan?«, flüsterte sie.
Die Alte wog den schweren Stein in ihrer Hand und schaute auf Djuwe hinunter. In Anbetracht des klaffenden Lochs im Schädel des Mädchens war überraschend wenig Blut ausgetreten. »Sie hat das Gesetz gebrochen«, sagte sie. »Sie musste bestraft werden.«
Garnday betrachtete die Leiche, fasziniert und entsetzt zugleich. Ihr Magen rebellierte, und die Galle kam ihr hoch, doch es gelang ihr, sich zu beherrschen. »Es ist die Aufgabe des Mannes, sie zu bestrafen«, hauchte sie.
Die Alte steckte den Stein in die Tasche aus Wallabyfellen an ihrer Taille. »Hilf mir, sie loszuwerden.«
Garnday trat einen Schritt zurück. Das Töten eines Stammesangehörigen war gegen das Gesetz. So etwas auf geheiligtem Grund zu tun, verärgerte die Geister und würde ihren Zorn über sie alle bringen. Es war die Tat einer Wahnsinnigen, und sie wollte nichts damit zu tun haben.
Die Hand der Frau legte sich wie eine Klaue fest um Garndays Arm. Die Alte stank aus dem Mund, als sie sich zu ihr beugte. »Mit deinem Sohn hat sie das Gesetz gebrochen. Sie hat Schande über meinen Sohn und über unsere Familie gebracht. Sie verschwindet am besten, bevor die Ältesten davon erfahren. Und für dich wäre es besser zu tun, was ich dir sage.«
Die Drohung war nicht zu überhören, doch Garnday hatte noch größere Angst vor den Geistern. »Aber was du gemacht hast, ist noch schlimmer«, zischte sie zurück. Sie versuchte, sich aus dem Klammergriff zu befreien, doch die Alte war erstaunlich stark. »Warum hast du sie nicht Malangi überlassen? Er wusste bereits, dass zwischen den beiden etwas vor sich ging. Er hat sie den ganzen Abend beobachtet und sucht wahrscheinlich schon nach ihr.«
»Dann müssen wir uns sputen.« Endlich lockerte die Alte ihren Griff. »Wir sind beide Mütter von Söhnen«, raunte sie. »Es ist unsere Pflicht, ihre Ehre zu verteidigen – egal, was sie machen.« Sie hob den Kopf, das runzlige Gesicht und die blassen Augen glichen einer Totenmaske. »Dein Sohn soll bald verheiratet werden, und du hast weitere Söhne, die ihm folgen sollen. Ich habe nur den einen, und ihm ist es bestimmt, Anführer des Stammes zu werden. Dieses Mädchen hätte das alles zerstört. Hilfst du mir jetzt?«
Das war keine Bitte. Es gab keinen Ausweg. »Aber wo sollen wir sie verstecken?«
»Ich kenne eine Stelle. Komm schnell.«
Garnday packte die Füße des Mädchens, während die ältere Frau die Arme nahm und voranging. Offenbar kannte sie diesen heiligen Ort gut. Eine tiefe Felsspalte führte in eine geheime schmale Höhle.
»Beeil dich!«, zischelte sie, als Garnday zögerte. »Unsere Arbeit ist noch nicht beendet. Wir haben nicht viel Zeit.«
Garnday gehorchte. Kurz darauf trugen sie ihre Last durch einen langen Tunnel hinab. Von den Wänden hallten ihre Atemzüge wider, und sie glaubte die Augen der bösen Geister zu spüren, die sie auf ihrem Weg in die Höhle beobachteten.
»Das reicht.«
Es herrschte vollkommene Finsternis. Garnday ließ die Last fallen und trat einen zögernden Schritt zurück. Ihre Nerven waren zum Zerreißen gespannt. Die Wände der Höhle schienen immer näher zu rücken.
Die Stimme der alten Frau dröhnte in der Dunkelheit. »Hier an dieser Stelle ist ein tiefes Loch.« Ihre knöcherne Hand umklammerte Garndays Arm und zog sie nach vorn, bis ihre Zehen den Rand eines unsichtbaren Abgrunds spürten.
Garnday zitterte angesichts der Gefahr, doch war ihr bewusst, dass sie der Alten gehorchen musste, wenn sie diesen schrecklichen Ort je verlassen wollte.
Auf den Befehl der Alten warfen sie die Leiche mit Schwung ins Leere und lauschten. Wie reifes Obst prallte der leblose Körper gegen unsichtbare Wände und löste dabei Steine und Geröll. Dieser stumme Fall hatte etwas Abstoßendes.
Die Alte warf einen schweren Steinbrocken hinterher. »So«, murmelte sie, »geschafft.«
Garnday hetzte zurück durch den Tunnel. Sie stolperte in die Höhle und zwängte sich ungeachtet der Schnitte und Kratzer durch die scharfen Felsen und die klebrigen, dornigen Pflanzen ins Freie. Sie rutschte über die steile Rundung des Eis und fiel auf den Boden. Dankbar krallte sie sich in die weiche rote Erde und sog gierig die herrliche kalte Nachtluft ein.
Rollende Kiesel kündeten den Abstieg der älteren Frau an. Garnday hörte, dass sie tief einatmete und einen leisen Schmerzenslaut von sich gab, als sie neben ihr landete. »Was ist los?«, wollte sie wissen. »Bist du verletzt?«
Ihre Frage wurde herrisch beiseitegewischt. »Nichts ist. Geh zu den anderen zurück!«
Garnday bedurfte keiner Aufforderung. Sie rannte auf den heimeligen Schein zu, der noch immer von der Feuerstelle ausging, und kroch unter die Kängurufelle. Während sie zitternd dort lag, kehrte auch die alte Frau zurück. Garnday konnte es nur erahnen, denn sie bewegte sich wie ein Schatten. Kein Wunder, dass es ihr gelungen war, das Liebespaar auszuspionieren.
»Sie ist weg! Meine Kleine ist verschwunden!« Der grauenhafte Schrei zerriss die Stille.
Garnday sprang mit klopfendem Herzen auf und packte ihre erschrockenen Kinder. Alle wurden wach, die Männer erhoben sich sofort und griffen nach den Speeren.
Das Gesicht der jungen Frau war tränenüberströmt. Sie raufte sich die Haare. »Sie ist weg. Die Geister haben mein kleines Mädchen geholt.«
»Seit wann?«
»Als ich wach wurde, war sie nicht mehr da«, jammerte die Mutter.
Malangi schritt in den Kreis. »Meine Frau ist auch fort«, verkündete er. »Ich habe fast die ganze Nacht nach ihr gesucht.« Er warf Djanay einen kurzen Blick zu. »Vielleicht haben die Geister auch sie geholt?«
Djanays Blick irrte umher. »Sie ist zu alt für die Geister«, platzte es aus ihm heraus. »Die nehmen nur Kinder.«
Zustimmendes Raunen machte die Runde, unterbrochen nur vom Jammern der beraubten Mutter. »Wir vergeuden Zeit«, kreischte sie. »Wir müssen sie finden.«
Die alte Frau zwängte sich in die Mitte der Gruppe. »Sucht bei den Steinen und auf den verborgenen Pfaden«, befahl sie. »Wenn wir sie nicht finden, werden wir singen, um sie zurückzuholen.«
Garnday musterte die Alte scharf. Sie würde doch kein Kind benutzen, um ihre Schandtat zu vertuschen! Und wenn doch – was hatte sie dann mit dem Kind gemacht?
»Komm schon. Worauf wartest du noch, Garnday?«
Garnday sah das Humpeln der Alten, die ihre linke Hüfte schonte. Vielleicht war das die Strafe der Geister für das Böse, das sie verübt hatte – denn wenn sie mit dem Clan nicht mehr mithalten konnte, bedeutete eine Verletzung den Tod.
Als die Sonne höherstieg, versammelten sich die Frauen und begannen zu singen. Sie mussten die Geister des Karlwekarlwe besänftigen, wenn sie die Verlorenen wiedersehen wollten.
Malangi starrte mit versteinerter Miene in die Flammen. Djanays Augen waren gerötet, doch er hatte immerhin die Kraft, das volle Ausmaß seiner Gefühle zu verbergen. Garnday konzentrierte sich auf die Lieder. Die Strafe, die sie von den Geistern zu erwarten hatte, würde bestimmt viel höher ausfallen, wenn auch das Kind verloren wäre.
Die uralten Gesänge wurden seit der Traumzeit von den Müttern an die Töchter weitergegeben. Eine Frau nach der anderen verließ den Kreis, streifte zwischen den heiligen Steinen umher und rief die Geister an, die Verlorenen freizugeben. Bei ihrer Rückkehr waren dann alle Augen hoffnungsvoll auf sie gerichtet; das Lied verklang, wenn man sah, dass sie allein kam.
Der Gesang wurde intensiver, je höher die Sonne stieg, doch von dem Kind und der jungen Frau gab es immer noch keine Spur. Garnday kehrte in den Kreis zurück und sah gerade noch, wie die Alte weghumpelte. Sie war lange fort, und ein Schauer der Hoffnung lief durch die Wartenden. Endlich tauchte die Alte auf, doch ihre Arme waren leer. Garnday beäugte sie argwöhnisch, denn sie hätte schwören können, dass sie ein Triumphieren über ihr Gesicht hatte huschen sehen. Wie war das möglich, wenn sie doch ohne das Kind zurückgekommen war?
Ein einziger zitternder Jammerlaut zerriss die Luft.
Sogleich trat Stille ein, und alle drehten sich gleichzeitig zu dem Geräusch um – in der irrwitzigen Hoffnung, es noch einmal zu hören. Und da war es wieder, kräftig, wütend und wild entschlossen, sich Gehör zu verschaffen.
Die Mutter schrie auf und rannte darauf zu, die anderen Frauen im Schlepptau. Das kleine Mädchen lag auf einem Felsabsatz, unverletzt, aber ausgehungert und verängstigt. Unter Freudengeschrei hob die Mutter ihr Kind hoch, und niemand dachte daran, sich zu den beiden Frauen umzudrehen, die sich nicht an dem Taumel beteiligt hatten.
In diesem Moment begriff Garnday, wie gerissen und stark die Ältere war, und erkannte, dass sie und Djanay in Lebensgefahr schwebten.
Die Feier war ausgelassen, fiel aber kurz aus, denn die Geister hatten Djuwe nicht zurückgegeben. Die Rituale mussten unverzüglich abgehalten werden, wenn Djuwes Geist ins Jenseits entlassen werden sollte.
Garnday drückte ihre Kinder an sich, während sie beobachtete, wie Malangi seinen Körper mit kalter Asche aus der Feuerstelle einrieb und die lange, sich wiederholende Totenklage anstimmte. Sie hätte nicht sagen können, was in ihm vorging. Unter normalen Umständen trauerte ein Witwer zwölf Monde lang, gab seine Frauen und Kinder in die Obhut von Verwandten, während er durch das Land streifte, doch wegen des corroboree würde Malangi seine einsame Wanderung verschieben.
Garnday entfernte sich unbemerkt und suchte Djanay. Schließlich fand sie ihn zwischen den länger werdenden Schatten. »Warum haben die Geister sie zu sich genommen?«
Garnday wusste, dass sie ihm eine weise Antwort geben musste. »Sie hat sie verärgert«, murmelte sie.
Er nickte und schaute mit starrem Blick über die Ebenen. »Dann hätten sie mich auch mitnehmen sollen, nicht das Kind.«
Sie hockte sich zu seinen Füßen nieder. »Sie haben sich entschieden, das Kind zurückzugeben«, antwortete sie ruhig. »Es steht uns nicht zu, ihre Gründe in Frage zu stellen, sondern wir sollten ihnen für die rechtzeitige Warnung danken.«
Ein langes Schweigen trat ein, in dem Djanay ihre Worte in sich aufnahm. »Du hast versucht, mich zu warnen, aber aus Stolz hörte ich nicht auf dich. Jetzt ist Djuwe für immer verloren.« Er wandte sich zu ihr um, sie sah die Angst in seinen Augen. »Wir haben das heilige mardayin gebrochen – was wird jetzt mit mir geschehen?«
»Es wird eine Strafe geben«, sagte sie vorsichtig. »Aber es hat den Anschein, als wären die Geister fürs Erste besänftigt.«
Er schaute über sie hinweg zu den Singenden. »Was soll ich tun, Mutter?«
Es gab viele Gefahren und zu viele Geheimnisse, sie musste ihre Wörter mit Bedacht wählen. »Du wirst Djuwe vergessen«, sagte sie schließlich mit einer Entschlossenheit, die ihre eigene Angst Lügen strafte. »Trauere um sie mit uns anderen und setze die Wanderung nach Uluru zu deiner Hochzeitszeremonie fort.«
»Wie soll ich das anstellen – wenn ich doch die grausame Strafe kenne, die Djuwe von den Geistern auferlegt wurde?«
»Weil du ein Mann bist und deiner Familie, deinem Stamm und deiner zukünftigen Frau gegenüber Verantwortung trägst. Die Geister werden dich beobachten, Djanay. Du musst achtsam sein – denn sie sind verärgert.«
»Sie beobachten mich?« Furchtsam schaute er sich um.
Garnday legte Nachdruck in ihre Worte. »Immer. Deshalb darfst du nicht mit Aladjingu zum Volk der Kunwinjku zurückkehren, wenn ihr einmal verheiratet seid«, sagte sie resolut. Ohne auf seine erschrockene Reaktion einzugehen, sprach sie hastig weiter. »Ihr müsst zum Nordwind wandern und euch einen Platz bei den Ngadyandyi suchen. Sie sind mit dem Onkel von Aladjingus Mutter verwandt und werden euch aufnehmen.«
»Aber ich gehöre zu den Kunwinjku. Ich bin ein Sohn des Clanführers und für den Rat der Ältesten bestimmt.«
»Die Geister sind rachsüchtig«, erwiderte Garnday. »Aber sie sind auch gerecht. Wenn du die Verbannung und den Verlust deines eigentlichen Platzes bei deinem Volk auf dich nimmst, werden sie zufrieden sein.«
Djanay war still, doch Garnday bemerkte seine Nervosität an der Art, wie er auf und ab schritt und nervös an seinem Daumennagel knabberte. Er wirkte niedergeschlagen, als er sich ihr zuwandte. »Ich habe also keine andere Wahl?« Sie schüttelte den Kopf.
Er ließ die Schultern hängen. »Dann höre ich auf deine Weisheit, Mutter.«
Er neigte den Kopf, und sie war versucht, eine Hand auszustrecken und die wilden schwarzen Locken zu berühren, doch wusste sie, dass er zu alt für die Zärtlichkeit einer Mutter war und nur ihre Weisheit und Kraft brauchte, um diese furchtbare Zeit zu überstehen. Wenigstens hatte sie ihn vor dem rachsüchtigen Malangi und dieser Hexe, die dessen Mutter war, in Sicherheit gebracht. Sobald er den Clan verlassen hätte, wäre er keine Bedrohung mehr.
Zehnmal fuhr die Sonnengöttin über den Himmel, bis sie endlich ihr Ziel erreicht hatten. Majestätisch erhob sich der uralte Berg Uluru aus den Wäldern ringsum, die Rundungen, Schrunden und eingekerbten Flanken warfen in der untergehenden Sonne tiefe Schatten. Die steilen roten Abhänge und die Pracht dieses heiligsten aller Orte verströmten eine Aura der Macht. Ehrfürchtig sah der Clan zu, wie die versinkende Sonne das Ockergelb in Gold- und Orangetöne tauchte, dann in immer dunkleres Rot, das am Ende in Schwarz überging. Sie waren in ihre spirituelle Heimat zurückgekehrt, nun mussten sie den Wächtern von Uluru, dem Volk der Anangu, ihren Respekt erweisen.
Es war das wichtigste corroboree des Jahres; jeder Mann, jede Frau und jedes Kind, das zu der langen Reise fähig war, nahm daran teil. Die Feuer brannten, sobald die Sonne verschwunden war, und viele verschiedene Dialekte und Sprachen vermischten sich mit dem Rauch in der Luft. Es herrschte allgemeine Aufregung. Vergangene Streitigkeiten und Feindseligkeiten waren vergessen, als sie sich auf die Zeremonien vorbereiteten.
Die Kunwinjku errichteten ihr Lager und begannen, Speerspitzen und Steinwerkzeuge gegen Bumerangs, Schwirrhölzer, zeremonielle Masken und Kopfschmuck einzutauschen. Als es dunkel wurde, bemalten sich die Ältesten und die initiierten Jungen mit Ocker und Lehm und setzten die speziellen Masken und den Kopfschmuck auf; sie waren bereit für das erste Ritual, das am Fuße des Uluru abgehalten wurde. Dann ertönte von fern das vibrierende Brummen von mindestens zwölf Schwirrhölzern. Diese flachen, stark verzierten Hölzer wurden an einem Strang aus fein geflochtenem Haar durch die Luft gewirbelt. Der Klang ebbte ab und schwoll an wie ein starker Wind, um im nächsten Augenblick zu einem Stöhnen wie von sich entfernenden Geistern abzuflauen.
Garnday sah, wie Djanay mit langen Schritten fortging. Sie war stolz darauf, dass er ihre Weisheit angenommen hatte und sich allmählich auf seine Ehe vorbereitete. Sie drehte sich wieder zur Feuerstelle und warf einen kurzen Blick zur alten Frau hinüber. Die Tage nach Djuwes Tod hatten ihr zugesetzt. Bedingt durch die Verletzung an ihrer Hüfte, war sie auf dem Weg durch die Wüste immer weiter zurückgeblieben.
Sie sahen sich unverwandt an und Garnday las die Angst in den Augen der Alten. Sie hatte dafür Verständnis. Malangis Mutter wusste, dass die Geister sie zu sich riefen und dass ihre endgültige Strafe kurz bevorstand. Dennoch kniff sie ihre betagten Lippen mit grimmiger Entschlossenheit zusammen; sie wusste, dass sie Garnday in der Hand hatte, und war noch nicht bereit, auf diese Überlegenheit zu verzichten.
Das corroboree dauerte fünfzehn Fahrten des Sonnenwagens über den Himmel. Die uralten Riten wurden mit vielen Gesängen und Tänzen ausgeführt, Bündnisse wurden geschlossen, zukünftige Ehen vereinbart, und es wurde festlich gespeist. Die Geschichtenerzähler wussten mit ihren unterschiedlichen Auslegungen der Traumzeit ihr Publikum zu fesseln, Künstler hielten das Ereignis sorgfältig auf den geweihten Wänden des Uluru fest.
Die Hochzeit von Djanay und Aladjingu, eine Verbindung zweier mächtiger Stämme, sollte am letzten Abend um Mitternacht stattfinden. Aladjingus Volk lagerte in angemessenem Abstand zu Djanays Stamm. Kurz vor Sonnenuntergang wurde ein riesiges Feuer angelegt. Die leise pulsierenden Schwirrhölzer stimmten ihren verlockenden Ruf an.
Kurz vor Mitternacht verkündeten die Onkel den Versammelten mit einem Gesang, dass eine Hochzeitszeremonie stattfinden solle. Im vorderen Teil der Prozession trugen die Mitglieder beider Stämme jeweils einen brennenden Stock und bewegten sich in Form einer Speerspitze aufeinander zu. Als sie zusammentrafen, verbanden sich die brennenden Stöcke, so dass die Flammen hoch in die klare, stille Luft schossen.
Djanays Nerven waren zum Zerreißen gespannt, als er mit Aladjingu auf ihre Onkel zuging. Malangi stand etwas abseits mit grimmiger Miene unter dem Weiß aus Lehm und Asche, dem Zeichen der Trauer. Ein Wort aus seinem Mund brächte die Zeremonie zu einem schrecklichen Ende. Djanay wagte nicht, ihn anzusehen.
»Kinder«, rief der älteste Onkel. »Das Feuer ist ein Symbol für den Ernst des mardayin. Keiner von euch beiden darf dieses Privileg, Mann und Frau, Vater und Mutter zu werden, missbrauchen oder auf die leichte Schulter nehmen. Es ist der Wille des Großen Geistes, dass ihr das Band der Ehe respektiert. So wie das vernichtende Feuer wird das Gesetz eurer Vorväter alle zerstören, die den Bund der Ehe entehren.«
Djanay zitterte, als sich ein einstimmiger Ruf erhob und Hunderte von Speeren gegen Schilde schlugen. Die brennenden Stöcke wurden in die Flammen geworfen, und alle tanzten und sangen. Die Eide, die er heute Abend abgelegt hatte, waren eine schreckliche Mahnung daran, wie knapp er dem Zorn der uralten Geister entgangen war. Er schaute auf Aladjingu; die mächtigen Worte ihres Ehegelübdes klangen ihm noch in den Ohren.
Das Mädchen schenkte ihm einen scheuen Blick und nahm seine Hand. »Mein Mann«, murmelte es. »Gemeinsam werden wir auf den Nordwind zugehen, und eines Tages wirst du mein Volk weise führen, denn ich habe das Flüstern der Urahnen vernommen.«
Djanay erkannte, dass er jetzt mit einer Frau gesegnet war, die die gleiche uralte Weisheit besaß wie seine Mutter. »Meine Frau«, erwiderte er, »gemeinsam werden wir stark sein.«
Das große Stammestreffen war vorüber. Die Kunwinjku machten sich auf die lange Wanderung nach Norden, doch schon bald wurde deutlich, dass die alte Frau nicht mehr mithalten konnte. Der Clan verlangsamte sein Tempo, um ihr Gelegenheit zu geben aufzuholen, und legte nachsichtig einen Ruhetag an einem Wasserloch ein, damit sie neue Kräfte sammeln konnte. Kurz darauf jedoch wurde einstimmig festgestellt, dass sie eine Behinderung darstellte, denn sie stützte sich so schwer auf ihren Mann, dass sie nur noch schleichend vorankamen.
Am vierten Tag, als man bereits plante, sie zurückzulassen, trat Garnday an die Seite ihres Mannes. »Ich will dir helfen«, erklärte sie ruhig, während sie das Gewicht der alten Frau auf ihren Arm verlagerte.
Als die Dämmerung hereinbrach, merkten sie, dass sie hinter dem Clan zurückgeblieben waren und kaum Hoffnung bestand, ihn bei dieser Geschwindigkeit einzuholen. Mit einem traurigem Seufzer half der Mann Garnday, seine sterbende Frau unter einen Baum auf den Boden zu betten. »Es ist die letzte Nacht«, sagte er traurig. Garnday nahm eines der kleinen, mit Wasser gefüllten Emu-Eier an sich. Dieses letzte Opfer bot sie der Älteren dar, wie es Brauch war. »Wir müssen jetzt aufbrechen«, sagte sie leise. »Ich bringe dir einen Abschiedsgruß, Kabbarli.«
Die alte Frau akzeptierte die respektvolle Anrede »Großmutter« und nahm das Opfer entgegen, doch ihre Augen waren bereits vom Tod überschattet.
Ihr Mann berührte die betagte Stirn. Tränen rollten über sein runzliges Gesicht, als er sich von der Frau verabschiedete, die er vor über dreißig Jahren geheiratet hatte. Dann wandte er sich ab und ging rasch den anderen nach, ohne sich noch einmal umzudrehen.
Garnday stützte sich auf ihren Grabstock und dachte an die Zeit, die sie gemeinsam verbracht hatten. Dann schritt sie entschlossen aus, um den jetzt ihr zustehenden Platz als älteste Frau einzunehmen.
Djanay und Aladjingu ließen sich im Nordosten nieder. Dort gab es Gras im Überfluss, das Wild anlockte; Bäume spendeten Schutz vor der Hitze. Im glitzernden Meer konnte man Fische fangen und aus den Tiefen Austern ernten. Es war ein gutes Land für die Jagd. Die Familie wuchs und Djanay wurde klar, dass er eine zweite Chance bekommen hatte.
Die Kraft und Weisheit, die er durch die Erfahrungen in seiner Jugend erworben hatte, machten ihn zu einem beliebten Ältesten. Als die Zeit für ihn gekommen war, die Ngadyandyi anzuführen, zeigte sich, dass er einer der weisesten Männer war. In den Jahrhunderten nach seinem Tod lebte seine Legende in den Höhlenmalereien weiter, die in einem Gebiet verborgen lagen, das man später Cooktown nennen würde.
Als die große Dürre wieder einsetzte, war Garnday fast vierzig, doch sprachen in ihren Träumen die Geister zu ihr; so führte sie ihren dezimierten Stamm auf einer großen Wanderung nach Süden in üppige Jagdgründe, an fischreiche Flüsse und an die tosenden Gestade von Kamay und Warang; dort lebten sie auf die spirituell strenge, aber einfache Art, die sich seit der Traumzeit nicht verändert hatte.
Als die Welt jedoch nach neuen Ländern und Reichtümern gierte, stand das Wesen ihrer uralten Lebensform kurz vor der Vernichtung. Kamay, das in aller Welt als Botany Bay bekannt werden sollte, würde schon bald das Herz der Invasion durch den weißen Mann sein.
ERSTER TEIL
Der unbekannte Süden
EINS
Cornwall, 1768
Jonathan Cadwallader, Earl von Kernoe, unterdrückte ein Gähnen und versuchte, nicht nervös zu zappeln. Das Mittagessen war längst beendet, und Onkel Josiah schien entschlossen, den ganzen Nachmittag zu reden. Draußen aber schien die Sonne und Susan, nach deren Gesellschaft er sich verzweifelt sehnte, würde auf ihn warten.
»Sitz still, Jonathan!«, ermahnte ihn Lady Cadwallader, ungehalten mit der Zunge schnalzend.
»Lass doch den Jungen, Clarissa!«, polterte Josiah Wimbourne. »Siebzehn ist ein unruhiges Alter, und ich vermute, er will hinaus ins Freie und nicht einem alten Fossil wie mir zuhören, das andauernd darüber schwafelt, welchen Vorteil Großbritannien daraus zieht, dass es den Siebenjährigen Krieg gewonnen hat.«
»Mit siebzehn, lieber Bruder, ist man alt genug, sich auf seine guten Manieren zu besinnen«, entgegnete sie. Dabei klappte sie ihren Spitzenfächer auf, als wolle sie ihr Missfallen unterstreichen. »Wenn sein Vater noch lebte, wäre er höchst unzufrieden. Jonathan scheint bei dir in London nichts gelernt zu haben.«
Jonathan begegnete dem Blick seines Onkels und schmunzelte. Sie wussten beide, dass es nicht stimmte, doch um seine Mutter bei Laune zu halten, bat Jonathan seinen Onkel, sich weiterhin auszulassen. »Worin liegen denn nun die Vorteile, Onkel?«, fragte er und erfasste mit einem Blick die wie immer nachlässige Kleidung des älteren Mannes.
Josiah zwinkerte mit den Augen, kratzte sich am Kopf und verschob dabei die schmuddelige Perücke, bis sie schräg über einem Ohr saß. Er legte keinen Wert auf seine äußere Erscheinung. Er war rau, aber herzlich, nahm kein Blatt vor den Mund und konnte dumme Menschen nicht ertragen. Auch mit fast vierundvierzig Jahren war er ein eingefleischter Junggeselle. Dabei mochte er Frauen, wie er seiner entrüsteten Schwester häufig erklärt hatte, er verstand sie nur nicht und zog ihnen die Gesellschaft von Büchern und Gelehrten vor.
»Im Gegensatz zu früheren Kriegen handelte es sich hierbei um einen globalen Konflikt, der nicht nur in Europa, sondern auch in Amerika, Indien und auf den Inseln in der Karibik ausgetragen wurde. Der Sieg Großbritanniens bedeutet, dass sich das strategische Gleichgewicht der Macht sehr zu seinen Gunsten verschoben hat.«
Liebevoll betrachtete Jonathan den altmodischen, abgetragenen Gehrock, der über dem Bauch des Onkels spannte und ihm fast bis an die stämmigen Waden reichte. »Ich weiß, Frankreich hat die meisten seiner Besitzungen in Nordamerika und beträchtliche Gebiete in Indien an Großbritannien verloren, aber was ist mit Spanien?«
»Wir sind mit einer beispiellosen Übermacht auf See als Sieger über unsere alten Feinde hervorgegangen«, polterte Josiah, verschränkte die Hände hinter dem Rücken und streckte den Bauch vor. »Unser Sieg ist so vollkommen, dass wir unsere Aufmerksamkeit darauf richten können, in den Pazifik vorzudringen und Spaniens Ansprüche in Frage zu stellen.« Er wiegte sich in seinen Schnallenschuhen vor und zurück, seine Augen strahlten innere Erregung aus, die Perücke drohte ihm in die Stirn zu rutschen. »Die Verlockungen des Südens sowie die Reichtümer Indiens und der Südsee üben auf Forscher, Freibeuter und alle, die nach Ruhm streben, eine enorme Anziehungskraft aus. Wir leben in aufregenden Zeiten, mein Junge.«
Jonathan war vor kurzem siebzehn geworden, doch er war schon immer unendlich neugierig gewesen auf die Welt, in der er lebte. In diesem Zeitalter des Forschens und Erfindens wurde sie ständig größer. Obwohl Jonathan die vergangenen vier Jahre in den düsteren Hallen einer strengen Schule in London verbracht hatte, war er ein Junge aus Cornwall, und die prägenden Jahre in diesem Landstrich hatten seine Leidenschaft für das Meer entfacht, das Verlangen, an Bord eines großen Segelschiffes zu gehen und zu entdecken, was jenseits des Horizonts lag. Wie er die Freibeuter beneidete! Wenn er sich ihnen doch nur anschließen könnte!
Die Legende von der Terra Australis Incognita und die Gerüchte über einen fast unerforschten südlichen Kontinent mit erstaunlichen Reichtümern hatte seit der Expedition von Marco Polo bei jedem Schuljungen den Hunger nach Abenteuern geweckt. Portugal, die Niederlande, Spanien, Frankreich und England hatten sich auf die Meere begeben, um Macht, Handelsbeziehungen und Reichtum zu erlangen, doch es waren Spanier und Niederländer, die nach und nach die Existenz eines solchen Landes bestätigten. »Den Aussagen aller zufolge, die jene westlichen Küsten angesteuert haben, liegen dort unwirtliche Gebiete«, sagte er.
»Diese Meinung würde die glücklose englische Besatzung der Triall, die im Jahre 1622 am Riff vor den Monte-Bello-Inseln Schiffbruch erlitt, gewiss bestätigen. Dann vergingen sechzig Jahre, bis William Dampier in New Holland an Land ging; er hatte überlebt, um darüber zu schreiben.«
Jonathan lächelte. »Und auch er war nicht gerade beeindruckt. Weshalb also werde ich das Gefühl nicht los, dass es abenteuerlich sein könnte, sich auf die Suche nach diesem mysteriösen New Holland zu begeben?«
Josiah übersah den vorwurfsvollen Blick seiner Schwester und ließ sich Zeit beim Anzünden seiner Tonpfeife. Sein gerötetes Gesicht strahlte interessiert, denn nichts gefiel ihm besser als ein lebhaftes Gespräch mit seinem geliebten Neffen. »Gelehrte und Geographen behaupten, dass New Holland genau auf den Breitengraden liegt, auf denen woanders Gegenden für ihre Fruchtbarkeit und ihren Reichtum an Mineralien berühmt sind. Warum sollte es dort nicht ebenso sein? Die Seeleute haben nur einen sehr kleinen Teil von dem gesehen, was anscheinend ein riesiger Kontinent ist. Woher will man wissen, dass dieser Ausschnitt typisch für alles ist, was dahinter liegt?«
»Die Niederländische Ostindienkompanie war trotz des Ratschlags von Jean Purry nicht daran interessiert, dort eine Kolonie zu errichten«, rief Jonathan ihm ins Gedächtnis.
Josiah nuckelte an seiner Pfeife, bis er eine Menge Qualm erzeugt hatte. Ungerührt ignorierte er den wild wedelnden Fächer seiner Schwester. »Purry war kein Forscher«, polterte er. »Sein Rat war das Ergebnis einer intelligenten Auslegung von Geographie und Klima. Im Übrigen hatte die Ostindienkompanie bereits eine Kolonie in Südafrika, also einen nützlichen Zwischenhalt auf dem Handelsweg nach Batavia.«
Jonathan erhob sich vom Stuhl und zupfte an seiner bestickten Weste. In seiner Phantasie war er bereits auf hoher See. »Ich wünschte, ich hätte die Freiheit, diese südlichen Gewässer zu erforschen.«
»Du hast Pflichten hier«, meldete sich seine Mutter zu Wort. Auf ihrem gepuderten, herrischen Gesicht zeigten sich rote Flecken, die sich keineswegs mit dem kunstvollen Gebrauch von Rouge oder der Hitze des Kaminfeuers erklären ließen. »Dein Titel bringt Verantwortung mit sich, Jonathan, und man kann von mir nicht mehr erwarten, die Last des Anwesens noch länger zu tragen.«
Es war ein vertrautes Argument, das jedoch nicht stichhaltig war, da das Anwesen trefflich von einem fähigen Verwalter und einer ansehnlichen Dienerschar geführt wurde. Außerdem besaß Clarissa Cadwallader trotz ihrer gertenschlanken Gestalt und ihres guten Aussehens einen eisernen Willen, mit dem sie die Zügel ihres Haushalts fest in Händen hielt. »Es wäre doch sicher für mich am besten, wenn ich die Welt außerhalb dieses Anwesens erforschte, Mama?«, fragte er leise und warf einen Blick auf seine Taschenuhr. Susan würde sich fragen, wo er bliebe. »Bildung und Reisen bringen Reife, und beides, da bin ich sicher, wäre mir hier sehr von Nutzen.«
Ihre Patriziernase wurde schmal, und den blassen Augen fehlte jede Wärme, als sie ihn betrachteten. »Deine Zeit in London sollte reichen«, sagte sie schließlich. »Dir scheint allerdings die Reife zu fehlen, die Zwänge zu begreifen, die deine Abstammung mit sich bringt.« Unter Spitzenrüschen hob und senkte sich ihre Brust. »Und wie unangemessen es ist, mit den unteren Klassen zu verkehren.«
Jonathan wurde rot. Seine Liebe zu Susan Penhalligan war ein weiterer Quell des Streits zwischen ihnen, und seine Mutter war offensichtlich nicht zu erweichen. Ihm lag bereits eine scharfe Entgegnung auf der Zunge, als sich sein Onkel einschaltete.
»Liebe Schwester«, dröhnte er. »Du bist zu streng mit dem Jungen. Er ist noch jung und muss sich die Hörner abstoßen. Der Hang zum Küchenpersonal wird bald vergehen.« Er musste den Anflug von Verachtung auf ihrer gepuderten Wange bemerkt haben, denn er fuhr hastig fort: »Jedenfalls wird es dem Anwesen nicht schaden, wenn man dem Jungen erlaubt, eine Zeitlang abzutauchen.«
Augenblicklich war Jonathans Interesse geweckt. Er hatte längst den Verdacht, dass dieser flüchtige Besuch einen Zweck hatte, und jetzt wusste er, dass der Alte etwas im Schilde führte.
Clarissa kniff missbilligend die Lippen zusammen. Ihre unter der kunstvollen Perücke streng gezupften Augenbrauen fuhren entsetzt in die Höhe. »Abtauchen? Warum sollte er abtauchen müssen?«
Josiah scharrte mit den Füßen, räusperte sich und riskierte erneut, ihr fest in die Augen zu sehen. »Ich habe einen Vorschlag, meine Liebe«, hob er an. Er warf Jonathan einen Blick zu. »Auch wenn ich nicht gerade die Aufregung und das Abenteuer bieten kann, nach dieser schwer zu fassenden Terra Australis zu suchen, so kann ich doch eine einmalige Gelegenheit in Aussicht stellen.«
Jonathan spannte sich an. Seine Phantasie trug ihn weit hinaus aus diesem stickigen Raum und weg von der Missbilligung seiner Mutter.
»Du sprichst in Rätseln«, sagte diese spitz.
»Als geachteter Astronom und Mitglied der Königlich Geographischen Gesellschaft hat man mich gebeten, an der Expedition nach Tahiti teilzunehmen, um den Durchgang der Venus vor der Sonne zu beobachten. Ich möchte, dass Jonathan mich begleitet.«
Jonathan blieb fast das Herz stehen. Tahiti! Noch dazu die Chance, über die Meere zu segeln, ungehindert von den Einengungen des Lebens hier in England – das wäre die Erfüllung seiner kühnsten Träume. Er betrachtete das Gesicht seiner Mutter und versuchte, sie kraft seines Willens zu ihrem Einverständnis zu zwingen.
»Soll das eine Bildungsreise sein?«
»Auf jeden Fall«, erwiderte Josiah, ihrem Blick ausweichend.
»Wird es gefährlich sein?«