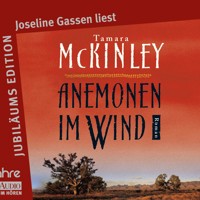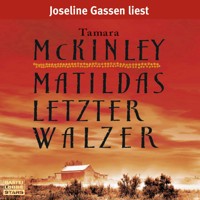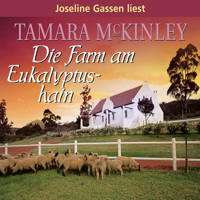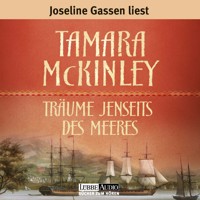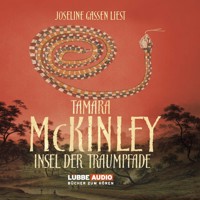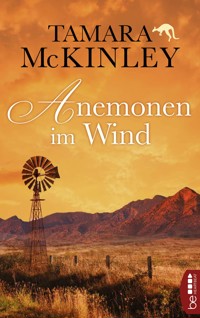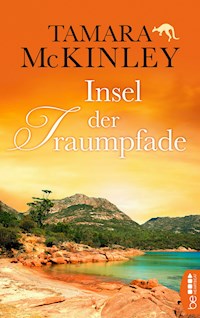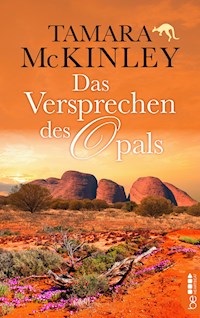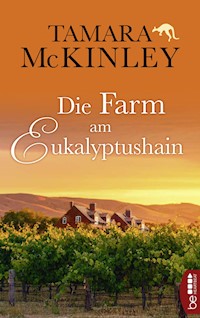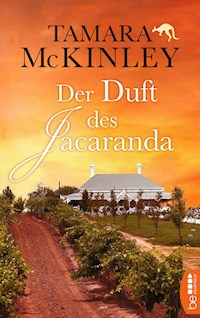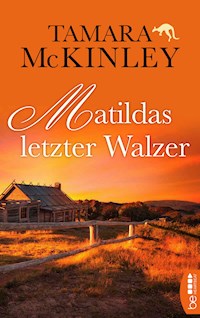7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Liebe und Sehnsucht in Australien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Ein ergreifender Roman über die Macht der Liebe und die Stürme des Herzens.
1947. Olivia Hamilton kehrt von London nach Australien zurück. Zusammen mit ihrem Jugendfreund Giles will sie das Geheimnis ihrer Geburt lüften. Denn seit dem Tod ihrer Mutter Eva weiß die junge Frau, dass sie adoptiert wurde - eine Entdeckung, die sie zutiefst erschüttert. Selbst Giles, der sie innig liebt, findet keinen Zugang mehr zu ihrem Herzen. Auf der Suche nach ihrer Herkunft folgt Olivia Evas Spuren und ist schon bald gefesselt von dem Leben dieser außergewöhnlichen Frau.
Tamara McKinley verzaubert ihre Leserinnen und Leser einmal mehr mit den Düften und Farben des roten Kontinents und schickt sie auf eine abenteuerliche Reise - zum Mittelpunkt des Herzens.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 575
Ähnliche
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
Zitat
PROLOG
EINS
ZWEI
DREI
VIER
FÜNF
SECHS
SIEBEN
ACHT
NEUN
ZEHN
ELF
ZWÖLF
DREIZEHN
VIERZEHN
FÜNFZEHN
SECHZEHN
SIEBZEHN
ACHTZEHN
NEUNZEHN
ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
ZWEIUNDZWANZIG
DREIUNDZWANZIG
VIERUNDZWANZIG
EPILOG
Über die Autorin
Alle Titel der Autorin bei beHEARTBEAT
Hat es Dir gefallen?
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
1947. Olivia Hamilton kehrt von London nach Australien zurück. Zusammen mit ihrem Jugendfreund Giles will sie das Geheimnis ihrer Geburt lüften. Denn seit dem Tod ihrer Mutter Eva weiß die junge Frau, dass sie adoptiert wurde – eine Entdeckung, die sie zutiefst erschüttert. Selbst Giles, der sie innig liebt, findet keinen Zugang mehr zu ihrem Herzen. Auf der Suche nach ihrer Herkunft folgt Olivia Evas Spuren und ist schon bald gefesselt von dem Leben dieser außergewöhnlichen Frau.
TAMARA MCKINLEY
Das Lied des Regenpfeifers
Aus dem australischen Englisch von Rainer Schmidt
Für Daireen Eva Liefchild McKinley und all die Frauen, die anderer Leute Kinder großziehen und lieben, als seien es die eigenen. Sie wissen, was Mutterschaft tatsächlich bedeutet.
Die schlimmsten Lügen werden oft im Stillen verbreitet.
Robert Louis Stevenson 1850–1894
PROLOG
Als die SS Arcadia vor der Westküste Australiens fast ohne Vorwarnung in einen Sturm geriet, schrieb man den 10. März des Jahres 1894. Das Schiff war sechs Wochen zuvor in Liverpool ausgelaufen.
Der Kapitän kämpfte tagelang darum, der titanischen See zu trotzen, aber allmählich befürchtete er, dass die Schlacht verloren war. Er hatte bereits hilflos mit ansehen müssen, wie drei Mann seiner Besatzung über Bord gespült wurden, als sie versuchten, einen Lukendeckel zu reparieren, und nun waren zwei der drei Masten gebrochen, wie Streichhölzer geknickt. Mittlerweile waren die Decks leer gefegt, die Ladung war in alle Winde zerstoben, aber die Schlote hatten standgehalten, und die mächtige Maschine dröhnte noch immer im Rumpf. Er wusste, dass sein Schiff genau wie er selbst schon andere Stürme besiegt hatte, und weigerte sich aufzugeben. In seiner Obhut waren tausendfünfhundert Passagiere und die Crew. Es war seine Pflicht, sie alle wohlbehalten an Land zu bringen.
Er spähte durch das regengepeitschte Fenster in die schwarze Nacht hinaus. Der Sturm hatte sie möglicherweise meilenweit vom Kurs abgebracht, und ohne Mond und Sterne war es unmöglich, ihre Position zu ermitteln. Er wiegte sich mit dem schwankenden, rollenden Deck unter seinen Füßen, umklammerte das große Steuerrad fester und fing an zu beten. Diese Küste war übersät von unsichtbaren Korallenriffen und Felsenklippen. Nicht einmal der stählerne Rumpf der Arcadia würde eine Kollision überstehen.
In einer der Kabinen der ersten Klasse auf dem Oberdeck klammerte Eva Hamilton sich an Frederick. Es war so stockdunkel, dass sie weder sein Gesicht noch das Funkeln ihres neuen Eherings sehen konnte. Trotz ihrer Angst verspürte sie eine Erregung, einen kribbelnden Schauder bei dem Gedanken, dass sie sich auf dem Höhepunkt eines großen Abenteuers befanden, das alle Erwartungen übertraf.
Das riesige Schiff stampfte, dass es Eva den Magen umdrehte; der Bug hob sich, und sie rollten aus dem Bett auf den Boden. »So kann es nicht weitergehen«, schrie Frederick durch das Heulen des Windes und das Donnern der Wogen. »Seit drei Tagen stecken wir in diesem Sturm. Das übersteht das Schiff nicht.«
»Aber es hat doch bis jetzt gehalten«, rief Eva, als sie einander in der Dunkelheit wieder gefunden hatten. »Wir müssen auf den Kapitän vertrauen.«
Frederick antwortete nicht, sondern nahm sie fest in die Arme.
Eva saß auf dem Boden, das Gesicht an seine Brust gepresst, den Rücken an die harte Eichentäfelung gelehnt. Zunächst hatte sich nur der Himmel im Osten verdunkelt, als das Unwetter aufgezogen war. Der Kapitän hatte die Passagiere beruhigt: Es werde alles gut gehen, dies sei ein typisches Risiko an der Westküste. Aber dann hatte der Wind zugenommen und zu heulen angefangen, und die Wellen türmten sich so hoch auf, dass sie den Horizont verdeckten. Die Passagiere hatten in ihren Kabinen Zuflucht gesucht. Die anfängliche Begeisterung war in Angst umgeschlagen.
Auch in Eva stieg nun erneut eine Woge der Angst auf, und so lenkte sie ihre Gedanken hastig in eine angenehmere Richtung, während sie versuchte, sitzen zu bleiben.
Sie waren unterwegs zu einem anderen Leben in einer neuen Heimat. Frederick würde dort seinen Dienst als Landvermesser Ihrer Majestät antreten, und sie würde sein Heim gestalten und am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, soweit Melbourne eines zu bieten hatte.
Es würde ein elegantes Haus sein, wenn die Möbel erst aus dem Laderaum an ihren Bestimmungsort gekommen wären. Während der langen Verlobungszeit hatte sie immer wieder davon geträumt, wie sie für die Damen der Gegend Soireen und Teepartys veranstalten würde. Ihre Aussteuer war sorgfältig in Truhen verpackt, die Abendroben und Teekleider in Leintücher gefaltet, um sie vor der Seeluft zu schützen. Welch ein Aufsehen sie und ihr gut aussehender Ehemann unter den Kolonisten erregen würden, die ohne Zweifel hoffnungslos hinter der Londoner Mode hinterherhinkten!
Ein wütendes Krachen riss Eva aus dieser erfreulichen Vorstellung. Das ganze Schiff bebte. Die Arcadia stürzte in ein Wellental hinab, und dann hob sich der Bug, höher und immer höher, bis es schien, als hänge das Schiff vom Himmel herab.
Eva schrie, als sie an der Kabinenwand entlangrutschten und gegen eine andere Wand prallten. Ringsum in der Dunkelheit klirrte Geschirr. Möbel krachten und splitterten, und der Lüster schlug gegen etwas Hartes und zerbarst in tausend Stücke. Nacktes Entsetzen fegte jeden Rest von Abenteuerlust davon.
»Freddy«, schrie sie und klammerte sich an seine Jackenaufschläge. »Wir gehen unter!«
»Halt dich an mir fest!«, rief er ihr ins Ohr. »Was immer passiert, lass nicht los!«
Er musste es kein zweites Mal sagen. Frederick war warm und stark – ihr Rettungsanker. Sie würde ihn nicht loslassen.
Der Bug krachte zurück in die tosende See und zitterte. Tausend Tonnen Wasser türmten sich vor der Arcadia auf, die jetzt hilflos in den Klauen des Riffs gefangen war.
Der Kapitän schaute hoch und wusste, dass das Ende gekommen war. Sein letzter Gedanke galt den armen Seelen im Zwischendeck und den Männern im Maschinenraum. Dann erreichte die Welle ihren Höhepunkt, sie fiel wie ein Riesenhammer auf das hilflose Schiff und brach ihm das Rückgrat.
Eva schrie erneut. Wasser strömte herein. Der Sturm zerrte an ihr mit eisigen Fingern, um sie von Frederick weg und in die heulende Finsternis zu reißen.
»Wir müssen hinaus!« Frederick zog sie auf die Beine. »Wir müssen zusammenbleiben!«, brüllte er durch das Sturmgeheul. »Halt dich fest, und lass nicht los!«
Sie umklammerte seine Hand. Eva war völlig durchnässt und fror bis ins Mark, denn sie trug noch immer ihr Dinnerkleid. Sie sah nichts und wusste nicht, in welche Richtung sie gingen. Sie musste auf Fredericks Orientierung vertrauen.
Das Schiff rollte und wand sich und grub sich immer tiefer in das Riff. Durch kniehohes Wasser stolperten sie in den Korridor hinaus. Schrecken erfüllte die wilde Nacht. Passagiere kämpften sich voran, stießen und trampelten einander in der Dunkelheit nieder, um zu den Rettungsbooten zu gelangen. Ihre Schreie mischten sich in das Heulen des Windes, es wirkte wie eine Vision der Hölle.
Eva packte Fredericks Gürtel, und er schob und drängte sich mit ihr durch das Chaos. Ihr langer Rock behinderte sie, doch jetzt ging es nur noch ums Überleben. Der instinktive Drang, die Rettungsboote zu erreichen und fortzukommen, bevor die See das Schiff verschlang und sie in die Tiefe riss, verlieh Eva Kraft.
Sie hörte Kinder, die nach ihren Müttern schrien. Spürte den panischen Griff eines Passagiers, der von einer ungeheuren Welle von Deck geschleudert wurde. In blinder Angst krallte sie sich an Frederick, ohne dass es sie noch kümmerte, über wen oder was sie hinwegtrampelte.
Dann waren sie bei den Rettungsbooten. Frederick packte Eva und presste sie gerade noch rechtzeitig an eine Eisenstrebe, als der nächste Brecher über das Deck krachte. Eva schnappte nach Luft, so gewaltig war die Wucht des Wassers. Hart hatte die Welle zugeschlagen. Brodelnder Gischt flutete über die ganze Länge des Schiffes und hatte alle mitgerissen, die vor ihnen da gewesen waren.
»Komm schon! Lauf!« Frederick versuchte, Eva von der Eisenstrebe zu lösen.
Überall war Dunkelheit, überall Chaos. Eva war betäubt von der Kälte, vom Heulen des Windes und vom Tosen des Meeres. Zudem geblendet vom beißenden Salzwasser, war sie bewegungslos erstarrt. Sie wusste nur, dass sie sich an etwas Festes klammerte – etwas, das sie vor der schrecklichen Welle und der alles verzehrenden Schwärze gerettet hatte.
Frederick schützte sie mit seinem Körper, als die nächste Woge über das sterbende Schiff hereinbrach. Sie tobte über alles hinweg, drohte Eva von der Strebe loszureißen und nahm ihr die Luft und jeglichen Mut, den sie vielleicht noch hatte.
»Jetzt, Eva!«, schrie Frederick. »Komm.« Er löste ihre Finger von der Eisenstrebe und zog sie in seine Arme, als wieder eine Welle über den Bug donnerte und eine Luke zerschmetterte. Wasser strömte in den vorderen Laderaum und brachte dadurch den Bug für einen Augenblick wieder in die richtige Lage.
Eva hörte das leise Knarren einer Winde. Frederick stolperte mit ihr über das Deck, vorbei an dem zertrümmerten Schlot. Ein Boot wurde über die Reling geschwenkt. »Sie lassen uns zurück!«, rief Eva. »Du musst sie aufhalten!«
Die Davits schwenkten nach außen. Das Boot entfernte sich vom schräg geneigten Deck. Wenn sie nichts unternähmen, bevor der nächste Brecher das Schiff überspülte, wären sie verloren.
Frederick machte einen Satz, als die Arcadia in einem machtvollen Todesschauer erbebte und das Rettungsboot nach außen schwang.
Eva wurde aus seinen Armen gerissen und in den Mahlstrom geschleudert. Sie wollte schreien, aber dann prallte sie auf dem Boden des Rettungsbootes auf, und die harte Landung verschlug ihr den Atem. Hände griffen nach ihr, zogen sie hoch, schoben sie zwischen die anderen, die es noch rechtzeitig geschafft hatten.
Sie schaute in die Höhe. Das Boot hing außerhalb der Reling über dem Wasser. Frederick war noch an Deck. Sie sah seine Umrisse, als er sich über die Reling beugte. »Freddy!«, kreischte sie. »Spring doch, spring!«
Er konnte sie nicht hören. Der Wind fegte ihre Worte davon, die im wütenden Meer ertranken.
Sie schüttelte die Hände ab, die sie zurückhalten wollten, und packte den nächsten Matrosen. »Sie müssen zurück«, schrie sie. »Mein Mann ist noch da oben!«
Er stieß sie von sich. Das kleine Boot schaukelte gefährlich an den Davits. »Wenn ich dieses Tau nicht loskriege, werden wir alle sterben!«, brüllte er. »Setzen Sie sich hin!«
Sie hatte keine Gelegenheit, ihn zu beschimpfen, denn das Boot prallte gegen die Schiffswand, und sie wurde erneut zu Boden geschleudert. Diesmal fand sie keine helfende Hand; die anderen Überlebenden klammerten sich fest an den Bootsrand. Verzweifelt starrte Eva zur Arcadia hinüber. Das Schiff zerbarst schnell. Felsen und Korallenriffe schlugen große Lecks unter der Wasserlinie, und die See brandete über die schräg liegenden Decks.
»Freddy«, wimmerte Eva. »O mein Gott, Freddy!« Ihre Tränen mischten sich mit dem Regen, und ein tiefes Schluchzen schüttelte sie, als sie sah, wie eine Wand aus Wasser vom Bug zum Heck flutete und alle Passagiere, die noch an Deck waren, mit sich fortriss in die Nacht. Aber auch das Rettungsboot war in höchster Not. Mit zunehmender Wucht wurde es immer wieder gegen die Arcadia geschleudert. Bald würde der Bug brechen. Es kam jetzt darauf an, die Nabelschnur zum Mutterschiff schleunigst zu durchtrennen.
Während die Seeleute mit den Trümmern kämpften, die sich in den Davits verheddert hatten, hielt Eva verzweifelt Ausschau nach Frederick. Aber es war zu dunkel. Sie konnte nichts sehen. Sie hörte die Schreie der Menschen im brodelnden Wasser, und mit einem Übelkeit erregenden Ruck knallte das Rettungsboot erneut gegen die Arcadia.
Jählings schoss das Heck des Bootes senkrecht auf das Wasser zu. Eva schrie wie alle anderen, aber sie verstummten wieder, als der Bug gleichzog. Wie die anderen Überlebenden klammerte sie sich an den Bootsrand und presste die Augen zu, und ihr Atem ging in flachen Stößen, als das Boot sich gerade richtete.
Es schwebte einen Augenblick lang in der Luft, stürzte mit atemberaubender Geschwindigkeit hinab und schlug mit einem Krachen, das durch Mark und Bein ging, auf dem Wasser auf. Sofort wurde es von einer gigantischen Woge von dem sterbenden Schiff weggerissen. Aber das kleine Boot hielt stand, und die überlebenden Männer ruderten mit aller Kraft, um möglichst viel Abstand zwischen sich und die unglückliche Arcadia zu bringen.
Eva stöhnte vor Angst und Schmerz. Da draußen, in schwärzester Nacht, auf dem weiten, wütenden Wasser eines fremden Ozeans, war ein Schiff gestorben, und mit ihm ihr Ehemann und alle Träume, die sie beide gehabt hatten.
EINS
Australien 1947
Zu Hause. Ein bewegendes Wort, das Wärme, Liebe und Geborgenheit heraufbeschwor. Nun, mit zweiunddreißig Jahren, war sie wieder hier, an einem Ort, der nur eine gefühlsgeladene Erinnerung gewesen war. Die Erinnerung an ewigen Sonnenschein und kindliche Vergnügungen – und an etwas Dunkles hinter der hellen Sonne, etwas, das sie erst jetzt, nach zweiundzwanzig Jahren, allmählich zu verstehen begann.
Olivia fröstelte, angerührt von einem Hauch, der kälter war als die leichte Brise, die vom Meer hereinwehte. Die längst vergangenen Tage der Kindheit kehrten plötzlich mit aller Macht zurück. Sie schaute den Kindern zu, die am Strand spielten, und eines davon erregte ihre besondere Aufmerksamkeit.
Das kleine Mädchen war darin vertieft, eine Sandburg zu bauen. Seine blonden Locken leuchteten in der Sonne, und sein Mund war konzentriert gespitzt. Es war, als habe die Zeit seit damals stillgestanden und als werfe Olivia nun einen Blick auf die, die sie einmal gewesen war. Als sei sie ein unschuldiges Kind, das nichts ahnte von dem Geflecht aus Geheimnissen und Lügen, das sie mit den Menschen ihres Vertrauens verband. Olivia wusste, dass solche Unschuld unbezahlbar war, denn die Wahrheit, sollte sie schließlich ans Licht kommen, konnte alles zerstören, woran sie geglaubt hatte.
Was für eine Zukunft mag diese Kleine haben, dachte sie, als das Kind seinen kleinen Blecheimer leerte und weiter grub. Welche Geheimnisse werden ihr Leben überschatten? Hoffentlich gar keine. Hoffentlich wird sie geliebt.
Olivia kämpfte die aufsteigenden Tränen nieder und zwang sich, ruhig zu bleiben. Die Jahre des Krieges hatten sie gelehrt, dass Selbstmitleid sinnlos war. Dass es Energieverschwendung war, der Wut freien Lauf zu lassen. Sie hatte gelernt, dass es wenig nutzte, durch die Angst vor dem Unbekannten in der eigenen Entschlossenheit zu wanken. Besser war es, diese stillen Augenblicke zu nutzen, um Kraft und Mut für das zu sammeln, was vor ihr lag. Denn die Wahrheit war hier in Trinity, und sie war entschlossen, sie zu finden.
Sie stopfte das Taschentuch in den Gürtel und klopfte ein wenig Sand von dem schmal geschnittenen Kostüm aus Shantungseide. Im Nachkriegslondon war es der letzte Schrei gewesen, aber hier am Strand, inmitten von Baumwollkleidern und Badeanzügen, kam sie sich ein wenig overdressed vor. Auch die weißen Handschuhe, die Handtasche und die spitzen, hochhackigen Pumps passten nicht in diese Umgebung. Mit einem leisen Lächeln beobachtete sie das Kind beim Spielen. Sie hatte sich nicht die Zeit genommen, erst im Hotel einzuchecken. Sie war zu ungeduldig gewesen, um sich vorher umzuziehen. Denn dieser Strand, diese winzige Ecke von Northern Queensland, barg all ihre Erinnerungen.
Auch wenn der Anlass für diese Reise verwirrend und schmerzhaft gewesen war, hatte es ihr Spaß gemacht, sich neu einzukleiden. Es war fast eine Erleichterung gewesen, die Schwesterntracht vorläufig an den Nagel zu hängen, das Grauen, das sie gesehen hatte, und die Verantwortung, die sie als Krankenschwester getragen hatte, zu vergessen und wieder zur Frau zu werden – auch wenn sie dabei alle lange gehorteten Bekleidungsmarken aufgebraucht hatte.
Mit einem tiefen Seufzer lehnte sie sich auf der Holzbank zurück und ließ den Blick über die Umgebung wandern. Sie hatte ganz vergessen, wie viel Platz es hier gab. Hatte vergessen, wie außergewöhnlich das Licht war – nach all der Dunkelheit und dem Kriegschaos in London. Die Zeit war auf einmal ohne Bedeutung; ein Tag folgte dem anderen in gemächlichem Tempo, ganz ohne das geschäftige Treiben, an das sie sich in England so sehr gewöhnt hatte. Es war, als hätte es den Krieg nie gegeben. Als sei dieses Fleckchen Erde einfach aus einem langen Schlaf erwacht und als seien die Albträume vergessen in der heilsamen Wärme der Sonne, die für die Australier beinahe selbstverständlich war.
Diese Wärme spiegelte sich in der Gelassenheit der Menschen, in ihrer heiteren Einstellung zum Leben und in ihrem gastfreundlichen Lächeln. Olivia schloss die Augen und gab sich dem Duft von Meersalz, von Kiefern und Eukalyptus hin. Der Zauber dieses speziellen Ortes tat allmählich seine Wirkung. Sie hatte vergessen, wie stark er war.
Alles um sie herum war ihr vertraut, denn ihre Träume wohnten hier. Es war ihr vertraut, weil die Erinnerung daran in ihr lebendig geblieben war, tief in einem sehnsuchtsvollen Winkel ihres Wesens, seit sie von hier hatte fortgehen müssen. Kein Wunder, dass die Heimkehr so aufwühlend war, dass es ihr den Atem verschlug. Nichts hatte sich verändert, erkannte sie. Es war, als habe diese Ecke der Welt nur auf diesen Augenblick gewartet; alles wirkte wie ein kostbares Geschenk, eben ausgepackt und funkelnd, und Olivia sog Bilder, Laute und Düfte in sich ein, die sie für immer verloren geglaubt hatte.
Der Strand war ein geschwungener Halbmond aus blassgelbem Sand, gesäumt vom milchweißen Gischt des warmen Pazifiks. An den äußersten Enden dieses Bogens lagen die schützenden Klippen aus schwarzem Fels, die im türkisblauen Meer versanken. Die Klippen waren rot gestreift. Rostrot – die Farbe des endlosen Outback, das nur wenige hundert Meilen westlich dieser friedlichen Bucht begann. Kiefern und leuchtend gelbe Akazien drängten sich oben auf diesen Klippen, und ihre Wurzeln gruben sich in einen dicken Teppich aus Kiefernnadeln, Zapfen und fetter schwarzer Erde.
Olivia atmete den Duft, der ein Teil ihrer Kindheit gewesen war. Elegant glitten die Pelikane über dem Wasser dahin, und sie hörte die Rufe der Brachvögel und Regenpfeifer. Zu Hause. Hier war sie zu Hause, ungeachtet der schmerzhaften Erinnerungen, ungeachtet der Geheimnisse, die sie noch aufzudecken hatte. Im großen Plan der Dinge war die Zeit ihrer Abwesenheit kurz und ihr Herz in Wahrheit nie fort gewesen. Denn wie die Bäume war auch sie in dieser schwarzen Erde verwurzelt. Sie betete nur, dass die Wurzeln tief genug reichten, um dem aufziehenden Sturm standzuhalten.
Giles fuhr sich mit dem Finger unter dem Kragen entlang und bereute, dass er nicht etwas Passenderes angezogen hatte. Sein Tropenanzug war von der Reise zerknautscht und schmutzig, der Hemdkragen zu eng, und die Krawatte würgte ihn. Er schob den Panamahut nach hinten und wischte sich mit dem Taschentuch über die Stirn. Die Hitze erinnerte ihn an Italien und an die endlosen Wochen im Kriegsgefangenenlager, nachdem er abgeschossen worden war. Die Flucht hatte einen hohen Preis gefordert, und selbst in dieser friedlichen Umgebung war ihm, als höre er Gewehrfeuer zwischen den Schreien der Seevögel.
Er zog den Hut wieder in die Stirn und strich sich den Schnurrbart glatt. Ich tue es für Olivia, ermahnte er sich. Was bedeuten da schon ein paar kleine Strapazen? Sie ist es wert.
Er betrachtete die junge Frau auf der Bank am Strand. Nicht nur ihre Kleidung, sondern auch ihre Haltung hob sie von den anderen ab. Er spürte, dass sie gern allein dort saß. Sie war sicher völlig durcheinander, und er glaubte zu verstehen, was ihr die Heimkehr bedeuten musste. Er hatte ähnliche Erfahrungen gemacht, als er schließlich aus dem Lazarett nach Wimbledon zurückgekehrt war, aber wenn man ihn gebeten hätte, die überwältigenden Empfindungen dieses Tages zu beschreiben, wäre er in arge Bedrängnis geraten. Sie waren zu vielfältig.
Er lockerte die Krawatte, knöpfte den Kragen auf, und nach kurzem Zögern streifte er die Jacke ab. Der leere Hemdärmel würde ihn für alle Zeit an den Krieg erinnern, aber damit würde er zurechtkommen müssen. Zumindest lebte er noch. Er legte die Jacke unter einer Kiefer auf den Boden, setzte sich hin und lehnte sich an die raue Rinde. Er zündete sich einen Zigarillo an und beobachtete Olivia durch den wehenden Rauch.
Zweiundzwanzig Jahre lang war sie nun schon ein Teil seines Lebens, und er erinnerte sich noch deutlich an den Tag, als sie und ihre Mutter in der stillen Straße in Wimbledon eingetroffen waren. Er schloss die Augen und sah wieder vor sich, wie die Kisten und Kästen aus dem Umzugswagen ins Haus geschleppt wurden. In einer Woche würde er elf Jahre alt werden, und er hatte gehofft, dass die neuen Nachbarn wenigstens einen Sohn hätten, mit dem er spielen könnte. Als Einzelkind war man einsam.
Er lächelte bei dem Gedanken an seine schmerzliche Enttäuschung, als das kleine Mädchen aus dem Taxi gestiegen war. Wie sehr er sich geirrt hatte, als er dachte, mit ihr könne er sich nicht anfreunden.
Olivia hatte ihn von Anfang an fasziniert, denn sie war anders als alle Mädchen, die er bisher kennen gelernt hatte. Obwohl sie ein Jahr jünger war, hatten seine raubeinigen Jungenspiele ihr Spaß gemacht, und wenn sie auf Bäume geklettert oder mit ihren Ponys im vollen Galopp durch den Park geritten waren, hatte sie ihm nicht selten gezeigt, was eine Harke war. Tapfer und tatkräftig war sie gewesen. Sie war nie in Tränen ausgebrochen, hatte nie gepetzt, und die Schrammen und Beulen ihrer Abenteuer hatte sie mit einer stolzen Verwegenheit getragen, die er bewundert hatte.
Giles musste lachen, als er die Erinnerungen Revue passieren ließ. Einmal hatte er sich über ihren Akzent lustig gemacht. Er hatte es nie wieder getan, denn er musste sogleich herausfinden, dass sie genauso schmerzhaft boxen konnte wie ein Junge.
Er schaute über den weiten Sand hinweg zu der jungen Frau am Strand hinüber, und die altvertraute Liebe durchströmte ihn. Die Jahre im Mädchenpensionat hatten Olivias raue Kanten geglättet, und der Akzent war verschwunden, aber noch immer blitzte manchmal ihr berühmtes Temperament auf, und sie war wieder der kleine Wildfang, der in einem ruhigen Augenblick einmal gestanden hatte, dass er sich in dem, was die Engländer »Society« nannten, nicht wohl fühlte.
In den Kriegsjahren war Olivia erwachsen geworden, wenn man glauben konnte, was im Lazarett erzählt wurde. Niemand saß so furchtlos am Steuer eines Krankenwagens, und niemand hatte widerspenstige Luftschutzwarte und Chirurgen so gut im Griff wie sie. Ihre Energie und ihre zupackende Vernunft hatten ihr gute Dienste erwiesen, aber die Versorgung der schreienden Verwundeten, die aus den brennenden Trümmern des East End befreit und ins Krankenhaus gebracht worden waren, hatte ihre sanfte Seite in den Vordergrund treten lassen.
Tief in Gedanken versunken saß sie dort. Klein und schlank sah sie aus, und ihr Gesicht lag im Schatten ihres Strohhutes. Nichts ließ die Leidenschaft ahnen, die in dieser zierlichen Gestalt wohnte, nichts die Ratlosigkeit, von der sie nach den Ereignissen der letzten paar Monate erfüllt sein musste. Ein beiläufiger Beobachter würde nur die Aura der Stille bemerken, die sie umgab, ihre adrette Kleidung und die trügerische Zartheit ihrer Erscheinung. Bei näherer Betrachtung würde er vielleicht noch das tiefe Feuer in ihren dunklen Augen, die trotzige Haltung ihres Kinns bemerken oder gar einen Hauch der Willensstärke hinter dieser elfenhaften Fassade spüren. Und möglicherweise würde ihm ihr glänzendes schwarzes Haar auffallen, das sie sich den Moden und den Befehlen der Pensionatsleiterin zum Trotz nie hatte schneiden lassen und das zu einem säuberlichen Knoten in ihrem Nacken geschlungen war.
Er schnippte die Asche von seinem Zigarillo und seufzte. Wie oft war er versucht gewesen, die Haarnadeln herauszuziehen und diese ebenholzschwarze Pracht durch seine Finger gleiten zu lassen? Wie oft hatte er diese dunklen, geschwungenen Brauen berühren, das Gesicht in beide Hände nehmen und den süßen Mund küssen, die zarte Haut spüren wollen?
Er senkte den Kopf und lächelte. Olivia würde ihn ohrfeigen, wenn er sich solche Freiheiten herausnähme – und das zu Recht. Er hatte ihr ja nie gesagt, was er fühlte, hatte nie gewagt, die tiefe Freundschaft aufs Spiel zu setzen, die sie über all die Jahre hinweg verband. Und jetzt war es zu spät. Welche Frau – besonders, wenn sie so schön war wie Olivia – würde ihn jetzt noch wollen?
Giles schob das flüchtig aufkeimende Selbstmitleid beiseite, wenngleich ihm bewusst war, dass der Gedanke nicht der Wahrheit entbehrte. Doch er fühlte auch einen Funken Hoffnung, der sich nicht ersticken ließ. Die Hoffnung, dass Olivia ihn doch noch eines Tages lieben könnte.
Er strich mit den Fingern über seinen leeren Ärmel. Der Geist seines linken Arms war noch da; er schmerzte, juckte, kribbelte, gab Leben vor, das nicht mehr existierte. Vermutlich würde er sich irgendwann an seinen Verlust gewöhnen. In gewisser Weise, dachte er, hat der fehlende Arm große Ähnlichkeit mit meiner Beziehung zu Olivia: Er ist vorhanden, aber nicht in der Form und Solidität, die ich mir wünsche. Ich habe mich mit dem Zweitbesten begnügen müssen, mit der Freundschaft zu ihr, und die Pläne, die ich zu Beginn des Krieges geschmiedet habe – Heirat, Kinder, ein Haus auf dem Land –, muss ich vergessen.
Wahrscheinlich teilt sie meine Leidenschaft nicht, sondern betrachtet mich mit tiefer Zuneigung als den älteren Bruder, den sie nie gehabt hat, als ihren besten Freund und Hüter ihrer Geheimnisse. Von Liebe zu reden würde vermutlich alles zwischen uns verändern; eine Verlegenheit würde aufkommen, die es nie gegeben hat, unsere Vertrautheit würde leiden, und am Ende würde alles zerstört sein, was uns teuer ist. Also würde er schweigen.
Er drückte seinen Zigarillo aus und vergewisserte sich, dass er wirklich nicht mehr glimmte, ehe er aufstand und die Jacke aufhob. Ich bin selbstsüchtig, gestand er sich ein; ich denke nur an mich, während Olivia so offenkundig besorgt ist. Sie hat diese Reise nicht grundlos unternommen, und ganz gegen ihre sonstige Gewohnheit hat sie mir den Grund bis jetzt nicht anvertraut. Es gibt keinen Zweifel daran, dass sie mich schon einweihen wird, wenn sie dazu bereit ist, und dann muss ich alle Gedanken an Liebe beiseite schieben und ihr einen festen Halt bieten. Denn er hatte das unbehagliche Gefühl, dass ein Sturm aufzog.
ZWEI
Kannst du vielleicht ’n Augenblick warten?«, schrie Maggie Finlay und plagte sich mit den Bierkästen durch die schmale Tür in die Bar.
»Hier kann man ja verdursten«, maulte der Schafscherer, der für ein paar Tage in die Stadt gekommen war, um sein sauer verdientes Geld auszugeben, bevor er zur nächsten Schafzuchtfarm weiterzog.
»Du wirst an was viel Scheußlicherem sterben, wenn du nicht mit dem Gewinsel aufhörst«, knurrte Maggie, während sie die Kisten unter dem Tresen stapelte und eine Flasche herausnahm. Dann starrte sie dem Scherer in die Augen. Er war ein zerzaustes Individuum mit lederner Haut und blutunterlaufenen Augen. »Erst das Geld, Freundchen. Du kennst die Regeln.«
Er zog einen Zehn-Shilling-Schein aus der Tasche und klatschte ihn auf die Theke. »Verdammt, Maggie, was ist dir denn heute über die Leber gelaufen?«
Maggie steckte die braunen Haarsträhnen fest, die dem Gewirr von Nadeln entkommen waren, mit denen sie ihre Frisur in Form hielt, und blies die Wangen auf. »Die Hitze, die Fliegen – und dass ich diesen Laden allein schmeißen muss, während Sam zum Angeln geht. Wie immer.«
Sie überließ ihn seinem Bier, wandte sich ab und fuhr mit einem feuchten Tuch über die Regale hinter der Bar. Obwohl sie so nah an der Küste wohnten, legte sich der Staub des Outback wie eine rote Schicht auf alles, und Maggie vermutete, dass sie bis zum Ende ihres Lebens versuchen würde, seiner Herr zu werden. Sie sah sich selbst im Spiegel hinter dem Regal und seufzte. Das leichte Baumwollkleid klebte ihr schon jetzt am Körper und war vom Staub der Bierkästen verschmutzt. Ihr Haar, das sie am Morgen frisch gewaschen hatte, wirkte strähnig und stumpf, und sie hatte dunkle Schatten unter den Augen. Zu dünn war sie auch – sie sah wie ein Junge aus, nicht wie eine Frau über dreißig. Dass sie kein anständiges Make-up trug, machte die Sache nicht besser. Anscheinend habe ich überhaupt keine Zeit mehr für mich selbst, dachte sie gereizt. Ich sehe schrecklich aus.
Trotzdem lebte sie gern in Trinity. Es war eine hübsche kleine Stadt, wirtschaftlich florierend und lebendig. Schafscherer und Viehtreiber kamen aus dem endlosen Hinterland, um hier ihr Geld auszugeben, und die Farmer flohen vor der furchtbaren Hitze auf ihren entlegenen Farmen, um sich in ihren Ferienhäusern an der Küste zu erholen. Alles in allem war Maggie froh, dass sie hier war, auch wenn die weite Reise in den Norden nicht ganz die erhoffte Erfüllung gebracht hatte. Ihre Neugier war wenigstens zum Teil gestillt worden, und angesichts dessen, was sie wusste, musste sie akzeptieren, dass manche Dinge einfach nicht sein sollten.
Ich sollte wirklich nicht murren, dachte sie beim Staubwischen. Ich habe Arbeit, ein Dach über dem Kopf und das Meer zum Schwimmen – zum Teufel mit allem anderen.
Sie schaute an ihrem Spiegelbild vorbei in den Raum hinter ihr. Das Hotel stand an der Ecke der Hauptstraße, die geradewegs zum Strand führte. Es war fast hundert Jahre alt, und bis jetzt hatte es Feuer, Hochwasser und die Plage der Weißen Ameisen überstanden, aber es konnte einen frischen Anstrich gebrauchen, und mehrere Fensterscheiben waren spinnennetzförmig gesprungen. Das Haus war braun gestrichen; beide Stockwerke waren ringsum von Balkonen umschlossen, auf denen die Gäste im Schatten sitzen und die Welt an sich vorüberziehen lassen konnten. Am Randstein vor dem Hotel standen immer noch die alten Anbindepfosten für Pferde, aber heutzutage kamen fast alle Gäste mit Autos oder Jeeps.
Die Bar war dunkel und trist wie mehr oder weniger jede Bar in Australien. Fliegenfänger hingen an der Decke, und ein klappriger Ventilator rührte in der heißen Luft, um den Gästen ein wenig Kühlung zu spenden. An den Wänden standen ein paar roh behauene Holzbänke, aber die meisten Leute lehnten lieber an dem polierten Kiefernholztresen, einen Fuß auf die Messingstange dicht über dem Boden gestützt.
Maggie hätte gern Tische mit Stühlen und Blumenvasen gehabt und vielleicht einen Teppich, der den Lärm schluckte. Baumwollvorhänge an den Fenstern wären auch hübsch. Aber sie wusste, dass so etwas nicht in Frage kam. Dies war eine Männerwelt, und nicht einmal ein weiterer Weltkrieg würde daran etwas ändern. Die Männer hatten es gern, wenn alles beim Alten blieb, und wahrscheinlich merkten sie nicht einmal, wie heruntergekommen und schäbig das Lokal war.
Die Frauen mit ihren ausgefallenen Ideen wurden immer noch in die Lounge oder auf die Veranda verbannt. Nachdem Maggie fast ein Jahr hier gearbeitet hatte, war sie damit einverstanden. Welcher Lady konnte es schon gefallen, einem Stall voller Kerle beim Fluchen und Prahlen zuzuhören, deren Lautstärke mit zunehmendem Alkoholkonsum wuchs? Regelmäßig kam es zu Prügeleien – wenn auch nie wirklich zu schweren –, und schon deshalb war das Mobiliar auf ein Mindestmaß beschränkt und Frauen der Zutritt zu diesem Raum untersagt.
Maggie lächelte; sie wischte noch einmal über das Regal und machte sich daran, die Gläser zu spülen. Sie wusste, warum ihr ein bisschen wehmütig zumute war. Sam. Unmöglich, dieser Mann. Unmöglich, ihre Gefühle für ihn zu leugnen. Wenn er sie doch nur einmal bemerken und mehr in ihr sehen würde als eine gute Geschäftsführerin und Bedienung hinter der Bar. Wenn er doch nur die Frau in ihr sehen könnte! Aber vermutlich war sie für Sam nur die Person, die putzte und kochte und sich um seinen Betrieb kümmerte. Die ihm bei Tisch Gesellschaft leistete und mit der er plaudern konnte, wenn die Bar geschlossen wurde und sie sich noch ein Stündchen entspannten, bevor jeder auf sein Zimmer ging.
Samuel White war der Eigentümer des Trinity Hotel. Er war als Kriegsheld aus Europa zurückgekehrt und mit der Tatsache konfrontiert worden, dass seine Frau und sein Sohn bei einem Buschfeuer ums Leben gekommen waren. Daraufhin hatte er dem Outback den Rücken gekehrt und sein Geld in dieses Hotel investiert. Mit seinen zweiundvierzig Jahren war er zehn Jahre älter als Maggie, aber er besaß immer noch die Energie eines halb so alten Mannes. Er war groß, schlank und sonnengebräunt, und sein dunkles Haar war an den Schläfen ergraut. Er sah nicht unbedingt gut aus – bis er lächelte. Dann leuchtete sein Gesicht, und Wärme strahlte aus seinen blauen Augen und betonte seine schwarzen Wimpern. Maggie war in ihn verliebt, das wusste der Himmel, und oft lag sie nachts wach und malte sich aus, wie es wohl sein mochte, das Bett mit ihm zu teilen.
»Besteht die Möglichkeit, dass man hier noch ein Bier kriegt?«
Die Stimme des Schafscherers riss sie aus ihren Gedanken, und dankbar nahm sie eine Flasche aus dem Kasten und öffnete sie. Es hatte keinen Sinn, sich zu wünschen, dass die Dinge zwischen Sam und ihr anders wären, als sie waren, solche Hirngespinste taten ihr überhaupt nicht gut.
Die Bar füllte sich langsam, und der Lärmpegel stieg, als man sich darüber zu streiten begann, wer in der kommenden Woche den Melbourne Cup gewinnen würde. Schwitzend servierte Maggie die Getränke, wischte Pfützen auf und versuchte, zwischen den streitenden Parteien zu vermitteln. Die Füße taten ihr weh, sie hatte Kreuzschmerzen, und noch immer war Sam nirgends zu sehen. Liebe hin, Liebe her, sie würde ihm gründlich die Meinung sagen, wenn er schließlich aufkreuzte.
Vornübergebeugt kämpfte Maggie mit einem schweren Fass, das an die Zapfanlage angeschlossen werden musste, sodass sie nicht bemerkte, dass der Lärm plötzlich nachließ. »Kann einer von euch Kerlen vielleicht mal hinter die Theke kommen und mir bei diesem verdammten Ding helfen?«, schrie sie. »Es sitzt fester als ein Korken in einem Leguanarsch.«
Die Stille, die auf diesen Hilfeschrei hin eintrat, war so ungewöhnlich, dass Maggie sich aufrichtete. Und was sie jetzt sah und hörte, hatte sie noch nie erlebt. Es war so still, dass sie das Heimchen im Abfluss zirpen hörte. Eine Wand aus Rücken drängte sich an den Tresen, sodass sie nicht sehen konnte, was dieses Phänomen hervorgerufen hatte.
Sie erhob sich auf die Zehenspitzen, aber da teilte sich die Wand vor ihr wie das Rote Meer. Stumm traten die Männer zur Seite, die Gläser fest an die Brust gedrückt, die Augen weit aufgerissen, voller Entsetzen und Misstrauen.
Eine Frau schritt durch die Bar, während die Tür hinter ihr zuschwang. Die Reaktion ihres Publikums schien ihr überhaupt nichts auszumachen; zwei jungen Männern, die anscheinend vergessen hatten, die Münder wieder zuzuklappen, nickte sie sogar lächelnd zu.
Maggie wurde rot; sie wusste, wie sie auf diese kühle, elegante Frau in ihrem feinen Kostüm und den weißen Schuhen wirken musste. Es war ihr auch bewusst, was für unflätige Reden sie noch einen Augenblick zuvor geführt hatte und dass die Frau sie gehört haben musste. Sie strich sich mit der Hand über das Haar, steckte ein paar lose Strähnen fest und versuchte, den Kragen ihres Baumwollkleides glatt zu streichen. Die Lady war mutig, wer immer sie sein mochte. Aus dem Ort war sie nicht, das stand fest, denn keine respektable Australierin würde sich jemals in der Bar blicken lassen, wenn sie nicht hinter dem Tresen arbeitete.
»Was kann ich für Sie tun, Schatz?«, fragte Maggie. »Die Lounge für Ladys ist hinten. Oder Sie setzen sich auf die Veranda, und ich bringe Ihnen was.«
Alle Augen starrten die fremde Frau an, als sie an die Bar trat und ihre Handtasche auf den Tresen legte. Gemurmel setzte ein, als sie die Handschuhe auszog und sich mit einem makellos weißen Taschentuch die Oberlippe betupfte. »Ob Sie wohl ein Zimmer für mich hätten?«
Eine Engländerin, erkannte Maggie. Kein Wunder, dass sie einfach so hier hereinrauscht. »Kommen Sie mit. Ich bringe Sie unter«, sagte sie hastig.
»Zuerst möchte ich gern etwas trinken.« Anscheinend war die Frau entschlossen, an der Bar stehen zu bleiben. »Ein kaltes Bier wäre genau das Richtige.«
Das Gemurmel schwoll an, und Maggie hörte deutlich, wie die ersten Kommentare hin und her gingen. »Ich serviere Ihnen was in der Lounge für Ladys«, erklärte sie mit einer Entschlossenheit, die nicht ahnen ließ, dass sie ein Lachen unterdrücken musste. Wer immer diese Frau sein mochte, sie war ziemlich abgebrüht, denn sie musste doch merken, welches Aufsehen sie erregte. Nicht übel. Wurde Zeit, dass der Laden ein bisschen aufgemischt wurde.
Maggie kam hinter dem Tresen hervor und zerrte die Fremde fast zur Seitentür. »Hier rein, Schatz. Bevor Sie meine Gäste ganz und gar vom Biertrinken abbringen.«
Sie betraten den kühlen Salon. Die Fensterläden waren geschlossen, und es war halb dunkel. Maggie drehte sich zu der Frau um. Sie war etwa so groß wie sie selbst und hatte große braune Augen, ein wenig dunkler als ihre eigenen. »Entschuldigen Sie«, sagte sie. »Aber die Kerle können komisch werden, wenn eine Frau die Bar betritt. Macht sie nervös.«
»Warum sollten sie meinetwegen nervös werden?« Ihr Tonfall war sanft, und ihre Vokale klangen rund.
»Weil es hier anders ist, Schatz. Das werden Sie noch lernen.« Maggie griff nach dem Gästebuch. Ihr war unbehaglich zumute; sie fühlte sich linkisch und war sich ihrer schmutzigen Kleidung und roten Hände nur allzu sehr bewusst. Diese Frau hatte eine beunruhigende Wirkung auf sie, die sie sich nur durch deren Ruhe erklären konnte, durch das Selbstbewusstsein, mit dem sie alles tat. »Eine Nacht, haben Sie gesagt?«
Die Handtasche wurde auf einen Beistelltisch gestellt, die Handschuhe wurden daneben gelegt. Der Hut wurde abgenommen, das schwarze Haar aus dem makellosen Gesicht gestrichen. »Mir scheint, wir haben auf dem falschen Fuß angefangen. Es tut mir leid, wenn ich Ihnen Unannehmlichkeiten bereitet habe.« Sie streckte eine schmale Hand aus. »Mein Name ist Olivia Hamilton.«
Maggie schüttelte die Hand. Sie bemerkte lackierte Nägel und das Fehlen eines Traurings. »Maggie Finlay. Geschäftsführerin und Kuli in diesem Haus.« Sie lachte nervös. »Viel ist es nicht, aber man hat ein Dach über dem Kopf, und die Bettwäsche ist sauber.«
Olivias Lächeln wirkte echt. »Dann freuen wir uns auf den Aufenthalt hier«, sagte sie leise. Dann bemerkte sie Maggies fragenden Blick. »Ich bin mit einem Freund unterwegs«, erläuterte sie. »Wir brauchen zwei Einzelzimmer, und ich weiß wirklich nicht, wie lange wir bleiben werden.«
Maggie verbarg ihr wissendes Lächeln, während sie beobachtete, wie Olivia das Anmeldeformular ausfüllte. Einzelzimmer oder nicht – sie war lange genug im Geschäft, um zu wissen, dass »Freunde« oft das Bett miteinander teilten. Es würde interessant werden zu sehen, was für einen Mann diese kühle, gefasste Olivia bevorzugte. Und noch interessanter wäre es herauszufinden, was zum Teufel sie so weit abseits der ausgetretenen Touristenpfade suchte.
»Maggie hat gesagt, du bist hier.« Giles kam in den Salon im ersten Stock, der ihre beiden Zimmer miteinander verband. »Wie ich höre, hast du ziemliches Aufsehen erregt. Alles redet über dich.«
»Dann lassen sie wenigstens so lange irgendeinen anderen armen Hund in Ruhe«, brummte Olivia und nahm einen Schluck von dem eiskalten Bier, das Maggie ihr gebracht hatte, und reichte Giles auch ein Glas.
Er hatte sich umgezogen; er trug jetzt eine leichte Sommerhose und ein frisches Hemd. Er sah gut aus mit seinem hellbraunen Haar, den nussbraunen Augen und dem sauber gestutzten Schnurrbart, aber Olivia merkte, dass er müde war. Die dunklen Ringe unter den Augen erzählten von schlaflosen Nächten und vielleicht auch von Schmerzen trotz der Medikamente. Aber Giles beklagte sich nie. Allmählich schien er sich mit dem Verlust des Arms abzufinden.
Lächelnd ließ Olivia sich in den weichen Sessel zurücksinken. Auch sie hatte sich gewaschen und umgezogen und sogar ein halbes Stündchen geschlafen, während Giles in der Bar einen Drink genommen hatte. Das lockere Baumwollkleid und die Sandalen waren sehr viel bequemer als das alberne Kostüm, und sie fühlte sich darin auch nicht so deplatziert. Aber sie war erschöpft. Es war eine weite Reise gewesen von Sydney nach Trinity, und sie konnte immer noch nicht ganz glauben, dass sie wirklich hier war. Sie nahm noch einen Schluck Bier und seufzte zufrieden. »Das ist was anderes als das warme Gebräu zu Hause.«
Giles stellte sein Glas auf einen Tisch und setzte sich. »Und«, hob er an, wie er es so oft tat, »hat sich die alte Stadt sehr verändert?«
Sie schüttelte den Kopf. »Eigentlich nicht. Es sind natürlich mehr Autos da, und die Straße ist geteert worden, aber ansonsten ist alles wie früher.« Sie schaute sich um. Die staubige Schildblume in der Ecke, die verschlissenen Sofas und Sessel, die verschrammten Tische und der stumpfe Anstrich, das alles war ihr so vertraut wie der quietschende Ventilator unter der Decke, die verstaubte Lamellentür, die auf die Veranda hinausführte, und die von schwarzen Punkten übersäten Fliegenfänger, die von der Decke baumelten. »Wenn ich nicht wüsste, dass das ein Hotel ist, könnte ich schwören, dies wäre das alte Haus. Wir hatten genau den gleichen Blumentopf in der Ecke.«
Sie bemerkte, dass Giles unruhig war, und noch bevor er den Mund öffnete, wusste sie, was er sagen würde. Aber sie musste noch verarbeiten, was heute geschehen war. Ihre Sinne waren erfüllt von Bildern und Klängen, die sie für immer verloren geglaubt hatte, und die Ungeheuerlichkeit dessen, was sie hier tat, raubte ihr fast den Verstand.
»Wirst du mir erzählen, warum wir auf die andere Seite der Welt reisen mussten?«
Im Stillen musste Olivia zugeben, dass sie ihm gegenüber nicht fair gewesen war. Der liebe Giles. Was hätte sie in den letzten Monaten ohne ihn angefangen? Er war so ein guter Freund, und sie hatte seine Wärme und seinen Großmut beinahe als selbstverständlich hingenommen. »Hat Mutter dir je erzählt, wie sie hierher gefunden hat?«
Giles schüttelte den Kopf. »Eva war mir immer ein Rätsel, Olivia. Ehrlich gesagt, ich glaube, sie mochte mich nicht besonders. Hat nie richtig mit mir gesprochen.«
Olivia nickte. »Ja, sie konnte so distanziert sein«, gab sie zu. »Aber ich glaube, es lag eher an ihrer Schüchternheit.«
Giles schnaubte. »Ich habe Eva immer für den am wenigsten schüchternen Menschen gehalten, der mir je begegnet ist. So klein und zierlich, wie sie war, hatte sie doch einen Blick, bei dem mir noch angst und bange wurde, als ich schon längst keine kurzen Hosen mehr trug. Die Teenachmittage bei euch zu Hause waren ein regelrechtes Fegefeuer.«
Olivia lachte. »Ja, sie waren ziemlich anstrengend.« Mutter hatte Wert auf Formen gelegt. Der Nachmittagstee war stets pünktlich um vier serviert worden, mit Gurkensandwiches, Scones und Kuchen. Die Sandwiches waren selbstverständlich ohne Kruste, und in den Tee gehörte Zitrone. Tee mit Milch galt als zu gewöhnlich.
Giles zog eine Grimasse. »Es war schrecklich, dauernd Teller und Tasse nebst Untertasse zu balancieren und dabei höflich Konversation zu treiben. Das hab ich nie richtig hingekriegt.«
Olivia lachte bei der Erinnerung an Giles als jungen Mann, der unbeholfen auf der Sofakante saß, die Teetasse in der einen, den Teller mit einem Berg Sandwiches in der anderen Hand, die Serviette auf den Knien. Trotz Mutters Drängen hatte er es selten geschafft, viel zu essen.
»Mutter konnte sich von ihrer viktorianischen Erziehung nie frei machen, und ich glaube, das war ihr Hauptproblem. Sie hat oft gesagt, sie habe immer das Gefühl, nicht hierher zu passen. Es gab kein Klassensystem, weißt du, nichts Handfestes, woran sie sich orientieren konnte. Und als sie schließlich nach England zurückkehrte, hatte sich dort so vieles verändert, dass sie nicht mehr damit umgehen konnte.« Olivia seufzte. »Die Arme! Aber sie fehlt mir wirklich, weißt du.«
»Natürlich«, sagte er sanft. »Es muss schwer gewesen sein, sie sterben zu sehen. Ich weiß nicht, wie du das überstanden hast.«
Olivia schaute aus dem Fenster. Der Himmel wurde allmählich dunkler und überzog sich mit violetten und roten Streifen. Es würde einen spektakulären Sonnenuntergang geben, und gern würde sie diesem Zimmer und den Erinnerungen entfliehen und wieder zum Strand gehen. Aber es war zu spät, den Rückzug anzutreten und sich zu wünschen, dass die Dinge anders wären, als sie nun einmal waren.
»Die jahrelange Krankenpflege verleiht einem eine harte Schale. Aber auf den Tod eines geliebten Menschen ist man nie vorbereitet.« Ihre Stimme brach, und sie blinzelte. Die Erinnerungen an Eva reichten sehr weit zurück. Eva war voller Leben gewesen, und scheinbar hatte nichts sie entmutigen können. Aber sie war nie eine übermäßig zärtliche Mutter gewesen. Nie hatte sie ihre Tochter unvermittelt umarmt und mit Küssen bedeckt. Oft hatte Olivia sich danach gesehnt, dass Eva die Zurückhaltung ablegte, in der sie gefangen war, und ein wenig Gefühl zeigte. Und sie hatte lange gebraucht, um zu verstehen, dass ihre Mutter ihr ihre Liebe nicht mit Küssen und Umarmungen zu beweisen brauchte.
»Am Ende war es eine Befreiung für uns beide. Sie hatte so große Schmerzen, und die Hilflosigkeit war ihr zuwider.«
»Das stimmt.« Giles strich über seinen Schnurrbart. »In gewisser Weise hab ich sie bewundert, auch wenn ich Angst vor ihr hatte. Sie wirkte immer so stark, so beherrscht. Darum hat es mich überrascht, dass sie dich ins Internat geschickt hat. Man hätte meinen können, dass sie Wert auf deine Gesellschaft legte. Immerhin war sie allein.«
Olivia verzog das Gesicht. »Grässlich war es dort. Aber Mutter glaubte das Richtige zu tun. Ich brauchte eine Schulbildung und gute Manieren; man musste mir beibringen, mich wie eine Dame zu benehmen, nicht wie ein Wildfang. Das hat man getan.« Sie lächelte schief. »Aber ich kann nicht behaupten, dass ich dort nicht einsam war, und ich weiß nicht, wie ich es überstanden hätte, wenn Priscilla nicht gewesen wäre.«
»Ah. Ja, Priscilla.« Giles lächelte, und das vergnügte Funkeln in seinen Augen entging ihr nicht. »Es gibt sie immer noch?«
Olivia lachte. »Nur hin und wieder. Wir sind erwachsen und brauchen einander nicht mehr so sehr.« Sie räusperte sich und nahm einen Schluck Bier. Sie fühlte sich ruhiger, bereit zu diesem Furcht erregenden Weg ins Unbekannte. Es war an der Zeit, dass sie Giles etwas über die Geschichte erzählte, die hinter dieser außergewöhnlichen Reise stand.
»Nach Mutters Tod im letzten Jahr hatte ich mich um alles zu kümmern, was mit der Haushaltsauflösung zusammenhing. Als ich ihren Sekretär ausräumen wollte, klemmte eine Schublade.« Olivia lächelte. »Du weißt, wie ungeduldig ich bin. Widerstand ertrage ich nicht. Also habe ich einen Schraubenzieher hineingeschoben und das Ding praktisch herausgerissen. Dabei wurde die Schublade natürlich beschädigt, aber als ich sah, was sich darin verbarg, war das nicht mehr wichtig.«
Giles beugte sich im Sessel vor. Sein leerer Hemdsärmel baumelte herab. »Für ein gutes Geheimnis hab ich immer etwas übrig«, erklärte er begeistert. »Was hast du gefunden?«
Obwohl ihre Gedanken in Aufruhr waren und verstörende Bilder vor ihr geistiges Auge traten, musste Olivia lächeln. In Giles steckte immer noch viel von einem kleinen Jungen, trotz des Grauens, das er erlebt hatte. Aber wie sollte sie beschreiben, wie erschrocken sie gewesen war, als ihr klar wurde, was sie da gefunden hatte? Sie sah sich wieder mitten auf dem Fußboden sitzen, die zerbrochene Schublade umgekippt neben sich, während ihr die Tränen ungehemmt über die Wangen liefen und die große Standuhr die Stunden schlug, einmal und dann noch einmal. Ihre ganze Welt war plötzlich aus den Fugen geraten, und sie hatte nicht mehr gewusst, was sie glauben sollte.
Olivia riss sich aus diesen düsteren Gedanken. Giles wartete immer noch auf eine Antwort. Aber sie wollte den ersten Tag in der Heimat nicht damit verderben, dass sie von diesen schrecklichen Stunden erzählte. Es war besser, alles von Anfang an zu schildern. Dieser Teil der Vergangenheit konnte ihr nichts anhaben; er war ungefährlich. »Ich werde es dir noch früh genug erzählen«, sagte sie leise. »Du musst Geduld haben. Es wird für uns beide nicht einfach werden.«
Giles lehnte sich stirnrunzelnd zurück und schaute sie forschend an, aber ihr war nicht anzusehen, was sie bewegte, und Olivia war entschlossen, sich nicht drängen zu lassen. Sie war noch nicht so weit, dass sie ihre wahren Sorgen zum Ausdruck bringen konnte, und wenn er begreifen sollte, warum sie hier waren, musste sie alles der Reihe nach erzählen. Sie und Giles hatten einander immer nah gestanden. Am Ende würde er alles verstehen.
Sie versuchte sich zu entspannen. Die Suche nach der Wahrheit hatte begonnen, und genau wie Eva Hamilton vor all den Jahren hatte auch sie, Olivia, keine Ahnung, wohin die Reise sie führen würde.
DREI
Olivia war erschöpft. Nach dieser langen Reise Evas Geschichte zu erzählen war doch zu anstrengend. Sie sah auf die Uhr. »Zeit zum Essen«, sagte sie. »Komm, Giles. Ich sterbe vor Hunger.«
Giles starrte sie entsetzt an. »Du kannst doch jetzt nicht einfach aufhören«, protestierte er. »Was ist aus Eva geworden? Und ist Frederick ertrunken?«
Sie gähnte. »Das wirst du bald erfahren.«
Giles erhob sich aus dem Sessel. »Das ist unfair«, murrte er. Als er keine Antwort bekam, raffte er Feuerzeug und Zigarillos zusammen und steckte beides ein. »Man erwartet hier ja wohl nicht, dass ich Schlips und Jackett trage, oder?«, fragte er mit einem ungeduldigen Unterton.
»Das glaube ich nicht. Es ist ja nicht gerade das Ritz.« Sie steckte ihm den leeren Hemdärmel in den Gürtel. »Jetzt komm, sonst verhungere ich noch.«
Seine Gereiztheit war verflogen. »Jawohl, Oberschwester«, sagte er scherzhaft, und mit einem sanften Kinnstüber ermahnte sie ihn, nicht zu weit zu gehen. Dann hakte sie sich bei ihm unter, und sie stiegen die Treppe hinunter.
Unten eilte Maggie mit voll beladenen Tellern an ihnen vorbei. »Abendessen ist fertig«, rief sie. »Folgen Sie mir!«
Wie das ganze Hotel hatte auch der Speiseraum schon bessere Zeiten gesehen. Aber der Boden war blank gebohnert, und auf den Tischen leuchteten schneeweiße Tischdecken. Die letzten Strahlen der untergehenden Sonne fielen durch die bleiverglasten Oberlichter und legten ihren goldenen Glanz auf die Speisegäste. Der Raum mochte schäbig sein, aber er war offensichtlich beliebt.
Olivia und Giles setzten sich an einen für zwei Personen gedeckten Tisch. Die neugierigen Blicke und die plötzliche Stille bei ihrem Eintreten entgingen ihnen nicht. Olivia lächelte und erwiderte die gemurmelten Begrüßungen mit einem Kopfnicken. Ihr war klar, dass sie Neugierde weckten, aber sie beschränkte sich auf nichts sagende Floskeln der Höflichkeit. Nicht jeder brauchte über ihre Angelegenheiten Bescheid zu wissen, und alte Gewohnheiten waren hartnäckig. Sie hatte zu lange in England gelebt, um allzu freigebig mit Informationen umzugehen.
»Bitte sehr«, sagte Maggie und stellte zwei hoch beladene Teller auf den Tisch. »Das wird ein bisschen Farbe in Ihr Gesicht bringen, das können Sie glauben«, bemerkte sie und lachte Giles an.
Olivia bedankte sich lächelnd und wurde mit einem nonchalanten Achselzucken belohnt, ehe Maggie zum nächsten Tisch weiterging. Ohne dass man sie darum hätte bitten müssen, hatte Maggie das Fleisch für Giles in kleine Stücke geschnitten, eine aufmerksame Geste, die Olivias Herz erwärmte. Aber dann starrte sie fassungslos auf ihren Teller. Vier – nein, fünf Lammkoteletts, ein Steak, ein Berg Kartoffeln und ein Spiegelei, alles großzügig mit Zwiebelsauce übergossen. Zwei dicke Scheiben Brot mit Butter balancierten auf dem Tellerrand. »Wie um alles in der Welt soll ich das aufessen?«, flüsterte sie Giles zu.
Er zwinkerte. »Du hast gesagt, du stirbst vor Hunger. Jetzt kannst du es beweisen.« Er griff zur Gabel und fing an zu essen. »Sehr gut«, stellte er fest. »Schön, mal wieder anständiges Fleisch zu essen.«
Olivia seufzte. Es war immer noch heiß, obwohl die Sonne fast untergegangen war und es zusehends dunkler wurde. Die Lebensmittelrationierung hatte ihren Appetit geschmälert, und dazu kam die Müdigkeit und die schreckliche Hitze; sie bezweifelte, dass sie von dieser gargantuanischen Mahlzeit viel herunterbringen würde. Aber der Duft von Minze und Zwiebeln war doch verlockend. Sie langte zu, und erstaunt stellte sie bald darauf fest, dass sie mehr als die Hälfte geschafft hatte. Giles hatte Recht. Hier war offensichtlich nichts rationiert, und es war ein Genuss, endlich einmal wieder ein Lammkotelett zu kosten.
Schließlich schob sie den Teller zur Seite und lehnte sich behaglich und satt zurück. Während Giles zu Ende aß, nutzte sie die Gelegenheit, um die anderen Gäste zu betrachten. Es waren ausnahmslos Männer, und einige waren offenkundig wohlhabender als andere: Vermutlich waren es Viehzüchter, der Adel des Outback. Sie saßen nicht mit Treibern und Scherern am Tisch, aber sie unterhielten sich quer durch den Raum mit ihnen, als gebe es keine Klassenschranken, einig mit sich und der Welt.
Was für ein seltsames Land dieses Australien doch ist!, dachte Olivia. Kein Wunder, dass Mutter sich nicht zurechtgefunden hat, denn anscheinend gilt hier keines der strengen Gesetze, die in der englischen Gesellschaft herrschen. Aber Olivia fand diese fröhliche Formlosigkeit herzerfrischend, und sie musste zugeben, dass sich auch in England manches allmählich änderte. Dazu war ein Krieg nötig gewesen – vielleicht konnte es jetzt für alle vorangehen.
Sie blickte auf, als Maggie das schmutzige Geschirr abräumte und stattdessen Schalen mit dampfendem Pudding und Vanillesauce hinstellte. »Ich werde ziemlich dick werden, wenn ich jeden Tag so viel esse«, sagte sie lächelnd.
»Glaube ich nicht«, antwortete Maggie und stellte die Teller auf ein Tablett. Sie musterte Olivia und lächelte. »Sie sind wie ich. Ein magerer Typ.«
Olivia wusste nicht recht, wie sie das aufnehmen sollte; sie musste diese Perle der Weisheit erst verdauen. Jahrelange Lebensmittelrationierung und harte Arbeit hatten sie abmagern lassen – es hatte nichts damit zu tun, dass sie so veranlagt war. »Ich habe wirklich keinen Platz mehr dafür«, sagte sie und wollte den Pudding zurückgehen lassen.
»Geben Sie ihn Giles. Er könnte ein paar Pfund mehr vertragen nach allem, was er durchgemacht hat.«
Olivia sah, dass Giles rot wurde; anscheinend hatte er sich ausführlich mit Maggie unterhalten, als er in der Bar sein Bier getrunken hatte. »Arbeiten Sie allein hier?«, fragte sie, als Maggie einen Löffel polierte und sorgfältig neben Giles’ rechte Hand legte.
Maggie warf den Kopf in den Nacken. »Lila und ihre Tochter stehen in der Küche, und morgens kommt jemand zum Saubermachen. Und am Wochenende hab ich Hilfe in der Bar. Sam sollte eigentlich auch hier sein – er ist der Eigentümer –, aber er ist wie immer auf Wanderschaft.« Ihre braunen Augen funkelten golden im Schein der Lampen. »Ich werde ihm das Fell über die Ohren ziehen, wenn er auftaucht«, drohte sie. »Er weiß, dass samstags abends viel Betrieb ist.«
Olivia trank eine Tasse Tee und beobachtete, wie Giles die beiden Portionen Pudding fast ganz vertilgte. Als er sich schließlich zurücklehnte und sich den Mund mit der Serviette abwischte, lachte sie leise. »Ich würde mich wundern, wenn du dich noch bewegen kannst, nachdem du das alles gegessen hast«, zog sie ihn auf. »Aber es ist schön, dass du wieder Appetit hast.«
»Trostfutter«, antwortete er mit zufriedenem Lächeln. »Erinnert mich an das Internat und die Offiziersmesse.« Er klopfte sich auf den Bauch und zündete sich einen Zigarillo an. »Das nenne ich ein anständiges Abendessen.«
Olivia lächelte, und als Giles ein ausgiebiges Gespräch mit einem Viehzüchter am Nachbartisch anfing, schaute sie zu, wie Maggie mit Tabletts voller Teller und Tassen ein und aus marschierte. Maggies Blick war wütend, ihr Mund schmal. Offensichtlich war der entlaufene Sam immer noch nicht wieder aufgetaucht, und Olivia bekam allmählich Mitleid mit diesem Unbekannten, denn mit Maggie war anscheinend nicht gut Kirschen essen.
Die anderen Männer luden Giles ein, etwas mit ihnen zu trinken, aber er hatte eigentlich keine Lust dazu; Olivia sah ihm an, dass die lange Reise sich allmählich bemerkbar machte. Also verabschiedeten sie sich und beschlossen, noch einen Spaziergang zum Strand zu machen. Nach einem solchen Essen brauchten sie ein bisschen Bewegung, um schlafen zu können.
Olivia atmete den milden Duft der Nachtblumen und die frische, salzige Seeluft ein. So still war es hier, die Straße so leer. Sie hakte sich bei Giles unter und genoss den Frieden und die leichte Brise, die vom Meer heraufwehte. Genoss die vertraute Gesellschaft.
Der Strand lag im Mondlicht, und das Wasser glitzerte unter einem schwarzen, von Sternen übersäten Himmel. Olivia zog die Sandalen aus, streifte die Strümpfe ab und grub die Zehen in den Sand. Er war noch warm von der Sonne. Sie hob den Rocksaum an und watete ins samtig kühle Wasser.
Giles zerrte sich Schuhe und Socken von den Füßen und folgte ihr. Sie standen bis zu den Knöcheln im weichen Wasser und betrachteten staunend den gewaltigen Himmel. Die Milchstraße war eine majestätische weiße Wolke aus Millionen von Lichtpunkten, ohne Anfang und Ende. Das Kreuz des Südens und der Orion funkelten kalt und klar vor dem Hintergrund endloser Dunkelheit, und der Mond war eine makellose Six-Pence-Münze aus Silber, die sich in den Meereswellen widerspiegelte.
Erneut verspürte Olivia den beruhigenden Einfluss dieses Ortes, der einmal ihr Zuhause gewesen war. Als Kind hatte sie nie draußen sein dürfen, wenn es dunkel war, aber sie hatte stundenlang an ihrem Zimmerfenster gesessen und die himmlische Pracht bestaunt. Die Sterne waren alte Freunde – und wie alte Freunde sagten sie ihr: Willkommen zu Hause.
Sam rieb die Stute ab, sorgte dafür, dass sie genug Futter und Wasser hatte, und verriegelte leise die Stalltür. Er hob Angelzeug und Fische auf, wandte sich dem hell erleuchteten Hotel zu und zog eine Grimasse. Es war spät, viel später, als er gedacht hatte, und Maggie würde ihm sicher eine Standpauke halten.
»Das Hotel gehört mir, verdammt«, knurrte er. »Ich kann kommen und gehen, wann es mir passt.«
Aber er wusste, dass er den starken Mann nur spielte. Ihn plagte das schlechte Gewissen, weil er Maggie mit der ganzen Arbeit allein gelassen hatte, und er wünschte, er hätte eine gute Entschuldigung für seine Verspätung. Aber die Wahrheit war, dass er einfach die Zeit vergessen hatte. An seinem bevorzugten Fischteich oben im Tafelland hatte er den Tag verträumt und die Einsamkeit und den Frieden genossen, den der Regenwald seiner Seele immer wieder spendete.
Ich werde alt, dachte er und beschloss, sich noch eine letzte Zigarette zu drehen, ehe er Maggie unter die Augen trat. Was ist nur aus dem zähen Viehzüchter geworden, der es mit Feuer und Hochwasser, Trockenheit und Gewehrkugeln aufgenommen hat? Ein Träumer ist er geworden, jawohl. Ein alter Knacker, der sich bemühte, eine veränderte Welt zu verstehen, die sich für ihn zu schnell entwickelte. Aber ohne Stella und den Jungen war das alles sowieso nicht mehr wichtig.
Er wölbte die Hände um das Streichholz, das im Dunkeln aufflammte. Bei dieser schlichten Handlung überlief es ihn immer noch eisig, denn sie erinnerte ihn an den Krieg, an die Heckenschützen, die sich an dem Streichholz orientierten, das zum dritten Mal achtlos angezündet wurde. Erinnerte ihn daran, dass ein einziger Funke genügt hatte, um alles zu vernichten, was er besessen und geliebt hatte.
Die Bilder dieser ausgebrannten Ruine, die er vorgefunden hatte, als er nach dem Krieg auf die Leonora-Farm zurückgekommen war, waren immer noch lebendig. Noch immer sah er die schlichten Grabsteine auf dem kleinen Friedhof vor sich. Sie waren bereits überwuchert – eine schreckliche Mahnung: Man konnte sein ganzes Leben lang gegen die Macht der Natur kämpfen, am Ende siegte sie immer. Es war eine harte Lektion gewesen.
Seufzend schob er das abgebrannte Zündholz wieder in die Schachtel und lehnte sich mit der Schulter an das raue Holz der Stallwand. Der Kampfeswille war ihm ausgetrieben worden. Er musste sich damit abfinden, dass Unerschrockenheit etwas für jüngere Männer war. Sie hatten die nötige Kraft – den Drang, immer wieder aufzustehen. Für ihn war der Krieg in jeder Hinsicht vorbei. Er war jetzt der Eigentümer eines schäbigen Hotels im hohen Norden von Queensland.
Sam schob die düsteren Gedanken beiseite und beobachtete Maggie durch das erleuchtete Fenster. Sie bewegte sich flink wie immer, und ihr Mund war dauernd in Aktion, als sie mit den Aborigine-Frauen in der Küche sprach. Er lächelte. Ein prima Mädchen, da gab es nichts. Dürr wie eine Bohnenstange, aber trotzdem nicht übel, wenn sie sich für einen besonderen Anlass herausgeputzt hatte. Er hatte eine perfekte Wahl getroffen, als er ihr seinen Betrieb anvertraute. Aber ihm war schon vor einiger Zeit klar geworden, dass die arme alte Maggie es ihr ganzes verdammtes Leben lang nicht leicht gehabt hatte, und er musste zugeben, dass er die Sache nicht gerade besser machte, wenn er so lange wegblieb und sie an einem Samstagabend allein ließ.