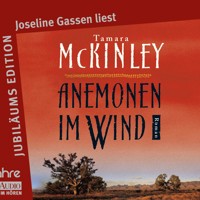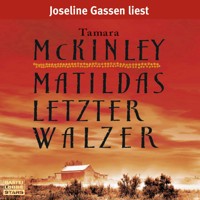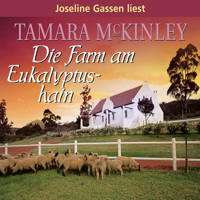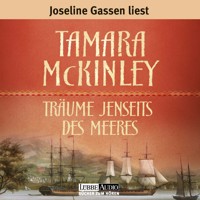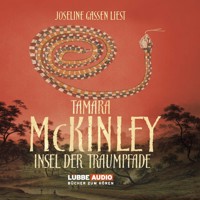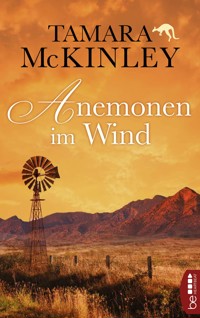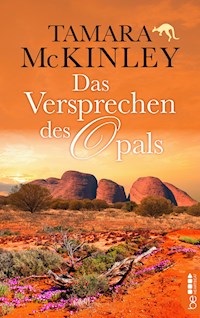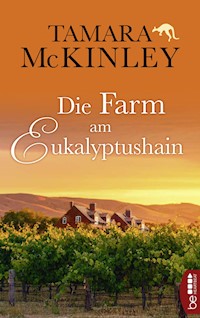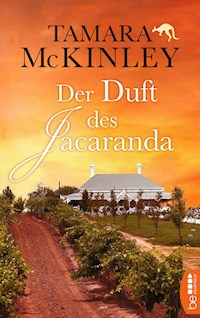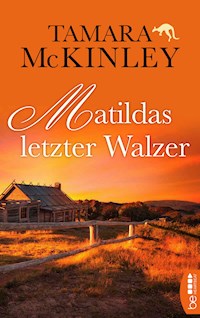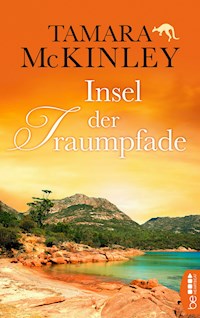
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: beHEARTBEAT
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Ozeana-Trilogie
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Eine Liebe so unendlich wie Australien
Sydney, 1795: Eloise Cadwallader ist der Stolz ihres Mannes Edward. Dennoch behandelt der Kommandant der englischen Armee seine schöne, kluge Frau mit der gleichen Härte wie seine Truppen, die er unerbittlich gegen die Ureinwohner Australiens treibt. Auch als Edward zunehmend dem Rum verfällt, verbietet Eloise sich aus Loyalität, ihn zu verlassen. Dabei gehört ihr Herz längst einem anderen Mann. Erst ein tragisches Ereignis gibt ihr die Kraft zu diesem Schritt. Doch ist Eloise nun wirklich frei - oder ist es schon zu spät für einen Neuanfang?
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 646
Ähnliche
Inhalt
Erschienene Titel der Autorin
Die Ozeana-Trilogie:
Band 1: Träume jenseits des Meeres
Band 2: Insel der Traumpfade
Band 3: Legenden der Traumzeit
Anemonen im Wind
Das Land am Feuerfluss
Das Lied des Regenpfeifers
Das Versprechen des Opals
Der Duft des Jacaranda
Der Himmel über Tasmanien
Der Zauber von Savannah Winds
Die Farm am Eukalyptushain
Jene Tage voller Träume
Matildas letzter Walzer
Über dieses Buch
Eine Liebe so unendlich wie Australien
Sydney, 1795: Eloise Cadwallader ist der Stolz ihres Mannes Edward. Dennoch behandelt der Kommandant der englischen Armee seine schöne, kluge Frau mit der gleichen Härte wie seine Truppen, die er unerbittlich gegen die Ureinwohner Australiens treibt. Auch als Edward zunehmend dem Rum verfällt, verbietet Eloise sich aus Loyalität, ihn zu verlassen. Dabei gehört ihr Herz längst einem anderen Mann. Erst ein tragisches Ereignis gibt ihr die Kraft zu diesem Schritt. Doch ist Eloise nun wirklich frei – oder ist es schon zu spät für einen Neuanfang?
eBooks von beHEARTBEAT – Herzklopfen garantiert.
Über die Autorin
Tamara McKinley wurde in Australien geboren und verbrachte ihre Kindheit im Outback des fünften Kontinents. Heute lebt sie an der Südküste Englands, aber die Sehnsucht treibt sie stets zurück in das weite, wilde Land, dessen Farben und Düfte sie in ihren Büchern heraufbeschwört. Mit ihren großen Australien-Romanen hat sie sich eine weltweite Fangemeinde erobert.
Homepage der Autorin: http://www.tamaramckinley.co.uk/
Tamara McKinley
Insel derTraumpfade
Aus dem australischen Englisch von Marion Balkenhol
beHEARTBEAT
Digitale Neuausgabe
»be« - Das eBook-Imprint der Bastei Lübbe AG
Für die Originalausgabe:
Copyright © 2008 by Tamara McKinley
Titel der englischen Originalausgabe: »A Kingdom for the Brave«
Originalverlag: Hodder & Stoughton Ltd., London
Für diese Ausgabe:
Copyright © 2008/2021 by Bastei Lübbe AG, Köln
Lektorat: Regina Maria Hartig
Redaktion: Christine Ruge-Adä
Covermotive: © Delphine Camberlin/shutterstock; © vvvita/shutterstock; © Creative Travel Projects/shutterstock
eBook-Produktion: Dörlemann Satz, Lemförde
ISBN 978-3-7517-0214-0
www.be-ebooks.de
www.lesejury.de
Der Freiheit Kampf, einmal begonnen,Vom Vater blutend auf den Sohn vererbt,Wird immer, wenn auch schwer, gewonnen.Lord Byron 1788–1824
Für Liam, Brandon, Brett und Fiona,auf dass sie nie die Pioniere, Abenteurer und Strafgefangenenvergessen mögen, die heldenhaft dafür gekämpft haben, Wohlstandund Freiheit nach Australien zu bringen.
Prolog
Der Schrei des Brachvogels
Brisbane River, 1795
Die Morgenröte hatte den Himmel noch nicht erhellt, doch der Trupp aus acht Reitern war bereits unterwegs. Edward Cadwallader schaute auf. Der Mond blieb hinter einer dicken Wolkenschicht verborgen. Es war eine perfekte Nacht zum Töten.
Im stillen Dickicht machten sie nur wenige Geräusche, denn die Hufe der Pferde und das klirrende Zaumzeug waren mit Jute umwickelt und die Männer hüteten sich, zu reden oder zu rauchen. Es war eine vertraute Routine, aber Edward war aufgeregt – wie immer in den letzten Augenblicken vor einem Überfall. Der Gedanke an das Bevorstehende steigerte seine Ungeduld.
Er ließ den Blick über die nähere Umgebung schweifen. Zu beiden Seiten erhoben sich Steilhänge mit gezackten Gipfeln aus dem Busch. Dunkle Felsblöcke und Baumgruppen boten Schutz, und sein Pferd zuckte unter ihm zusammen, als etwas durch das Unterholz huschte. Edward hielt die Zügel fest umklammert. Er war angespannt, denn sie hatten ihr Ziel fast erreicht. Ein einziger Laut könnte sie verraten.
Er drehte sich nach den Männern um, die ihm auf diesen nächtlichen Raubzügen bereitwillig folgten, und erwiderte das Grinsen seines ergrauten Sergeanten. Er und Willy Baines hatten sich einst gleichzeitig dem New South Wales Corps angeschlossen. Sie hatten die Zelle eines Militärgefängnisses geteilt und nebeneinander auf der Anklagebank gesessen, als sie wegen Vergewaltigung einer Frau vor Gericht standen – und sie hatten zusammen gefeiert, als die Klage schließlich abgewiesen wurde. Einer wusste vom anderen, was er dachte, und der Sergeant hatte auch Verständnis für Edwards Blutrunst. Obwohl Welten zwischen ihnen lagen, betrachtete Edward ihn als seinen besten Freund.
Edward spähte in die Finsternis. Nach zwei Stunden im Sattel hatten sich seine Augen längst an die Dunkelheit gewöhnt. Er konnte darauf vertrauen, dass seine Männer den Mund hielten, wenn sie nach Sydney zurückkehrten. Die Säuberungen sollten nicht zum Gegenstand öffentlicher Auseinandersetzungen werden, auch wenn sie immer häufiger vorkamen und es allgemein bekannt war, dass die Schwarzen mit Gewalt von dem dringend benötigten Land vertrieben wurden. Doch je weniger die Öffentlichkeit über die militärischen Maßnahmen der Vertreibungen erfuhr, desto besser – und im Übrigen, wen kümmerte es schon?
Die Gegend um den Hawkesbury River war bereits gesäubert, und obwohl der abtrünnige Pemulwuy noch immer frei herumlief, war Edward überzeugt, dass es sich nur noch um wenige Wochen handeln konnte, bis man ihn und seinen Sohn aufgetrieben und erschossen hätte. Jetzt hatte er die Aufgabe, die Letzten des Turrbal-Stammes vom Brisbane River zu vertreiben.
Es waren aufregende Zeiten, und Edward war mittendrin im Geschehen. In den Jahren, in denen er in die Wildnis versetzt worden war, hatte er viel gelernt. Und er hatte entdeckt, wie spannend es war, die Schwarzen zu jagen. Sein Ruf und der Respekt, den er bei seinen Männern genoss, hatten sich bis zu den Behörden in Sydney Town herumgesprochen. Trotz seiner fragwürdigen Vergangenheit war er zum Major befördert worden mit der Aufgabe, dieses Gebiet von dem schwarzen Pack zu befreien. Dafür hatte ihm der General zugesagt, seine Versetzung an den Brisbane River um zwei Jahre abzukürzen. Das Leben war schön, und Edward freute sich auf seine Rückkehr nach Sydney, wo er sein Glück machen und ein Haus bauen wollte, um das ihn jeder beneiden würde.
Der Gedanke, wieder eine weiße Frau zu haben, verstärkte seine innere Erregung noch. Die Eingeborenen stanken und kämpften oft wie Katzen – aber er hatte nichts gegen eine Herausforderung. Doch auch wenn er schwarze Haut exotisch gefunden hatte, zog er den Geruch von weißem Fleisch vor.
Er lenkte seine Gedanken wieder auf die bevorstehende Aufgabe. Wenn das vorbei war, würde er noch Zeit genug haben, um an Frauen zu denken. Jetzt brauchte er einen klaren Kopf, wenn sie nicht in einen Hinterhalt geraten wollten. Die Schwarzen mochten ja unwissende Wilde sein, aber es war ihr Land und sie kannten es viel besser als jeder Soldat, und sei er noch so gut ausgebildet.
Der Stoßtrupp rückte schweigend durch den Busch vor, auf der Hut vor versteckten Kriegern in der Dunkelheit. Als es hell wurde, zogen graue Sturmwolken über den Himmel, und die Anspannung wuchs. Nun begann der gefährlichste Teil ihres Ritts, denn das Lager lag nur noch knapp eine Meile entfernt.
Edward zügelte sein Pferd, damit es stehen blieb, und sprang aus dem Sattel. Er wartete, bis die anderen bei ihm waren. »Ihr wisst, was zu tun ist?« Seine Stimme war leiser als ein Flüstern.
Sie nickten. Vor wenigen Tagen hatten sie alles bis ins Detail geplant, und sie wussten, dass man ihnen bei jeder gefangenen Frau freie Hand ließ.
»Ladet eure Musketen«, befahl Edward, »und denkt daran: Es darf keine Überlebenden geben!«
»Was ist mit den Kindern und den Weibern?«
Edward betrachtete den neuen Rekruten – ein dünner, junger Kavallerist mit hellen Augen, einem unehrenhaften Führungszeugnis und dem Hang zu Eingeborenenfrauen. Mit grimmiger Miene und kalten Augen untermauerte Edward seine Autorität. »Schwarze Frauen kriegen Kinder, und die wachsen auf, um sich wieder zu vermehren. Es geht mich nichts an, was ihr macht oder wie ihr es macht, aber ich will, dass heute Abend keiner übrig bleibt.« Er funkelte den Kavalleristen an und war befriedigt, als er Angst in dessen Blick wahrnahm.
Das bleiche Gesicht des Jungen färbte sich rot.
Edward wandte sich an Willy Baines. »Wir erkunden zuerst«, murmelte er, »nur um sicher zu gehen, dass sie noch da sind.«
Willy kratzte sich die Kinnstoppeln. Keiner von ihnen hatte sich in den letzten vier Tagen gewaschen oder rasiert, denn die Nase eines Eingeborenen witterte den Geruch von Seife oder Pomade meilenweit. »Das ist sehr wahrscheinlich«, erklärte er. »Nach Aussage meiner Spione kommen sie schon seit Jahrhunderten hierher.«
»Du und deine Spione, Willy! Wie kriegst du die Myalls nur dazu, dir so viel zu erzählen?«
Willy schüttelte den Kopf, während sie sich von den anderen entfernten. »In unseren Augen sehen sie zwar alle schwarz aus, und ich kann sie, verdammt noch mal, nicht auseinanderhalten, aber es gibt Stammesunterschiede, und für eine Flasche Rum oder ein bisschen Tabak erzählt ein guter Mann alles, was er weiß.«
Edward legte seinem Begleiter eine Hand auf die Schulter. »Du bist mir ein Rätsel, Willy, und nur ein toter Myall ist ein guter Myall. Komm, lass uns nachsehen, was wir hier haben!«
Sie ließen die anderen zurück, die ihre Musketen luden, und suchten sich vorsichtig einen Weg durch das Unterholz am Ufer. Der Fluss war seicht und gewunden, das Schilf und die überhängenden Bäume boten in dieser mondlosen Nacht eine perfekte Deckung. Die beiden Männer lagen auf dem Bauch und hoben den Kopf vorsichtig über das hohe Gras, während sie das schlafende Lager betrachteten.
Die Stammeskrieger, unverheiratete junge Männer, bildeten in lockerer Formation eine schützende Phalanx um die Frauen, Kinder und älteren Männer. Die meisten schliefen auf dem Boden, doch es gab auch drei oder vier gunyahs, Unterstände aus Gras und Eukalyptus, in denen die Ältesten ruhten. Hunde rührten sich, um sich zu kratzen, von heruntergebrannten Lagerfeuern stiegen kleine Rauchschwaden auf, alte Männer husteten Schleim, Säuglinge wimmerten. Grinsend nahm Edward den Anblick in sich auf. Die Turrbal hatten keine Ahnung, was ihnen bevorstand.
Lowitja fuhr aus dem Schlaf auf und zog instinktiv ihren fünfjährigen Enkel näher zu sich. Irgendetwas war in ihre Träume eingedrungen, und als sie die Augen aufschlug, vernahm sie den klagenden Schrei eines Brachvogels. Es war der Ruf der Totengeister – der durchdringende, quälende Ton gepeinigter Seelen, eine Warnung vor Gefahr.
Mandawuy strampelte in der festen Umarmung seiner Großmutter und hätte aufgeschrien, wenn sie ihm nicht die Hand über den Mund gelegt hätte.
»Still!«, befahl sie mit der leisen Bestimmtheit, der er auf der Stelle zu gehorchen gelernt hatte.
Er setzte sich ruhig und unerschrocken auf. Die bernsteinfarbenen Augen seiner Großmutter waren starr auf den Rand des Lagers gerichtet. Was konnte sie sehen?, fragte er sich. Waren Geister auf der Lichtung? Konnte sie Stimmen hören – und wenn ja, was sagten sie ihr?
Lowitja lauschte dem Schrei der Brachvögel. Es waren jetzt viel mehr geworden, als versammelten sich die Geister der Toten, als vereinten sich ihre Stimmen zu einem qualvollen Wehklagen, das ihr Herz durchbohrte. Dann nahm sie im Grau der Morgendämmerung gespenstische Umrisse wahr, die sich zwischen den Bäumen hindurchwanden. Sie wusste, wer sie waren und warum sie gekommen waren.
Sie mussten sich beeilen: Das Lager rührte sich. Edward und Willy verschwanden in den dunkleren Schatten und kehrten zu den wartenden Männern zurück. Diese standen mit geladenen und gespannten Waffen bereit. Es konnte losgehen. »Aufsitzen!« Edward nahm die Zügel seines Pferdes und schwang sich in den Sattel. »Im Schritt.«
Die Reihe rückte in geübter Präzision vor, bis die Männer fast in Sichtweite des Lagers waren. Die Erregung war beinahe greifbar. Edward hob seinen Säbel. Die ersten Sonnenstrahlen ließen die Klinge aufblitzen. Er hielt den Säbel erhoben und kostete den Moment aus.
»Attacke!«
Gleichzeitig trieben sie die Pferde zum Galopp an. Die Tiere spannten sich an, die Nüstern gebläht, die Ohren flach an den Kopf gelegt, während die Reiter johlten, schrien und ihnen die Sporen gaben.
Lowitja war vom Erscheinen des Geistvolkes wie gebannt. In den mehr als dreißig Jahren, die sie nun lebte, hatte sie es noch nie so deutlich gesehen. Zuerst dachte sie, der ferne Donner stamme von einem Sommergewitter. Sie zog sich aus ihren Visionen zurück, und ihre Hände griffen mechanisch nach Mandawuy, denn ihr fiel auf, dass sich den Hunden das Fell sträubte, und sie vernahm den warnenden Aufschrei der Vögel, die mit rauschendem Flügelschlag von den Bäumen aufflogen.
Als der Donner lauter wurde, schrak der Rest des Stammes aus dem Schlaf. Säuglinge und kleine Kinder weinten, als ihre Mütter sie aufnahmen. Die Krieger schnappten sich Speere und Keulen, und die Älteren erstarrten. Die Hunde kläfften wütend.
Der Donner kam näher und erfüllte die Luft. Die Angst brachte Lowitja auf die Beine. Die Erde unter ihren Füßen bebte. Jetzt begriff sie, warum die Geister zu ihr gekommen waren und sie gewarnt hatten. Sie musste Mandawuy retten. Lowitja zwang all ihre Kraft in Beine und Arme, packte ihren Enkel und rannte los.
Dornen stachen, Äste peitschten sie, Wurzeln drohten sie zu Fall zu bringen, aber sie lief weiter durch den Busch. Trommelnder Hufschlag und Gewehrschüsse zerrissen hinter ihr die Luft, doch sie schaute sich nicht um und rannte.
Mandawuy gab keinen Laut von sich. Er klammerte sich an seine Großmutter, Arme und Beine um sie geschlungen, Tränen des Entsetzens fielen heiß auf ihre Haut. Schreie, Rufe und Schüsse hallten von der Lichtung wider.
Lowitjas Herz hämmerte, ihre Brust schmerzte, Beine und Arme wurden schwer wie Blei, während sie sich mit dem einzigen lebenden Kind ihres Sohnes durch den Busch kämpfte und einem ungewissen Ort der Sicherheit entgegenstrebte.
Sie preschten durch die leichten gunyahs und die schwelenden Feuer, so dass ein Funkenregen aufstob. Die erste volle Bleiladung hatte Männer, Frauen und Kinder blutig zu Boden geworfen, wo sie von den Pferden der Angreifer zertrampelt wurden. Schreie zerrissen die Luft. Die Flinkeren rannten davon. Jetzt ging der Spaß erst richtig los.
Die Hunde liefen in alle Richtungen, während Frauen Kinder packten und Männer mühsam nach ihren Speeren und ihrem nulla nulla, einer Holzkeule, suchten. Die Älteren versuchten auf allen vieren zu entkommen oder setzten sich einfach hin, die Hände über dem Kopf verschränkt in dem erbärmlichen Glauben, damit die Säbel abzuwehren. Kleine Kinder standen vor Entsetzen erstarrt, als die Pferde auf sie zupreschten, um sie in die dunkelrote Erde zu stampfen. Einige der jüngeren stärkeren Männer wollten ihre flüchtenden Familien verteidigen, doch sie hatten keine Zeit, ihre Speere zu werfen und die schweren Keulen zu schwingen, ehe sie in Stücke zerhackt wurden.
Edwards Blutrunst war erwacht; er drehte sein Pferd in engem Kreis und feuerte seinen zweiten Schuss auf eine alte Frau, die an den Resten eines Lagerfeuers kauerte. Rasch lud er nach, während sie in die Flammen stürzte. Er würde auf sie kein Blei mehr verschwenden – sie würde ohnehin bald tot sein.
Er fuhr in einem fort, neu zu laden, bis der Lauf so heiß war, dass man ihn nicht mehr anfassen konnte. Als er nicht mehr schießen konnte, benutzte er den Karabiner als Keule, mit der er nach links und rechts ausholte, um Schädel zu zertrümmern und Hälse zu brechen, um alle niederzumähen, die nicht schnell genug fliehen konnten, und sie dann mit dem Säbel zu erledigen. Sein Pferd schäumte und verdrehte die Augen, als gunyahs Feuer fingen und sich auf der Lichtung Rauch ausbreitete. Es stank nach verbranntem Fleisch und brennendem Eukalyptus; in dem dichten schwarzen Rauch fingen die Augen an zu tränen, die Kehle schnürte sich zu.
Zwei von Edwards Männern waren abgestiegen und jagten hinter zwei Frauen her, die unter die Bäume geflohen waren. Willy machte kurzen Prozess mit ein paar Kindern, und die anderen waren damit beschäftigt, drei Krieger niederzustechen, die ihre Speere trotzig erhoben hatten.
Edward jagte hinter zwei Jungen her und metzelte sie mit einem Säbelstreich nieder. Die Klinge war voller Blut, seine Uniform besudelt, und die Flanken seines Pferdes klebten. Aber er war noch nicht fertig – seine Gier war noch nicht befriedigt – und suchte ein weiteres Opfer.
Ein Mädchen auf der anderen Seite der Lichtung hatte die Bäume fast erreicht – doch es kam nur langsam voran, denn es hatte bereits Bekanntschaft mit einem Säbel gemacht. An seiner Schulter klaffte das blutige schwarze Fleisch auseinander wie ein obszöner rosa Mund.
Er trat dem Pferd in die Flanken, galoppierte auf das Mädchen zu und hob den Säbel. »Sie gehört mir, Willy«, brüllte er, denn sein Freund hatte es ebenfalls erspäht.
Die Verfolgte schaute mit weit aufgerissenen Augen über die Schulter.
Edward überholte sie und verstellte ihr den Fluchtweg.
Das Mädchen erstarrte.
Edward enthauptete es mit einem Streich. Dann galoppierte er zurück auf die Lichtung, um zu sehen, was die anderen ihm übrig gelassen hatten.
Lowitja versteckte sich in den schützenden Ästen des Baumes, hoch über dem Waldboden. Sie umklammerte Mandawuy und hielt ihn durch Stillen ruhig, während das Blutbad auf der Lichtung tobte. Sie hörte jemanden unter sich vorbeilaufen, Gewehrschüsse, die entsetzlichen Schreie der Sterbenden – und vergoss stille Tränen, als sie brennendes Fleisch roch. Sie konnte sich das Grauen nur vorstellen, das ihrem Volk widerfuhr, konnte nur zum Großen Geist beten, dass wenigstens einige diesen Tag überlebten.
Doch die Stille, die dann eintrat, war noch furchteinflößender. Sie lag schwer in der Luft, beladen mit einer Dunkelheit, die Lowitja endlos erschien. Sie wartete noch lange. Ihr Körper zitterte unter der Anstrengung, Mandawuy in den Armen zu halten und sicher auf dem hohen Ast auszuharren. Sie wagte nicht einzuschlafen.
Die Sonne warf ein dünnes bleiches Licht über den Horizont, als Lowitja mit ihrer kostbaren Last den Baum hinunterkletterte. Sie nahm Mandawuys kleine Hand in die ihre und näherte sich vorsichtig der Lichtung, bereit zu fliehen. Sie fürchtete sich vor dem Anblick, dem sie sich stellen musste. Doch die Geister der Ahnen riefen sie und führten sie zu den Schlachtfeldern, so dass sie mit eigenen Augen sah, was der weiße Mann angerichtet hatte, und dieses Wissen weitergeben konnte.
Sie stand am Rande der Lichtung, noch nicht mutig genug, diesen Ort des Todes zu betreten. Das Lager war ruhig und still – und in dieser Stille vernahm sie das Flüstern längst verstorbener Krieger, die gekommen waren, die Völker der Eora und Turrbal zu holen und in die Geistwelt mitzunehmen. Rauchfahnen stiegen in der windstillen Morgendämmerung auf und schwebten in ruhelosen, gespenstischen Schwaden über zerschmetterten Kochtöpfen, zerstückelten Leibern und zerbrochenen Speeren.
Schaudernd stand Lowitja neben ihrem Enkel. Niemand war verschont worden – nicht einmal das kleinste Kind. Sie hörte die Fliegen summen, die in dunklen Wolken über den Leibern hingen, die in den Erdboden gestampft waren. Sie waren bereits von den aasfressenden Krähen und Dingos gezeichnet, die in der Nacht um das frische Fleisch gekämpft hatten. Bald würden der Goanna mit seinen scharfen Echsenzähnen und Klauen sowie Insekten und Maden kommen, um die Reste zu vertilgen.
Lowitja betrachtete den Ort des Todes und wusste, dass niemand überlebt hatte. Es war in Erfüllung gegangen, was ihr die Geistträume und die geworfenen Steine prophezeit hatten. Sie würde nie wieder an diesen Ort zurückkehren, sondern gen Westen zum Uluru gehen. Es war eine lange, gefährliche Strecke für eine einzelne Frau – sie würde den Rest ihres Lebens darauf verwenden, sie zu vollenden –, doch der Uluru war ihre geistige Heimat, und sie würde lieber sterben bei dem Versuch, dorthin zu gelangen, als hier unter den weißen Wilden zu bleiben.
Sie nahm ihren Enkel auf den Arm und gab ihm einen Kuss. Er war der Letzte der reinrassigen Eora – das letzte Bindeglied zwischen ihr, Anabarru und dem großen Ahnen Garnday. Er musste gut behütet werden.
Erster Teil
Launen des Meeres
Eins
An Bord der Atlantica, Juli 1797
George Collinson stand auf der Steuerbordseite an Deck des stampfenden Schiffes, das Teleskop am Auge, und suchte die gewaltige Dünung des Südlichen Ozeans ab. Es war früh am Morgen, und die Sonne brach nur selten durch die dahinjagenden Wolken. Möwen schrien, und der Wind drang wie ein scharfes Messer durch seinen Mantel und die Stiefel. Die Segel der Atlantica blähten sich, und die Takelage ächzte.
Seit Tagen waren keine Wale gesichtet worden, und da sie bereits einige Fässer voll Tran und gepökeltem Fleisch im Frachtraum hatten, darüber hinaus Fischbein für Hunderte von Korsetts, erwog der amerikanische Kapitän Samuel Varney, nach Sydney Cove zurückzukehren. Sie waren seit sechs Monaten auf See, und die Mannschaft wurde allmählich unruhig.
Die Atlantica war ein hochseetüchtiger Walfänger aus Nantucket, Massachusetts, anders als die kleineren Walfänger, die nur für eine kurze Saison in Küstennähe arbeiteten. Sie war für die wilden Ozeane vor Van Diemen’s Land und Neuseeland geschaffen, wo die Besatzung damit rechnen konnte, monatelang fern von jeglicher Zivilisation zu sein. Sie war gut ausgerüstet, hatte drei Masten, einen stämmigen Bug, ein eckiges Heck und sieben Beiboote, die über dem Schanzkleid hingen. Hinter dem Hauptmast stand eine hässliche Backsteinanlage mit Kesseln, die angeheizt würden, um den Tran vom nächsten Fang zu kochen. Der Kapitän und seine Offiziere waren achtern untergebracht, den Harpunieren Kojen im Zwischendeck zugeteilt. Der Rest der Mannschaft schlief vorn, mittschiffs befand sich die Luke in den großen Schiffsrumpf, in dem die Fracht und Vorräte sowie zweitausend Fuß Ersatztauwerk aufbewahrt wurden.
George verzog das Gesicht, Graupel und eiskalte Gischt durchnässten ihn, doch er schaute unentwegt durch sein Teleskop und suchte nach der legendären Fontäne oder der Schwanzflosse, die das Signal zur Jagd setzen würde. In diesen Gewässern wimmelte es um diese Jahreszeit für gewöhnlich von Nordwalen, und jeder Fang brachte eine Zulage.
Fast eine Stunde später wurde der Ruf laut: »Backbord! Wale in Sicht!«
George drehte sich rasch um und stellte sein Teleskop scharf. Sein Herz raste, sein Mund trocknete aus, als er die unverwechselbaren Schwanzflossen einiger schwarzer Wale einfing. Die Jagd stand kurz bevor – jetzt wurde es spannend.
Kapitän Varney erteilte vom Achterdeck aus Befehle mit einer dröhnenden Stimme, die selbst den Wind übertönte. Er drehte das Steuerrad, um den schwerfälligen Bug nach Backbord zu wenden. Matrosen rappelten sich auf, um Segel und Takelage anzupassen, und George schloss sich dem Sturm auf die Beiboote an.
Sie waren fast zehn Meter lang und liefen zu beiden Enden spitz zu, so dass Bug und Heck hoch über dem Wasser lagen. In jedem Boot waren zweihundert Faden Manilatauwerk aufgerollt, und die zwanzig Kerben in den Heckpollern markierten die Anzahl der Wale, die in den vergangenen sechs Jahren gefangen worden waren. Samuel Varney bevorzugte eine fünfköpfige Mannschaft in jedem Boot, so dass die Ruder an beiden Seiten gleichmäßig besetzt waren, wenn der Harpunier seinen Platz verließ. Die sechste Ruderbank im Bug war so ausgehöhlt worden, dass der Harpunier mit den Oberschenkeln Halt fand, wenn er seinen Speer mit den Widerhaken abschoss.
George kletterte ins erste Boot, das bereits zu Wasser gelassen wurde. Er fuhr seit drei Jahren mit Samuel Varney und war inzwischen ein erfahrener Walbootsvormann. Als er seinen Platz am Heck einnahm und das schwere Ruder packte, dessen Schaft mindestens fünfundzwanzig Fuß maß, überlief ihn das vertraute Prickeln. Das Rennen war eröffnet. Wer würde diesmal der Erste sein, der einen Wal harpunierte?
Sie hatten ihr Einersegel gehisst, das den Wind einfing, und die Männer legten sich in die Riemen, angefeuert von George, der sie mit allen Flüchen, die er kannte, zu noch größerer Eile antrieb und dabei den nächsten der wendigen Riesen ansteuerte. Die anderen Steuermänner waren ebenso vehement, und ihre Rufe überdeckten das Rauschen des Meeres. Der Wettlauf um die Beute hatte begonnen.
Georges Boot lag um wenige Zentimeter vorn. Sie waren jetzt nah dran – so nah, dass das große Tier mit einem Schlag seiner Schwanzflosse das Boot zerteilen konnte. So nah, dass sie sein Auge sahen und die Turbulenzen im Wasser spürten. Sie näherten sich mit dem Bug voran der windabgewandten Seite des Wals und fühlten, wie er auf- und abtauchte. Ein leichter Schlag mit den Flossen, und sie wären verloren.
»Mach dich bereit!«, rief George dem Harpunier zu.
Der Mann zog auf der Stelle sein Ruder ein und klemmte sich an den Bug, hob die Harpune und zielte.
»Jetzt!«
Der eiserne Speer mit den Widerhaken grub sich in glattes schwarzes Fleisch.
»Getroffen!«, brüllte George den anderen Booten zu, die das Rennen verloren hatten. Sie würden außerhalb der Gefahrenzone abwarten, bis der Wal getötet war.
Der Wal erhob sich aus dem Wasser, warf sich herum und schlug Wellen, auf denen ihr Boot zu kentern drohte. Taue zischten durch Eisenringe und über den Heckpoller, als er wieder abtauchte.
George tauschte rasch den Platz mit dem Harpunier. Er griff nach einer Lanze und wartete. Seine Aufgabe war es, das Tier zu töten, nachdem es den Stich der Harpune gespürt hatte.
Der Wal befand sich einige Faden unter ihnen, doch als er die Oberfläche wieder durchbrach, schoss er davon und schleppte das Boot hinter sich her. »Piekt die Riemen!«, rief George, inzwischen in Hochstimmung. »Jetzt wird Schlitten gefahren wie in Nantucket!«
Die Ruder wurden hochgestellt und die Leine an der Harpune mit Wasser überschüttet, damit sie sich nicht entzündete, wenn sie mit rasender Geschwindigkeit über den Heckpoller glitt. Die Leine wurde eingeholt oder locker gelassen, je nachdem ob das Tier abtauchte oder an die Oberfläche kam und durch das Wasser davonschoss, um dem Widerhaken zu entkommen.
George wartete ab. Nach fast einer Stunde zeigte das Ungetüm erste Anzeichen von Ermüdung. Langsam tauchte es auf, um Luft zu holen, die Fontäne aus seinem Atemloch war nicht mehr so hoch und kräftig, seine Geschwindigkeit ließ nach. George stieß zu, und die Lanze grub sich tief hinter das Auge des Wals.
Blut schoss aus der Wunde.
»Rote Flagge!«, schrie George. »Festhalten!«
Im Todeskampf bäumte sich der Koloss noch einmal wild auf und zog das Boot hinter sich her. Er schlug mit der großen Schwanzflosse um sich und wälzte sich unter Qualen. Blut spritzte in alle Richtungen und färbte die kochende See rot. Das Boot wurde auf den Wogen hin und her geworfen, die Männer klammerten sich fest und fürchteten um ihr Leben. Das Wasser im Boot stieg ihnen bis an die Knie. George blieb nichts anderes übrig als zu beten, der Harpunier möge im Umgang mit dem Ruder ebenso erfahren sein wie er, während dieser den Kurs korrigierte, wenn die wahnsinnigen Krämpfe des tödlich verwundeten Tiers auch sie schüttelten.
Dann verlor der Meeresriese den Kampf. Mit einem letzten Schwall Blut rollte er auf den Rücken und rührte sich nicht mehr.
»Kiel oben!«, signalisierte George schleunigst den anderen Booten.
Sie hatten die Jagd aus sicherer Entfernung verfolgt, denn man konnte in einem Moment der Unvorsichtigkeit von Bord gefegt werden und zu Tode kommen. Nun würden sie den Wal mit Seilen festzurren, bevor er sich mit Wasser vollsog, und ihn zur Atlantica schleppen, wo man den Speck kochen würde, um den Tran zu gewinnen. Dann würden die Knochen gesäubert, das Fleisch eingepökelt und in Fässer gepackt. Und morgen würden sie sich auf die lange Rückfahrt nach Sydney begeben.
Sydney Cove, Juli 1797
George stand an Deck, genoss die warme Sonne und nahm gierig den Anblick und die Geräusche von Sydney Town in sich auf. Eine fleischige Hand legte sich auf seine Schulter. Es war Samuel Varney.
»Spar dein Geld, mein Junge!«, dröhnte er mit dem schleppenden Akzent von Nantucket. »Huren und Rum sollten nur flüchtige Bekannte sein. Trag es auf die Bank, das sag ich dir!«
George hatte diese Lektion in jedem Hafen zu hören bekommen, den sie in den vergangenen drei Jahren angesteuert hatten, und bis auf zwei Vorfälle an Land, als Rum und Wollust ihn übermannt hatten, war er dem Ratschlag gefolgt. »Mein Kontostand sieht ganz gut aus, Käpt’n«, antwortete er grinsend.
Hellblaue Augen blitzten in Samuels zerfurchtem, wettergegerbtem Gesicht auf. Er kratzte sich den dichten weißen Bart. »Das bezweifle ich nicht, mein Sohn«, brummte er. »Hast einen guten Kopf auf den Schultern – dafür, dass du noch so jung bist.«
»So jung nun auch wieder nicht«, protestierte George. »Ich bin dreiundzwanzig.«
»Ha! Da musst du noch eine schöne Strecke zurücklegen, bis du in mein Alter kommst – aber das wird schon, mein Junge. Das wird.«
Samuel hatte Salzwasser in den Adern und wusste mehr über die Seefahrt als so mancher andere. Außerdem war er der Geschäftsmann schlechthin, und seine Flotte aus fünf Walfängern und zwei Robbenfängern trieb Handel von der südlichen Arktis bis zu den Gewürzinseln und quer über den Atlantik. Er hatte George als jungen Matrosen angeheuert und ihn unter seine Fittiche genommen, nachdem George Erfahrungen gesammelt und das raue Nomadenleben auf einem Walfänger lieben gelernt hatte. Sie hatten festgestellt, dass sie die Kenntnis des Meeres, Geschäftstüchtigkeit und die Freude an der Jagd teilten. Und George war in Samuels Obhut aufgeblüht.
Er stand neben seinem Ziehvater, während sie in kameradschaftlichem Schweigen ihre Pfeifen rauchten und beobachteten, wie das restliche Walfleisch und der letzte Tran entladen wurden. Eine Sendung Pökelfleisch stand bereits auf dem Kai, und die Fässer mit kostbarem Reis, Tabak, Tee und Gewürzen, die sie von den Gewürzinseln und aus Batavia mitgebracht hatten, waren bereits unterwegs ins Lager der Regierung. Die Fahrt hatte sich gelohnt, und George wusste bereits, was er mit seinem Anteil an den Einnahmen machen wollte.
Als hätte er die Gedanken des jungen Mannes gelesen, deutete Samuel auf eine große Brache am westlichen Ende des Kais. »Da könnte einer ein schönes Lagerhaus errichten«, polterte er los, »wenn er das nötige Kleingeld und einen Sinn fürs Geschäft hat.«
»Genau das habe ich mir auch gedacht«, sagte George. »Tatsächlich treffe ich mich heute Nachmittag mit jemandem von der Hafenbehörde, um über den Kauf des Grundstücks zu verhandeln.« Er betrachtete den alten Mann, die Mütze mit ihren Salzflecken, den Strickpullover, die grobe Leinenhose und die festen Stiefel. Niemand hätte geahnt, dass Samuel Varney ein sehr reicher Mann war. »Aber es wäre für alle Betroffenen von Vorteil, wenn ein gewisser Walfangkapitän sich einverstanden erklärte, seine Ware dort zu lagern, damit der beste Preis über mein Lager erzielt würde.«
Samuel brüllte vor Lachen. »Er wäre ein Narr, wenn er so eine Gelegenheit ausschlagen würde.« Dann wurde seine Miene ernst. »Aber können wir deinem Verwalter vertrauen? Ein Lager zu führen könnte eine Versuchung bedeuten, wenn der Eigentümer nur selten an Land ist.«
»Matthew Lane hat eine Frau und acht Kinder zu ernähren. Er wäre dumm, wenn er mich betrügen würde.«
Nachdenklich strich Samuel sich über den Bart. »Wenn du das Land bekommst, sind wir im Geschäft«, sagte er schließlich. Er drückte George die große Hand, dass es knackte.
»Dann gehe ich jetzt am besten an Land und bereite mich auf das Gespräch bei der Behörde vor«, meinte George und rümpfte die Nase. »Ich brauche ein Bad, muss mich rasieren und mir die Haare schneiden lassen.«
»Besuchst du danach deine Familie?«, fragte der Ältere.
George nickte. »Es ist eine ziemliche Strecke raus nach Hawks Head Farm, aber meine Mutter würde es mir nie verzeihen, wenn ich den Weg nicht auf mich nähme.«
Samuel zwinkerte mit den Augen. »Hat sie dir verziehen, dass du zur See gegangen bist?«
George vergrub die Hände tief in den Hosentaschen. Sein Weggang hatte seinen Eltern viel Sorge bereitet, doch nachdem er den ersten Walfänger gesehen hatte, war ihm klar gewesen, wo seine Zukunft lag. Trotz der Einwände seiner Mutter war er wild entschlossen gewesen und hatte sie schließlich davon überzeugt, dass es richtig für ihn sei, fortzugehen. »Nicht so ganz«, musste er zugeben. »Aber ich glaube, sie hat erkannt, dass mir nicht bestimmt war, Farmer zu werden, und mein Bruder Ernest kommt ganz gut damit klar, den Betrieb zu führen, solange ich mein Scherflein dazu beitrage.«
Die blauen Augen betrachteten ihn unentwegt. »Du schlägst einen leichten Ton an, mein Junge, aber ich spüre, dass dir die Vorfälle, die deine Familie hinaus an den Hawkesbury River geführt haben, noch immer zu schaffen machen.« Er verstummte, als George den Blick abwandte, und fuhr dann fort: »Ich habe die Gerüchte gehört, mein Sohn.«
George schaute über die Bucht auf das kleine Holzhaus oben auf der Anhöhe. Die Erinnerungen standen ihm noch so deutlich vor Augen, als wäre alles erst gestern passiert. Auch nach vier Jahren waren die Schatten, die sie warfen, noch gegenwärtig. Dennoch hatte Samuel recht: Es war an der Zeit, sich ihnen zu stellen.
»Es war das schlimmste Jahr meines Lebens. Ernest war mit Millicent verlobt«, begann er zögernd. »Sie hatte die Schrecken der Zweiten Flotte überlebt, und Mutter hatte sie aufgenommen, weil sie aus derselben Ecke Cornwalls stammte.« Die Worte kamen ihm leichter von den Lippen, als er beschrieb, wie Millicent nach einer Auseinandersetzung mit seiner Schwester Florence die Flucht ergriffen hatte und dann von Edward Cadwallader und seinen Kumpanen vergewaltigt worden war – und wie sie den Mut aufgebracht hatte, die Männer vor Gericht zu bringen.
»Meine Schwester ist lieber weggelaufen, statt zuzugeben, dass sie bei den Geschehnissen in jener Nacht eine Rolle gespielt hat, aber ich bezweifle, dass ihre Zeugenaussage etwas geändert hätte. Die Gerichtsverhandlung war eine Farce. Sie hat Millicent zerstört und unsere Familie in ihren Grundfesten erschüttert«, sagte er verbittert.
»Edwards Vater, Jonathan Cadwallader, Earl von Kernow, hat dem Gericht erzählt, er habe ein Verhältnis mit meiner Mutter gehabt. Er benutzte einen Brief von ihr, um sie anzuschwärzen. Er beschuldigte sie, sich rächen zu wollen, weil er ihr den Laufpass gegeben hatte. Ihre Freundschaft mit Millicent, die vor vielen Jahren aus seinem Haushalt entlassen worden war, bekräftigte sein Argument nur. Und da die Angeklagten fest bei ihren Falschaussagen blieben, wurde der Fall niedergeschlagen.«
George ballte die Fäuste. »Mein Vater wusste, was zwischen Mutter und dem Earl vorgefallen war – deshalb sind wir nach Australien gegangen –, aber weil es an die Öffentlichkeit gezerrt worden war, sah sich meine arme Mutter gezwungen, mit Ernest und mir darüber zu reden.« Trotz des warmen Tages überlief es ihn kalt. »Der Selbstmord von Millicent und das Verschwinden von Florence haben meine Mutter in Verzweiflung gestürzt, und mein Vater hat deshalb beinahe seinen Glauben an Gott verloren. Ernest war fest entschlossen, Rache zu üben. In seiner Wut hat er sich gegen alle gekehrt, die ihn lieben.«
»Ich kann verstehen, warum deine Familie an den Hawkesbury River gezogen ist.« Samuel betrachtete das kleine Holzhaus auf dem Hügel. »Hier wären ihre Erinnerungen übermächtig gewesen.«
»Es war ihre Rettung. Ernest hat sich in die Farmarbeit gestürzt, und Vater hat seine Energie in die Gründung einer Mission gesteckt.«
»Und was ist mit deiner Mutter Susan?«
George lächelte sanft. »Sie ist die Tochter eines Fischers aus Cornwall und hat einen eisernen Willen. Sie krümmt sich zwar, zerbricht aber nie.«
»Trotzdem muss sie sich um deine Schwester sorgen«, murmelte Samuel. »Habt ihr im Laufe der Jahre etwas von ihr gehört?«
George schüttelte den Kopf. »Florence hatte schon immer ihren eigenen Kopf; wir mussten uns damit abfinden, dass wir erst etwas von ihr hören werden, wenn sie zur Rückkehr bereit ist.« Er atmete tief durch und spürte die Wärme der Sonne wieder. Die Erinnerungen waren vorläufig zerstreut.
»Ich bin sicher, dass dein Besuch deiner Familie Trost spenden und ihre Stimmung heben wird«, sagte Samuel.
»Aus den Briefen meiner Mutter lese ich, dass anscheinend Hoffnung für die Zukunft besteht. Ernest wirbt um die älteste Tochter eines benachbarten Farmers. Sie ist ein paar Jahre älter als er, aber ein nettes Mädchen nach allem, was man hört. Mutter beschreibt sie als pummelig und gemütlich und ebenso geschickt im Haus wie mit dem Vieh.« Er warf Samuel einen kurzen Blick zu. »Hört sich an wie eine Partie, die im Himmel geschlossen wurde, wenn du mich fragst.«
»Ich nehme an, es dauert nicht mehr lange, bis ein verflixtes Weib auch dich in die Krallen bekommt, mein Junge. Nimm mich beim Wort! Frauen sind nichts weiter als ein teures Ärgernis. Und ich muss es wissen – ich habe drei gehabt, und keine war auch nur einen Pfifferling wert, nachdem die Zeit der Werbung vorbei war. Konnten mir nicht mal Kinder schenken.«
George lachte. »Ich habe viel zu viel Spaß, um an Heirat zu denken«, erwiderte er und klopfte den Tabakrest aus seiner Pfeife. »Eine Frau müsste schon ziemlich schnell laufen, um mich einzufangen – und was Kinder betrifft …« Er schüttelte sich. »Der Himmel möge mich bewahren!«
»Letzten Endes werden wir alle eingefangen, mein Sohn«, entgegnete Samuel. »Früher oder später fallen wir auf ein hübsches Gesicht und schlanke Fesseln rein und unser Verstand lässt uns im Stich.«
»Ich nicht«, sagte George gutgelaunt. Er klopfte Samuel auf den Rücken, steckte die Hände in die Taschen, pfiff ein Seemannslied vor sich hin und schlenderte die Gangway hinunter an den Kai. Das Leben war perfekt, so wie es war. Eine Frau, die es stören würde, hätte ihm gerade noch gefehlt.
Sydney Town, August 1797
Eloise kämpfte gegen die Übelkeit an, die sie im sieben Monat ihrer ersten Schwangerschaft immer noch quälte, und vermied einen Blick in den Spiegel ihrer Frisierkommode. Sie wusste, dass sie blass und abgespannt war und ihre grünen Augen an Glanz verloren hatten. »So viel zum Aufblühen«, sagte sie mit leichtem Akzent, der ihre deutsche Herkunft ahnen ließ. »Ich sehe halb tot aus und fühle mich auch so.«
Edward Cadwalladers Lippen berührten flüchtig ihren Nacken. »Es dauert ja nicht mehr lange«, antwortete er, prüfte seine Erscheinung im Spiegel und putzte seinen Schnurrbart. »Unser Sohn macht sich nur bemerkbar.«
Er trat an den Kamin. »Wir wissen noch nicht, ob es ein Sohn ist«, erinnerte Eloise ihn.
»Alle Cadwalladers haben Söhne«, entgegnete er unwirsch. »Im Übrigen beeil dich, Eloise, der Gouverneur wartet nicht gern! Du bist immer noch im Nachthemd.«
»Geh ohne mich!«, bat sie. »Mir geht es nicht gut, und mein Zustand wird meine Abwesenheit erklären.«
»Selbstmitleid ist kaum eine Entschuldigung«, fuhr er sie an. »Zieh dich an!«
Eloise stellte sich ihm entgegen. »Ich habe keine Lust, am Fest des Gouverneurs teilzunehmen«, sagte sie. »Du wirst viel mehr Spaß daran haben, wenn ich hierbleibe.«
»Du bist meine Frau und wirst tun, was ich dir sage!«, schrie er.
Eloise ließ sich nicht einschüchtern. Ihr Vater, Baron Oskar von Eisner, hatte sie und ihre Schwestern angeschrien, seit sie denken konnte, und sie war solche Schikanen gewohnt, doch er hatte seinen Willen nie so unfreundlich durchgesetzt wie Edward.
»Ich trage dein Kind unter dem Herzen«, entgegnete sie ruhig. »Die Schwangerschaft war nicht leicht, und mir geht es nicht gut. Der Gouverneur wird den Grund für meine Abwesenheit verstehen.«
Er funkelte sie wütend an. »Mit dem Baron kannst du vielleicht in diesem Ton reden«, sagte er, »aber du wirst schon merken, dass ich Ungehorsam nicht dulden kann.«
Eloise blieb nach außen hin ruhig, doch das Herz schlug ihr bis zum Hals. Sein Verhalten zeigte ihr, dass er tatsächlich ein ganz anderer Mann war als ihr Vater. »Es ist kein Ungehorsam, Edward«, sagte sie in einem Ton, mit dem sie ihn zu besänftigen hoffte. »Nur gesunder Menschenverstand. Sollte ich ohnmächtig werden oder mich übergeben, wird es eine Szene geben, und ich bin sicher, dass du darauf verzichten kannst.«
Edward musterte sie. »Ich hätte wissen sollen, dass eine deutsche Frau für alles ein Argument hat.« Er schritt durch den Raum und öffnete die Tür. »Wir sprechen noch darüber, wenn ich zurückkomme. Ich erwarte von dir, dass du angezogen bist und im Wohnzimmer auf mich wartest, auch wenn es noch so spät wird.«
Er schlug die Tür zu, und Eloise fuhr zusammen.
Dann packte sie die Wut. Sie nahm ihre Haarbürste und warf sie mit voller Wucht gegen die Wand. Die Bürste schlug auf dem Boden auf, und Eloise sank auf ihren Frisierhocker. Langsam, aber sicher zermürbte Edward sie, und sie hatte Angst vor seiner Rückkehr, denn sie wusste, dann stand ein Wortgefecht bevor und ihr Kampfgeist ließ rasch nach.
Sie blieb in der Stille sitzen und lauschte den knackenden Geräuschen im Gebälk des Hauses, das sie am Stadtrand gemietet hatten. Es war klein und zugig, die Räume vollgestopft mit Säcken, Truhen und Kisten, die auf den Tag warteten, an dem ihr Haus in der Watsons Bay fertiggestellt war. Sie hätten ein paar Zimmer über dem Hotel ihres Vaters am Kai bewohnen können, doch Edward hatte das Angebot abgelehnt, und sie waren nach ihrer Hochzeit hier eingezogen.
Sie hatte das Gefühl, als rückten die Wände näher, je länger sich die Stille hinzog. Als das Kind sich regte, legte sie die Hände auf den Bauch und unterdrückte die Tränen, die ihr den letzten Rest Selbstvertrauen rauben würden. Sie sehnte sich nach der Gesellschaft ihrer Schwestern, nach ihrem gutherzigen Vater und nach dem Trost einer vertrauten Umgebung – nach mehr als der herablassenden Art ihres Mannes, der es an Mitgefühl fehlen ließ.
Ein Holzscheit rutschte auf dem Rost im Kamin, und Funken stoben in den Schornstein hinauf. Eloise sah in das schwelende Feuer und machte sich ihre Lage bewusst. Der Titel ihres Vaters bedeutete hier nur wenig; dass er am Anleger ein erfolgreiches Hotel gebaut hatte, machte ihn in dem rigiden Klassendenken dieses britischen Außenpostens, in dem Geschäftsleute schief angesehen wurden, nur noch mehr zum Außenseiter. Ihre Heirat mit dem Erben des Earl von Kernow hatte ihr in der Gesellschaft von Sydney zwar zu einem gewissen Ansehen verholfen, dennoch wusste sie, dass man sie in manchen Kreisen noch misstrauisch beäugte, obwohl sie in München eine gute Schulbildung genossen und ihr Englisch nur einen leichten Akzent hatte. Eloise hatte sich gegen die versteckten Kränkungen und das hinterhältige Grinsen wappnen müssen; inzwischen war sie darin geübt, den kleinlichen Snobismus einiger Frauen zu ignorieren – ihrem Mann aber hatte sie nur wenig entgegenzusetzen.
Sie waren noch kein Jahr verheiratet, doch Edwards ständige Spitzen und sein diktatorisches Gehabe hatten bereits ihren Tribut gefordert. Trotzdem klammerte Eloise sich an die Hoffnung, dass sie sich nichts vorzuwerfen hatte. Schon in den ersten Wochen nach der Hochzeit war Edwards wahrer Charakter zutage getreten; er hatte nur noch wenig mit dem Mann gemein, der ihr den Hof gemacht hatte. Er war häufig abwesend, hatte etwas gegen die Besuche ihrer Familie, verlangte von ihr ein perfektes Auftreten und war zunehmend launisch und streitsüchtig.
Sie zog den Seidenschal fester um ihr Nachthemd, während sie sich an die euphorische Zeit seiner Brautwerbung erinnerte und sie mit einer Klarheit betrachtete, die man nur rückblickend gewinnen kann. Ihre Naivität war ihr Ruin gewesen, denn solche Versiertheit, wie Edward sie an den Tag legte, hatte sie bis dahin noch nie erlebt. Sie hatte sich nur allzu leicht von seinen tadellosen Manieren und seinem gewinnenden Wesen blenden lassen, ohne den Mann hinter der prächtigen Uniform und dem englischen Titel zu sehen, den er erben würde.
Mit leerem Blick starrte sie in die Flammen. Sie hätte ihren Instinkten folgen und sich seinem Werben entziehen sollen, nachdem er sie zum ersten Mal angesprochen hatte – damals hatte sie hinter seinem blendenden Lächeln sofort etwas Dunkles gespürt. Doch gerade das hatte seiner Werbung die Würze verliehen, und sie war seinem Charme bereitwillig erlegen. Sie hatte geglaubt, sich verliebt zu haben. Doch Liebe war etwas, was sie von ihren Eltern kannte – sie wurde inniger, brachte Trost, Sicherheit und Freundschaft, ein Gefühl des Wohlergehens, das zwei Menschen verband und sie vor der Welt schützte.
Eloise musste sich wohl oder übel eingestehen, dass das, was sie in der euphorischen Zeit ihrer stürmischen Romanze erlebt hatte, nichts als Schwärmerei gewesen war. Sie hatte in einer Phantasiewelt gelebt und geglaubt, sie habe ihren Prinzen gefunden, mit dem sie bis ans Lebensende glücklich sein würde. Einige Wochen lang hatte es auch so ausgesehen, als könnten sich ihre Träume erfüllen, denn sie hatte im ersten Monat sein Kind empfangen.
Schwer seufzend nahm sie das schmerzliche Gefühl zur Kenntnis, versagt zu haben. Edwards Wärme und Aufmerksamkeit waren abgekühlt, seit sie durch ihre Schwangerschaft an Umfang zugenommen hatte und kraftlos geworden war. Nun bereitete sein Alkoholgenuss ihr Sorgen, und seine Laune war so unberechenbar, dass sie über seine längere Abwesenheit nur erleichtert war. Es war deutlich geworden, dass er sie nicht mehr liebte – und sie fragte sich, ob auch er die Heirat bereute.
Sie erhob sich und begann sich anzuziehen. Sie musste lernen, ebenso mit Edwards Krittelei zu leben wie mit der Tatsache, dass ihr Wohlbefinden ihm gleichgültig war. Die Würfel waren gefallen: Sie war bis an das Ende ihrer Tage an ihn gebunden, und sie konnte nur hoffen, dass sich seine Laune bessern würde, sobald das Kind geboren war. Nervös fummelte sie an den Bändern ihres Unterkleids herum und versuchte, den Gedanken zu verscheuchen, was geschehen würde, wenn es ein Mädchen würde.
Edward merkte, dass er zu spät zum Fest des Gouverneurs kam, doch es handelte sich um eine zwanglose Zusammenkunft, so dass keine Eile geboten war. Seine schlechte Laune und seine Wut hatte die Hure in dem Zimmer über der Wirtschaft besänftigt. Seit Wochen war Eloise keine richtige Ehefrau gewesen – was konnte sie anderes von ihm erwarten?
Während sein Pferd die unbefestigte Straße entlangtrabte, atmete er die Düfte der Nacht ein, die so anders waren als die im Norden, und zog Bilanz über alles, was er seit seiner Rückkehr nach Sydney erreicht hatte. Seine Versetzung war früher aufgehoben worden, als er erwartet hatte. Im November 1796 war er mit seinen Männern im Hafen eingelaufen. Das Schiff, das sie nach Süden gebracht hatte, war genauso heruntergekommen und verwahrlost gewesen wie die Männer, die ihre Pferde ausluden und über die Geschäfte herfielen. Während seiner Abwesenheit hatte sich viel verändert. Mit dem Recht, nun über Schatzwechsel zu verfügen statt über Schuldscheine, die man nur in den regierungseigenen Lagern gegen Waren eintauschen konnte, hatten er und seine Offizierskollegen ihren Wohlstand ausgebaut.
Er hatte seinen Grundbesitz ausgeweitet, indem er freigelassenen Sträflingen, die wenig Begeisterung für die Landwirtschaft zeigten, die Landrechte abgekauft hatte. Der Handel mit den Kapitänen zur See lief auf Hochtouren; ihre Waren ließen sich mit großem Gewinn an die Kolonisten verkaufen. Die Vorschriften für den Arbeitseinsatz von Strafgefangenen waren gelockert, und nun verfügten er und die anderen Offiziere nicht nur über das Monopol im Großhandel und über herrschende Stellungen innerhalb der Kolonie, sondern auch über eine Menge Diener, die sie nichts kosteten, da diese von der Regierung ernährt und eingekleidet wurden.
Edward war hochzufrieden. Die Zeit in der Wildnis lag hinter ihm, und sein Vermögen wuchs von Tag zu Tag. Das Haus in der Watsons Bay war fast fertiggestellt, und er stand kurz davor, Vater zu werden. Er war angekommen. Nichts und niemand würde ihm im Weg stehen – am wenigsten sein Vater. Eines Tages würde der die Rolle bereuen, die er bei der Versetzung seines Sohnes aus Sydney an den Brisbane River gespielt hatte, nachdem dieses verfluchte Weib seine Kameraden und ihn vor Gericht gebracht hatte. Edwards Laune verschlechterte sich wieder. Sein Vater hatte ihn aus einer misslichen Lage befreien müssen, und diese Demütigung machte ihn noch immer rasend.
Als in der Ferne die Lichter des Government House aufblinkten, lenkte Edward die Gedanken zu Eloise zurück. Er war damals erst wenige Tage wieder in Sydney gewesen, als er die Einladung zum Dinner im Hotel des Deutschen erhielt. Sie war überraschend gekommen, denn er war dem sogenannten Baron erst einmal begegnet, als er in dessen Hotel einen Drink zu sich nahm. Der Mann war ihm gesellschaftlich kaum gleichgestellt, doch Edward hatte an jenem Abend nichts anderes vorgehabt und deshalb die Einladung angenommen. Der langweilige Abend hatte sich in dem Augenblick gewandelt, als er der ältesten Tochter des Barons vorgestellt wurde.
Eloise hatte ein feines Gesicht mit glasklaren grünen Augen, umrahmt von goldblonden Wimpern, und einen hellen Lockenkopf. Sie war schlank und so groß, dass sie ihm fast bis an die Schulter reichte, und trug ein eisblaues Kleid. Ihr Dekolleté war makellos wie Alabaster. An Hals und Ohren glitzerten Diamanten, und eine weiße Rose zierte ihr Haar. Der Eindruck, den sie auf ihn machte, war wie ein Schlag in die Magengrube gewesen, und Edward war das Sprechen schwergefallen. Sie hatten die üblichen Nettigkeiten ausgetauscht, und sie war mit raschelndem Rock weitergegangen. Sie hielt sich kerzengerade, und ihr prächtiges Haar fiel in goldenen Locken über ihre Schultern. Noch nie hatte er eine Frau so begehrt. Er musste sie haben.
Unaufhörlich hatte er sie verfolgt, seinen ganzen Charme ausgespielt und seine Ungeduld gezügelt, da sie ihm selbst den keuschesten Kuss verweigert hatte. Dennoch hatte die Werbung ihn beschwingt, denn Eloise war Feuer und Eis, und die Herausforderung, die sie darstellte, war unwiderstehlich.
Bald darauf war Eloises Widerstand in sich zusammengefallen, und Ende Januar hatten sie geheiratet, nur zwei Monate nach ihrer ersten Begegnung. Er hatte recht gehabt mit dem Feuer: Ihre Vereinigung war beglückend gewesen, und er hatte sie mehr denn je begehrt, als sie ihm kurz darauf sagte, sie erwarte ein Kind von ihm.
Edward nahm die Zügel fester in die Hand. Die Liebe hatte bei seiner Werbung um Eloise keine Rolle gespielt. Der Wunsch, ihre Schönheit zu besitzen, hatte ihn zu der Heirat angespornt, doch inzwischen war sein Verlangen einer großen Belastung ausgesetzt. Eine endlose Übelkeit hatte Eloise ans Bett gefesselt, und wenn sie aufstand, lief sie stets im Nachthemd herum. Der Gestank nach Erbrochenem und der Anblick ihres aufgeblähten Leibs widerten ihn an, und er war verärgert, weil sie ihn nicht zu gesellschaftlichen Anlässen begleiten wollte. Er hätte sich zu gern mit seiner schönen, schlanken Eloise auf Festen und Tanzveranstaltungen gezeigt, um sich in dem Neid zu sonnen, den er in den Augen anderer Männer sah. Er trieb das Pferd zum Galopp an, wild entschlossen, weder über die Unzulänglichkeiten seiner Frau noch über seine mangelnde Geduld mit ihr nachzudenken. Wenn eine Ehe zum Stillstand gekommen war, musste ein Mann sich woanders trösten. Eloise sollte sich glücklich schätzen, wenn er seine ehelichen Rechte nicht einforderte.
Kap der Guten Hoffnung, September 1797
Die Empress schlingerte und stampfte durch die schwere See. Der Sturm hatte zugeschlagen, nachdem sie Südafrika verlassen hatte, und nur wenigen Passagieren ging es noch so gut, dass sie ihre Kabinen verlassen konnten.
Alice Hobden wurde in der winzigen Kabine hin und her geschleudert und konnte sich kaum auf den Beinen halten. Zwei Jahre Kampf gegen die Malaria in der Hitze und dem Staub von Kapstadt hatten ihren Tribut gefordert, und sie fragte sich, ob es ein Fehler gewesen war, dass sie hartnäckig behauptet hatte, sie sei reisetüchtig. Doch der Gedanke, dass Jack in New South Wales auf sie wartete, hatte sie in ihrem entschiedenen Wunsch, bei ihm zu sein, nur bestärkt. Es hatte fast ein weiteres Jahr gedauert, bis sie die Überfahrt auf einem Schiff buchen konnte, das so weit nach Osten fuhr, und jetzt, da sie unterwegs zu ihm war, würde sie den Teufel tun und sich dem Selbstmitleid und der Übelkeit hingeben.
Sie warf einen Blick auf ihre Kabinengenossin, eine Frau mittleren Alters mit einem Hang zum Jammern und einer nervenden Stimme. Morag fuhr nach New South Wales zu ihrem Mann, der beim Militär war. Sie schlief, und Alice seufzte erleichtert, während sie sich ihr dichtes helles Haar aufsteckte. Sie hatte fast den ganzen Tag damit verbracht, Morag zu pflegen, und nichts als Klagen für ihre Bemühungen geerntet.
Schaudernd versuchte Alice, das Gleichgewicht zu halten. Die Nacht war eisig kalt, und sie täte alles lieber als hinauszugehen, doch wenn sie diese zweite Herde Merinoschafe sicher zu Jack bringen wollte, blieb ihr nichts anderes übrig. Sie prüfte ihren Geldgürtel, den sie auch in den schlimmsten Fieberanfällen nicht abgelegt hatte. Er war unter ihren Kleidern verborgen, und obwohl er viel leichter war als zu Beginn ihrer Reise in Sussex, klirrte er noch immer beruhigend an ihrer Hüfte, wenn sie ihr Kleid und die Unterröcke ordnete. Sie zog ihren Reisemantel über und straffte sich. Ihre heikle Situation mochte zwar unangenehm und beängstigend sein, doch wenn Jack es geschafft hatte, den Transport auf einem Sträflingsschiff zu überleben, ohne den Glauben an die Zukunft zu verlieren, hatte sie nicht das Recht, sich über die raue See zu beklagen.
Ohne Vorwarnung bäumte sich das Schiff auf und tauchte so abrupt ab, dass ein Zittern durch das Spantenwerk lief. Alice wurde auf die schmale Koje geworfen. Ihr Kopf prallte gegen einen Holzbalken, und sie sackte wie betäubt in die Kissen. Ihr war, als hätte dieser Schlag ihr sämtliche Energie genommen, denn plötzlich war sie zu erschöpft, um sich in Bewegung zu setzen. Da ihr Magen rebellierte und ihr Kopf pochte, schloss sie die Augen und lenkte die Gedanken auf erfreulichere Dinge.
Sussex war in weite Ferne gerückt, doch sie kam nicht gegen ihre Sehnsucht an. Fast vierzehn Jahre lang war der Bauernhof ihr Zuhause gewesen, und am letzten Tag hatte sie sich dort jede Einzelheit eingeprägt, wohl wissend, dass sie den Hof nie wiedersehen würde, doch in der Hoffnung, die Erinnerung im Herzen zu bewahren. Dann könnte sie sich später, wenn sie einsam und verängstigt war wie in diesem Augenblick, mit dem Gedanken an das alte Bauernhaus trösten, dessen Strohdach tief über die winzigen Fenster reichte.
Lächelnd erinnerte Alice sich an die getünchten Lehmwände, an den Steinboden, der in zweihundert Jahren von trampelnden Füßen ausgetreten war. Ihre Schritte hallten auf den Bodenplatten wider, und der Geruch des Holzfeuers hing in der kalten Asche des großen Kamins und in den Deckenbalken aus Eiche. Die Wände waren oberhalb der Kerzenhalter mit Rußspuren verschmiert, und an den eisernen Haltern hingen Eiszapfen aus Wachs – eine Mahnung an dunkle Winternächte, in denen der Wind draußen heulte und die frühen Lämmer hereingetragen wurden, um sie am Feuer aufzuwärmen.
Alice klammerte sich an die Wände der Koje und stieg in Gedanken die schmalen, wackeligen Stufen zum Schlafzimmer unter dem Dach hinauf. Der Boden fiel schräg zur vorderen Wand und zum kleinen Fenster mit dem Eisenriegel ab. Sie hatte beinahe das Gefühl, als wäre ein Teil von ihr in Sussex geblieben, denn während sie hin und her geworfen wurde, sah sie die Hügel von Sussex, die sich hinter gepflügten Feldern und üppigen Weiden erhoben. Schafe grasten unter einem bedrohlichen Himmel, doch zwischen den Wolken warfen die Sonnenstrahlen einen goldenen Schimmer auf die Hecken.
Nun merkte Alice kaum noch etwas vom Rollen und Stampfen des Schiffes, denn sie hatte sich dem Anblick der Felder hingegeben, sah den mäandernden Fluss vor sich, der unter der Steinbrücke in seinem kalkigen Bett gurgelte, bis er am Weiler Alfriston vorbei ins Meer schoss. Sie sah den uralten Kirchturm und die anderen Strohdächer, die sich am Ufer drängten, und hörte, wie die Glocken die Gemeinde zum Abendgebet riefen.
Bei der Erinnerung an jene letzten Augenblicke wurden ihre Wimpern feucht von Tränen. Sie hatte das Haus verlassen, denn sie wollte nicht dort sein, wenn der neue Besitzer eintraf, und war hinaus in den Hof gelaufen. Das Pferd hatte geduldig am Zaun gestanden, das Maul tief ins üppige Gras getaucht, der Schweif schlug nach den lästigen Fliegen, die stets mit dem Sommerregen kamen. Sein braunes Fell war struppig, die Beine kurz, der Rücken breit – und obwohl das Tier launisch war, liebte Alice es.
»Genug gefressen, Bertie«, hatte sie gesagt und ihm das Zaumzeug angelegt, die Zügel entwirrt und eine Decke über seinen Rücken gebreitet. »Wenn du nicht aufpasst, wirst du zu dick zum Laufen, und wir haben noch ein ganzes Stück vor uns.«
Bertie hatte ihr die gelben Zähne gezeigt, und sie hatte ihm liebevoll den Hals getätschelt und ihn dann an den Baumstumpf geführt, damit sie aufsteigen konnte. Alles, was einen Wert besaß, war verkauft worden, ihr Sattel eingeschlossen. Doch Alice war geritten, seitdem sie aufrecht sitzen konnte, so dass die Decke auf dem Pferderücken ausreichen würde.
Wieder rollte eine Träne über ihr Gesicht, als sie sich vergegenwärtigte, wie sie sich heruntergebeugt hatte, um das Gatter zu öffnen. Es schwang weit auf, als sie ihre Fersen in Berties Flanken grub und ihn aus dem Hof trieb. Sie hatte nach vorn geschaut – denn ihre Zukunft lag nun weit hinter dem Horizont.
Alice wischte sich die Tränen ab und putzte sich die Nase. Der arme Bertie war mit den anderen Pferden an Bord eingepfercht und wunderte sich wohl, was da vor sich ging. Unbeholfen erhob sie sich aus der Koje, richtete ihre Kleidung, atmete einmal tief durch, um die Mischung aus Anspannung und Angst zu unterdrücken, die sie häufig überfiel, und taumelte zur Tür.
Sie hatte sich auf ein waghalsiges Abenteuer eingelassen und konnte kaum glauben, dass es wirklich eingetroffen war. Doch da war sie, eine Fünfunddreißigjährige auf ihrem Weg zu einem neuen Leben in einer neuen Welt. Sobald sie die Tür aufstieß und Regen und Gischt ihr ins Gesicht peitschten, wurde sie an die Realität erinnert.
Der Ozean wogte, und die Deckplanken, die unter ihren Füßen bockten, wurden überschwemmt. Sie musste sich an alles klammern, was sie fand, um nicht über Bord gespült zu werden. Ihr Mantel war bald durchnässt und zog sie nach unten; ihre Röcke und Unterröcke flatterten wie verrückt, um ihr dann durchweicht an den Beinen zu kleben.
Langsam und unsicher arbeitete sie sich voran, bis sie an den kleinsten Pferdeverschlag kam, der von einem jungen Matrosen bewacht wurde. Er hatte den Befehl, jedes Pferd zu erschießen, das durchzugehen drohte. Die acht Tiere standen breitbeinig mit hängenden Köpfen da. Ihr Fell war dunkel vor Nässe. Sie tätschelte Bertie, der sie missmutig beäugte, und gab ihm eine Handvoll Hafer, womit er sich begnügen musste. Er war alt und zäh – er würde es überleben.
Haarnadeln lösten sich, und als Alice sich in den Wind drehte, peitschten ihr Strähnen ins Gesicht. Es war, als wollte man sich gegen einen Rammbock stemmen, und sie fragte sich gerade, ob sie die Schafspferche wohl jemals erreichen würde, als eine Stimme sie zusammenfahren ließ.
»Sie sollten bei diesem Wetter nicht hier draußen sein.«
Alice blinzelte im Regen. »Ich muss mich um die Schafe kümmern«, schrie sie zurück.
Der Mann vor ihr verzog das Gesicht, nahm sie beim Arm, und sie taumelten zusammen über das Deck, bis sie im Windschatten des Eingangs zur Kapitänskajüte Schutz fanden.
»Vielen Dank!«, keuchte sie und strich sich die nassen Haare aus dem Gesicht.
»War mir ein Vergnügen«, erwiderte er mit beinahe spöttischer Verbeugung. Er musterte sie von Kopf bis Fuß. »Henry Carlton, zu Ihren Diensten, Madam.«
Bei einem Blick in sein wohlgeformtes Gesicht flammte Interesse in ihr auf. »Alice Hobden«, stellte sie sich vor.
»Ich bin entzückt, Ihre Bekanntschaft zu machen. Wo sind denn die verdammten Schafe?«
»Unter Deck. Da unten ist es wärmer – und trockener«, fügte sie kleinlaut hinzu und zupfte an ihrer durchnässten Kleidung.
»Die Tiere müssen Ihnen viel bedeuten, wenn Sie Ihr Leben dafür aufs Spiel setzen«, brüllte er. Im selben Moment wurden sie gegeneinander geworfen.
Alice’ Gesicht wurde vor Verlegenheit hochrot, und sie versuchte sich zu fassen. »Stimmt«, erwiderte sie außer Atem. »Sie sind mein Vermögen.«
Er hielt sie im Gleichgewicht, und seine grauen Augen zwinkerten belustigt. »Sind Sie sicher, dass Sie da hinuntergehen müssen?«
»Offensichtlich sind Sie nie ein Farmer gewesen«, entgegnete sie mit einem Blick auf seine kostspielige Kleidung und die juwelenbesetzte Krawattennadel. Ihr fiel ein, dass er in Kapstadt mit einigen Dienern im Schlepptau an Bord gekommen war.
»Aber ich bin ein Gentleman«, erwiderte er. »Bitte, lassen Sie sich von mir helfen.«
»Von hier aus komme ich klar«, sagte sie ihm. »Trotzdem vielen Dank.«
Er zog sich den Mantelkragen bis ans Kinn und trat wieder in den Sturm.
Kichernd schaute Alice ihm hinterher. Es bestand kaum ein Zweifel, dass sie ihm gefallen hatte – und sie fühlte sich geschmeichelt, denn sein Aussehen und Auftreten waren durchaus reizvoll. Dann schalt sie sich im Stillen, sich wie ein dummes Gör zu benehmen, und stieg die gefährlich steile Treppe hinunter zu den Mannschaftsunterkünften.
Der Gestank nach Erbrochenem und eingepferchten Tieren sowie Küchendunst schlugen ihr entgegen, und sie hielt sich die Nase zu. Sie wankte an schaukelnden Hängematten vorbei zu den Pferchen. Hier unten war es finster, nur ein paar Laternen und die Feuer in den beiden Backsteinöfen spendeten ein wenig Licht. Wenigstens war es warm, und da die Seeleute sich an ihre Anwesenheit gewöhnt hatten, schenkten sie ihr nur wenig Beachtung.
Die Männer, die keinen Dienst hatten, schliefen entweder oder spielten Karten und tranken. Der Koch schob gefüllte Pfannen in die Öfen, zog andere wieder heraus und rief seinem Gehilfen Befehle zu. Die jungen Offiziere lärmten bei einem Würfelspiel. Die meisten scheinen der Kinderstube noch nicht entwachsen zu sein, dachte Alice, während sie achtgab, wo sie hintrat, und einen dubiosen Fleck auf dem Boden umrundete. Doch dass ihr das auffiel, bewies vermutlich nur, dass sie selbst älter wurde.
Die beiden Widder waren in getrennten Pferchen untergebracht, denn sie wollte nicht, dass sie miteinander kämpften, und die acht Mutterschafe standen auf der anderen Seite, in eine Ecke neben die Schlafquartiere der Offiziere gezwängt. Die anfängliche Nervosität der Tiere hatte sich allmählich gelegt; sie hatten die wolligen Köpfe blökend durch das Gitter gesteckt und schwankten im Rhythmus des Schiffes.