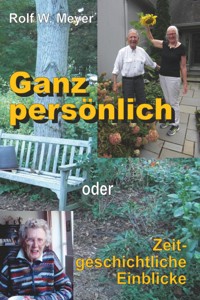
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Wir alle wollen wissen, wer wir sind und woher wir kommen. Es ist verständlicherweise die Suche nach dem eigenen Ich. Für jeden von uns ist die Geschichte der eigenen Vorfahren auch ein Teil seiner eigenen Geschichte. Verfolgt man die Spuren verwandtschaftlicher Vorfahren und dokumentiert ihre jeweiligen Lebensumstände, dann bleibt dadurch auch ein Stück Zeitgeschichte erhalten. Urteile über ein ganzes Leben eines Vorfahren können verständlicherweise nur von einem Menschen in fortgeschrittenem Alter gegeben werden, wenn er die Vergangenheit selbst erst als Geschichte begreift und die betreffende Person mit den damaligen Zeitumständen in Verbindung bringt. Bekanntlich bewundern wir in der Rückschau auf große Zeiträume in vielen Fällen die Leistungen unserer Vorfahren. Wie dieses Buch belegt, waren es in der Tat bemerkenswerte Erfolgsgeschichten. Dabei sollten wir allerdings in der Jetztzeit nie vergessen, dass wir es selbst sind, die die Zukunft zu meistern haben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 531
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rolf W. Meyer
Ganz persönlich
oderZeitgeschichtliche Einblicke
Rolf W. Meyer
Ganz persönlich
Copyright: © 2023 Rolf W. Meyer
Umschlag & Satz: Erik Kinting – www.buchlektorat.net
published by: epubli GmbH, Berlinwww.epubli.de
Zur Erinnerung an Eva Mathilde Traulsen geb. Baumann (1914–2008) und Dr. Samuel J. Brendler (1922–2016), die sich als herausragende Persönlichkeiten für ihre Familien und Verwandten erwiesen hatten.
Sowie zur Erinnerung an all die Verwandten, die selbstlos, auch in schwierigen Zeiten, als „Helfer am Nest“ zur Verfügung standen.
Ein Blick zurück in großer Dankbarkeit.
„Alles fließt, nichts bleibt.“ („Panta rhei, ouden menei.“)
Heraklit (520 v. Chr. – 480 v. Chr.)
„Der Charakter des Menschen ist sein Schicksal.“
Heraklit
„Es ist für die Menschen nicht gut, dass ihnen alles zuteil wird, was sie wollen.“
Heraklit
„Es ist keine Schande, nichts zu wissen, wohl aber nichts lernen zu wollen.“
Platon (427 v. Chr. – 347 v. Chr.)
„Im Leben fängt man dann und wann auch wieder mal von vorne an.“
Quelle unbelegt
Prolog
Der US-amerikanische Schriftsteller Alexander Murray Palmer Haley (1921–1992) ging von der Gewissheit aus: „Wir alle wollen wissen, wer wir sind und woher wir kommen. Ganz gleich, was wir im Leben erreichen, ohne diese Klarheit bleibt eine Leere in uns, ein Gefühl der Wurzellosigkeit.“
Die Fragen „Woher kommen wir?“ und „Wer sind wir?“ hat die Menschen in ihrer Kulturgeschichte schon immer beschäftigt. Es ist letztendlich die Suche nach dem eigenen Ich. Für jeden von uns ist die Geschichte seiner Vorfahren auch ein Teil seiner eigenen Geschichte.
Der Kulturhistoriker und Schriftsteller Gustav Freytag (1816–1895) hat einmal geschrieben: „Vielleicht wirken die Taten und Leiden der Vorfahren noch in ganz anderer Weise auf unsere Gedanken und Werke ein, als wir Lebenden begreifen. Aber es ist eine weise Fügung der Weltordnung, dass wir nicht wissen, wieweit wir selbst das Leben vergangener Menschen fortsetzen, und dass wir nur zuweilen erstaunt merken, dass wir in unseren Kindern weiterleben.“
Die Erfahrung lehrt uns, dass, wenn man älter wird, die Erinnerung an die Vergangenheit in den eigenen Gedanken einen immer größeren Raum einnimmt. Der alternde Mensch, dessen Erwartungen von der Zukunft geringer werden, kehrt gleichsam den Blick öfter als zuvor rückwärts. In der größeren Besinnlichkeit, mit der er das Leben betrachtet, werden Bilder vergangener Jahrzehnte, Bilder seiner Mitmenschen, die ihn begleitet haben, und Bilder seiner Erlebnisse aus weit zurückliegenden Zeiträumen deutlicher. So träumt der alternde Mensch von seiner Kindheit und sieht sich in Räumen und an Orten, die aus seiner Gegenwart seit langem entschwunden sind.
Diese Erkenntnis war für mich als alternder Mensch ein Impuls dafür, ein Buch über die Lebens- und Erfahrungswelt eigener Vorfahren zu schreiben. Bezugsquellen zu diesem Thema standen aus privaten Familienarchiven aus der eigenen häuslichen Familientruhe in Ratingen-Lintorf und aus dem Familienarchiv meiner Großcousine Heinke Brendler geb. Traulsen in Suffield, CT, USA zur Verfügung. Im Laufe vieler Jahrzehnte waren in diesen Archiven Dokumente aus verschiedenen verwandtschaftlichen Nachlässen eingelagert worden.
Bei deren Durchsicht fanden sich somit eine Vielzahl alter Briefe und andere Hinterlassenschaften, wie zum Beispiel Gästebücher, aus mehreren Generationen. Für die Hinterbliebenen ist die Entscheidung über die Vernichtung solcher Nachlässe oder deren Aufbewahrung als Familiendokumente nicht immer einfach. So kann etwa die Scheu vor der Erinnerung an einen Menschen, der einem nahe stand, zu dem Entschluss führen, Briefe zu vernichten.
Die Erfahrung zeigt, dass es für jemanden, der nach Jahrzehnten Mitteilungen von Vorfahren liest, schwer ist, alte Briefe richtig zu verstehen. Dazu müssen nämlich historische Umstände und verwandtschaftliche Verhältnisse berücksichtigt werden. Sofern es sich in Briefen um rein persönliche Belange handelt, sollten diese Dokumente mit besonderem Verständnis und Einfühlungsvermögen gelesen werden. Anderenfalls können leicht oberflächliche Urteile entstehen. Auch sollten längst vergangene personenbezogene Geschehnisse mit Abstand betrachtet werden und einer anderen Generation keinen Anlass zu falschen Beurteilungen geben.
Urteile über ein ganzes Leben eines Vorfahren können verständlicherweise nur von einem Menschen in fortgeschrittenem Alter gegeben werden, wenn er die Vergangenheit selbst erst als Geschichte begreift und die betreffende Person mit den damaligen Zeitumständen in Verbindung bringt.
Übrigens: In der Rückschau auf große Zeiträume bewundern wir bekanntlich in vielen Fällen die Leistungen unserer Vorfahren. Dabei vergessen wir jedoch so oft, dass wir es selbst sind, die die Zukunft zu meistern haben.
Vergleiche ich nun persönlich beispielsweise die Erlebniswelt, in der meine Großeltern väterlicherseits zu Beginn des 20. Jahrhunderts im Vogtland gelebt haben, mit der Erlebniswelt meiner Eltern in Nordrhein-Westfalen der 1960er Jahre, so hatte sich bereits in dieser Zeitspanne eine gewaltige kultur-technische Entwicklung vollzogen. Die Enkel- und Urenkelgenerationen meiner Großeltern sind im 21. Jahrhundert Zeitzeugen einer kultur-technischen Entwicklung, die im wahrsten Sinne des Wortes eine Revolution im Zeitraffer darstellt.
Die Auswirkungen dieser Revolution haben nicht nur weit reichende gesellschaftspolitische und kulturelle Veränderungen innerhalb der Nationalstaaten hervorgerufen, sondern sie bewirken auch, dass die Menschen der Weltgemeinschaft durch die rasante Entwicklung der Informationstechnologie immer stärker „zusammenrücken“. Wir leben heute in einer „horizontal strukturierten, flachen Welt“ (Thomas L. Friedmana [1]).
Allerdings: Nach dem militärischen Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar 2022 sind wir, wie es die gegenwärtige deutsche Außenministerin Annalena Baerbock (Jahrgang 1980) formulierte, „in einer anderen Welt aufgewacht.“ Seitdem sind wir Zeitzeugen eines Konfliktes Autokratie versus Demokratie, da der Präsident Russlands, Wladimir Wladimirowitsch Putin (Jahrgang 1952) eine andere Weltordnung fordert. Der britische Historiker Timothy Garton Ash (Jahrgang 1955) betont zu Recht, dass Putins Taten einen Wendepunkt in Europas Geschichte bedeuten.
Damit erfährt unsere Welt eine Spaltung. In dieser Weltgemeinschaft hatten, was Deutschland betrifft, die Kinder seit drei Generationen im Allgemeinen einen höheren Lebensstandard als deren Eltern.
Der deutsche Soziologe und Kulturwissenschaftler Andreas Reckwitz [2] betont, dass das einstmals gegebene Versprechen von „Fortschritt und Wohlstand“ sich nicht mehr aufrechterhalten lässt. Stattdessen hebt Andreas Reckwitz die Bedeutung der „Resilienz“ (Psychische Widerstandsfähigkeit) hervor. [3] Seiner Ansicht nach muss die Gesellschaft lernen, „sich gegen die unvermeidlichen Risiken zu wappnen.“ [4] Damit soll zum Ausdruck gebracht werden, dass man am Ende der Gewissheiten lebt, alles sei wieder möglich.
Zu guter Letzt: Erwähnenswert ist die Beschreibung der Zusammenstellung und Zustellung der Briefdokumente („Family Letters“), die aus privatem Besitz in USA im Dezember 2022 nach Deutschland transportiert werden sollten.
Dazu muss man aber wissen, dass über viele Jahrzehnte hinweg überwiegend von den Verwandten Eva Mathilde Traulsen und ihrem Mann Fritz Traulsen aus Rendsburg, Schleswig-Holstein, anlässlich ihrer Besuche bei den Familien ihrer in den 1960er Jahren in die USA ausgewanderten Töchter Ingeborg, Heinke und Gisela, einer Tradition folgend, jedes Mal aus der „Alten Welt“ Familiendokumente von mehreren Generationen aus Nachlassbeständen in die „Neue Welt“ überführt wurden.
Wenn Gegenbesuche der amerikanischen Verwandtschaft in Deutschland stattgefunden hatten, befanden sich im Rückreisegepäck in die USA manch wertvolle Familiendokumente.
Im Privathaus des Ehepaars Heinke und Sam Brendler an der Ostküste der USA hatten sich somit in großen Zeiträumen die „Family Letters“ als Archiv-Dokumente angehäuft.
Als nun die Idee aufkam, auf der Grundlage von Briefen und anderen verwandtschaftsbezogenen Unterlagen eine Chronik zu den Vorfahren zu erstellen, haben meine in den USA lebenden Großcousinen („Großbasen“) Heinke und Gisela dankenswerterweise aus ihrem Dokumenten-Archiv Briefe aus dem Zeitraum der 1930er Jahre bis in die 1970er Jahre ausgewählt und als Postsendung über USPS („United States Postal Service“) vorbereitet.
Heinke’s Sohn Thomas hat diese Briefsendung nach einem Besuch im Haus seiner Mutter in Suffield, CT auf der Rückfahrt zu seinem Wohnort Providence, im Bundesstaat Rhode Island (RI) mitgenommen und dort als „Priority Mail“ über USPS postalisch auf den Weg gebracht.
Erste Zwischenstation war Newport, RI, wo sich ein Post-Verteilungszentrum befindet. Danach erfolgte die Zustellung der Briefe-Sendung zum Internationalen Post-Verteilungszentrum in Jameica, NY (New York State) [5]. Von dort aus wurden die „Family Letters“ zum Internationalen Flughafen John F. Kennedy, New York, befördert. [6] Die Flugreise von der Ostküste der USA über den Atlantik nach Deutschland in der „Alten Welt“ [7] konnte beginnen.
Der Flugtransport der Familiendokumente zum Internationalen Flughafen in Frankfurt am Main erfolgte zuverlässig. Die Organisation DHL [8] brachte schließlich per Lieferwagen die Postsendung zum Verteilungszentrum in Langenfeld, Nordrhein-Westfalen, von wo aus dann DHL die „Family Letters“ in Ratingen dem Erdenbürger Rolf W. Meyer aushändigte.
Bestätigung des Erhalts der Postsendung per E-Mail von Rolf W. Meyer an seine US-Verwandten Heinke, Gisela und Thomas: „The parcel shipment ‚Family Letters‘ has arrived!“
Antwort-E-Mail von Heinke: „Hurray!“
Auf der Grundlage dieses Dokumentationsmaterials und von weiterem zusammengestellten Ergänzungsmaterial konnte nun die Umsetzung des geplanten Buchprojektes beginnen. Denn wenn man die Spuren von verwandtschaftlichen Vorfahren nicht verfolgt, geht damit auch ein Stück Zeitgeschichte verloren.
Nebenbei bemerkt: Es ist sicherlich davon auszugehen, dass in manchen verwandtschaftlichen Annalen [9] Begebenheiten aus weit zurückliegenden Zeiträumen dokumentiert sind, von denen man oft nur durch Zufall davon erfährt. Dies kann auch die eigene Historie betreffen, was an folgendem Beispiel belegt werden soll: Meine Ururuhrgroßmutter Dorothea Friederike Hoff (1773–1845) aus Schönheide [10], seit 1798 verwitwete Baumann, gebar 1808, also nachdem sie 10 Jahre Witwe gewesen ist, ihr 3. Kind, nämlich Christian Friedrich Baumann (1808–1885), wobei der Vater ihres 3. Kindes unbekannt ist. Beim Geburtseintrag ihres Sohnes, der am 18.9.1808 auf die Welt kam, ist vermerkt: „Die Mutter des Kindes gibt an, dass sie in der Neujahrsnacht dieses Jahres (1807/1808), als sie das Dorf hinaufging, von 2 ihr unbekannten Männern mit Gewalt angehalten und von einem derselben genothzüchtigt worden sei.“ [11]
Verständlicherweise beschäftigt die Nachkommenschaft aus der Baumannschen Linie die Fragen: „War die Aussage der damaligen Vorfahrin Dorothea F. C. Hoff aus Schönheide nur eine Schutzbehauptung? Falls ja, wer war aber dann der tatsächliche Vater ihres 3. Kindes?“
Bei der Erörterung dieses historischen Ereignisses aus dem 19. Jahrhundert mit der Verwandten „Tante Hilde“ aus Rendsburg im 21. Jahrhundert, vertrat diese Verwandte pragmatisch die Auffassung: „Dorothea Hoff verwitwete Baumann hatte in der Lebensphase ihres Witwendaseins ein Verhältnis mit dem damaligen Pfarrer der Kirchengemeinde in Schönheide, der sich offensichtlich damals für den erwähnten Eintrag in das Kirchenbuch entschieden hatte.“
19. Jahrhundert
Geschichtliche Ereignisse:
1832:
Hambacher Fest in der Pfalz ((27. bis 30. Mai 1832)
1839:
Das preußische Regulativ vom 9. März über die Beschäftigung jugendlicher Arbeiter in den Fabriken verbietet Kinderarbeit vor Vollendung des neunten Lebensjahres. Es gilt als das erste deutsche Gesetz zum Arbeitsschutz.
1848:
Karl Marx und Friedrich Engels veröffentlichen das Kommunistische Manifest.
1848:
Deutsche Revolution (Märzrevolution)
1856:
Der „Dritte Pariser Frieden“ vom 30. März 1856 als Folge des Krimkrieges führt zu einer Neuordnung Europas.
1856:
Bei Steinbrucharbeiten im Neanderthal bei Düsseldorf wurden 16 Knochen in der Feldhofer Grotte entdeckt. Der Lehrer Johann Carl Fuhlrott erkannte, dass es sich um Überreste eines Frühzeitmenschen handelte. In Anlehnung an den Fundort wurde der Name Neanderthaler gewählt.
1859:
Am 22. November 1859 veröffentlichte der englische Wissenschaftler Charles Darwin sein Werk „Die Entstehung der Arten“. Darin stellte er seine Evolutionstheorie dar.
US-amerikanischer Bürgerkrieg zwischen den konföderierten Südstaaten der USA und der Union, den Nordstaaten
1864:
Am 13. November wird die Liberty Party als erste Partei der Anti-Sklaverei-Bewegung in der Geschichte der Vereinigten Staaten von Amerika gegründet.
1864:
Theodor Schwann und Matthias Jakob Schleiden begründen die Zelltheorie.
1866:
Gründung des Norddeutschen Bundes als Vorgänger des Deutschen Kaiserreiches
1869:
Eröffnung des Suezkanals
1870–1871:
Deutsch-Französischer Krieg
1873:
Dreikaiserabkommen (Deutschland, Österreich, Russland) in Berlin beschlossen
1875:
Im Deutschen Reich schließen sich in Gotha (Thüringen) der von Ferdinand Lassalle 1863 gegründete Allgemeine Deutsche Arbeiterverein (ADAP) und die von Wilhelm Liebknecht und August Bebel 1869 gegründete Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP) zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands (SAP) zusammen, die 1890 in Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) umbenannt wurde.
1878:
Österreich besetzt Bosnien und Herzegowina
1878:
Sozialistengesetz Bismarcks gegen die Sozialdemokratie
1881–1889:
Einführung der Bismarckschen Sozialgesetze in Deutschland (Kranken-, Unfall-, Renten- und Invaliditätsversicherung)
1883:
Der erste Teil von Friedrich Nietzsches dichterisch-philosophischem Werk „Also sprach Zarathustra“ erscheint.
1899:
Am 11. August eröffnet Kaiser Wilhelm II den Dortmund-Ems-Kanal. Das östliche Ruhrgebiet hat damit einen Schiffsweg zur Nordsee.
***
Ein Gedicht des Urgroßvaters Christian Friedrich Baumann [12] aus dem Jahr 1861 zum 22. Geburtstag des Fräuleins Mathilde Therese Lenk [13]:
Freude wünsch‘ ich Dir und fröhlich Leben,
an dem Tag, der Dich zuerst begrüßt.
Tausend Wünsche für Dein Wohl erheben
Hoch mein Herz, das Dir ergeben ist.
Glück und froher Mut erhalte
Sich ins späteste Alter Dir,
Und des Friedens Engel walte
Segnend immer über Dir.
Ruhig blicke auf die Tage
Der Vergangenheit zurück.
Keine Thräne, keine Klage
Trübe je Dein Lebensglück.
***
Im Herbst des Lebens
Der Herbst als natürliche Jahreszeit stellt eine Übergangszeit dar. Es ist eine Zeit des Wandels. Hierbei geht es nicht um einen Neubeginn, sondern es betrifft das Abschiednehmen in der Natur, wobei nicht das Wachsen im Vordergrund steht, sondern es handelt sich um das Weniger werden.
So beobachtet man im Herbst, dass Laubbäume ihre Blätter verlieren und kahl werden. Die Tage werden kürzer und die Natur bereitet sich auf die kalte Jahreszeit Winter vor. Starke Stürme, Winde und starke Regenfälle können auch in das Leben der Menschen, als Teil der natürlichen Umwelt, eingreifen.
Im Herbst treten alle Anzeichen auf einen Wandel hervor und damit auch auf Veränderungen. Auch im menschlichen Leben spricht man im höheren Alter vom „Herbst des Lebens“. Damit meint man den Lebensabend, das Rentenalter, im Allgemeinen das fortgeschrittene Lebensalter.
So wie der Herbst als Jahreszeit zum Jahresablauf gehört, so spielt auch das Weniger im menschlichen Leben eine große Rolle. Das zeigt sich darin, dass sich mit zunehmendem Alter die Gesundheit verschlechtern kann, die geistigen Kräfte allmählich nachlassen und das Leben immer beschwerlicher werden kann. Denn man ist nicht mehr jung und stark leistungsfähig.
Den Herbst des Lebens erfährt jeder Einzelne von uns, wenn auch unterschiedlich.
***
Veränderungen mit dem Alter
10 Jahre – ein Kind
20 Jahre – jung gesinnt
30 Jahre – rascher Mann
40 Jahre – wohlgetan
50 Jahre – stille stehen
60 Jahre – geht’s Altern an
70 Jahre – ein Greis
80 Jahre – schneeweiß
90 Jahre – gebückt zum Tod
100 Jahre – Gnad bei Gott
***
Wissenswert
In dem folgenden Herbstgedicht „O trübe diese Tage nicht“, das der deutsche Schriftsteller Theodor Fontane [14] im Jahr 1895 veröffentlichte, wird ein Zeitabschnitt menschlichen Lebens beschrieben. Die Jahreszeit Sommer und die „Flut des Lebens“ [15] sind dahin. Nun steht die Jahreszeit Winter bevor. Es stellt sich die Frage, wie der älter gewordene Mensch darauf reagiert. Seine Reaktion auf solch einen Lebenseinschnitt ist verständlich: Der Mensch geizt mit seiner Lebenszeit, das bedeutet, er will jede Lebensstunde festhalten, „denn auch der letzte Sonnenschein hat seinen Glanz.“
Deshalb beschwört Theodor Fontane das Schicksal, dem alten Menschen jede Stunde seines Lebens ganz zu gönnen.
O trübe diese Tage nicht
O trübe diese Tage nicht,
sie sind der letzte Sonnenschein.
Wie lange, und es lischt das Licht,
und unser Winter bricht herein.
Dies ist die Zeit, wo jeder Tag
Viel Tage gilt in seinem Wert,
weil man’s nicht mehr erhoffen mag,
daß so die Stunde wiederkehrt.
Die Flut des Lebens ist dahin,
es ebbt in seinem Stolz und Reiz.
Ein banger, nie gekannter Geiz.
Ein süßer Geiz, der Stunden zählt
Und jede prüft auf ihren Glanz.
O sorge, daß uns keine fehlt
Und gönn uns jede Stunde ganz.
Erwähnenswert
Ein weiteres Gedicht, das zum Thema „Im Herbst des Lebens“ passt, ist die sehr nachdenkliche und spirituell angehauchte Dichtung von Rainer Maria Rilke [16] in Form seines Gedichtes „Herbst“, das der österreichische Lyriker 1902 schrieb.
Herbst
Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten,
sie fallen mit verneinender Gebärde.
Und in den Nächten fällt die schwere Erde
Aus allen Sternen in die Einsamkeit.
Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh Dir andre an: Es ist in allen.
Und doch ist einer, welcher dieses Fallen
Unendlich sanft in seinen Händen hält.
Die 1900er und 1910er Jahre
„Man muß die Ämter den Leuten und die Leute den Ämtern geben.“
Deutsches Sprichwort
„Wer ein Amt genommen, ist der Freiheit verkommen.“
Deutsches Sprichwort
Geschichtliche Ereignisse:
Russisch-Japanischer Krieg
1905:
Russische Revolution
1905:
Albert Einstein begründet die Allgemeine Relativitätstheorie
1907:
In der bildenden Kunst entsteht der Kubismus
1908, 13. März:
Die Marke Steiff Original für Spielzeug aus Filz und ähnlichem Material wird eingetragen.
1908, 30. Mai:
In Deutschland wird ein Versicherungsvertragsgesetz verabschiedet.
1908, 21. September:
Der Mathematiker Hermann Minkowski hält in Köln einen Aufsehen erregenden Vortrag über Raum und Zeit. Die Raumzeit gewinnt Konturen.
1908, 28. Oktober:
Erster Motorflug in Deutschland durch Hans Grade in Magdeburg
1910:
Am 20. Dezember kann Ernest Rutherford den experimentellen Nachweis von Atomkernen erbringen.
1912:
Jungfernfahrt und Untergang der Titanic
1914, 28. Juli:
Beginn des Ersten Weltkrieges, der bis 1918 in Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Ostasien geführt wird
1914, 30. Juli:
Generalmobilmachung in Russland
1914, 1. August:
Kriegserklärung des Deutschen Reiches an Russland
1914, 31. August:
Sieg der deutschen über die russischen Truppen in der Schlacht bei Tannenberg
1917:
Oktoberrevolution in Russland und Beginn des Bürgerkrieges in Russland bis 1922
1918:
Novemberrevolution in Deutschland
1919:
Gründung der Weimarer Republik
1919:
Ausrufung und Niederschlagung der Bremer und der Münchener Räterepubliken
1919, 14.–15. Juni:
Erster Non-Stopp-Flug über den Atlantik durch John Alcock
Bemerkenswertes zur Vermählungsfeier der Großeltern des Autors Rolf W. Meyer väterlicherseits im Jahr 1901
„Bekanntmachung. Se. Hoheit „Prinz Amor“ haben allergnädigst geruht, heutigen Tages Herrn Otto Meyer und Fräulein Emma Baumann, wohlgeboren in den Ehestand zu erheben. Hierbei ist ersterem das Haus=Kreuz vom Orden des Ehepantoffels, zu tragen am Geduldsfaden, letzterer der Titel Frau Meyern verliehen worden.
I.U.: Heinrich“ [17]
„Steckbrief. Gegen den bezeichneten Otto Meyer aus Haselbrunn ist die gerichtliche Haft wegen verschiedener schwerer Verbrechen verhängt worden. Derselbe hat einem jungen Mädchen, Namens Emma Baumann, das Herz geraubt und entsprang schließlich aus dem Junggesellenstande, um sich sein beklagenswertes Opfer selbst auch noch nachzuholen.
Wir bringen beistehend die Physiognomien der beiden Personen und fordern jedermann auf, Betreffende, wo und wie man sie auch erwischt, zu fassen und möglichst einzeln verpackt (er in Holzwolle, sie in Watte) schleunigst anher zu transportieren.
Elsterberg, den 2. Mai 1901
Die Staatsanwaltschaft.Gez. Neidhammel.“ [18]
Er:
Sie:
Alter:
verlebt
gerade recht
Größe:
passend
auch passend
Statur:
proportionell
etwas zur Korpulenz veranlagt
Haltung:
militärisch
stramm
Gesicht:
gewöhnlich
schwiegermutterhaft
Augen:
verliebt, rollend
durchbohrend
Bart:
„Es ist erreicht“, ein Teil noch beim Kürschner [19]
keinen
Haar:
blond
eigene
Stirn:
kraus
mit Franzen
Besondere Kennzeichen:
Er gibt sich viel unter dem Namen „Klitscher“ [20] aus.
Sie hört auf die Namen Renettel und Schußwickel [21]
Bemerkenswertes
„Jede Generation lächelt über die Väter, lacht über die Großväter und bewundert die Urgroßväter.“
William Somerset Maugham (1874–1965)
Vorfahren mütterlicherseits
Mein Urgroßvater August Schmitz kam 1853 in Mettmann zur Welt. Bis zu seinem 14. Lebensjahr besuchte er die Elementarschule in Mettmann. Da er ein guter Schüler war, hätte sein Lehrer es gern gesehen, dass mein Großvater Lehrer geworden wäre. So aber kam er beim Nachbarn, dem Kupferschmied Hohmann, in die Lehre. Nach einer dreijährigen Militärzeit beim Infanterie-Regiment 93 in Düsseldorf ging er auf Wanderschaft. Dabei hat er längere Zeit in Celle gearbeitet. Nachdem er die Meisterprüfung vor der Handwerkskammer in Elberfeld abgelegt hatte, machte er sich in den 1870er Jahren in Mettmann selbständig. Dort heiratete er 1880 Laura Nordmann. Aus der Ehe gingen fünf Kinder hervor. Mit seinen Ersparnissen und einem Darlehen seines Schwiegervaters Ferdinand Nordmann kaufte er 1880 das Haus Freiheitsstraße 876 in Mettmann. Durch Fleiß und Klugheit brachte er sein Unternehmen empor. Nach einigen Jahren wurde er in den Stadtrat von Mettmann gewählt. In dieser Stadt war er Mitbegründer der Fortbildungsschule und des Gewerbevereins für das Handwerk. Aufgrund seiner beruflichen Erfolge zog er mit seiner Familie nach Düsseldorf, Oberbilker Allee 295. Hier brachte er sein Handwerk zu höchster Blüte, vorwiegend mit kunstgewerblichen Arbeiten wie Lampen, Türen, Beschläge, Kamine und dergleichen in Kupfer. Als Kupferschmiedemeister stellte er 1902 auf der großen Gewerbeausstellung in Düsseldorf, die den Rang einer Weltausstellung hatte, seine Erzeugnisse aus und erhielt eine Silbermedaille sowie die bronzene Staatsmedaille. 1904 erhielt er als Teilnehmer an einer Sammelausstellung der Stadt Düsseldorf in St. Louis, Missouri (USA) eine Bronzemedaille. August Schmitz führte zahlreiche Arbeiten an öffentlichen Gebäuden durch. Außerdem hatte er eine reiche Privatkundschaft.
Ein kenntnisreicher und zuverlässiger Handwerksmeister
Das vielseitige, handwerkliche Können meines Urgroßvaters schätzte man auch während der Zeit des Kalkabbaus im Neanderthal, wo bekanntlich im August 1856 zwei Arbeiter beim Ausräumen der Feldhofer Grotte 16 Knochen fanden, die der Lehrer Johann Carl Fuhlrott aus Elberfeld einem eiszeitlichen Menschentyp, nämlich dem Neanderthaler, zuordnete. Interessant ist ein Referenzschreiben, das Wilhelm Pasch aus Düsseldorf am 24. August 1901 meinem Urgroßvater ausgestellt hatte: „Während meiner Tätigkeit als Geschäftsführer und Betriebsleiter der früheren Actien-Gesellschaft für Marmor-Industrie zu Neanderthal, von Anfang der 70er Jahre bis Ende der 80er Jahre, habe ich den Kupferschläger, Installateur und Pumpenmacher Herrn August Schmits zu Mettmann bei Anlage von Brunnen vielfach zu Rate gezogen, und, auf Grund dessen hervorragender Kenntnisse über die Wasserführung des Gebirges, eine Anzahl von Brunnen für Trinkwasser mit stets sicherem Erfolg an verschiedenen Stellen des im allgemeinen als brüchig und wasserarm bekannten Neandertales und Hochdahler Terrains anlegen lassen, welche sich auch dauernd als gut, gesund und gleichmässig wasserhaltend bewährt haben. Die fachmännische Kontrolle dieser Brunnen und ihrer Querschläge auf genügenden Wasserzufluss vor Ort, während des Abteufens und auch später, wurde gleichfalls stets durch Herrn Schmits ausgeführt. Die für die Brunnen erforderlichen Pumpen und Leitungen, eine Pumpe ausgenommen, hat Herr Schmits geliefert und eingebaut, desgleichen umfangreiche Rohrnetze zur Verteilung des der Hauptleitung des Neandertaler Pumpwerkes entnommenen Betriebswassers auf die verschiedenen Ziegeleiarbeitsplätze und sonstigen Verbrauchsstellen der genannten Actien-Gesellschaft ferner führte derselbe um die Mitte der 1880er Jahre große bauklempnerische und Zinkbedachungsarbeiten beim Umbau des Neandertaler Spinn- und Weberei-Etablissements aus, desgleichen stets auch einen Teil der Erneuerung und Unterhaltung des diversen Betriebsgeschirrs. Nach Inkrafttreten des Dynamitgesetzes lieferte Herr Schmits für die Neandertaler Steinbrüche ein zum Teil aus seiner eigenen Initiative von ihm construiertes System von Sicherheitsapparaten zum gefahrlosen Auftauen von erstarrtem Dynamit und erwarb sich damit die ungeteilte Anerkennung auch der behördlichen und berufsgenossenschaftlichen Aufsichts-Organe. Bei all diesen Leistungen, Lieferungen und Arbeiten, deren Betrag sich auf viele tausende von Mark belaufen hat, und für welche sich nicht immer feste Preisvereinbarungen im Voraus treffen ließen, ist es niemals zu Differenzen und Beanstandungen irgendwelcher Art gekommen. Ich habe Herrn Schmits allezeit als einen kenntnisreichen, zuverlässigen, ruhigen und umgänglichen Mann, als rechtlich denkenden und handelnden tüchtigen Handwerksmeister und Geschäftsmann kennen und schätzen gelernt und rechne es mir zur Ehre, ihm solches hiermit bescheinigen zu dürfen.“
Düsseldorf, Carl-Antonstr. 24, den 24. August 1901
gez. Wilhelm Pasch
In Düsseldorf beteiligte er sich auch in Düsseldorf politisch am öffentlichen Leben. Zweimal wurde er als Kandidat für die Nationalliberale Partei für den Reichstag aufgestellt. In Düsseldorf-Oberbilk gründete er den Arbeiterverein. Der Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914 war ein Schlag für sein Unternehmen, da der einzige Sohn Otto Fritz sich kriegsfreiwillig meldete, alle Arbeiter einberufen wurden und damit die Arbeiten eingestellt werden mussten. Als sein Sohn 1920 unerwartet an den Folgen eines Kriegsleidens starb, beschleunigte das auch das Ende meines Urgroßvaters. Er starb 1924.
Meine Urgroßmutter Laura Schmitz geborene Nordmann wurde 1852 in Mettmann geboren, wo sie auch aufwuchs und geheiratet hat. Sie hatte blaue Augen und dunkelblondes Haar von besonderer Länge. Ihre Zöpfe reichten bis zu den Kniekehlen. Da sie ihr Kopfhaar nicht waschen konnte, reinigte sie es durch beständiges Kämmen. Sie war eine musterhafte Hausfrau, die fleißig arbeitete, sehr sparsam, selbstlos und genügsam war. Als kirchengläubige und fromme Person las sie sonntags regelmäßig in der Bibel. Bis ins hohe Alter war sie eitel und legte Wert auf korrekte Kleidung. Ihr Schwiegersohn Ludwig Schröder sagte einmal: „Ich habe meine Schwiegermutter nie mit Hausschuhen gesehen.“ Ernsthafte Krankheiten hatte meine Urgroßmutter, die 1940 starb, nie gehabt.
***
Urgroßvater Christian Friedrich Baumann (1836–1910) aus Elsterberg und sein Testament [22]
Christian Friedrich Baumann ordnete seinen Nachlass durch ein Testament vom 24. September 1909, in welchem er seine sechs Kinder zu Erben einsetzte mit der Maßgabe, dass die kinderlos verheiratete Anna Marie Heyer (1867–1944) von ihren Geschwistern beerbt werden sollte [23] und dass bei vorzeitigem Tode von Minna Kießig, Clara Anlauft und Emma Meyer deren Kinder das „eingebrachte Eigentum“ erhalten sollten, im Falle Kießig unter Ausschluss der Nutznießung des Ehemanns Ernst Philip Kießig. [24] Seinem Sohn Christian Friedrich („Fritz“) Baumann sollten die Kosten seines Studiums voll angerechnet werden. Das im Geschäft („Eisenwaren C. L. Oschatz“ in Elsterberg) stehende Kapital sollte 5 Jahre stehen bleiben und zu 4% verzinst werden.
Eine Aufstellung der Hinterlassenschaft vom 3.9.1911 ergab folgendes Vermögen:
Aktiva: 130.793,34 Mark
Passive: 13.487,10 Mark
________________________
Überschuss: 117.306,24 Mark
Jedes der 6 Kinder erhielt sonach 36.682,12 Mark
Darauf wurden angerechnet:
Anna Heyer: 35.839,22 Mark, so dass verblieben 842,90 Mark
Otto Baumann: Forderungen an seinen Vater, Begräbniskosten und verschiedene übernommene Passiven – verblieben 52.000,72 Mark
Minna Kießig: 13.320,25 Mark, so dass verblieben 23.361,87 Mark
Clara Anlauft: 28.356,36 Mark, so dass verblieben 8.325,76 Mark
Emma Meyer: 7.252,15 Mark, so dass verblieben 29.429,97 Mark
Fritz Baumann: 19.850,00 Mark, so dass verblieben 16.832,12 Mark
Christian Friedrich Baumann hatte den Schwiegersöhnen Robert Heyer [25] und Ernst Kießig in den vorausgehenden Jahren für Webereiunternehmen (Firma Heyer & Rieck, Firma Kießig & Heyer) Kapital gegeben. Die Unternehmen waren erfolglos infolge des Niedergangs der „mechanischen Weberei“ im Elsterberg – Greizer Industriegebiet in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts.
Aus Misstrauen gegenüber diesen beiden Schwiegersöhnen entzog Schwiegervater Christian Friedrich Baumann, wie bereits angesprochen, dem Schwiegersohn Ernst Philipp Kießig die ehemännliche Nutznießung am Vermögen seiner Ehefrau und bestimmte bei seiner verheirateten Tochter Anna Marie Heyer den Heimfall ihres Erbteils an ihre Geschwister, falls sie vor ihrem Ehemann sterben sollte. Auch in den Familien Anlauft und Meyer ordnete der Vater Christian Friedrich Baumann die Erbfolge der Kinder an, falls seine Töchter vor ihren Ehemännern sterben sollten.
Wegen der von ihm als kränkend empfundenen Zurücksetzung durch den Schwiegervater hat Ernst Kießig nach seinem 1907 erfolgten Wegzug aus Elsterberg diesen Ort nie mehr betreten. Oft begleitete er seine Familie von Ruppertsgrün bis nach Görschnitz, kehrte aber am Görschnitzberg wieder um.
Übrigens: Das Studium des 6. Kindes von Christian Friedrich Baumann aus Elsterberg, sein Sohn Christian Friedrich Baumann, hat nach Aussagen von dessen Schwestern insgesamt 18.000 Mark gekostet. Nach den wirtschaftlichen Verhältnissen in dem ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts stellte diese Geldsumme einen recht bedeutenden Finanzbetrag dar.
Die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg – Erinnerungen meines Vaters (Jahrgang 1901)
Das Leben in den Jahren vor dem Ersten Weltkrieg lief für die Menschen in Deutschland in ruhigen Bahnen. Es war, so wie ich es aus meiner Sicht sah, ein Leben ohne große Probleme. Mein Elternhaus und die Umgebung hatten den Lebenszuschnitt des mittelständischen Bürgers. Man lebte einfach, ohne Luxus und großen Aufwand, aber in der Sicherheit einer festen Lebensgrundlage. Mein Vater wurde in seiner Umgebung für wohlhabend gehalten, was aus Sicht von Außenstehenden sicherlich auf seinen Grundbesitz zurückzuführen war. Und doch bestand nie das Gefühl, dass nicht immer gespart werden müsste. Der Zwang zur „Bescheidenheit“ in der Lebensführung wurden mir und meinen Geschwistern von den Eltern ständig vorgehalten, zum einen unter dem Hinweis auf die eigene erfahrene Erziehung zur Bescheidenheit, zum anderen war es die Belehrung, dass es anderen Mitmenschen nicht so gut ginge. Es war aber für uns Kinder nicht immer einzusehen. Mancher Mitschüler von mir fuhr mit der Straßenbahn zur Schule, ich hingegen musste laufen. Von allen Geschwistern hatte nur meine Schwester Annemarie Mathilde einmal für einige Zeit eine Monatskarte für die Straßenbahn. Ein Fahrrad, der sehnliche Wusch von mir, wurde mir oft versprochen. Bekommen habe ich es nie. Als im Gymnasium mancher Mitschüler als Sohn eines vermögenden Fabrikanten oder eines höheren Beamten einen besseren Lebensstil erkennen ließ, wuchs in mir das Gefühl, einen besseren Lebensstandard nur durch eigene Leistung erreichen zu können. Dabei hatte mein Vater 1913 bei der Erhebung des Wehrbeitrages ein Vermögen von 250 000 Mark versteuert.
Sonntags gab es einen Braten, in der Woche ein- bis zweimal Fleisch. Das Abendbrot war einfach. Reste vom Mittagessen wurden „aufgewärmt“ oder Wurst und Brot gegessen. Ich habe nie erlebt, dass auf das Brot außer der Butter auch noch etwas Marmelade aufgestrichen wurde. Kuchen für den Sonntag wurde zu Hause gebacken. Meistens gab es den überlieferten „Hefenkloß“, je nach Jahreszeit wurden aber auch andere, flache Kuchen gebacken. In den Zeiten der Entbehrlichkeit steckten übrigens die hölzernen Kuchendeckel zum Schutz gegen das nächtliche Herausfallen in den Kinderbetten zwischen Bettgestell und Matratze.
Wein für meine Eltern habe ich auf dem Mittagstisch nur einige Male zum Weihnachtsbraten erlebt. Bier wurde zuweilen im Krug aus einer der Wirtschaften in der näheren Umgebung geholt. Wenn ich losgeschickt wurde, um Zigarren zu holen, dann waren es immer sechs Stück zu acht Pfennigen. Wurde auf einem Spaziergang eingekehrt, z.B. in die Pfaffenmühle, dann gab es höchstens ein Würstchen und eine Brauselimonade, die, je nach Auswahl, grellgrün, rot oder gelb war. Im Herbst wurden Äpfel und Birnen eingelagert und Preiselbeeren sowie Heidelbeeren eingekocht. Die Beerenhändler zogen mit kleinen Wagen durch die Straßen und man hörte von weitem ihr Rufen „Heedelbeer, Heedelbeer!“ Kirschen und Pflaumen wurden von vorbeifahrenden Händlern im Korb erstanden. Sauerkraut und Gurken legte die Hausfrau selbst ein. Südfrüchte wurden selten gekauft. Die erste Banane habe ich um 1912 gegessen. Apfelsinen, die sehr sauer waren, wurden vor dem Genuss in Zucker gelegt. Anschließend wurde eine Apfelsine für die ganze Familie aufgeteilt. Spargel habe ich erst als Student in Leipzig um 1920 das erste Mal mit Bewusstsein gegessen. Tomaten, die mein Onkel Ernst Philipp Kießig (1868–1929) in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts selbst angebaut hatte, wurden als etwas Besonderes betrachtet und „Paradiesäpfel“ genannt. Mein Onkel hatte die Tomate während seines Aufenthaltes in USA kennen gelernt. Mein Vater hat nach Beginn des Ersten Weltkrieges begonnen, Tomaten in seinem Garten anzubauen. Pfirsiche waren mir in meiner Jugend ganz unbekannt. Der Grund: Der Pfirsichbaum gedieh nicht in dem rauen Klima des Vogtlandes. Den Nussbaum habe ich erst als Student kennen gelernt. Die Massenanfuhr von Erdbeeren, Spargel und Pfirsich aus den Obstanbaugebieten der Elbe in das Vogtland und Erzgebirge wurde erst möglich, als das Lastauto den Verkehr beherrschte. Kartoffeln wurden für das ganze Wirtschaftsjahr eingekellert. Die Wäsche wurde im Garten hinter dem Haus auf dem Rasen gebleicht. In der Waschküche im Kellerbereich befanden sich der beheizbare Waschkessel, das Waschbrett und ein Wäschewringer. 1911 legten sich meine Eltern eine elektrische Waschmaschine zu. Sie wurde, gegen Entgelt, nicht nur von den Hausbewohnern, sondern sogar von Nachbarn benutzt.
Die Arbeiter in allen Betrieben arbeiteten von 6 Uhr bis 18 Uhr mit 3 Pausen täglich 10 Stunden. Am Sonnabend wurde bis 17 Uhr gearbeitet. Die Schule begann vom dritten Schuljahr an regelmäßig um 7 Uhr während des Sommers und um 8 Uhr im Winter. In den Oberklassen hatten die Schüler zweimal wöchentlich nachmittags Unterricht.
In Haselbrunn gab es auch einen Kramladen, der „Colonialwarenladen“ genannt wurde. Er führte alles in seinem Angebot, vom Petroleum über Holzpantoffel, Pferdepeitschen und Schnupftabak bis zum Bückling, der Leberwurst, Brot, Mehl und Bleichsoda. Wenn die Kutscher Frühstückspause machten und ihr Bier tranken, war der Kramladen auch gleichzeitig Frühstücksstube. Das Duftgemisch in einem solchen Kramladen war bemerkenswert. Oft genug schmeckte der Harzer Käse nach Petroleum. Viele Händler kamen aber auch noch ins Haus. Haushaltsgeräte aus Blech und Holz wurden in Wagen umhergefahren oder in die Häuser getragen. Der „Lettermann“ mit Leitern, Wannen und Besen war ein Ereignis auf der stillen Straße. Seine Ankunft verriet „ander Wetter“. Kroaten mit Blech und Mausefallen, Italiener mit Gipsfiguren, andere Händler mit Stoffen oder englischem Heftpflaster waren ständige Gäste. Das Schild an der Haustür „Betteln und Hausieren verboten“ hatte eine echte Bedeutung. Auch arbeitsscheue Bettler, ja sogar Zigeuner [26], zogen durch das Land. Scherenschleifer und Kesselflicker verrichteten ihre Arbeit im Hof oder auf der Straße. Man konnte darauf warten. Manches gesprungene Tongeschirr wurde von einem Kesselflicker mit einem Drahtnetz versehen. Mancher Bettler bekam ein Essen. Andere Bettler ließen das Brot vor der Tür liegen.
Im Herbst wurden Schafherden und Gänseherden aus Pommern und Schlesien durch Haselbrunn getrieben. Die Tiere wurden unterwegs zum Mästen für den Winter abgesetzt. Gemächlich zogen sie mit Lärm und viel Staub ihres Weges. Der Fußweg vor dem Haus auf der Haselbrunner Straße musste zweimal wöchentlich gekehrt werden. Im Winter musste bis 8 Uhr vor dem Haus „Bahn gemacht“ werden, das heißt, bis dahin musste der Gehweg schneefrei sein. Das war schon bald die Aufgabe für mich.
Wie stand es um die Preise in jener fernen Zeit? Zwei Semmeln kosteten 5 Pfennige, das Dreierbrot einen Dreier (Drei-Pfennig-Stück). Zwölf Stahlfedern kosteten einen Groschen (das entsprach 12 Pfennigen), ein Schulheft 5 Pfennige. Das Schulgeld für das Gymnasium machte mit 150 Mark schon eine Menge Geld aus. Ein Glas Bier kostete 12 Pfennige, die billigste Zigarre 4 Pfennige und 12 der billigsten Zigaretten 10 Pfennige. Eine damals gängige Zigarettenmarke war „Luccas“, die ein langes Papphohlmundstück trug. Der Straßenbahnfahrpreis lag bei 10 oder 15 Pfennigen. Der Schneiderlohn für einen Anzug betrug 70 Mark. Die Arbeiter in der Ziegelei gingen mit einem Wochenlohn von 15 Mark nach Hause. Die direkten Steuern waren minimal.
Der Erste Weltkrieg bricht aus
„Ihr werdet wieder zu Hause sein, ehe noch das Laub von den Bäumen fällt.“
Kaiser Wilhelm II. zu den im August 1914 in Richtung Belgien ausrückenden Truppen
„Um nichts auf der Welt möchte ich diesen herrlich aufregenden Krieg missen.“
Britischer Marineminister und späterer Premierminister Winston Churchill im Herbst 1914
„Wie hätte der Künstler, der Soldat im Künstler nicht Gott loben sollen für den Zusammenbruch einer Friedenswelt, die er so satt, so überaus satt hatte! Krieg!“
Thomas Mann, deutscher Schriftsteller [27]
Als am 1. August 1914 der Erste Weltkrieg begann, war mein Vater Quartaner. Im Juni dieses Jahres hatte er noch den jährlichen Schulausflug nach Schloss Burgk an der Saale und nach Saalfeld gemacht. Das Wichtigste an dieser Fahrt war für die Schüler das Abkochen im Freien. Aluminiumkocher mit Hartspiritus waren eine Neuigkeit zu dieser Zeit. Kochgemeinschaften wurden gebildet, in denen jeder etwas zum gemeinsamen Essen beisteuern musste. Für seine Gruppe lieferte mein Vater die Erbsensuppe. Auf einem Feld unweit der Saale wurden die Mahlzeiten zubereitet. Es war für alle Anwesenden wesentlich fesselnder als die Besichtigung des Schlosses.
Als die Schüler aus den Sommerferien zurückkehrten, war die Welt und auch die Schule verändert. Der Krieg ging durch Europa und bestimmte nun das Leben der Menschen. Das bürgerliche Zeitalter war endgültig vorüber.
Die Sommerferien hatte mein Vater in Elsterberg bei den Verwandten Paul Oswald Anlauft (1870–1939) und seiner Frau Clara Mathilde (1877–1960), eine Schwester seiner Mutter, verlebt. Dort spielte er mit seinem Vetter Fritz Paul Anlauft (1900 - 1978) auf dem Fabrikgelände der Weberei oder am Uferbereich der Elster. Zuweilen nahm ihn auch sein Onkel Otto Baumann (1869–1935), der älteste Bruder seiner Mutter, mit, wenn er auf Kundenbesuch „über Land ging“.
Doch mit einem Male wurde nach dem Mord von Sarajewo [28], der am 28. Juni 1914 geschah, und nach der Mobilmachung in Österreich die Eisenbahnstrecke, die durch Elsterberg führte, von Sonderzügen mit österreichischen Reservisten befahren. Der 1. August 1914 war ein Sonnabend gewesen, ein heißer Hochsommertag in einer Welt, die seit der Ermordung des österreichischen Thronfolgers Franz Ferdinand an jenem 28. Juni 1914 voller Anspannung und Sorge um den Frieden war. An diesem Tag wurde mein Vater gegen sechs Uhr abends von Tante Clara zur „Fürstenhalle“, einer Gastwirtschaft unweit des kleinen Bahnhofes von Elsterberg geschickt, um Onkel Paul von seinem Abendschoppen zum Abendbrot heimzuholen. Sein Onkel saß zu diesem Zeitpunkt mit anderen Männern auf der Veranda beim Bier. Die Ereignisse in Europa gaben genug Gesprächsstoff. Da kam plötzlich aus der gegenüberliegenden Post ein Beamter und heftete einen Zettel an das Anschlagbrett. Einer der Tischgenossen, die dem abendlichen Verkehr zum Kleinstadtbahnhof zusahen, sagte scherzhaft: „Der Richard hängt’s gute Wetter raus.“ Er meinte den Wetterbericht der Post. Doch immer mehr Neugierige blieben vor dem Anschlagbrett stehen. Im Nu entstand ein großer Menschenauflauf. Es wurde gerufen, laute Stimmen waren zu hören, man redete wild durcheinander und viele aus der Menschenmasse entfernten sich eilig, um schnell nach Hause zu gelangen. Auf dem Anschlag war zu lesen: „Seine Majestät der deutsche Kaiser hat wegen drohender Kriegsgefahr die Mobilmachung befohlen. Erster Mobilmachungstag ist der 1. August 1914.“ Das bedeutete, dass schon am nächsten Morgen die ersten Reservisten einrücken mussten. Der Krieg stand vor der Tür. Betroffen liefen mein Vater und sein Onkel heim. Die Umwelt war plötzlich wie ein zerstörter Ameisenhaufen. Diesem Augustabend sollten noch Jahrzehnte von Not und Elend folgen.
Schon am nächsten Tag war der Zugverkehr eingeschränkt. Am Sonntag erschien überraschend mein Großvater, um seinen Sohn heimzuholen. Er hatte einen überzeugenden Grund. Zum einen war der Landsturm aufgerufen worden, so dass mein Großvater mit seiner Einberufung rechnen musste. Zum anderen vertrat er die Ansicht, dass sein Sohn solch eine Mobilmachung, wie sie sich in Plauen abspielte, in seinem Leben nicht wieder erleben würde. Schon am Nachmittag fuhren sie nach Haselbrunn. Der Zug war von den letzten Reisenden überfüllt. In der Innenstadt von Plauen drängte sich eine große Menschenmasse. Einberufene Reservisten zogen in Gruppen durch die Straßen. Es wurde laut gesungen. Von überall her erklang „Die Wacht am Rhein“. [29] Einige Personen auf dem Dach der Hauptpost erregten die Aufmerksamkeit von Hunderten von Zuschauern. Mit einem Mal war die Angst vor Spionen da. Einzelne Soldaten mit der neuen feldgrauen Uniform und dem gelben Lederzeug verursachten Menschenaufläufe. Die Ausrüstung wurde bewundert und der „gediente“ Mann war stolz auf seine Sachkenntnisse. Wichtig war die Erkenntnis, dass es an dieser Uniform keine Knöpfe mehr gab, die man hätte blank putzen müssen. Mein Vater und mein Großvater kehrten in die Örtlichkeit „Reichshallen“ ein, wo ein großer Trubel herrschte. Unentwegt wurden Extrablätter ausgerufen. Die erste Kriegserklärung hatte eine überschwängliche Begeisterung ausgelöst. Von den Tischen herunter wurden Reden gehalten, es wurde gesungen und immer wieder erklang ein „Hoch lebe“ auf den Kaiser und den König. Für den Feind hatte man nur Spott und Hohn übrig. Jeder Soldat, dessen man habhaft werden konnte, wurde wie ein Held gefeiert. Aus spärlichen Meldungen von der Grenze wurden Siegesnachrichten. Mein Vater stand in all dem Wirbel und plötzlich war er nicht mehr ein Kind. Sein Vater erklärte ihm alles mit dem Hinweis, diese denkwürdigen Ereignisse gut in Erinnerung zu bewahren. Und er fügte hinzu:“ Wir werden noch viel erleben.“ Wie Recht hatte er.
Die 1920er und 1930er Jahre
„Die Freiheit des Menschen liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern, dass er nicht tun muss, was er nicht will.“
Jean-Jacques Rousseau (1712–1778) [30]
„Wenn der Alltag dir arm erscheint, klage ihn nicht an – klage dich an, daß du nicht stark genug bist, seine Reichtümer zu rufen, denn für den Schaffenden gibt es keine Armut.“
Rainer Maria Rilke (1875–1926)
„Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.“
Benjamin Franklin (1706–1790) [31]
Geschichtliche Ereignisse:
Der Friedensvertrag von Versailles tritt in Kraft
1920, 26. November:
Lenins Rede „Den Kapitalismus einholen und überholen“
1921, 1. Juli:
Gründung der kommunistischen Partei Chinas
1921, 26. August:
Der Reichsfinanzminister Matthias Erzberger wird bei Bad Griesbach im Schwarzwald Opfer eines der politisch motivierten Fememorde in der Weimarer Republik.
1922, 30. Dezember:
Gründung der Sowjetunion
1923, 13. August:
Gustav Stresemann (DVP) wird neuer Reichskanzler
1923, 29. Oktober:
Ausrufung der Republik Türkei durch Kemal Atatürk
1926, 8. Mai:
In Düsseldorf wird die Große Ausstellung für Gesundheit, soziale Fürsorge und Leibesübungen (GeSoLei) eröffnet, die bis zum 15. Oktober 1926 über 7,5 Millionen Menschen besuchen.
1927, 19. März:
In Berlin kommt es zwischen bewaffneten Verbänden der Nationalsozialisten und der Kommunisten zu schweren Straßenschlachten.
1927, 1. Juni:
Eröffnung des Hindenburgdammes, der die Insel Sylt mit dem Festland verbindet.
1927, 23. August:
Die Angeklagten Sacco und Vanzetti werden auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet.
1927, 25. November:
70 Regierungen schließen in Washington D.C. ein internationales Radiotelegraphisches Abkommen.
1929, 24. Oktober:
Schwarzer Donnerstag an der New Yorker Börse, Beginn der Weltwirtschaftskrise
1931, 18. März:
Der erste Elektrorasierer kommt auf den Markt.
1931, 11. Dezember:
Das britische Parlament erlässt das Statut von Westminster, das den Dominions („Herrschaften“) im British Commonwealth of Nations weitgehende gesetzgeberische Unabhängigkeit einräumt. Damit werden Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Neufundland und der irische Freistaat souveräne Staaten.
1931, 16. Dezember:
In der Eisernen Front formieren sich vor allem Sozialdemokraten und Gewerkschafter in der Zeit der Weimarer Republik im Widerstand gegen den Nationalsozialismus.
Reisen können den geistigen Horizont erweitern
„Das Leben ist eine Reise und der Reisende lebt zweimal.“
Omar Chayyam (1048–1131) [32]
„Ich habe noch nie eine Grenze gesehen. Aber ich habe gehört, dass diese im Kopf einiger Menschen existieren.“
Thor Heyerdahl (1914–2002) [33]
Mein Vater, Christian Friedrich Otto Meyer, ein gebürtiger Vogtländer und Angehöriger der „Generation auf der Drehscheibe“, [34] hatte im Jahr 1976 im Zusammenhang mit einer Dokumentation seiner Lebenserinnerungen [35] auch Reisen beschrieben, die er in den 1920er und 1930er Jahren unternommen hatte.
Reisejahr 1926 – Unterwegs in Südtirol
Während der Referendarstation bei einem Plauener Rechtsanwalt reiste ich mit dem kargen Erlös nach Südtirol. In Bozen wohnte ich im Gasthaus „Luna – Mondschein“. Es bestand übrigens nach dem Zweiten Weltkrieg immer noch. Nach der Ankunft in diesem besagten Gasthaus saß ich im sonnigen Innenhof und aß das erste Mal im Ausland, umgeben von der bunten Kulisse südlichen Lebens.
Italien war bis zum Sieg des Faschismus [36] Tummelplatz von Korruption, Unpünktlichkeit, Unsauberkeit. Es galt als Land der Bettler. Die Eisenbahnzüge verkehrten unregelmäßig. Das war die Regel. Auf dem Brenner fuhr der Zug aus Innsbruck keineswegs zur rechten Zeit ab. Die Reisenden hingen aus den Fenstern. Man schimpfte. Warum es nicht weiterging, erfuhr man nicht. Vom Bahnhof in Bozen folgten mir auf dem Weg zum Gasthof mehrere bettelnde Kinder lange Zeit, beständig ihren Bettelspruch murmelnd. Überall sah man Bettler. Die Menschen waren zum Teil ärmlich gekleidet. Zigeuner, meist Frauen, liefen durch die Straßen oder bettelten unter den Lauben. Jeder Fremde wurde angesprochen.
Bei der Rückreise nach Deutschland warteten auf dem Bahnsteig mit mir zahlreiche Reisende auf den Zug. Man wusste nicht zu sagen, wann der Zug aus Verona komme, ob vielleicht überhaupt nicht. Das Land und Bozen gefielen mir. Aber die Schlamperei war mir doch neu.
Die engen Gassen mit den Vorlauben, die bunten Kleider der Tiroler, die Fülle von Obst, die gemütlichen Wirtschaften in alten Schankräumen und der Tiroler Rotwein: Das war eben der Süden. Zahlte man in der Wirtschaft, so warf der Kellner das Münzgeld auf die Tischplatte und entschied, ob die Münze echt oder ein Falschstück war, ob er sie annahm oder zurückwies. Falschgeld schien in großem Maße im Umlauf zu sein.
Ich machte einige Ausflüge in die Umgebung und sandte ein Kistchen Tiroler Trauben nach Hause, die den Fremden auf dem Verkaufsmarkt versandfertig angeboten wurden. Die Sendung erregte große Freude bei meinen Eltern.
Reisejahr 1927 – Eindrücke von der pommerschen Insel Usedom
Während eines kurzen Sommerurlaubes im Jahr 1927 verbrachte ich in Karlshagen auf der Insel Usedom [37] zwei Wochen. Karlshagen war zu dieser Zeit „ein billiges und unentwickeltes Dorf“ abseits von den bekannten Ostseebädern Zinnowitz, Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck, die schon fast als Vorstädte Berlins galten. Am Ende der Insel Usedom im Westen lag Peenemünde, das später als Raketengelände [38] weltbekannt geworden ist.
In Karlshagen kostete damals die Tagesvollpension 3,50 RM (Reichsmark [39]). Es gab billiges Essen und man hatte eine einfache Unterkunft in dürftigen Sommerhäusern, die von Berliner Kneipenwirten im Sommer bewirtschaftet wurden.
Auch die Badegäste waren meist aus Berlin. Der Strand war unentwickelt, bot aber unbeschwerte Badefreuden. Nachts kamen die Seehunde auf den Strand und ruhten sich aus. Abseits von dem kleinen Badeort Karlshagen vergnügte sich ganz frühmorgens eine Tanz- oder Gymnastikgruppe mit Spielen und Übungen nackt am Strand. Ältere Herren wurden plötzlich unerwartet zu Frühaufstehern und mogelten sich als Strandläufer an die damals ungewöhnliche Darbietung heran.
Reisejahr 1928 – Südtirol in der Zeit des Faschismus
Im Oktober 1928 reiste ich ein zweites Mal nach Südtirol. Inzwischen saß der Faschismus fest im Sattel und hatte in Italien für Ordnung gesorgt. Bei der Einfahrt des Zuges in die Station Brenner sprangen vorn und hinten je zwei Faschisten (schwarze Uniform, lange Trottel an der schwarzen Kappe) auf den Zug und übernahmen ihn von den österreichischen Bahnbeamten.
Es fand eine strenge Passkontrolle statt. Alle Zeitungen der Fahrgäste wurden eingezogen. Mein „Grieben-Reiseführer“ wurde lange durchgeblättert. Offenbar erregten die Stadtpläne und Landkarten Argwohn. Es erfolgte eine eingehende Gepäckdurchsicht. Auf die Minute genau fuhr der Zug unter Leitung der Faschisten ab. Überall an der Fahrtstrecke sah man Mussolini-Bilder und die charakteristischen Faschisten-Zeichen. Die Taschendiebe und Bettler in Bozen waren verschwunden.
Die Preise waren festgesetzt worden und wurden streng überwacht. Man wurde in den Wirtschaften und Einkaufsläden nicht mehr betrogen. Es herrschte Ordnung im Land. In der Vorstadt ging ich durch eine Straße mit Miethäusern. An der Ecke fand ein Auflauf von Menschen statt und man vernahm ein wortreiches Gezänk streitender Frauen. Die Fenster waren von Zuschauern besetzt, die sich am Streit beteiligten. Plötzlich ertönten ein Pfiff und der Ruf: „Faschista!“. Alle liefen zurück in die Häuser. Augenblicklich war die Straße leer und still. Kurz darauf schritt eine Streife von zwei Faschisten strengblickend daher.
Wieder einmal war Traubenzeit. Ich stieg zur Talfer- und zur Oswaldpromenade hinauf, fuhr nach Meran, wo ich in dem herrlich alten Gasthof „Burggräfler“ mit knarrenden Treppen und Dielen für 8 Lire wohnte. Ich fuhr auch in die Schluchten des Sarntales.
In Meran gab es auch herrlich alte Weinstuben und Kaffeeschenken. Doch der marmorweiße Triumphbogen der Faschisten am Eingang des Passeiertales (ital. Val Passiria) kränkte mich sehr. Ich habe seine Inschrift nicht vergessen, auch als ich 17 Jahre später als englischer Kriegsgefangener in Meran recht frei umherlaufen konnte.
Hic patriae finessiste signahunc excoluismus ceteroslingua, arte, legibus.
Hier sind die Grenzen des Vaterlandes.Setzt die Zeichen.Von hier aus haben wir die anderenausgebildet in der Sprache, Kunst undGesetzen.
„Ceteros“ … das waren wir, die Barbaren aus dem Norden! Der Triumphbogen war während des Höhepunktes der Unterdrückung der Tiroler deutschen Minderheit durch den Faschismus errichtet worden.
Reisejahr 1930 – Auf Verwandtenbesuch in Schweden
Im Jahr 1930 fuhr ich zum ersten Mal in den Norden. Meine Base Margarete („Gretel“) Emma Kießig [40], die in Stockholm (Schweden) verheiratet war, ermunterte mich ebenso zu einem Besuch, wie mich meine Schwester Magdalene Emma [41], die mehrere Jahre als „deutsches Kindermädchen“ in Stockholm gelebt hatte, mit ihren Schilderungen des schwedischen Lebensstils dazu ermunterte, einmal nach dem schönen Land im Norden zu reisen. Meine Base „Gretel“ hatte mir eine Fahrt durch den Göta-Kanal empfohlen und als Reisezeit wegen des Mittsommers den Monat Juni. Meinen Freund Otto Kästner (ein ehemaliger Klassenkamerad vom Realgymnasium in Plauen) konnte ich als Mitfahrer gewinnen.
Über die Lebensart der Schweden und den Wohlstand des Landes war ich genügend aufgeklärt. Einige Brocken Schwedisch, vor allem Zahlen und Redensarten, lernte ich schnell. Die deutsche Sprache war, wie ich wusste, unter der älteren Generation – und der alten Königin aus deutschem Hause [42] – die erste Fremdsprache gewesen. Vor allem wollte ich meine frühere Gönnerin während der Zeit der Inflation [43], Fräulein Bohmann, besuchen und kennen lernen.
Mein Reiseplan hatte selbst bei meinem neuen Chef in Dresden, Präsident Dr. Palitzsch im Sächsischen Landeskriminalamt Unterstützung gefunden. Ich war der einzige „junge“ Mann in der kleinen Oberbehörde und Dr. Palitzsch, ein früherer Staatsanwalt, der über weite Beziehungen ins Ausland verfügte, war in diesem Jahr zugleich Präsident der Internationalen kriminalpolizeilichen Kommission, der Vorgängerin der heutigen „Interpol“. Gleich bei meiner Antrittsmeldung hatte er, nachdem er sich über meine persönlichen Verhältnisse unterrichtet hatte, mir leutselig den Rat gegeben: „Heiraten Sie nicht zu früh. Reisen Sie, solange Sie frei sind. Später kommen Sie mit einer Familie nicht mehr dazu!“ Er hatte recht. Ich war ja erst 28 Jahre alt und habe mir diese Lebensweisheit wohl gemerkt.
Zum Landeskriminalamt Dresden kamen oft Ausländer zu Besuch. Es hatte den Ruf, noch besser zu sein als das Landeskriminalamt in Berlin. Vor allem war der Name des Präsidenten Dr. Palitzsch im Ausland bekannt. Unter den Besuchern aus Schweden in diesen Monaten war eine Gruppe Kriminal-Inspektoren aus Stockholm und ein Assessor aus Gävle, dessen Betreuung mir oblag. Nun also gab mir der Präsident den Auftrag, den Polizeipräsidenten in Stockholm aufzusuchen und ihm „Grüße von Dr. Palitzsch“ zu bestellen und bei der Gelegenheit mir auch die Einrichtungen der schwedischen Kriminalpolizei anzusehen. Es war sehr wirkungsvoll, wie sich zeigen wird.
Der Reiseplan war für Juni 1930 festgesetzt, die Fahrkarten waren durch die Base Gretel Kießig vermittelt. Man bedenke, dass es Reisebüros für derartige Vermittlungen, wie sie heute an jeder Ecke in einer Großstadt zu finden sind, damals nicht gab. Man musste selbst einen Reiseplan aufstellen und die Zug- und Schiffsverbindungen ermitteln.
Der sehr alte Götakanal, er stammt wohl aus den ersten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts, führt von Göteborg über den großen Vänner- und den kleineren Vättersee nach den Schären der Ostküste bei Motala und Nörrpöping. Die ziemlich hohen Höhenunterschiede überwindet der Kanal durch treppenartig angelegte Schleusen. Der Kanal ist nicht breit. Die Schiffe sind entsprechend schmal gebaut. Über weite Strecken dampfen sie durch dichte Wälder und Weideland. Sie nahmen damals nur eine beschränkte Zahl von Reisenden auf, ich meine so um etwa 20 Personen herum. Die Plätze mussten lange vorher gebucht werden.
Wir fuhren aus Sachsen nach Saßnitz und Trälleborg. Als wir abends durch die sonntägliche Stadt gingen, saßen die Menschen bei noch hochstehender Sonne im Freien. Wir waren 500 km nördlich unserer Heimat.
Karlskrona erreichten wir mit der Eisenbahn. Von dort aus fuhren wir mit dem Schiff zu der Insel Gotland, nach Visby. Das Schiff lief spätabends aus. Wir wollten einige Tage in Gotland bleiben und die „Roseninsel“ und die alte Stadt mit ihrer Stadtmauer sehen. Es war schönes, warmes Juniwetter. Nach einigen Tagen wollten wir nach Stockholm weiterfahren, wieder zu Schiff. Über diese Reise habe ich nach der Rückkehr eine Skizze geschrieben, die in den „Chemnitzer Nachrichten“ veröffentlicht wurde. Ich schilderte in dieser Veröffentlichung, was mir als Fremdling an Land und Leuten zu dieser Zeit in Schweden auffiel.
In Stockholm wohnten Otto Kästner und ich bei meiner Base Gretel Collén, die uns mit Ratschlägen half, die schöne Stadt Stockholm zu erleben. Ihr Mann, Helge Collén, beruflich ein Ingenieur mit einer Werkstatt für Schiffsmotoren, besaß ein großes Motorboot. Er hatte einen Onkel, einen reichen Waldbauern aus der Landschaft Dalarna, zu Besuch. An dem Sonntag erschien dieser würdige, alte Onkel mit weißem Backenbart in der Tracht seiner Heimatprovinz, um mit uns die Schären von Stockholm zu erleben. Die Schären, ein Gewimmel von großen und kleinen Inseln, deren geologischer Unterbau blankes, dunkles Gestein ist, zuweilen bewachsen, reichen von Stockholm 40 km nach Osten bis zur freien Ostsee. Von Süden nach Norden verlaufend bilden sie wohl auf 170 km die Ostseeküste des Landes.
Ab und zu stehen unter den Kiefern Sommerhäuschen aus Holz, die rot angestrichen sind. Hier und da sieht man nur einen Bootssteg. Immer aber ist ein Flaggenstock dabei und tagsüber weht die schwedische Fahne im Wind. Gretel Collén und die Eltern von Helge waren mit von der Partie. Unsere Gastgeber hatten einen mächtigen Frühstückskorb mit. Während der Bootsfahrt gab es zum Nachweis der schwedischen Vorliebe für viel und gutes Essen Butterbrote und Fischkonserven aller Art, dazu Tomaten und Gurken sowie natürlich den „Schnaps“. Es war ein wundervoller Tag.
Zu einem späteren Zeitpunkt ging ich zum Polizeipräsidium in Stockholm und brachte bei der Kriminalpolizei die mir aufgetragenen Grüße des Präsidenten Dr. Palitzsch aus Dresden für den Polizeipräsidenten an. Doch es war nur sein Stellvertreten anwesend. Dieser hatte als Regierungsrat das Gehalt eines deutschen Polizeipräsidenten, was ich schon wusste. Ich bekam ausreichend Gelegenheit, die hohen Gehälter der Beamten, den Lebensstandard und den sich von unserem Lebensstil stark unterscheidenden Lebensstil der Staatsbeamten in Schweden zu studieren.
Es wurde mir gar nicht viel gezeigt. Die Einrichtungen der schwedischen Behörde waren offensichtlich bescheidener als beim sächsischen Landeskriminalamt. Dagegen wurde mir bald eröffnet, dass ich zum Mittagessen eingeladen sei. Als ich mich zu wehren versuchte, sagten mir die schwedischen Beamten, dass für ausländische Besucher ein Bewirtungsfonds vorhanden sei – für jedes Land in einer anderen Höhe und dass dieser für deutsche Polizeibeamte bestimmte Fonds in diesem Jahr noch gar nicht in Anspruch genommen worden sei. Die Gelegenheit sei also günstig.
Nun gingen nicht etwa 2 Beamte mit, die ich in Dresden kennen gelernt hatte, sondern es erschienen noch zwei weitere freundliche Herren. Es wurde eine Taxe gerufen. Man wählte ein Speiserestaurant am Wasser aus. Die schwedischen Gastgeber gaben sich Mühe, immer wieder zu versichern, dass es ein Glücksfall sei, dass der erste Deutsche in diesem Jahr bewirtet werden könnte, um kräftig den Bewirtungsfond anzuzapfen.
Da in Schweden Alkoholverbot bestand, war das Bier, „Pils“ genannt, dünn und wässrig. Es hatte nur einen Gehalt von ½% Alkohol. Meine Gastgeber waren auf Schnaps aus, von dem zu jedem warmen Gang ein Glas ausgegeben werden durfte. Als Vorspeise gab es deshalb kleine Fleischklößchen, die sofort wieder abgetragen wurden, nachdem die Schnapsgläser gekommen waren. Dann wurde eine Suppe gereicht und wieder ein Glas „Sprit“. Es folgte der Fleischgang, wieder mit „Sprit“ und auch „Pils“, das nicht rationiert war.
Die vier Schweden waren recht fröhlich, dass sie zu einem so schönen Lunch gekommen waren, zumal ich schon auf das zweite und dritte Glas Sprit zu ihren Gunsten verzichtet hatte. Ich erinnerte mich daran, dass sie als Besucher in Dresden gar nicht hatten glauben wollen, wie selten ich Sprit zu trinken pflegte. Sie gingen damals während des Vormittags aus dem Dresdener Präsidium zu einem Frühschoppen in eine schöne alte Bierwirtschaft nahe der Frauenkirche und kamen dann nach einer Stunde mit einer „Fahne“ wieder zurück.
Als ich mich nun zum Schluss unseres gemeinsamen Essens in Stockholm bedankte, wiesen sie das zurück und bedankten sich für die Gelegenheit, die ich geboten hatte, den Fonds mit einem schönen Mahl auszunehmen. Obwohl ich mich zurückhielt, war es doch ziemlich viel, was ich zu den vielen „Skol“ zu mir hatte nehmen müssen und ich war froh, als mich die lustigen Kriminaler mit der Taxe zu Gretels Wohnung fuhren. Sie war ganz unbesorgt über mein langes Ausbleiben und hatte sich die Trinkerei schon vorher gedacht. Sie hielt es für selbstverständlich, dass man mich zum Essen eingeladen hatte.
Stockholm war eine saubere Stadt. Die roten Ziegelbauten spiegelten sich mit dem blauen Himmel überall im Wasser. In diesen Tagen meines Aufenthaltes in Schweden schien die Sonne bis 22 Uhr 30. Und um 1 Uhr morgens war sie schon wieder da. Wir besuchten das Freilichtmuseum auf Skansen und aßen mit Base Gretel im Restaurant eines eleganten Kaufhauses.
Mit Fräulein Bohmann, der ich einen Besuch gemacht hatte, fuhren wir zum Essen hinaus in die Schären. Wo wir auftraten, wurde ein Schnaps angeboten. Ich war darauf hingewiesen worden, diese Geste gebührend zu loben. Der Alkohol, der jedem Mann und jeder Frau je nach Alter auf „Spritkarte“ zustand, wurde in einem staatlichen Laden gekauft und jeder setzte ihn mit anderen Säften oder Früchten zu einem Likör an. Jeder war auf seine Mischung stolz. Gretel hatte mir eingeprägt, dass es ein Gebot der Höflichkeit sei, den „Hausgemachten“ zu loben. Das tat ich denn auch. Viele Schweden, mit denen ich zusammenkam, fragten mich auch (was ich seit den Besuchen in Dresden erwarten musste), wieviel Alkohol ich im Monat kaufe und trinke, wo er doch in Deutschland frei käuflich und so billig sei. Immer sah ich verwunderte Gesichter, wenn ich sagte, ich kaufe mir im Jahr höchstens eine Flasche Cognac.
Dann kam der Augenblick der Abreise aus Stockholm mit dem Götakanalboot „Astrea“. Dieses Boot war kaum so lang wie ein Elbdampfer, aber schmaler und höher. Die Fahrt dauerte, wie ich mich zu erinnern vermag, drei oder vier Tage. Nachts lag das Boot fest. Es waren nicht viele Reisende an Bord. Die Verpflegung war echt „schwedisch“. Ich habe mir damals aufgeschrieben, was auf dem „Smorgosbord“ an „schwedischem Vortisch“ stand, ehe man zur Suppe überging. Wenn ich alles rechnete, kam ich, so glaube ich, auf 36 Speisen.
Am Mittsommertag lagen wir mitten im Land Schweden bei einem kleinen Ort an einer Ausweichstelle, um zu übernachten. Wir verließen das Schiff, gingen etwas ins Land hinein und kamen zu einem Haus, vor dem Fahnen aufgezogen waren und Bänke und Stühle standen. Zunächst hielten wir es für ein Gasthaus, denn eine größere Menschenmenge bewegte sich um einen Tanzplatz und bewegte sich vor dem Haus. Man war offenbar bei der Vorbereitung eines Mittsommerfestes. Im Inneren des Hauses wurden Getränke und belegte Brote ausgegeben.
Wir kamen auf den Gedanken, uns etwas zu trinken geben zu lassen. Als wir mit einigen Wortbrocken Schwedisch unseren Wunsch vorbrachten, erfuhren wir aber, dass wir kein Gasthaus, sondern eine private Gesellschaft vor uns hatten, die in der hellen Nacht ein Mittsommerfest mit Tanz, Musik und Mittsommerfeuer abhalten wollten. Gleichwohl bot man uns zu essen und zu trinken an. Das war uns etwas unangenehm. Wir wollten zunächst ablehnen, nahmen aber schließlich das Angebot an, um die schwedische Gastfreundschaft nicht zu kränken.
Die Schiffsreise endete in Göteborg. Die Wasserfälle des Göta-Alv bei Trollhättan wurden wieder mit Hilfe von Schleusen umgangen. Im großen Handelshafen von Göteborg gingen wir von Bord des Kanalbootes. Wir fuhren mit dem Zug nach Kopenhagen, wo wir uns trennten. Freund Otto Kästner musste heim. Ich hatte noch Zeit und genug Geld, um mir Kopenhagen anzusehen und die dänischen Smörrebröd zu studieren und sie mit dem üppigen schwedischen Vortisch zu vergleichen. Im Restaurant bekam man eine lange Liste vorgelegt, in der untereinander alle Auflagen für belegte Brote (wie etwa Fleisch, Wurst, Käse, Fisch usw.) eingetragen waren. Dahinter befanden sich Spalten mit allen denkbaren Brotarten. In die Brotspalte machte man ein Kreuz für den gewünschten Belag und nach kurzer Zeit stand die Platte mit den belegten Broten vor dem Gast. Es war etwas einfacher als die riesige Auswahl schwedischer Leckerbissen. Zudem erfolgte das Servieren schneller und war auch noch billiger.
Der schwedische Assessor aus Gävle hatte mir seinerzeit in Dresden beim Vergleich der Lebensweise in Deutschland und Schweden erklärt: Schweden – Dänemark – Norwegen, das sei wie Deutschland – Österreich – die Tschechoslowakei [44], stufenweise billiger, aber auch einfacher.
Reisejahr 1932 – Eine Seereise mit der „Njassa“ der deutschen Ostafrika-Linie
In diesem Jahr brachte mich eine Seereise um Westeuropa herum. Die deutsche Ostafrika-Linie führte damals ihren Linienverkehr durch das Mittelmeer und das rote Meer nach dem früheren Deutsch-Ostafrika [45], um das Kap nach dem früheren Deutsch-Südwestafrika [46] und um Westafrika herum nach Europa aus. Da die deutschen Siedler auf Europaurlaub bei der Rückreise nach Afrika Zeit und Geld sparen wollten, die die Reise von Hamburg ins Mittelmeer ausmachten, pflegten sie Plätze erst von Genua ab zu belegen. Daher wurde die Reise von Hamburg über Antwerpen, England, Portugal, Spanien, Mallorca nach Genua verbilligt angeboten.
Ich buchte für den 27.8.1932 auf der „Njassa“ [47] mit 8.750 Br. Reg. Tons, die, als kombiniertes Fracht- und Passagierschiff umgebaut, neben 72 Plätzen der Ersten Klasse die neue Mittelklasse mit 160 Plätzen anbot. In Hochstimmung und voller freudiger Erwartung fuhr ich in Hamburg mit der Taxe zum Freihafen, wo am Liegeplatz nachmittags die Passagiere „anrollten“.
Es ist ein wundervolles Gefühl, am Aufgang eines Schiffes empfangen und hineingeführt zu werden, um dann über Gänge und Treppen im Kabinenteil unterzutauchen. Ich lag in einer Vierbettkabine der Mittelklasse, in der ich zunächst der einzige Bewohner war. In Southampton wurden zwei Engländer erwartet. Bis zur Abfahrt war Zeit genug, das Schiff von innen und außen zu betrachten. Am Kai wirkt auch ein mäßig großes Schiff riesengroß. Man steht also vor seinem schwimmenden Hotel.
Bald kamen die Schlepper. Die Passagiere sammelten sich am Heck. Die zurückbleibenden Angehörigen verabschiedeten sich und gingen von Bord. Für viele war es sicher ein Abschied für lange Zeit, wenn nicht sogar für immer. Wer ahnte von den Afrikadeutschen, was die Zukunft bringen würde?
Dann wurde das Fallreep eingezogen. Die Schlepper zogen langsam an. Vorsichtig, ganz vorsichtig löste sich das Schiff vom Kai. Die Reisenden an der oberen Reling, die wenigen Leute unten an der Kaimauer winkten. Ein merkwürdiges Gefühl beschleicht den Reisenden, wenn sich ein Schiff zur Überseereise vom Festland löst. Das Land bleibt ganz langsam zurück, Meter für Meter. Die Musik spielt: „Muß i denn, muß i denn zum Städtele hinaus“. Der Wasserstreifen, der Schiff und Land trennt, wird immer größer. Das mächtige Boot wird frei. Nun hört man die noch verhaltene Maschinenarbeit. Und dann geht es elbabwärts, durch das Gewimmel des Hamburger Hafens, an den St. Pauli – Landungsbrücken vorbei. Man wittert die See. Das Erlebnis dieser Ausreise ist mir unvergesslich geblieben.





























